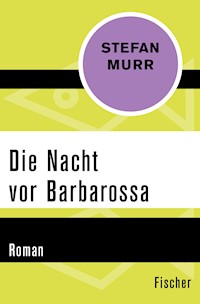3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Schicksalhafte Wege sind keine Einbahnstraßen. Das zeigt dieser zeitbezogene Roman, in dem Stefan Murr die Geschicke von Männern und Frauen verfolgt, deren Wege sich sowohl in früheren Tagen als auch in unserer ereignisreichen Zeit gekreuzt haben. Dabei entdecken sie in ihren Lebensgeschichten Tatbestände, die sie in das Abenteuer einer gemeinsamen, ihnen bislang unbekannten Vergangenheit verstricken. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Ähnliche
Stefan Murr
Das späte Geständnis
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Auf einem der Friedhöfe von Paris – dem schönsten, wie viele meinen – ist in der nördlichen Ecke das Grab einer jungen Frau zu finden. Der Grabstein ist aus schlichtem weißem Marmor. Tiefschwarz eingraviert, trägt er nichts als eine wunderschöne langstielige Rose, den Vornamen Florence, ohne Familiennamen oder sonstigen Zusatz, die beiden Daten 11. 3. 1920 und 21. 8. 1944, sowie die Worte «Morte pour la France».
Die Geschichte dieses Grabes wird hier erzählt.
Dank
Für ihre medizinische Beratung danke ich meinen Freunden
Dres. Monika und Richard Geisler.
Spätherbst 1989
Das Gerücht verdichtete sich gleichsam zu einer lastenden Wolke, die über dem Kreisstädtchen Sternberg lag und durch die Türritzen und Fensterläden in die abendlichen Stuben, Werkstätten und Geschäfte seiner Bürger drang. Die Staatssicherheit gibt auf. Bisher haben die da drüben in Schwerin, und vielleicht auch in Berlin, geglaubt, daß sie so weitermachen können wie bisher. Aber jetzt geben sie auf.
Was das im Klartext zu bedeuten habe, fragte in seiner ruhigen und überlegten Art, die er auch in den zurückliegenden, sich überstürzenden Ereignissen des Umbruchs bewahrt hatte, der Druckermeister Eicke Nordhöven. Seine kleine, altmodische Druckerei war von ein paar Kohlenfadenbirnen nur matt erhellt, und so waren auch die Gesichter der zehn oder zwölf Besucher Eicke Nordhövens, die in der Runde um ihn herumstanden und durcheinanderredeten, kaum zu erkennen.
Man war das alles noch gar nicht richtig gewöhnt. Daß man überhaupt hier bei Nordhöven herumstehen und reden konnte, was man wollte, daß vielleicht sogar Eicke auf seinen vorsintflutlichen Maschinen drucken konnte, was er wollte, ohne daß diese Stasirüpel die Nasen hineinsteckten und alles von zuunterst nach zuoberst kehrten.
«Das heißt», sagte einer der Männer, nachdem er mit seiner sonoren Stimme das Durcheinanderreden beendet hatte, «im Klartext heißt das, daß sie da draußen am Wahrsberg Leine ziehen, daß sie klammheimlich die Bude ausräumen und ihre Akten nach Schwerin schaffen, um sie zu vernichten. Ich habe das selber gesehen.»
Draußen am Wahrsberg, etwas abseits von der schmalen Straße nach Kobrow, stand die häßliche Betonbaracke des Staatssicherheitsdienstes, abgeschirmt vor den Blicken Neugieriger, auf einem großen, mit hohen Zäunen gesicherten Gelände. Nur wer genau hinsah, konnte über die Baumkronen hinweg ein Gewirr geheimnisvoller Antennenanlagen entdecken, über welche diese Dienststelle direkt mit dem Zentrum in der Normannenstraße in Berlin verbunden war. Entlang der Straße wiesen Schilder in der der Sozialistischen Einheitspartei eigenen rüden Sprache darauf hin, daß hier Sperrgebiet sei und daß Stehenbleiben, Fotografieren und vor allem der Eintritt verboten waren. Wegen dieser Schilder und wegen der wohlbegründeten Angst vor dem langen Arm der Staatssicherheit hatten die Bewohner des Kreises dieses Areal über Jahrzehnte hinweg peinlichst gemieden. Und jetzt sollte man plötzlich ungestraft nicht nur darüber reden, sondern möglicherweise gar etwas dagegen unternehmen können. Und genau das war es, was Eicke Nordhöven wissen wollte.
«Warum seid ihr also hier?»
«Weil wir etwas dagegen tun wollen», hieß es. «Weil wir uns nicht gefallen lassen, daß diese Banditen ihre Akten verbrennen und dann verschwinden, als ob nichts gewesen wäre.»
«Jawohl, Eicke», schrie ein anderer dazwischen. «Das wollen wir schon genau wissen. Die haben Akten über jeden geführt, sogar über die Hundertprozentigen, ihre eigenen Genossen. Wir wollen schon wissen, was da drinsteht. Und du vom Demokratischen Aufbruch bist genau der Richtige, um das rauszukriegen.»
Die Besucher starrten Eicke Nordhöven mit erwartungsvoll aufgerissenen Augen an.
«Leute», sagte Eicke ruhig, «Leute, wißt ihr auch, was ihr euch da vorgenommen habt? Kein Mensch hier kann sagen, ob die Stasi wirklich aufgelöst ist und was die für Befehle geben. Wenn die schießen …»
«Die schießen nicht mehr», wurde Eicke entgegengeschrien. «Die sind froh, wenn wir nicht schießen. Und wenn wir uns nicht beeilen, dann kommen wir zu spät und sehen von diesen Brüdern keinen einzigen mehr, und von ihren Akten noch weniger.»
«Wir gehen alle mit», schrie ein anderer, als Nordhöven zögerte. «Und es gehen noch viel mehr mit, wenn ein paar den Anfang machen. Aber wir müssen es schnell tun.»
«Jetzt, mitten in der Nacht?» fragte Eicke Nordhöven, aber er erntete nichts als erbitterten Widerspruch.
«Jetzt sind sie vielleicht dabei, die Panzerschränke auszuräumen und die Lastwagen zu beladen», hieß es. «Morgen früh ist es zu spät. Dann sind die über alle Berge. Los, Eicke, wenn du zu feige bist, gehen wir alleine.»
Ein anderer rief: «In meinem Schuppen lagern noch Hunderte von Fackeln für die Jugendweihe und Erichs Geburtstag und von Vierzig Jahre DDR her. Die stelle ich zur Verfügung, kostenlos.»
Begeisterte Zurufe quittierten diesen Vorschlag. Immer mehr Menschen, denen von irgendwoher zugeflogen war, was in dieser Nacht hier vorging, drängten herein. Und gegen halb neun Uhr platzte die Bombe. Die Menge quoll aus Eicke Nordhövens Haus auf die Straße. Es war eine stille Seitenstraße, nur von einigen Peitschenlampen mäßig beleuchtet, gesäumt von ein-, höchstens zweistöckigen Häusern. Eicke Nordhöven sprang auf die Motorhaube eines Wartburg, der da herumstand, und es kostete ihn Mühe, sich gegen den Lärm durchzusetzen, den seine Mitbürger vollführten.
«Leute», rief er, «Leute, ich bitte mir aus, daß alles geordnet vor sich geht. Es wäre ganz schlecht, wenn wir uns jetzt ins Unrecht setzen würden …»
«Die haben sich vierzig Jahre lang ins Unrecht gesetzt», schrie man ihm entgegen.
«Um so schlimmer, wenn wir das jetzt auch täten», erwiderte der Druckermeister. «Leute, unsere Revolution ist bis jetzt unblutig und gewaltfrei verlaufen, einmalig in der Geschichte. Die ‹Freunde› sind bis jetzt in ihren Kasernen geblieben …»
«Freunde», wurde aus der Menge heraus gehöhnt, «jetzt kannst du ruhig das Maul aufmachen und ‹Russen› sagen, oder ‹Iwans›. Mit den Freunden ist es vorbei.»
Nordhöven redete weiter: «Das Dümmste, was wir tun könnten, wäre, aus den Freunden Feinde zu machen. Leute, stellt euch doch vor: Wir machen eine Revolution, um dieses marode System zum Teufel zu jagen, und die Russen schießen nicht. Versetzt euch doch nur mal ein einziges Jahr zurück, ein paar Monate nur …»
Beifallsrufe unterbrachen den Druckermeister. Er sprach weiter. «Also, seid vernünftig und laßt die Kirche im Dorf. Erst recht, wenn ihr nachher Fackeln in den Pfoten habt.» Er machte eine etwas atemlose Pause und fuhr dann fort.
«Also gut, ich führe euch raus zum Wahrsberg, zusammen mit …» Er nannte ein paar Namen, darunter auch den einer Frau, die mit begeistertem Beifall begrüßt wurden. «Aber ich bitte mir aus, daß es keine Gewalttaten gibt, keinen Vandalismus, kein Feuer, keine Racheakte. Wir werden versuchen zu sichern, was zu sichern ist. Dazu bilden wir sieben ein Komitee. Ihr anderen bleibt vor dem Gebäude.»
Noch zwei oder drei Anordnungen gab der Druckermeister, dann sprang er von der Motorhaube des Autos und setzte sich an die Spitze des Zuges, der sich zu formieren begann. An der nächsten Ecke stand eine Doppelstreife der Volkspolizei in Pelzmützen, langen Mänteln, mit umgehängten Kartentaschen. Die Männer sahen unbewegt zu und grüßten auf Nordhövens Zuruf. Auch für sie hatte sich seit dem 9. November die Erdachse um 180 Grad gedreht.
Überall öffneten sich jetzt Fenster, und Menschen traten vor die Türen. Viele schlossen sich spontan den Marschierenden an. Ein paar Straßenzüge weiter war beim Friseurmeister Wandäcker das Hoftor aufgestoßen, und die Schuppentüren dahinter standen offen. Dort teilte der schmächtige Friseur, der sich vor drei Wochen als erster in die Dienststelle der Partei gewagt hatte und den Rücktritt des Kreisvorsitzenden gefordert hatte, die Fackeln aus, die noch vor kurzem zur Selbstdarstellung und Beweihräucherung des kaputten Systems bestimmt gewesen waren. Zwei oder drei Halbwüchsige schleppten mit Feuereifer Arme voll davon auf die Straße, wo sich die Demonstranten darum rissen. Schon wurden die ersten entzündet, mit denen dann immer weitere in Brand gesetzt wurden. Flackernd erfüllte der rötlichgelbe Feuerschein die Gasse, und grauer Rauch quoll mit beißendem Geruch in den wolkenverhangenen Himmel der Novembernacht. Schließlich waren es zwei- bis dreihundert Bürger, die sich wieder in Bewegung setzten und Richtung Marktplatz und Rathaus marschierten. Als der Zug auf die Marktfreiheit hinausbog, bestrahlte der Fackelschein die wuchtige Backsteingotik des Platzes, ein eindrucksvolles Bild vor den tiefhängenden Wolken, die jetzt ein auffrischender Nordwest über die Dächer des Städtchens trieb.
Der Zug nahm seinen Weg in südlicher Richtung und verließ die bebauten Randgebiete. Von hier aus ging es über eine grobgepflasterte Chaussee durch eine steinalte Allee prächtiger, jetzt entlaubter Ahornbäume, bis sich rechts aus der Dunkelheit heraus der flache Wahrsberg leicht erhob, mit seinen 66 Metern Seehöhe die größte Anhöhe in dieser Gegend. Drüben, wo die Staatssicherheit sich eingeigelt hatte, gaben die gleichförmigen Peitschenlampen, mit denen sich die Deutsche Demokratische Republik überall erleuchtete, heute abend kein Licht.
«Die sind weg», hieß es in der Menge. «Abgehauen sind die, seht ihr. Wenn die noch was zu beschützen hätten, wäre es dort taghell.»
Die Menge bog nach rechts in einen Nebenweg ein, und plötzlich standen sie – viele von ihnen zum ersten Mal – vor dem Metallzaun und vor dem zweiflügeligen Einfahrtstor mit den martialischen Schildern, die verkündeten, daß hier jegliches Weitergehen und der Eintritt bei Strafe verboten waren. Nur wenige Sekunden verharrten die vom Fackelschein beleuchteten Menschen, dann begannen die Beherztesten zu skandieren: «Stasihunde, traut euch raus – sonst kommen wir zu euch ins Haus.» Lauter und drohender wurden die Sprechchöre, und mit einemmal flammte wirklich die rund um das Areal gezogene Kette der Peitschenlampen auf und bestrahlte kalt die ganze Szene. Von der plötzlichen Helligkeit wie gelähmt, schwiegen die Männer einige Sekunden unschlüssig. Nur die Fackeln knisterten. Irgend etwas mußte jetzt passieren. Die Baracke war nicht zu sehen. Wer würde auf dem Sandweg erscheinen, der von dem doppelten Metalltor in die Tiefe des Strauchwerks führte, das das Gelände verbarg? Würden es Verrückte mit Maschinenpistolen vor dem Bauch sein? Ein Uniformierter der alten Macht, der großspurig vor Unüberlegtheiten warnte? Eine Gruppe von Bewaffneten mit scharfen Hunden an der Leine, die sie hier auch schon gehabt hatten?
Eine oder zwei gespannte Minuten lang geschah nichts. Schon wurde vor dem Tor wieder Unruhe laut, als auf dem Sandweg, noch halb im Schatten, eine Gestalt sichtbar wurde. Als der Mann zögernd in den Lichtkreis der Peitschenlampen trat, erkannten ihn einige. «Der Kutte ist das … das ist doch der Warrentin … was hat denn der hier zu sagen …?»
Der jetzt langsam und verängstigt auf das Tor zukam, war Kurt Warrentin, ein Mann, der handwerklich sehr geschickt war und von der Stasi als Hausmeister beschäftigt wurde. Auch Eicke Nordhöven kannte ihn. Er wandte sich an die hinter ihm Wartenden, bei denen wieder Ungeduld und Zorn erwachten.
«Ich rede mit ihm, aber ihr müßt das Maul halten, sonst verstehe ich nicht, was er sagt.»
Als der Lärm hinter ihm etwas abklang, wandte Nordhöven sich an den Hausmeister hinter dem Metalltor um und sagte: «Wir wollen da rein, Kutte. Wo ist euer Chef? Wir sind ein Bürgerkomitee, und die Leute wollen nicht, daß ihr die Akten beiseite schafft, die ihr über uns angelegt habt. Mach auf und laß uns rein.»
Der Mann hinter dem Tor hob hilflos beide Arme. «Ich hab hier doch gar nichts zu sagen, Eicke. Ich war hier doch nur das kleinste Licht. Der, der denen die Wasserhähne gedichtet und das Klo ausgeräumt hat. Ich kann doch für das alles nichts.»
«Sagt ja auch gar keiner», antwortete der Druckermeister. «Wir wollen ja auch nichts von dir, sondern von deinen Brötchengebern. Mach auf, oder hol uns einen her, mit dem wir verhandeln können.»
«Es ist keiner mehr da von denen, Eicke», erwiderte Warrentin. «Die sind über alle Berge, schon seit heute nachmittag.»
Ein Wutgeheul und drohendes Fackelschwenken in Eicke Nordhövens Rücken quittierte diese Eröffnung. «Und ich habe den Befehl …» fuhr Warrentin mit erhobener Stimme fort, aber was er hatte sagen wollen, ging im allgemeinen Getöse unter.
«Befehl … Befehl … Hört euch das an. Befehle will er ausführen, der Arschkriecher. Hier gibt es keine Befehle mehr, Kutte, außer unseren eigenen, merk dir das. Und jetzt laß uns endlich rein, damit wir an die Akten rankommen.»
«Aber es sind doch gar keine Akten mehr da», überschrie der Hausmeister mit schriller Stimme das Getöse. «Alles abtransportiert, zum Bezirk nach Schwerin. Seid doch vernünftig, Leute. Das kommt da alles in den Reißwolf. Das ist doch das Beste, was die machen können. Da bleibt über keinen mehr Material zurück.»
Damit jedoch ging es vor dem Zaun erst richtig los.
«Hört euch das an», schrien sie erbost. «Der hat überhaupt noch nichts begriffen, dieser Idiot. Das wollen wir ja gerade erfahren, was das für Material war, du Hammel.»
Drohend die Fackeln schwenkend, drängte die Menge gegen das Tor und brachte Eicke Nordhöven und die anderen Mitglieder des Komitees, die dort standen, in eine schwierige Lage. Sie warfen die Arme hoch und versuchten, sich gegen die schiebenden und drängenden Männer zur Wehr zu setzen. Schließlich gelang es dem Drucker, sich umzuwenden.
«Mach das Gitter auf, Kutte», schrie er. «Sonst erdrücken die uns hier.»
Mit dem Rücken stemmten sich die zuvorderst Stehenden gegen die Menge und schafften dem Hausmeister drinnen so viel Spielraum, daß er den Haken der Sperrstange aus der Öse heben konnte. Wie eine Flut brach die Menge durch das sich weit öffnende Tor und stürmte, von dem Licht der Fackeln abenteuerlich angestrahlt, den sandigen Weg zur Baracke hinauf. Als sie ankamen, standen aber unter dem Eingang bereits die Mitglieder des selbsternannten Bürgerkomitees, und Eicke Nordhöven hielt die Herandrängenden mit seiner mächtigen Stimme vorerst zurück.
«Leute», schrie er, unter der schon geöffneten Eingangstür stehend, «Leute, das hat alles keinen Zweck. Die sind auf und davon, das sieht doch jeder. Und wenn wir erfahren wollen, was die alles weggeschafft und was sie dagelassen haben, dann geht das nicht, wenn hier Hunderte reindrängen und alles zusammentrampeln. Ich schlage vor, wir hier schauen uns das alles erst mal an, berichten dann, was wir festgestellt haben, und sichern, was noch zu sichern ist. Wenn wir das gemacht haben, könnt ihr nach und nach auch rein und euch das alles anschauen. Einverstanden?»
Es ging noch ein paarmal hin und her wegen diesem und jenem, dann betrat das Komitee das Gebäude. Es war eine häßliche Baracke aus grauen Fertigbauplatten, zweistöckig, niedrig und mit einem gewellten Eternitdach flach abgedeckt, aus dem sich geheimnisvolle Antennenanlagen in den Nachthimmel reckten. Unten waren die operativen Räume und die Archive gelegen, und oben gab es eine Reihe öder Unterkünfte für das Personal, das hier Dienst gemacht hatte. Vier oder fünf seien es gewesen, erklärte Warrentin, immer wieder andere, nur selten habe man sie in der Stadt gesehen. Und wenn, dann habe man sie nicht gekannt, weil sie ja alle nicht aus dieser Gegend stammten. Auch was man hier getrieben habe, wußte der Hausmeister zu berichten. Von hier aus habe man nicht nur den ganzen Kreis mit seinen 25000 Einwohnern geheimdienstlich fest im Griff gehabt, sondern aufgrund der günstigen Lage des fast siebzig Meter hohen Wahrsberges seien von hier aus die westlichen Rundfunksender überwacht und – man höre und staune – auch der Funk- und Fernsprechverkehr der in der Region stationierten sowjetischen Besatzungstruppen abgehört worden. Ein Archiv mit den Dossiers über acht- bis zehntausend Bürger des Kreises sei vorhanden gewesen, allerdings sei davon nichts mehr übrig – bitte sehr, hier …
Warrentin stieß die Tür zu einem Raum auf, in dem sich Aktenregale, Schreibtische und Panzerschränke befanden, alle ausgeräumt, mit weit aufgerissenen Türen und Schubladen, wie nach einer heil- und regellosen Flucht. Stühle waren umgekippt, auf dem Boden lagen Unmengen von Papier herum, Zigarettenkippen und geleerte Flaschen dazwischen. Mit der Fußspitze schob Eicke Nordhöven beiläufig den Unrat auseinander und stieß dabei auf ein Bündel von vier oder fünf dicken Wachstuchheften. Er hob eines davon auf, öffnete es und las auf der ersten Seite einen Namen, den er hier und in dieser Form zu finden nicht erwartet hatte.
Der Hausmeister führte die Gruppe weiter. Hier der Abhörraum mit den Resten der Antennenleitungen, die herausgerissen aus der Wand hingen. Die nächste Tür der Senderaum, der das gleiche Bild bot. Eicke Nordhöven warf das Wachstuchheft wieder auf den Boden zu der übrigen Hinterlassenschaft des geflohenen Stasi-Personals und sagte:
«Wann haben die denn das alles geschafft, Kutte?»
«In der Nacht auf heute haben sie angefangen, und am Nachmittag waren sie fertig. Auf zwei Armeelastwagen hat alles Platz gehabt. Geräte, Uniformen, Akten – alles. Dann haben sie nicht den Weg durch die Stadt genommen, sondern sind nach Süden runter über Kobrow, Demen auf Feldwegen gefahren, deshalb hat keiner in der Stadt was davon gemerkt.»
Nachdem sie das, was sie soeben erfahren hatten, auch verarbeitet und ihre Enttäuschung, zu spät gekommen zu sein, hinuntergeschluckt hatten, trat Eicke Nordhöven ans Fenster, um der gespannt wartenden Menge draußen das niederschmetternde Ergebnis mitzuteilen.
Als der Drucker zu sprechen anfing, breitete sich draußen ein merkwürdiges und vorerst nicht zu definierendes Schweigen aus. Es war die Stille der machtlosen Erbitterung, der Wut und der Enttäuschung, gleichzeitig aber auch die Ruhe vor dem Sturm. Alles hatten die Mitglieder des Bürgerkomitees, die vor den geöffneten Fenstern standen, erwartet, nur das nicht, was jetzt tatsächlich geschah. Plötzlich hob nämlich einer von denen, die da draußen warteten, in gefährlicher Ruhe den Arm mit dem Fackelstumpf und schleuderte ihn durch eines der Fenster in das Gebäude, wo ein Papierkorb und sein Inhalt sofort Feuer fingen. Andere folgten diesem Beispiel, ebenfalls völlig ruhig. Wie zischende Kometen flogen Dutzende von brennenden oder glimmenden Fackelstümpfen in das Innere der Baracke und entzündeten Matratzen, Papierreste, Gardinen. Zuerst wollten Nordhöven und seine Leute sich dem allem noch entgegenstemmen mit dem Hinweis, daß damit die letzten Beweise in Flammen aufgingen. Aber mit Vernunft war nichts mehr zu machen. Zu lange hatte sich das Gefühl der Unterdrückung und Wehrlosigkeit in den Menschen aufgestaut, als daß jetzt noch etwas hätte gebremst oder gar verhindert werden können.
Mit plötzlich losbrechendem Wutgeheul stürmten die Sternberger Bürger gegen das Haus vor, drangen durch die Tür und kletterten über die Fensterbrüstungen. In die Gardinen und Bettwäsche, Holzgegenstände und Strohsäcke stießen sie ihre Fackelstümpfe, und es zeigte sich, daß nichts mehr dieses Haus zu retten vermochte. Beißender Qualm kroch bald durch die Räume, durchzuckt von aufloderndem gelben Flammenschein, wenn irgendwo ein neues Fenster oder eine Tür aufgestoßen wurden. Anfangs wurden noch Stühle zertrümmert und Schränke umgeworfen, aber es dauerte nicht mehr lange, bis Schreie laut wurden: «Raus … raus … raus hier … wollt ihr mit verkohlen hier drin …» Das um sich greifende Feuer trieb die Leute in die Flucht.
In diesem Augenblick entsann Eicke Nordhöven sich der fünf Wachstuchhefte, die er in einem der Räume unbeachtet auf dem Fußboden hatte herumliegen sehen. Er stürmte durch den Flur, fand das Zimmer, wurde angerempelt von anderen, die es mit schon triefenden Augen und vor Mund und Nase gehaltenen Tüchern verließen, und drang in das Inferno aus Rauch und prasselndem Feuer vor. «Mensch, Eicke», dachte er einen Lidschlag lang, «steht denn das dafür, was du da machst? Laß doch alle fünfe gerade sein, wie die anderen, die soeben ihren Gefühlen freien Lauf lassen.» Aber dann war doch das Pflichtgefühl stärker, das Pflichtgefühl und die Neugier. Die Neugier, was es wohl war, das Dr. Frank Steppach mit seiner schwer leserlichen, aber unverwechselbaren Handschrift fünf dicken Wachstuchheften anvertraut hatte. Die Neugier, wie diese Hefte in die Stasi-Baracke gekommen und warum sie nicht weggeschafft worden waren; das Pflichtgefühl einem Arzt gegenüber, der als gewissenhafter Internist bei einer einfachen Routineuntersuchung die lebensgefährliche Erkrankung an Eicke Nordhövens herznaher Aorta entdeckt und durch die Überweisung zur sofortigen Operation das Leben des Druckermeisters im letzten Augenblick gerettet hatte. Und noch einmal die Neugier. Die Neugier darauf, ob diese Hefte etwas von dem Geheimnis verrieten, von dem Dr. Frank Steppach umgeben gewesen war, der vor langer Zeit, in den sechziger Jahren, aus der Bundesrepublik in die DDR gekommen war und das Ambulatorium der Kreisstadt bis zu seinem Unfalltod vor einigen Jahren betreut hatte.
Dies alles schoß Eicke Nordhöven durch den Kopf, als er jetzt, die Schiffermütze vor Mund und Nase gepreßt, sich in den von Qualm und Flammen erfüllten Raum vortastete, verbissen nach den Heften suchte, sie schon halb benommen auch fand, an sich raffte und unter seinen Anorak schob. Er taumelte zur Tür. Hustend und tränend, wurde er von draußen hinaus in den Flur gezerrt, durch diesen weitergestoßen, bis er als einer der letzten den Ausgang erreichte.
In weiter Runde standen die Menschen nun im flackernden Flammenschein um das Gebäude herum und sahen zu, wie es starb. Jedes Bersten eines Fensters, jedes Aufblähen des Daches und jedes langsame Einknicken eines Sendemastes begrüßten sie mit begeistertem Beifall. Dieser wurde am lautesten, als das Feuer offenbar den Sicherungskasten erreichte, wobei mit einem Schlag sämtliche elektrische Lampen erloschen, auch die Peitschenlampen, die in weiter Runde das Gelände umringten. Schon bald war die gefürchtete Baracke nur noch ein glosender rauchender Haufen, dessen qualmende Reste nach und nach in sich zusammenfielen.
Zu diesem Zeitpunkt jedoch war Eicke Nordhöven schon ziemlich weit vom Schauplatz der Ereignisse entfernt und auf dem Weg nach Hause. Dort draußen bei der brennenden Baracke konnte er nichts mehr ausrichten. Und dafür, daß er nach Kräften versucht hatte, das, was dort geschehen war, zu verhindern, hatte er mehr als einen Zeugen. Seine Frau Lis fand er noch wach und mit einer Handarbeit beschäftigt. Wie er es immer tat, hängte er seine Mütze an einen Haken innen an der Tür, nachdem er die Wohnküche betreten hatte. Lis sah von ihrer Arbeit auf.
«Habt ihr gezündelt?»
«Woher weißt du das?» fragte ihr Mann.
«Deine Kleider riechen danach», antwortete sie.
«Sie haben die Bude runtergebrannt», sagte er. «Sie war leer. Die Wut und der Zorn waren zu groß. Ich konnte es nicht verhindern.»
Eicke Nordhöven zog die fünf Wachstuchhefte unter seinem Anorak hervor und ließ sie auf den Küchentisch klatschen. Dann zog er auch den Anorak aus und hängte ihn unter die Mütze an den Türhaken. Als er zum Tisch zurückkam, hatte die Frau die Handarbeit beiseite gelegt und das erste Heft in die Hand genommen.
«Doktor Steppach?» fragte sie.
Er nickte. «Das einzige, was ich retten konnte. Keine Ahnung, was es zu bedeuten hat.»
Lis Nordhöven blätterte unschlüssig in dem Heft. «Ich kann seine Schrift nicht lesen», sagte sie. «Aber es scheint eine Art Tagebuch zu sein. Er hat es in Daten eingeteilt.»
Nordhöven griff nach dem Heft, das sie ihm hinhielt, blätterte darin. «Ich habe keine Ahnung, wie es zur Staatssicherheit gekommen sein kann. Um ihn war ja immer etwas Geheimnisvolles. Es hat keiner gewußt, wer er war und woher er kam.»
«Aus dem Westen soll er doch gekommen sein», sagte die Frau. «Das war das einzige, was man über ihn wußte.»
«Ja», antwortete Eicke. «Und das wird es vielleicht auch sein, weshalb ihn die Stasi in die Mangel genommen hat. Aber so wichtig scheint denen der Fall auch wieder nicht gewesen zu sein, sonst hätten sie die Hefte wohl mitgenommen.»
Er ging hinüber zum Wandbord, kramte dort seine Brille hervor, setzte sich an den Küchentisch und versuchte, die steile gleichmäßige Schrift mit den stark ausgeprägten Ober- und Unterlängen zu entziffern. Er las: «Im Oktober des Jahres 1960 wurde ich als junger Internist im Alter von 33 Jahren an den Städtischen Krankenanstalten zu Aschaffenburg der Leitende Arzt der Inneren Abteilung bei Professor Dr. Harald Fredeburg.»
Was weiter dort stand, fesselte die Aufmerksamkeit des Druckermeisters so sehr, daß er alles andere vollständig vergaß. Um Mitternacht herum fragte ihn seine Frau, die im Begriff war, zu Bett zu gehen, ob sie ihm noch einen Kaffee kochen solle, was Eicke Nordhöven dankend annahm. Seine Frau brachte ihm die dampfende Kanne, stellte eine Tasse dazu und Zucker, gähnte und zog sich zurück.
Als sie am nächsten Morgen in die Küche kam, um sich um das Frühstück zu kümmern, saß ihr Mann immer noch da, so wie sie ihn verlassen hatte. Er hatte in dieser Zeit die Kanne Kaffee geleert sowie vier der Hefte ganz und das fünfte zur Hälfte gelesen. Übermüdet sah er hoch, nahm die Brille ab, starrte seine Frau an, reckte sich und sagte: «Das ist eine Geschichte, Lis, die alleine lohnt es schon, daß ich da draußen in der Baracke war. Wenn das hier mit verschwunden oder gar verbrannt wäre … gar nicht auszudenken.»
Er stand auf, reckte sich noch einmal und begann, nachdenklich in der kleinen Küche auf und ab zu gehen, dabei schüttelte er manchmal in ungläubigem Staunen den Kopf. Was denn in den Heften stehe, wollte Lis wissen, während sie Feuer machte und Wasser aufsetzte.
«Das kann man nicht in drei Worten wiedergeben, Frau», antwortete Eicke. «Es ist die Geschichte, wie Doktor Steppach aus dem freien Westen hierher zu uns nach Mecklenburg gekommen ist. Und warum er mit dem kleinen Ambulatorium vorne an der Wilhelm-Pieck-Straße zufrieden war, obwohl ihm drüben in der Bundesrepublik eine große Karriere offengestanden hätte. Ich habe so etwas Ähnliches noch nie gelesen. Wir wußten viel zu wenig von der Vergangenheit und vom Leben überhaupt, verstehst du? Das haben sie uns ja alles unterschlagen.»
Und es stimmte, was Eicke Nordhöven in diesem Augenblick empfand und zu seiner Frau sagte. Er war kein alter Mann. Als Jahrgang 1944 war er gerade fünfundvierzig Jahre alt, in diese Republik hineingeboren und mit ihr groß geworden. Sein Lebensweg war der übliche: Grundschule, Junge Pioniere, Freie Deutsche Jugend, Oberschule, Abitur, Dienst bei der Nationalen Volksarmee weit drunten im Süden, Mitglied der Blockpartei LDPD, ein Liberaler also, was immer unter dem Begriff liberal in einem Zwangsstaat wie diesem zu verstehen war. Durch die Gewissenskonflikte, die das sozialistische Repressionssystem seinen eingesperrten Zwangsbürgern zugemutet hatte, hatte er sich schlecht und recht hindurchgemogelt wie Millionen andere. Und dennoch war es ihm insgesamt besser ergangen als den Millionen anderen, denn durch eine Reihe unglaublicher Zufälle verbunden mit einem Rest sorgsam gehätschelter Beziehungen zum Rat des Kreises in Schwerin war es Eicke Nordhöven gelungen, die elterliche Druckerei als Privatbetrieb zu erhalten. Mit ein Grund dafür war der nachweisbare Umstand gewesen, daß sein Vater in den Zwanzigern und zu Beginn der dreißiger Jahre Flugblätter für die KPD gedruckt hatte und später sogar illegal für die Linke im Untergrund tätig gewesen war. Opfer hatten für diese Selbständigkeit gebracht werden müssen. Das erste bestand darin, daß in diesen ganzen Jahren nicht eine einzige Investition möglich gewesen war. Und das zweite, daß Nordhöven sich verpflichten mußte, für die Partei alles zu drucken, was diese von ihm verlangte. Auf diese Weise waren sie – seine Frau und eine Schwägerin – ein Familienbetrieb geblieben. Sie waren zwar frei, aber sie waren arm, verbraucht und besaßen eine hoffnungslos veraltete Ausrüstung. Von der Welt wußten sie wenig oder nichts. Das war es, was Eicke gemeint hatte, als er vorhin sagte «das haben sie uns ja alles unterschlagen». Er fügte hinzu, daß das da vielleicht auch einmal gedruckt werden würde, denn eine solche Geschichte müsse der Nachwelt erhalten bleiben. Danach schob er wieder seine Brille vor die Augen, blieb am Küchentisch sitzen und las auch das fünfte Heft zu Ende.
Damit wurde er fertig, als seine Frau Lis das Mittagessen auf den Tisch brachte. Auf einer gesonderten Seite am Ende des Manuskripts zeigte Eicke Nordhöven seiner Frau eine sorgfältig geschriebene und deshalb gut lesbare Notiz des Autors: «Sollte er mich überleben, sollen diese fünf Hefte übergeben werden an Professor Dr. Harald Fredeburg in der westdeutschen Stadt Aschaffenburg.» Dazu eine Adresse.
Was es mit diesem Professor auf sich habe, wollte Lis Nordhöven von ihrem Mann wissen, während sie ihre Suppe löffelten.
«Das ist es ja», sagte Eicke. «Es hat einen tragischen Konflikt zwischen diesen beiden Männern gegeben, von dem der Professor in Aschaffenburg bis zum heutigen Tag wahrscheinlich keine Ahnung hat.» Er schwieg einige Sekunden und setzte dann hinzu: «Wenn er überhaupt noch lebt. Auf jeden Fall muß ich versuchen, dieses Vermächtnis des Doktors zu erfüllen.»
«Was redest du da von einem Vermächtnis?» fragte Lis. Eicke spürte, daß seine Frau der Sache reserviert gegenüberstand. Aber das war eben ihre Art, auch in anderen Dingen des Lebens.
«Es ist ein Vermächtnis, Lis», sagte er deshalb betont. «Und wir verdanken es Doktor Steppach, daß ich heute hier sitze und daß wir uns darüber unterhalten können.»
«Und was wäre, wenn du es nicht entdeckt hättest?»
«Ich habe es aber entdeckt, Lis», sagte der Mann.
«Oder wenn du es nicht aufgehoben hättest?»
«Ich habe es aber aufgehoben. Und ich habe es gelesen, und allein das verpflichtet mich dem verstorbenen Doktor gegenüber.»
«Wann hat der Doktor das denn überhaupt niedergeschrieben?» fragte die Frau, und Eicke erwiderte: «Beendet muß er das Manuskript um 1979 herum haben, bevor er und seine Frau diesen Motorradunfall hatten.»
Das Arztehepaar war im Sommer 1979 bei einem Verkehrsunfall im Ostseebad Kühlungsborn ums Leben gekommen, an dem ein Lastkraftwagen der Volkspolizei beteiligt gewesen war, der den Beiwagen glatt abrasiert und beide sofort getötet hatte. Sie wußten es, der ganze Kreis wußte es, ja beinahe der ganze Landstrich hier oben an der Küste. Es war wohl auch mit ein Grund dafür gewesen, daß sich die Staatssicherheit mit Dr. Steppachs Nachlaß beschäftigt hatte. Um die Akten indessen vor dem unerwarteten Zugriff der Bevölkerung in Sicherheit zu bringen, dafür war die Sache scheinbar doch nicht wichtig genug gewesen. Und so lagen die fünf Hefte mit dem Lebensbericht des praktischen Arztes Dr. Frank Steppach nun auf dem Küchentisch des Druckerehepaares Nordhöven und warteten auf das, was mit ihnen geschehen würde.
«Wie alt müßte der Professor denn sein, wenn er noch lebt?» forschte Lis. Eicke rechnete nach.
«Wenn ich das, was ich gelesen habe, richtig einschätze», sagte er, «dann müßte der Professor ungefähr um 1912 herum geboren sein. Wenn er noch lebt, wäre er demnach 77 Jahre alt.»
Die Überprüfung eines Restes Westgeld in dem uralten meergrünen Geldschrank des Kontors ergab einen Betrag von 211 Mark 44 Pfennigen. Aber bevor Eicke Nordhöven die Reise nach Mainfranken antrat, wollte er sichergehen. Plötzlich erwies es sich, daß man bei der Polizeidienststelle in Schwerin, entgegen allem bisherigen Leugnen, doch die westdeutschen Telefonbücher hatte und daß sie jetzt mit einem Mal auch eingesehen werden konnten. In dem Aschaffenburger Band forschte Eicke nach dem Namen Fredeburg und fand keinen Eintrag. Was er indessen fand, war die Adresse des Einwohnermeldeamtes der Stadt. Dorthin richtete er schriftlich die Anfrage, ob man ihm etwas über das Schicksal eines Professors Dr. Harald Fredeburg mitteilen könne. Dann wartete er. Nach zehn Tagen erhielt er eine Antwort folgenden Inhalts:
Sehr geehrter Herr Nordhöven, Ihre Anfrage vom 29. November beantworten wir wie folgt: Ein Professor Dr. Harald Fredeburg ist in der Meldedatei der Stadt als hier wohnhaft nicht mehr eingetragen. Die betreffende Person lebt noch. Im Zusammenhang mit ihrer Identität liegt jedoch eine Besonderheit vor, zu der wir schriftliche Auskünfte nicht erteilen dürfen. Es müßte hierzu ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht werden. Wir stellen Ihnen – da das ja jetzt möglich ist – eine persönliche Vorsprache unter Vorlage entsprechender Unterlagen anheim. Hochachtungsvoll usw. usw.
Am übernächsten Tag tankte Eicke Nordhöven seinen gar nicht mal so alten Wartburg voll und machte sich zu frühester Stunde auf seine erste Reise in den Westen. Erschöpft und verwirrt von der ihm bisher unbekannten Hektik eines ungezügelten Autoverkehrs gelangte er noch am Abend nach Aschaffenburg und fand auch ein Quartier, das mit seinen 211 Mark 44 in Einklang zu bringen war. Er schlief gut, frühstückte am nächsten Morgen und begab sich dann zu Fuß zum Einwohnermeldeamt, wo er den Brief vorwies und nach dem Herrn fragte, dessen Unterschrift er trug. Der «Herr» war eine nicht besonders liebenswürdige Beamtin mittleren Alters, die Eicke Nordhöven in ihr Büro holte, das hinter dem Schalterraum gelegen war. Sie zog aus einem Ordner die beiden bisher gewechselten Briefe hervor und bat Eicke Nordhöven um eine Erläuterung. Der Besucher holte ziemlich weit aus und schilderte vor allem sein persönliches Verhältnis zu dem verstorbenen Dr. Steppach. Er hatte allerdings nicht mit dem Amtsschimmel gerechnet, der wie stets in beiden Teilen Deutschlands gleich laut wieherte. Die Beamtin fragte ihn nach einem Sterbenachweis über Dr. Frank Steppach, den Eicke Nordhöven nicht vorweisen konnte. Er hatte an dergleichen überhaupt nicht gedacht.
Schon machte die Frau Miene, ihren Ordner zu schließen, als der Besucher begann, die Ereignisse der zurückliegenden Wochen im allgemeinen und den dramatischen Brand der Sternberger Stasibaracke im besonderen zu schildern. Damit gelang es ihm wenigstens, die Frau für seine Sache zu interessieren. Huldvoll erklärte sie, daß sie bereit sei, ihm zu glauben, bestand aber darauf, daß ein Sterbenachweis für Frank Steppach nachgeliefert werden müsse. Schließlich wies Eicke Nordhöven die Beamtin noch einmal auf die Notiz am Ende des Manuskripts hin, wonach dieses an einen Mann namens Dr. Harald Fredeburg zu gehen habe, falls dieser noch lebe. Nachdem die Frau nun bereit war, sich intensiver mit der Angelegenheit zu beschäftigen, zog sie einen Computerausdruck aus ihrem Schnellhefter und sagte:
«Es ist nämlich so, der Mann, den Sie meinen, hat tatsächlich von 1947 bis 1963, also siebzehn Jahre lang, unter dem Namen Dr. Fredeburg hier als Chirurg und Chefarzt gearbeitet. 1963 allerdings muß es ein Verfahren gegeben haben, denn von da an lebte der gleiche Mann unter dem Namen Dr. Maximilian Benedikt weiter und behielt seine alte Position als Facharzt für Chirurgie und leitender Arzt der Städtischen Krankenanstalten bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1977 bei. Was dem zugrunde gelegen hat, kann ich nicht sagen, denn darüber haben wir keine Unterlagen. Wir haben nur den Antrag Dr. Fredeburgs und eine Bestätigung des Gerichts, daß Dr. Fredeburg seinen ursprünglichen Namen Maximilian Benedikt wieder führen dürfe, unter dem er am 16. Juni 1912 hier in Aschaffenburg geboren wurde.»
«Davon kann Dr. Steppach nichts gewußt haben», sagte der Mann aus der DDR. «Sonst hätte er nicht 1979 noch den Namen Fredeburg verwendet.»
Das sei möglich, meinte die Beamtin einsilbig. Deshalb fuhr Eicke Nordhöven fort: «Bis ungefähr 1961 muß auch Dr. Steppach hier in dieser Stadt gelebt haben, ergibt sich darüber etwas aus Ihren Unterlagen?»
Die Beamtin fragte ihren Computer, der aber nichts enthielt. Daraufhin gab sie eine telefonische Anweisung, und nach wenigen Minuten lag eine entsprechende Karteikarte vor ihr. Sie las vor: «Frank Steppach ist am 9. Mai 1927 geboren und war mit Ausnahme einer kurzen Militärdienstzeit immer hier gemeldet. Er war Mediziner, erwarb das Doktorprädikat und das Facharztdiplom als Internist und ist seit dem September 61 ohne Abmeldung spurlos aus dieser Stadt verschwunden. Das ist alles, was ich Ihnen dazu sagen kann.»
«Es stimmt aber mit dem überein, was Dr. Steppach in diesen Aufzeichnungen selbst schreibt», sagte Eicke Nordhöven. «Über die Gründe muß ich meinerseits Stillschweigen bewahren. Aber Sie können Ihre Kartei jetzt vervollständigen. Denn von diesem Zeitpunkt an war er Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und Leiter des allgemeinärztlichen Ambulatoriums zu Sternberg im Bezirk Schwerin. Er starb am 31. Juli 1979 bei einem Verkehrsunfall in Kühlungsborn im Bezirk Rostock.»
Ohne äußerlich erkennbare Gemütsbewegung machte die Frau eine Notiz auf ihre Karteikarte und verpflichtete ihren Besucher dann noch einmal in strengem Ton, unbedingt die Nachweise für seine Behauptungen nachzuliefern. Schließlich sah sie ihn mit einem Anflug menschlichen Interesses an und sagte:
«Und nun brauchen Sie noch die Adresse von Professor Benedikt.» Ohne eine Antwort abzuwarten, zog sie einen Zettel zu sich heran, notierte darauf Anschrift und Telefonnummer und schob den Zettel über die Tischplatte ihrem Besucher zu. «Das ist draußen in Haibach, Herr Nordhöven. Am besten nehmen Sie ein Taxi.»
«Ich habe einen Wagen», sagte Eicke Nordhöven stolz, bedankte sich und stand auf.
«An Ihrer Stelle würde ich vorher telefonieren», rief ihm die Frau noch zu, bevor er die Tür hinter sich zuzog. Aber genau das beschloß Eicke Nordhöven, auf keinen Fall zu tun. Er ging zurück zu seiner Pension, zahlte den Logispreis, packte seine Sachen zusammen und bestieg sein Auto. Denn wenn er den Professor antraf, wollte er keinesfalls ein zweites Mal übernachten. Und das nicht nur wegen der zweihundertelf Mark vierundvierzig.
Er nahm seinen Weg hinaus nach Haibach und fand dort eine hübsche kleine Stadt am Fuße des Wendelberges, und etwas abseits der Hauptstraßen ein ruhiges Wohnviertel. Er hielt den Wartburg an und betrachtete die Umgebung. Es erstaunte ihn, daß der Professor nicht, wie es seinen sozialistischen Vorstellungen entsprochen hätte, eine große, vornehme Villa bewohnte. Vielmehr gab es eine an den Berghang geschmiegte Fichtenparzelle, in der drei elegante und durch Bepflanzung geschickt gegeneinander abgeschirmte Wohneinheiten standen, aus Sichtbeton, zweistöckig mit Flachdach. Nach Süden zu hatten die einzelnen Wohnungen tief nach unten gezogene Loggien, die Brüstungen bildeten Pflanztröge, worin zu dieser Jahreszeit, kurz vor Weihnachten, niedriges Nadelgewächs wurzelte. Das mittlere der drei Häuser trug die Nummer, die der Mann aus Mecklenburg suchte. Die Klingeltafel wies nur fünf Namen auf. Einer davon war der des Arztes. DR. MAX BENEDIKT stand dort zu lesen, sonst nichts. Eicke Nordhöven läutete.
Nach kurzer Zeit knisterte es in der Sprechanlage, und Eicke Nordhöven vernahm ein fragendes «Ja bitte?» Darauf war er nicht vorbereitet. Eine funktionierende Meldeanlage hatte er überhaupt noch nie gesehen. Er fragte also etwas verwirrt, ob er mit Professor Benedikt sprechen könne.
«Ja, das bin ich», antwortete der Arzt. «Wer sind Sie denn und was wollen Sie?»
Die Stimme klang frisch und sehr distanziert, keineswegs greisenhaft. Die Stimme eines Mannes, dessen Absicht es nicht war, sich von jedem Beliebigen stören zu lassen. Er wartete auf Antwort. Eicke Nordhöven räusperte sich vor Verlegenheit und sagte dann: «Ich heiße Eicke Nordhöven. Ich bin der Besitzer einer Druckerei in Sternberg in Mecklenburg. Und ich habe Ihnen etwas zu übergeben. Allerdings ist mir Ihr Name als Dr. Harald Fredeburg genannt worden.»
Eine Weile war Schweigen in der Anlage. Ein Schweigen der Überraschung. Dann wurde von oben geantwortet. «Ich habe einmal so geheißen. Das ist lange her. Was ist es, das Sie mir zu übergeben haben?»
«Eine Art schriftliches Vermächtnis, Herr Professor.»
«So! Und von wem?»
«Von Doktor Frank Steppach.»
Wieder war eine Weile Schweigen. Dann der Professor: «In welcher Beziehung stehen Sie zu Doktor Steppach?»
«In gar keiner mehr. Doktor Steppach war Leiter des Ambulatoriums in unserer Kreisstadt, und ich war sein Patient. Er starb im Juli 1979. Zwischen den Resten der Akten unserer Staatssicherheit fanden sich fünf Hefte mit handschriftlichen Aufzeichnungen. Am Ende steht die Anweisung, diese Hefte Doktor Fredeburg zu übergeben, falls er Doktor Steppach überleben sollte. Halten Sie sich für empfangsberechtigt, Herr Professor?»
«Ja, das halte ich», antwortete nach einer Pause der Arzt. «Kommen Sie herauf.»
Gleichzeitig ertönte der Türsummer, und Eicke Nordhöven drückte die Tür aus Vollglas auf. Er kam in eine nicht allzu große und eher niedrige Eingangshalle, mit dunkelgrau gemasertem Marmor verkleidet und mit einer von eckigen, ebenfalls marmorverkleideten Säulen gestützten schneeweißen Decke, von der ein Kristall-Lüster hing. Im Hintergrund gab es einen Aufzug, den Eicke aber mied. Eine großzügige Treppe war mit roten Kokoslaüfern belegt. Im Obergeschoß war eine der beiden schweren messingbeschlagenen Mahagonitüren geöffnet, und unter ihr wartete der Professor auf den Besucher. Für jeden der beiden Männer war das Erscheinungsbild des anderen fremdartig. Für den Mann aus Mecklenburg, der in seiner dunkelblauen Schiffermütze, seinem Rollkragenpullover unter der groben Joppe und mit den fünf Heften unter dem linken Arm die Treppe heraufgestapft kam, hatte der Professor rasch etwas übrig. Für Nordhöven unterschied sich das Aussehen des Arztes von dem Eindruck, den seine Stimme gemacht hatte. Der Professor war nicht mehr als mittelgroß, und dazu war seine Gestalt schon ein wenig gebeugt. Er trug eine helle, wohlgebügelte Hose, darüber eine dunkelbraune Homespunjacke und dazu ein cremefarbenes Rollkragenhemd. Der Kopf war der eines älteren Herrn – und doch auch wieder nicht. Der Haarwuchs war schon spärlich und silberfarben, mit hoher Stirnglatze. Dazu kam eine ebenfalls silbrige englische Bürste auf der Oberlippe. Schmal sprang die Nase vor, und auf ihr saß eine goldgeränderte bifokale Brille. Hinter ihren Gläsern bemerkte Eicke Nordhöven das einzige, was ihm äußerlich zu der Stimme zu passen schien, die er unten vor der Haustür gehört hatte: zwei Augen von einem tiefen, fast anthrazitfarbenen Grau, die ihn ziemlich kühl musterten.
Nachdem auch Eicke Nordhövens Prüfung zur Zufriedenheit des Arztes ausgefallen war, bat er ihn in die Wohnung und schloß die Tür. Nordhöven nahm seine Mütze ab und fand sich unversehens in der dämmerigen Behaglichkeit eines kultivierten Zuhause. Einzelne Stehlampen brannten und betonten die Abgrenzung der Räume gegen das eintönige Grau des tristen Wintertages draußen. Es gab dämpfende Teppiche, tiefe behagliche Sessel und einzelne geschmackvoll plazierte Möbelstücke aus Barock und Biedermeier. Man setzte sich, und der Professor bot etwas zu trinken an. Für den Mann aus Sternberg war das alles eine andere Welt. Etwas bedrückt zog er die fünf Hefte unter seinem linken Arm hervor und legte sie, pedantisch gestapelt, vor den Hausherrn auf die vertiefte indische Messingplatte des niedrigen länglichen Tisches. Dort ließ sie der Professor vorerst unberührt liegen. Ob sein Besucher diese Aufzeichnungen denn gelesen habe?
«Ja», antwortete Nordhöven. «Sonst wüßte ich gar nicht, wer Sie sind und an wen sie gehen sollen.»
«Dann kennen Sie also Doktor Steppach und wahrscheinlich auch mich weit besser als ich selbst?»
Eicke Nordhöven antwortete langsam und überlegt. Alles, was er in den Wachstuchheften über den Mann ihm gegenüber erfahren hatte, zwang ihn zu größter Zurückhaltung und Diskretion.
«Ich weiß nur, was Doktor Steppach über Sie geschrieben hat, Herr Professor. Ob es die Wahrheit ist, wissen nur Sie allein. Und ob Doktor Steppach über sich selbst die Wahrheit geschrieben hat, wissen vielleicht auch nur Sie.»
Eicke Nordhövens Augen hatten sich allmählich an das behagliche winterliche Dämmerlicht gewöhnt, das in dem weitläufigen und niedrigen Wohnzimmer herrschte. Er sah jetzt auch die Rücken zahlloser Bücher, die in den Regalen standen, welche die Wände vom Fußboden bis zur Decke einnahmen. Er sah in einem dieser Regale die großformatige Fotografie einer jungen Frau von einer sonderbar strengen Schönheit, die noch dadurch betont wurde, daß diese Aufnahme offenbar ein Schnappschuß war. Die junge Frau schien von dem Fotografen angesprochen oder gerufen worden zu sein, denn sie blickte über die linke Schulter zurück auf den Betrachter. Sie trug auf glattem, kinnlangem dunklen Haar eine flotte Baskenmütze, und undeutlich konnte man erkennen, daß sie ein Männerhemd mit militärischem Schnitt angehabt haben mußte, denn man sah einen Ansatz von sportlichen Schulterklappen. Von dieser Fotografie ging eine erregende Spannung aus. Irgendwie paßten Bild und Frau nicht in die heutige Zeit.
Der Professor fuhr in dem Gespräch fort: «Doktor Frank Steppach war in meiner Klinik der Leiter der Inneren Abteilung. Er erschien am 6. September 1961 nicht zum Dienst, und ich habe seit diesem Tage nichts mehr von ihm gehört.»
«Ich weiß», sagte Eicke Nordhöven. «Er beschreibt es in seinen Aufzeichnungen.»
«Schreibt er auch etwas über seine Gründe?» forschte der Professor.
Eicke Nordhöven, der seine Augen nicht von der in narbiges Naturleder gerahmten Fotografie wenden konnte, antwortete nachdenklich: «Ja, er schreibt auch etwas über seine Gründe.»
«Was interessiert Sie an dieser Fotografie?» fragte der Professor, der bemerkt hatte, wohin sein Besucher sah. Darauf angesprochen, sah sich Eicke Nordhöven vor der Wahl, ausweichend zu antworten oder konkret. Er entschied sich nach kurzem Zögern für das zweite. «Ich kenne auch diese Frau dort», sagte er. «Sie ist Florence de Chateauvilain, die Tochter des französischen Admirals Robert de Chateauvilain.»
Daraufhin trat eine Weile Stille ein. Sie war so tief, daß man plötzlich das Schilpen der Meisen hörte, die sich draußen in der Loggia um den besten Platz am Futterring zankten. Als Eicke Nordhöven es endlich wagte, den Blick dem Hausherrn zuzuwenden, saß der Professor in seinem Sessel, das Glas, aus dem er gerade hatte trinken wollen, in der halb erhobenen Hand und starrte seinen Besucher an.
«Diesen Namen können Sie sich nicht aus den Fingern saugen», murmelte er endlich. «Wo haben Sie ihn her?»
«Doktor Steppach schreibt darüber», sagte Eicke Nordhöven.
Der Arzt stellte das volle Glas zurück auf die indische Messingplatte, erhob sich und ging hinüber zur Glastür, die zur Loggia führte. Nach einer Weile drehte er sich um und sagte: «Frank Steppach hat diese Frau nicht gekannt, Nordhöven. Er kann sie gar nicht gekannt haben. Wie kommt er zu ihrem Namen?»
«Um diese Frage zu beantworten, wollte er vielleicht, daß Sie seine Aufzeichnungen lesen», sagte Eicke Nordhöven. «Sie sollten es wirklich tun, Herr Professor. Es gibt vieles in Ihrem Leben, von dem selbst Sie nichts wissen. Und ganz grundlos bin ich die achthundert Kilometer schließlich auch nicht hier herunter gefahren.»
Schweigend stand Maximilian Benedikt, der einmal für 17