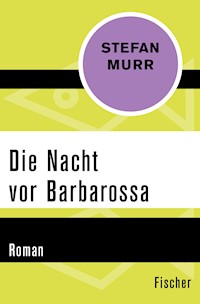3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Er hatte eine Entdeckung gemacht, die weltweit revolutionär war. Damit kein anderer an das unbezahlbare Geheimnis kam, sollte er aus dem Verkehr gezogen werden. Doch entführt wurde er schließlich von ganz anderen Leuten. Und die hatten ein Motiv, das ebenso banal wie aberwitzig war ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Ähnliche
Stefan Murr
Der Josephson-Coup
Kriminalroman
FISCHER E-Books
Inhalt
»Im sechzehnten Jahrhundert war Machiavelli einer der ersten, der das Management als eine vom moralischen Gesetz getrennte Funktion betrachtete. Er entwickelte eine amoralische Theorie für die Führung von Organisationen.«
Pascale/Athos: Geheimnis und Kunst des japanischen Managements, HEYNE-KOMPAKTWISSEN, Band 121, S. 21
»Die Rechner der 5. Generation, deren Schaffung das japanische Wirtschaftsministerium zum nationalen Anliegen ausgerufen und für 1990 angekündigt hat, sollen klein, robust, automatenhaft und billig sein; sie sollen lernen, assoziieren, logisch schließen, Entscheidungen treffen und Informationen wie mit den Sinnen eines Menschen erfassen können; als gesprochene Sprache, geschriebene Texte, gesehene Bilder oder Grafik. Die Autonomisierung der Apparate erreicht den Rang der Substitution menschlicher Fähigkeiten.«
Dr. Horst Herold, Präsident (1971–1981) des Bundeskriminalamtes i.R. im Bayerischen Rundfunk am 30. März 1984
»In Tokio steht die Ausrottung der Konkurrenz auf dem Programm, die Fortsetzung des Krieges auf wirtschaftlicher Ebene.«
Dr. Peter Niedner, Vorsitzender des Vorstandes der Triumph/Adler AG in NÜRNBERGER ZEITUNG vom 25. März 1983
1
Hätte man jemals erfahren, was wirklich dahintersteckte, wäre diese Kriminalaffäre unter der Bezeichnung »Der Josephson-Coup« in die Polizeigeschichte eingegangen. Sie begann an einem 29. Oktober. Dieser Tag war ein Sonntag und der letzte Tag einer bereits seit über drei Wochen anhaltenden Hochdrucklage, die das Land mit herbstlicher Schönheit verwöhnt hatte. Jedoch kündigte sich für die Abendstunden von den Britischen Inseln her die Kaltfront eines Regen- und Sturmtiefs an. Davon war am Morgen gegen neun Uhr noch nichts zu merken, als Marieclaire Veyth im Frühstückszimmer mit ihrem Sohn Ralph telefonierte. Sie war sechsunddreißig, eine Schönheit mit schmalem Gesicht, großen dunklen Augen und straff zurückgekämmtem, dunklem Haar, das kleine, anliegende Ohren freiließ und in der Gefahr stand, etwas strähnig zu wirken, sobald man es vernachlässigte. Ihr Blick ging während des Gesprächs über den mit weißem Porzellan und Silber gedeckten Frühstückstisch hinaus in den weitläufigen Garten, in dem ein zarter Bodennebel zwischen den Blautannen hing. Ralph war vierzehn Jahre alt und befand sich etwa dreihundert Kilometer von ihr entfernt in der Telefonzelle neben dem Postzimmer im Unterhaus des Landschulheims am Solling in Holzminden an der Weser.
»Mutti«, sagte er. »Mutti, stell dir vor, wir können heute fahren. Und weil in vielen Gegenden Allerheiligen dazwischenliegt, und das alles sonst für manche zu kurz und zu gedrängt würde, brauchen wir erst in einer Woche wieder hier zu sein. Eigentlich wollte ich während der Herbstferien hierbleiben. Wer weiter als zweihundert Kilometer weg wohnt, darf das. Aber jetzt bin ich von Stettens eingeladen worden …«
»Stettens, wer ist das?« fragte Marieclaire ihren Sohn, und Ralph warf Regin Stetten, der neben ihm stand, einen vielsagenden Blick zu. »Jetzt will sie wissen, wer ihr seid«, flüsterte er und gab dann die Hand mit der zugehaltenen Sprechmuschel wieder frei. »Regin ist eine Klasse unter mir und seit Ostern mein bester Freund. Sie haben Steinbrüche und wohnen in Rabenau, ganz in der Nähe von Gießen. Darf ich, Mutti? Ach bitte, das wäre Spitze.«
»Gießen? Dann bist du ja ohnehin schon fast hier, Ralph. Und ist das Regins Eltern überhaupt recht? Wissen sie denn etwas von der Einladung? Oder habt ihr das unter euch Jungens abgemacht?«
Diese Fragen verwirrten Ralph, und er übergab ohne Ankündigung den Telefonhörer an seinen Freund. Regin, ein aufgeweckter Junge mit klaren blauen Augen und blondem Haar im Pagenschnitt, verhandelte mit Ralphs Mutter weiter.
»Na klar, Frau Gersheim …«
Ralph stieß seinem Freund in die Seite. »Veyth heißt sie, du Niete«, zischte er. »Ich heiße Gersheim und mein Vater auch.«
»Tschuldigung, Frau Veyth«, sagte der Junge. »Ralph hat mir das natürlich erzählt, aber ich hab’s vergessen. Also, Frau Veyth, ich habe gestern abend mit meinen Eltern gesprochen, und es ist ihnen recht. Bis heute in einer Woche. Wir haben ein prima Fremdenzimmer unter dem Dach, und wenn Ralph etwas braucht, kann er es von mir kriegen, okay?«
»Und wie kommt ihr dorthin?« fragte Marieclaire. »Gib mir Ralph noch mal, Regin.«
Der Junge reichte den Hörer wieder seinem Freund und sagte, während er das tat: »Jetzt will sie noch wissen, wie wir zu uns kommen. Ist die alte Dame aber umständlich, Mann.«
»Mutti«, sagte Ralph in die Sprechmuschel. »Hör mal, Mutti, Regins Bruder Edzard, Ed heißt der sozusagen, der ist in der Abschlußklasse. Der ist neunzehn, und die haben gerade ihr Abi schriftlich hinter sich. Der hat schon seinen Führerschein und einen Käfer, der nimmt uns mit und bringt uns auch wieder her, einverstanden?«
Ralphs Mutter zögerte. »Neunzehn und seinen Führerschein – wenn das gutgeht … Paß mal auf, Ralph, gib mir Stettens Telefonnummer. Ich spreche mit Onkel Franz und ruf euch dann noch mal an. Was ist denn das für ein Krach bei euch?«
Draußen vor der Telefonzelle drängelten sich andere Schüler, die auch darauf warteten, mit ihren Eltern die plötzlich notwendig gewordene Ferienregelung abzusprechen. Ralph gab noch einmal Regin den Hörer und hielt die Tür zu, während Regin die Telefonnummer seiner Eltern durchgab. Als das geschehen war, hängte Regin den Hörer ein, Ralph öffnete die Tür und das nächste Team stürmte laut schimpfend die Telefonzelle.
In Bad Homburg-Oberstedten war Dr. Franz Veyth vom oberen Stock, wo die Schlafzimmer lagen, nach unten gekommen und hatte das Frühstückszimmer in dem Augenblick betreten, da seine Frau den Hörer des Telefons auf die Gabel zurückgelegt hatte.
»Mit wem hast du gesprochen, Liebling? Sonntag morgen, neun Uhr. Ziemlich ungewöhnlich.«
Veyth kam herüber zu seiner Frau und küßte sie, erst auf die Stirn und dann aufs Haar. Marieclaire stand auf. »Ralph hat aus dem Landschulheim angerufen«, sagte sie. »Setz dich, Franz, ich bringe den Kaffee und lege die Eier ins Wasser.«
Marieclaire verschwand in die Küche, und Franz Veyth setzte sich an den Frühstückstisch und schob Brotscheiben in die Schlitze des Toasters.
»Es ärgert mich jedesmal, wenn ich dich Hausarbeit machen sehe«, sagte er, als Marieclaire mit einem Tablett aus der Küche kam, auf dem die Kaffeekanne stand. »Als ob wir uns keine Haushälterin leisten könnten.«
Marieclaire schenkte ihrem Mann Kaffee ein, danach sich selbst, und setzte sich.
»Ich finde es gut, daß wir niemanden ständig im Haus haben. Lieber mache ich wirklich mal am Wochenende was zurecht, als daß ich jede Nacht darauf achten muß, ob jemand im Haus herumschleicht und womöglich durch Schlüssellöcher schaut oder an Türen lauscht. Wenn Frau Braun von Montagfrüh bis Freitagabend jeden Tag zwölf Stunden hier herumschnüffelt, genügt das, findest du nicht auch?«
Der Toaster schnappte, Franz Veyth zog eine Scheibe heraus, reichte sie seiner Frau über den Tisch und lachte. Marieclaire begann sich das Brot zu streichen. »Und außerdem müssen wir auf den Knien danken, daß wir eine ehrliche Person haben, bei dem, was hier alles so herumsteht. Bei Diebstahl von innen versagt jede Alarmanlage, vergiß das nicht. Ich kann nicht jeden Tag dein goldenes Besteck nachzählen.« Sie biß in das Brot.
»Dein goldenes Besteck, Marieclaire. Du solltest unser gemeinschaftliches Testament nicht vergessen und wenigstens ›unser‹ sagen. Was wollte der Junge?«
»Ralph läßt dich grüßen. Sie haben ein paar Tage Ferien, und er möchte mit einem Freund zu dessen Eltern nach Hause fahren. Stetten oder so ähnlich heißen die Leute. In der Nähe von Gießen. Sie sollen Steinbrüche haben.«
»Steinbrüche, so«, sagte Franz. »Wie kommt er denn dorthin, zu den Leuten mit den Steinbrüchen.«
Das Unbehagen, das Marieclaire bei dem Telefongespräch mit Ralph befallen hatte, verspürte sie erneut, als sie zu ihrem Mann sagte: »Ralphs Freund hat einen neunzehnjährigen Bruder in Holzminden, der gerade sein Abitur macht. Mit dessen Wagen wollen die drei Jungen fahren.«
Franz Veyth blickte hoch und sah seine Frau an. »Neunzehn? Und mit dessen Wagen? Was sind denn das für Leute, die ihrem Neunzehnjährigen ein eigenes Auto kaufen, bevor er irgendwas auf die Waage gebracht hat? Noch nicht einmal das Abitur.«
Marieclaire kannte den konsequenten Grundton in der konservativen Einstellung ihres Mannes nur allzugut.
Sie konnte das selbst nicht nachvollziehen und litt deshalb darunter. Etwas gequält sagte sie: »Das tun doch heute fast alle, wenn sie das Geld dazu haben, Franz.«
»Ich habe das Geld dazu ganz gewiß, Marieclaire, sogar für einen Bentley oder einen Maserati. Aber ich schwöre dir, seinen Führerschein und seinen ersten Wagen bezahlt der Junge selbst. Ob er dafür spart oder arbeitet ist mir egal. Wenn er später mal in die Firma will, muß er ohnehin beides können: sparen und arbeiten.« Franz Veyth machte eine Pause und schüttelte dann den Kopf. »Und erst neunzehn«, fuhr er fort. »Das gefällt mir ganz und gar nicht. Die fahren ja heute alle wie die Irren.«
»Du wirst doch dem Jungen nicht den Spaß verderben wollen, Franz?« sagte Marieclaire, als ihr Mann das Telefon zu sich herüberzog.
»Nein«, antwortete Franz Veyth. »Ralph ist für mich wie ein eigener Sohn. Wenn ich Verantwortung habe, habe ich auch Pflichten. Wie ist doch wieder die Nummer?«
Marieclaire wußte sie auswendig und sagte sie ihrem Mann. Franz Veyth wählte und verlangte, als am anderen Ende der Leitung abgehoben wurde, nach seinem Stiefsohn. Er mußte eine Weile warten, und dann hörte Marieclaire ihn fragen: »Wie?« und hinzufügen: »Wann war das?« Nachdem Veyth die Antwort auf diese Frage erhalten hatte, sah er mechanisch auf die Armbanduhr und legte den Hörer auf. »Die Jungen sind vor zehn Minuten losgefahren.«
»Und ich habe Ralph ausdrücklich gesagt, daß sie warten sollen, bis ich zurückgerufen habe«, erwiderte Marieclaire.
Franz Veyth stand auf. »Du weißt doch, was sie alles in den Wind schlagen«, sagte er. »Jetzt können wir nur noch hoffen, daß das gutgeht, unzuverlässig wie die sind.«
»Er ist doch nun erst mal vierzehn«, sagte Marieclaire. »Vielleicht warst du mit vierzehn auch noch nicht so zuverlässig wie jetzt.«
Dr. Franz Veyth gab darauf keine Antwort. Er trat ans Fenster und blickte durch die riesige, isolierte Scheibe nach draußen in den Garten, wo eine goldene Schicht herabgefallenen Laubes den allmählich welkenden Rasen bedeckte. »Leiman sollte morgen kommen und den Garten in Ordnung bringen«, sagte er.
»Leiman haben sie die Fenster eingeschmissen. Und seine beiden Kinder werden fast täglich auf dem Heimweg von der Schule blutig geprügelt«, erwiderte Marieclaire. »Er wohnt in einer Gegend, wo fast nur Deutsche sind. Es wäre besser für ihn, wenn er in die Nähe von anderen Türken ziehen würde, da können sie sich gegenseitig helfen. Dieser Ausländerhaß kocht hoch wie Milch auf dem Feuer, und man kann gar nichts dagegen tun.«
Franz Veyth seufzte. Fast ein Fünftel der Belegschaft in der »Kältetechnik« bestand aus Ausländern. Er hatte es kommen sehen, als in der Gier nach immer mehr Wohlstand die Regierungen jeder Schattierung undurchdachte und später aus dem Ruder laufende Ausländergesetze verabschiedet hatten, die Illusionen weckten und zum Mißbrauch herausforderten. Es war unvermeidlich, daß sich in der Bevölkerung Ressentiments bildeten, die sich anstatt gegen die Urheber gegen die Opfer richteten, sobald es erforderlich wurde, sich wieder nach der Decke zu strecken. Und jetzt schob die Regierung, wie mit Blindheit geschlagen, der Bevölkerung die Schuld zu, die sie primär selber traf. Franz Veyth wandte sich um. »Nein«, sagte er, »man kann gar nichts dagegen tun.« Er beugte sich zu seiner Frau und küßte sie auf beide Wangen.
»Du fährst zum Golfplatz?« fragte sie.
»Ich spiele eine Partie«, sagte ihr Mann. »Zum Mittagessen bin ich wieder zurück.«
Er verließ das Zimmer. Marieclaire sah ihn später draußen über den Rasen zum Garteneingang der Garage gehen. Er trug lange, helle Hosen, einen karierten Sportpullover, einen hellen Wollschal und eine helle englische Schirmmütze. Eine gute und auffallende Erscheinung.
Von seiner Krankheit, die ihm zu schaffen machte, sah man ihm wahrhaftig nichts an. Marieclaire wußte, daß ihr Mann das Golf-Kabriolett nehmen würde, nicht wegen der Namensassoziation zwischen dem Spiel und dem Wagentyp, sondern weil sein persönlicher Stolz sein persönliches Understatement war. Es gehörte zu seinem Ehrgeiz, daß unter den protzigen Statuskarossen, mit denen andere Mitglieder des Klubs sich großtaten, sein Wagen der kleinste und unscheinbarste war. Denn jedermann wußte dennoch, daß Franz Veyths Konto, und auch das seines Vaters und Großvaters, schon für große Wagen gereicht hatten, als die anderen, die sie jetzt vorzeigten, noch Schubkarren geschoben hatten oder mit dem Fahrrad gestrampelt waren.
Er steuerte das Auto rückwärts aus der Garage, drückte auf einen Knopf, damit das Tor sich schloß, und fuhr auf der stillen Villenstraße, in der er wohnte, davon.
Wie seit vielen Wochen wartete Bernd Hassmeyer auch an diesem Tag in einem Fahrzeug, welches die Parade der Wohlstandskutschen auf dem Parkplatz des Sachsenhausener Golfklubs keineswegs zu scheuen brauchte, dort, wo Veyth zum erstenmal rechts einbiegen mußte. Er hatte den Wagen in einer nach links führenden Seitenstraße abgestellt, in die Veyth beim Abbiegen niemals zu blicken hatte, weil die Vorfahrt anders verlief. Und in der Tat hatte Veyth das Fahrzeug, das ihm folgte, bisher noch nie bemerkt.
Hassmeyer lächelte zufrieden, als er seinen Wagen vom Bordstein steuerte und mit der Präzision eines Computers registrierte, daß es auch diesmal das gleiche war. Veyth nahm die Autobahn an der Auffahrt Bad Homburg-Nord. Hassmeyer folgte ihm bis hinunter zum Bad Homburger Kreuz.
»Wenn er jetzt rechts fährt, ist es heute soweit«, knurrte Hassmeyer seinem Beifahrer Alfred Mardorf zu und sah durch den Schleier des feinen Nebels gespannt nach vorne, wo gleich darauf an dem Kabriolett von Franz Veyth das rechte Blinklicht aufleuchtete. Auch Hassmeyer blinkte und folgte in angemessener Entfernung dem weißen Kabrio hinüber auf die A 5, auf der sie in Kürze das Nordwestkreuz und das Westkreuz passierten. An der Kelsterbacher Ausfahrt verließ Veyth die Autobahn und fuhr in Richtung Frankfurter Süden weiter. Jetzt gab es nach Hassmeyers gewissenhaften Beobachtungen nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder fuhr Veyth zu seinem Werkslabor, das in einem Gewerbegebiet von Niederrad lag, oder zum Sachsenhausener Golfklub, worauf seine Kleidung und die Tatsache hindeuteten, daß heute Sonntag war. Eine gewisse Enttäuschung bemächtigte sich Hassmeyers, als Franz Veyth tatsächlich die Schnellstraße bei Niederrad verließ und durch das Gewirr schmaler Straßen bis zu dem Grundstück in der Nähe eines Fußballplatzes fuhr, auf dem sich das Labor befand. »Scheiße«, sagte Mardorf, als Dr. Veyth das Kabrio vor dem Gittertor anhielt und ausstieg.
»Der holt bloß was«, erwiderte Hassmeyer. »Schau ihn doch an, so fährt man nicht ins Labor. Und das Licht läßt er auch brennen.«
»Sollen wir?« fragte Mardorf nach einigen Sekunden des Überlegens.
»Natürlich«, antwortete Hassmeyer, schlug gleichzeitig die Räder ein und wendete den Wagen, um, wie es hundertmal überlegt und mehrmals geprobt worden war, noch vor Dr. Veyth auf dem weitläufigen Waldparkplatz des Sachsenhausener Golfklubs zu sein. Dies gelang.
Schien heute auf den Taunusbergen auch eine zwar etwas blasse, aber strahlende Spätherbstsonne, und war noch auf der Höhe von Oberursel und Bad Homburg der Dunst licht und durchsichtig, so war doch hier unten in der Mainniederung ein grauer und feuchter Nebel, der sich, wenn überhaupt, erst am späten Vor- oder frühen Nachmittag verflüchtigen würde. Und das war für die Ausführung von Bernd Hassmeyers Plan ideal.
Er erreichte mit seiner großen Limousine den sich zwischen alten Nadelbaumbestand hineinziehenden Parkplatz des in die Wälder südlich von Sachsenhausen eingebetteten Golfplatzes, wo alles noch in feiertäglicher Ruhe dalag. An einer Stelle, von wo aus sie gut beobachten konnten, wendete er die Limousine und fuhr sie rückwärts zwischen die Bäume. Durch die Frontscheibe konnten sie alles überblicken. Auf dem weitläufigen Parkplatz standen bis jetzt nicht mehr als acht oder zehn Wagen. Franz Veyth kam mit dem Kabriolett etwa zwanzig Minuten später. Er hatte die Scheinwerfer noch immer eingeschaltet, fuhr jetzt langsamer und suchte sich dann einen Platz drüben in der Nähe der anderen Fahrzeuge, wo auch die Gebäude des Klubheims unter hochgewachsenen Fichten zu sehen waren. Er löschte das Licht, stieg aus und versperrte den Wagen. Während er, nachdem er das getan hatte, das Schlüsseletui spielerisch in der einen Hand schlenkerte, schob er die andere in die Tasche der Hose und blickte prüfend in den grauen, nur nach oben etwas heller und durchsichtiger werdenden Nebel. Schließlich gab er sich einen Ruck und schritt trotz des schlechten Ergebnisses seiner Prüfung hinüber zu dem Eingang der Klubgebäude, wo er in der Tür des etwas zurückliegenden Flachbaus verschwand. In der halb versteckten Limousine sahen Bernd Hassmeyer und Alfred Mardorf einander in die von dunklen Bärten eingerahmten Gesichter.
»Heute könnte es klappen«, knurrte Mardorf. Hassmeyer ließ den Motor an. Langsam und sehr leise glitt die Limousine, hier und da mit den Reifen durch eine flache Pfütze platschend, quer über den Platz, wurde noch einmal gewendet und stieß dann rückwärts auf die freie Stelle neben der linken Seite von Franz Veyths Kabriolett, wo dieser, wenn er zurückkam, um nach Hause zu fahren, einsteigen mußte.
Die beiden Männer dachten in diesem Augenblick an das gleiche. Bereits zweimal war das Unternehmen mißglückt. Einmal weil nicht genügend Platz neben Franz Veyths Fahrzeug zur Ausführung ihres Plans gewesen war, und ein zweites Mal, weil in letzter Sekunde eine Störung durch ein ankommendes Fahrzeug und dessen Insassen eingetreten war. Diesmal würde es gelingen. Die Zeit bis dahin überbrückten die beiden Männer schweigend und gegen ihre Nervosität ankämpfend. Zu den vereinbarten Maßnahmen gehörte, daß Mardorf als der kleinere und geschicktere sich mit der Chloroformkapuze, die sich in einer luftdichten, mit einem Schraubverschluß versehenen Plastikdose griffbereit befand, in den Fond des Wagens begab, während Hassmeyer als der körperlich stärkere, den rechten Vordersitz einnahm, um den schwierigeren Teil des Ganzen zu erledigen. Als alles das geschehen war, warteten die Männer. Die Scheiben der aufwendigen Limousine waren grünlich getönt und ließen bei der ohnehin geringen Tageshelligkeit nur einen minimalen Einblick in das Wageninnere zu.
Die Geduld der beiden Männer in diesem Fahrzeug wurde auf keine sehr lange Probe gestellt. Allgemein waren bei dem nebligen Wetter die Partien aufgegeben oder auf den Nachmittag verschoben worden. Franz Veyth begrüßte im Foyer der Klubräume einige Bekannte, lehnte angebotene Drinks ab, nahm aber bei der dunkelhaarigen und hübschen Frau Gärtner am Büfett das obligate Käsebrot zu sich, daß sie ihm immer für zehn Uhr dreißig machte und auf welches Veyth angewiesen war, wenn er nicht seiner Gesundheit schweren Schaden zufügen wollte. Um dreizehn Uhr fünfzehn mußte er aus demselben Grund zurück bei Marieclaire beim Mittagessen sein. Da er sich ungern Eventualitäten aussetzte, und dazu gehörte das an Feiertagen gegen Mittag beginnende unbeherrschbare Fahrzeugchaos an den neuralgischen Straßenpunkten, bezahlte er gegen elf Uhr fünfzehn bei Frau Gärtner seinen Imbiß, wechselte mit dem einen oder anderen Klubfreund noch ein Wort, verabschiedete sich hier und dort und trat kurz danach aus der Eingangstür wieder hinaus auf den noch immer in diffusem Nebel liegenden Parkplatz, wo er einem soeben angekommenen Ehepaar aus Neu-Isenburg begegnete, das ihm vom Sehen bekannt war. Dr. Franz Veyth grüßte und hielt diesem Ehepaar höflich die Tür auf. Dies war das letzte, was vorerst die Öffentlichkeit von ihm hörte oder sah. Anschließend schlenderte er quer über den Parkplatz, erreichte sein Kabriolett und begab sich auf die linke Seite des Wagens, um die Tür aufzuschließen.
Dies war der berechnete und unzählige Male geprobte Augenblick, da sich hinter seinem Rücken die beiden rechten Türen der meergrünen Limousine öffneten und Bernd Hassmeyer hinter ihn trat, um mit einem ebenfalls lange und intensiv eingeübten Judogriff Franz Veyths Arme so nach rückwärts zu biegen, daß es einfach war, den völlig überrumpelten Mann wehrlos zu machen und mit dem Kopf zuerst durch die hintere Tür in den Fond der Limousine zu stoßen, wo Mardorf bereits mit der Chloroformkapuze wartete und sie ihm über den Kopf zog. Das alles dauerte keine zehn Sekunden. Als Franz Veyths letzte instinktive Abwehrversuche erloschen, zerrte Mardorf den Körper zu sich, wo er unter der ebenfalls bereitgehaltenen Wolldecke verschwand, während Hassmeyer bereits wieder hinter dem Steuer saß und den Motor gestartet hatte. Gespannt beobachtete er abwechselnd durch die Frontscheibe die Szenerie rings umher und im Rückspiegel die Aktivitäten seines Komplizen. Es war vereinbart, daß Mardorf jetzt Veyth die Wagenschlüssel abnehmen, das Kabriolett aufschließen und mit diesem zu dem verabredeten Versteck fahren sollte, so daß die Öffentlichkeit für einen Zeitraum, dessen Dauer die Entführer völlig unter Kontrolle hatten, über das, was wirklich geschehen war, gänzlich im unklaren blieb, und sie damit eine erhebliche Vorgabe an Handlungsfreiheit behielten. Hassmeyer mußte immer wieder zugeben, daß die Planung dieser Sache überzeugend war. Jedoch schien das gleiche für ihre Durchführung nicht zu gelten.
»Na, was ist denn mit den Schlüsseln, verdammt noch mal?« drängelte er ungeduldig und nervös.
»Ich finde keine«, sagte Mardorf. »Hinüber ist er, aber er hat keine Autoschlüssel dabei.«
»Das gibt’s nicht, such die Taschen durch, schnell, Mann …«
Hassmeyer hörte vom Rücksitz her die Geräusche, als der andere Franz Veyths Taschen durchwühlte. Eine Geldbörse flog auf den Rücksitz, ein Taschentuch, eine Pillenschachtel, die Hausschlüssel.
»Nichts«, keuchte Mardorf. Beide spähten durch die Seitenfenster des Wagens nach draußen, um festzustellen, ob Veyth die Schlüssel vielleicht unmittelbar vor dem Aufschließen der Wagentür entglitten und zu Boden gefallen waren. Aber die Stelle zwischen den beiden Autos war vollkommen leer. Um zu überlegen, was jetzt zu tun war, hatten sie nur wenige Sekunden Zeit. Hassmeyer sah nämlich in der Eingangstür des Klubgebäudes eine junge Frau auftauchen und suchend über den weitläufigen Parkplatz blicken. Er konnte das zwar nicht in allen Einzelheiten erkennen, aber aus der Haltung ihrer Hände schloß er, daß sie in einer von ihnen die Wagenschlüssel Franz Veyths hatte. Veyth mußte sie dort drin verloren oder vielleicht auch liegengelassen haben, und diese Frau hielt nun nach ihm Ausschau, um sie ihm zu bringen. Aber sie konnte ihn nirgends entdecken, denn Dr. Franz Veyth lag im Fond ihres Wagens unter einer Wolldecke verborgen, im Chloroformrausch, der zwanzig, vielleicht auch fünfundzwanzig Minuten anhalten konnte. Und in dieser Zeit mußte er dort angelangt sein, wo der Aufenthalt für ihn vorbereitet war und wo sie auch selbst unterschlüpfen wollten. Das nächste würde sein, daß diese penetrante Person da drüben die Treppe herunterstöckeln und unter lauten Rufen nach Dr. Veyth quer über den Platz herüberkommen würde.
»Leg dich flach«, rief er deshalb seinem Komplizen zu. »Verschwinde aus ihrem Blickfeld. Wir müssen ohne das Kabrio weg. Dieses Suppenhuhn da drüben kann uns das ganze Konzept vermasseln.«
Fast gleichzeitig legte er den Gang ein, beschleunigte maßvoll und sehr unauffällig und fuhr so harmlos wie möglich in Richtung Ausfahrt. Als die Limousine kurz darauf das Golfplatzgelände verließ, wußten beide, daß nun das Gelingen ihres Plans von dieser Frau abhängig war.
»Was heißt das für uns?« fragte Mardorf nach einer Weile von hinten, aber Hassmeyer fuhr ihn an: »Ruhig, du Idiot, was weißt du denn, wann der wach wird? Und je weniger er weiß oder erraten kann, desto besser.«
Also schwiegen sie, bis sie nach etwas mehr als zwanzig Minuten Fahrzeit, während welcher Franz Veyth keinerlei Lebenszeichen von sich gegeben hatte, den Ort Dietzenbach erreichten.
Dietzenbach ist eine jener synthetischen Siedlungen, wie sie aus den Wunschträumen zahlloser sogenannter Besserverdienender entstanden waren, denen man in den vergangenen Jahren eingetrichtert hatte, daß es nunmehr »in« sei, im Grünen zu wohnen. Es waren aber dann so viele Besserverdienende geworden, daß nichts anderes übriggeblieben war, als auch diese Wunschträume mit Wohnanlagen aus Sichtbeton und öden, mit Zweitwagen zugeparkten und nachts von langweiligen Peitschenlampen erhellten Asphaltstraßen zuzukleistern. Hallenbad, Einkaufszentrum, Sportplatz und Tennishalle, Griechenrestaurant, Italiener, Jugoslawe, Kunsteisbahn und Autovertretung, ebenfalls alles aus Fertigbauteilen in Sichtbeton, hoben die Lebensqualität der Bewohner. Behausungen in Dietzenbach wurden in Frankfurter Tageszeitungen etwa wie folgt angeboten: »Luxusbungalow, voll unterkellert, Atriumbauweise, zwei Garagen, herrliche, unverbaubare waldnahe Wohnlage, nur fünfzehn Autominuten vom Stadtzentrum Frankfurt«, und so weiter und so weiter …
In eines dieser Grundstücke bog Hassmeyer nunmehr mit der Limousine und ihrer brisanten Fracht ein. Das Haus stand in Hanglage. Eine große Doppelgarage ging über in eine Einzimmerwohnung im Souterrain mit eigener sanitärer Einrichtung. Nachdem das Garagentor, das sich selbsttätig schloß, sobald ein Fahrzeug die Lichtschranke von außen nach innen durchfahren hatte, nach unten gekippt war, trugen die beiden Männer den noch immer unbeweglichen Veyth in seine neue Behausung, legten ihn dort auf ein Sofa, schoben ihm ein Kissen unter den Kopf und deckten ihn sorgsam zu. Danach schlossen und versperrten sie die gepolsterten, eisenblechbeschlagenen Sicherheitstüren und begaben sich nach oben in den eigentlichen Wohntrakt. Lisbeth war Hassmeyers Frau. Sie bemerkte die beiden Männer durch die offenstehende Küchentür und ließ es zunächst bei einem fragenden Blick bewenden. Ihr Mann hielt ihr eine Faust mit dem aufgerichteten Daumen entgegen, das genügte. Erst später erzählte er Einzelheiten.
»Nur das mit seinem Wagen hat nicht geklappt, den mußten wir stehenlassen, weil er die Schlüssel verlegt oder verloren hatte.«
Mardorf fügte hinzu: »Und gerade als wir es bemerkten, kommt das Suppenhuhn von der Theke raus auf den Parkplatz und sucht den Veyth, um ihm seine Autoschlüssel nachzutragen.«
Lisbeth Hassmeyer stellte ihrem Mann die gleiche Frage wie vorher schon sein Komplize Mardorf: »Und was heißt das alles für uns, Bernd?«
Hassmeyer erläuterte: »Das heißt, daß uns ein Trumpf verlorengeht. Anders hätten sie nach Veyth mitsamt seinem Kabriolett gesucht und vielleicht eher an einen Unfall geglaubt als an so etwas hier. Nun aber werden sie das weiße Kabriolett demnächst finden und sich die Wahrheit zusammenreimen können.«
»Die volle Wahrheit? Oder nur die Tatsache, daß es kein Unfall war?« fragte Lisbeth Hassmeyer, und wieder empfand ihr Mann jenen Stolz auf sie, der ihn immer überkam, wenn sie in brenzligen Situationen steckten. Dann blieb Lisbeth überlegt, cool und hatte die für eine Frau überraschende Fähigkeit, sich auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren.
Er wandte sich an Mardorf. »Geh runter in die Garage, und bring die Kennzeichen wieder in Ordnung, damit wir das nicht vergessen.«
Sie hatten weder für diesen Coup in riskanter Weise Kennzeichen gestohlen noch solche anfertigen lassen, sondern durch Aufkleben winziger Stückchen weißer Folie Buchstabengruppe und Ziffern in ihrer Aussagekraft minimal, aber höchst wirksam verändert. Das hatte den großen Vorzug, daß das äußere Bild von Zulassungsstempel und TÜV-Plakette für jeden zufälligen Betrachter aussah wie gewöhnlich. Im übrigen hatten sie mit der die Situation unserer Tage allgemein kennzeichnenden Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit und Trägheit der meisten Menschen und mit der immer weiter um sich greifenden Geringschätzung von Details gerechnet. Ob mit Erfolg oder nicht, würde in der zu erwartenden Aussage des Suppenhuhns zutage treten.
Die Möglichkeit einer Überprüfung durch die Polizei hatten sie bewußt vernachlässigt. Wirklich im Griff hatte die Polizei nicht einmal mehr den Massenverkehr auf den Fernstraßen. Jeder Stop auf der A 5 würde Stauungen bis zurück nach Gießen und Kassel zur Folge haben, und selbstverschuldete Situationen, die eine Überprüfung herbeiführen konnten, konnte man als intelligenter Mensch – und für einen solchen hielt Bernd Hassmeyer sich mit Recht – vermeiden.
»Das wird davon abhängen, wie genau die Frau uns beobachtet hat«, antwortete er deshalb. »Und das werden wir in ein paar Stunden wissen, wenn wir ›Heute‹ und ›Tagesschau‹ gesehen haben.«
»Meinst du wirklich, daß die das bringen?« fragte Lisbeth Hassmeyer.
»Das werden wir bald erfahren«, antwortete ihr Mann.
»Aber ganz gleich, ob sie es bringen oder nicht, wir werden aus allem entnehmen können, was sie von der Sache halten. Denn das Kabriolett werden sie bis dahin gefunden haben.«
Danach wandte Bernd Hassmeyer sich zum Telefon, sah auf die Armbanduhr, wartete noch ein paar Sekunden, bis die vereinbarte Zeit erreicht war, und wählte dann eine Nummer. Die Person, die am anderen Ende der Leitung den Hörer abhob, schwieg. Das war verabredet. Hassmeyer sagte: »Die Orchidee ist jetzt aufgeblüht. Aber die Blätter haben Flecken.«
Auch das war verabredet und war der Code dafür, daß Dr. Franz Veyth sich an seinem Aufenthaltsort befand, daß er körperlich unversehrt, daß aber ein Unsicherheitsfaktor zurückgeblieben war. Als darauf keine Antwort erfolgte, sagte Hassmeyer noch: »Ich erwarte Ihre weiteren Weisungen, wegen Pflege, Gießen und so weiter.«
Als er in der Muschel das Knacken vernahm, das anzeigte, daß sein Gesprächspartner aufgelegt hatte, legte auch er seinen Hörer auf.
Bernd Hassmeyer hatte keine Ahnung, wann die Pläne für eine Entführung von Dr. Franz Veyth wirklich ausgearbeitet worden waren und wer hinter ihnen stand. Hätte er es gewußt, dann wäre die Ruhe, mit der er sich jetzt eine Pfeife anzündete, geheuchelt gewesen.
2
Toyotomi Naosuke trug einen hellgrauen Flanellanzug aus New York, ein elegant gestreiftes Oberhemd aus London, dazu eine dunkelblaue seidene Strickkrawatte aus Paris, Schuhe aus Italien und eine goldene Armbanduhr der bekanntesten Marke aus der Schweiz. Jedoch waren seine Statur, seine Augen, sein rabenschwarzes, lackartiges, am Wirbel ein wenig widerspenstiges Haar, vor allem aber sein Verstand und die Kälte seines Herzens durch und durch japanisch. Wenn Toyotomi Naosuke durch die endlosen, mit dicken Teppichen belegten Korridore schritt, erstarb zunächst alles Leben. Wer immer konnte, verzog sich in einen Seitenflur, ein Zimmer oder einen Waschraum, wer nicht dieses Glück hatte, blieb stehen und versank in einer stummen Verbeugung, bis Toyotomi Naosuke mit einem knappen Neigen seines kleinen und fast viereckigen Kopfes vorüber war. Die modernen Mätzchen, mit denen Konosuke Matsushita es erreicht hatte, außergewöhnliche Fähigkeiten in ganz gewöhnlichen Menschen zu entwickeln