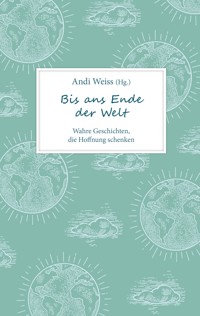
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hier erzählen Menschen von ihren guten Erfahrungen inmitten belastender Lebenssituationen. Ehrlich, ungeschönt und hoffungsvoll. Die Bandbreite zeigt, dass unerwartete, wundersame Wendungen möglich sind. Auch dann, wenn die Umstände aussichtslos zu sein scheinen. Was die Geschichten miteinander verbindet, ist die tröstliche Erfahrung, dass Menschen auch in schwierigen Situationen die Gegenwart Gottes ganz real erleben durften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Herausgeber
Andi Weiss ist auf zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen als Songpoet und Geschichtenerzähler unterwegs. Die andere Hälfte seiner Zeit berät und begleitet er als Coach und Logotherapeut Menschen in Krisensituationen und unterstützt Firmen in der Förderung ihrer Führungskräfte. Auch als Buchautor hat er sich bereits einen Namen gemacht. Von der renommierten Hans-Seidel-Stiftung wurde er mit dem „Nachwuchspreis für Songpoeten“ ausgezeichnet. Andi Weiss ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in der Nähe von München. Er engagiert sich für die Hilfsorganisation Opportunity InternationalDeutschland.
Mehr Informationen über den Autor, Logotherapeuten und Künstler finden Sie unter www.andi-weiss.de und www.trauer-sucht-trost.de
Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
– Jesus (Matthäus 28,20)
In jeder Nacht, die mich umfängt, darf ich in deine Arme fallen.Und du, der nichts als Liebe denkt, wachst über mir, wachst über allen.Du birgst mich in der Finsternis, dein Wort bleibt noch im Tod gewiss.
– Jochen Klepper
Inhaltsverzeichnis
Verblüffung am Ende der Welt
Der Bär, der Frosch und Onkel Jesus
Du glitzerst!
Ich bin zumutbar!
Es war Sommer …
Lotta
Trotzdem Ja zur Hoffnung sagen
Eine zweite Chance
Ein Leben auf der Suche
Schrei nach Liebe
Das „MichaPrinzip“
Auf der anderen Seite der Tür
Geschichte vom Strand
Bekenntnisse am Sterbebett
Christus – für dich gegeben
Warum? Oder doch eher wozu?
Wenn der Himmel die Erde berührt
Viktoria zum Gedächtnis
Der Kampf um meine Stimme
Das Flüstern der Liebe
Schau auf Gott
Tanzend in die Ewigkeit
Bis ins Ziel
Die Angst zurückzubleiben
Fürchte dich nicht
Sternentochter
Hast du heute schon Danke gesagt?
Es begab sich aber zu der Zeit …
Der unsichtbare Besucher
Freiheit gelernt in Afrika
Auf dem Wasser gehen
Am Ende der Welt
Das Fotoalbum
Gedankenlesen
Mein Jahr 2021 mit den Liedern von Andi Weiss
Nachsitzen
„Wir haben schon so viel geschafft …“
So eine Blamage
Starker Mann
Von Gott tief berührt
Zwei Engel „on tour“
Die Speisung der 5.000
Gebt, so wird euch gegeben
Gott im Religionsunterricht
Liebe Leserin, lieber Leser!
Herzlich willkommen in diesem wunderbaren Buch!
Hier erzählen ganz unterschiedliche Menschen von ganz unterschiedlichen Alltagswundern. Was alle Geschichten miteinander verbindet, ist die wundersame Erfahrung, dass Menschen wieder neu Hoffnung finden und so über sich hinauswachsen können. Hier finden sich viele verschiedene Begebenheiten und Erlebnisse, die zeigen, dass das Leben unerwartete, wundersame Wendungen nehmen kann. Auch dann, wenn Situationen schon längst aussichtslos schienen.
Normalerweise sollte ein Vorwort in einem Buch ja zeitlos sein. Aber gerade schreibe ich diese Zeilen nach vielen Corona-Monaten und immer noch mitten in der Pandemie. Seit einigen Wochen herrscht Krieg auf europäischem Boden und ich höre in den vielen Beratungsgesprächen, die ich tagtäglich mit Menschen führe, wie groß das Entsetzen, aber auch die eigene Angst ist. Die Bilder, die wir gerade im Fernsehen sehen, verstören und machen mich sprachlos. Mitten in diesen schwierigen Zeiten möchte ich mich gemeinsam mit den Autorinnen und Autoren in diesem Buch auf die Suche nach dem „Licht am Ende des Tunnels“ machen. Möchte fragen, was uns Menschen auch in diesen Stürmen trotzdem hoffen, trotzdem glauben und trotzdem leben lässt.
Im Konzentrationslager in Buchenwald wurden zwei Häftlinge beauftragt, ein Lied über das Lager zu schreiben. Daraus wurde später die berühmte „Buchenwald-Hymne“. Da heißt es: „Halte Schritt, Kamerad, und verlier nicht den Mut, denn wir tragen den Willen zum Leben im Blut und im Herzen, im Herzen den Glauben!“ Und später im Refrain: „O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen, und was auch unsere Zukunft sei – wir wollen trotzdem Ja zum Leben sagen, denn einmal kommt der Tag – dann sind wir frei!“ Welche Worte und was für eine Hoffnung in einer so lebensfeindlichen Umgebung!
Jesus sagt: „Seid getrost, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt.“ Das ist viel mehr als nur eine billige Vertröstung. An dieses Versprechen können wir uns gegenseitig immer wieder erinnern. Nicht mit einfältigen Floskeln, nicht mit einem sorglosen „Du brauchst doch keine Angst zu haben!“, sondern durch gemeinsames Ringen, durch das Suchen und Finden von tragfähigen Antworten. Dazu braucht es Geschichten. Wenn wir beginnen, unsere Nöte und Sorgen, unser Schaffen und Scheitern, unsere Erfolge und Brüche erzählend zu teilen, dann beginnen wir, gemeinsam nach Trost zu suchen, und werden dabei feststellen: Wir sind nicht allein – und wir waren es nie!
Der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer, der von den Nationalsozialisten ermordet wurde, betete ein berührendes Gebet in seiner Zelle. Dieses Gebet begleitet mich schon seit vielen Jahren und in diesen Tagen ganz besonders. Ich muss meine eigene Dunkelheit nicht verschweigen. Ich darf bei Gott ehrlich und offen meine Zweifel, meine Angst, meine Sorgen und mein Scheitern benennen. Und mitten in den Stürmen des Lebens trotzdem einen Halt finden, der weit über alle Alltagssorgen hinaus tragfähig ist.
„In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht;ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht;ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe;ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden;in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld;ich verstehe deine Wege nicht,aber du weißt den rechten Weg für mich.“
Bleiben Sie behütet!
Ihr
Andi Weiss
LICHT AM ENDE DES TUNNELS
Ich weiß, der Sturm wird grade stärker,
und du glaubst, du schaffst das nicht.
Jeder Sinn bleibt dir verborgen.
Du sehnst dich so sehr nach mehr Licht.
Du tastest still im Dunkeln weiter,
Du suchst verzweifelt nach deinem Glück.
Doch alle Pläne sind gescheitert,
Du weißt, es gibt jetzt kein Zurück.
Ich weiß, du wolltest noch so viel machen,
so viel lachen, noch so viel tun.
Und aus dem schönsten Sommerregen
wird gerade ein Monsun.
Auch wenn jetzt alle Stricke reißen,
auch wenn dir gar nichts mehr gelingt –
dann hör auf dieses kleine Lied hier,
das jetzt in deinem Herz erklingt.
Ich weiß, da ist ein Licht am Ende des Tunnels.
Und es scheint für dich, auch wenn alle Winde wehn.
Ich weiß, in dir liegt so viel Gesundes
und du wirst auch diesen Sturm hier überstehn.
Ich weiß, du wirst auch diesen Sturm hier überstehn.
Ich weiß, noch bohrt in dir der Zweifel,
ich weiß, noch lähmt dich deine Angst.
Und wird der Sturm auch grade stärker,
es kommt der Tag, an dem du tanzt.
In dir liegen große Schätze
und die kann niemand zerstörn.
Ich weiß, in deinem Herzen klingt es.
Und ich hoff, du kannst es hörn?
Text und Melodie: © ANDI WEISS, www.andi-weiss.de
(Aus der CD: „WEIL IMMER WAS GEHT“)
Verblüffung am Ende der Welt
Was mache ich denn ausgerechnet hier in Blumental im Chaco Paraguays, am Ende der Welt? Wir schreiben Karfreitag, den 6. April 2012. Hinter mir liegt eine lange Reise. Erst mit dem Flieger von Frankfurt aus rund 11.000 Kilometer bis nach Asunción, der Hauptstadt des südamerikanischen Landes Paraguay. Dann mit einem Auto aus der Stadt heraus und mehrere Stunden lang auf der fast schnurgeraden Asphaltpiste, überwiegend durch menschenleere Wildnis bis nach Fernheim, eine der mennonitischen Kolonien in der Chaco-Region.
Der Chaco ist ein riesiges, sehr dünn besiedeltes Gebiet in der Grenzregion zwischen Paraguay, Bolivien und Argentinien. Oft extrem heiß, trocken, übersät mit struppigen Dornbüschen. Hier haben in den letzten Generationen mutige Mennoniten aus Europa unter schier unsäglichen Strapazen ihre „Kolonien“ errichtet. Hier wollten und wollen sie frei und fröhlich ihren Glauben und ihre pazifistische Lebenshaltung ausüben, was sie in der alten Heimat (ganz ursprünglich in Nordfriesland, dann für einige Jahrhunderte in Osteuropa) nicht durften.
Noch vor einhundert Jahren – so erfahre ich – gab es hier nur Trockenheit und Hitze. Lediglich eine Handvoll Einheimischer zog von Wasserloch zu Wasserloch durch die menschenverachtende Gegend oder unterhielt kleine landwirtschaftliche Betriebe. Heute aber ist die Region durch hart arbeitende Mennoniten im Sinne des Wortes „aufgeblüht“. Vor den Nachkommen der Pioniergeneration darf ich nun bei mehreren Veranstaltungen singen und heute mit ihnen in Blumental Gottesdienst feiern.
Dazu sind wir von Philadelphia aus am Karfreitagmorgen noch einmal eine gute Stunde mit dem Auto unterwegs. Wir holpern über eine Sandpiste, die so aussieht, als wolle sie uns ins Nirgendwo führen. Oder – so überlege ich – bis zu einem Bretterzaun mit der Aufschrift: „Ende der Welt. Weiterfahrt auf eigene Gefahr“.
Nach viel Ruckelei und Staub kommen wir am Ziel an, steigen aus, recken und strecken unsere Glieder. Blumental also. In the middle of nowhere. Ein paar wenige Gebäude. Rund herum trockenes Gestrüpp. Zwei, drei Sandpisten, die von verschiedenen Richtungen herkommen und sich hier kreuzen. Na, super. Was mache ich denn ausgerechnet hier in Blumental, wo sich kaum eine Menschenseele zeigt?
Den Musikgottesdienst zu Karfreitag werde ich zusammen mit zwei jungen Musikern aus der Mennonitengemeinde gestalten, die mich an Klavier und Gitarre begleiten, außerdem mit einer geübten Sprecherin des deutschsprachigen Radios ZP 30, die Bibeltexte liest. Anlage, Leinwand, Beamer, alles ist zügig in dem geräumigen Gemeindehaus aufgebaut. Ein kurzer Soundcheck noch, dann heißt es warten. Ich gestehe: Dabei werden meine Zweifel an der Aktion von Minute zu Minute größer.
Noch 15 Minuten vor dem Gottesdienst hat sich kaum ein Besucher eingefunden. Aber dann strömen sie plötzlich wie auf Kommando herbei. Wolken von Sand und Staub fliegen gen Himmel und kündigen jedes einzelne Fahrzeug an. Die Kirche füllt sich in Windeseile. Und dann geht es los, mit deutscher Pünktlichkeit und keineswegs mit lateinamerikanischer „Lockerheit“. Während des Vorspiels der beiden Musiker sehe ich mich um und kann es kaum glauben: Etliche Hundert Menschen feiern mit uns einen musikalischen Passionsgottesdienst. Festtäglich gekleidete Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder sitzen dicht gedrängt.
Ob sie etwas anfangen können mit meiner Art zu formulieren, zu moderieren, geistliche Inhalte in Musik umzusetzen? Ich gestehe, dass ich unsicher bin. Ein Sprachproblem gibt es nicht. Muttersprache der Menschen hier ist eine spezielle Form von „Plattdeutsch“, das sie aus der norddeutschen Heimat ihrer Vorvorfahren mitgebracht haben. Ihr „Hochdeutsch“ fürs Gespräch mit Menschen wie mir klingt für meine Ohren etwas eingerostet, mit osteuropäisch anmutender Sprachmelodie und gelegentlichen spanischen Brocken. Aber wir verstehen einander bestens. Die Zuhörerinnen und Zuhörer jedenfalls hören konzentriert zu. Sie wirken dabei auf mich ernst, fast verschlossen. Ich sehe in die wettergegerbten Gesichter von Landwirten, Viehzüchtern, Handwerkern und ihren Familien, die hier ein hartes Leben unter extremen Bedingungen führen. Und mit denen mich zumindest auf den ersten Blick nicht viel mehr als eine ähnliche Sprache und der Glaube verbinden.
Dann die absolute Überraschung für mich, als wir das Lied „Unser Vater“ anstimmen: 1994 haben wir dieses Lied veröffentlicht (den Text habe ich zum „Vaterunser“-Gebet geschrieben, die Melodie stammt von Hans-Werner Scharnowski). Jetzt möchte ich versuchen, den Menschen hier in Blumental den eingängigen Refrain beizubringen. Doch das ist nicht nötig. Zu meiner großen Verblüffung steht die versammelte Gemeinde auf und singt das Lied lautstark mit: „Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen!“ – mehrstimmig, überwiegend auswendig, voller Inbrunst. Ich begreife: Mein Lied ist längst vor mir angekommen in Blumental. Hier, ziemlich nahe am (gefühlten) Ende der Welt. Unglaublich.
Mir steigen beim Singen Tränen in die Augen. Gedanken und Gefühle überrollen mich. Ich entsinne mich an manche Stunde auf einem der Hügel am See Genezareth. Dort, wo irgendwo auf einer Anhöhe Jesus den Menschen nicht nur die gewaltige Botschaft der Bergpredigt mitgab, sondern ihnen speziell auch das wertvolle persönliche Gebet anvertraute, das für die Menschen damals und für uns heute als Einstieg ins Gespräch mit unserem himmlischen Vater dienen kann. Von dieser abgelegenen Gegend im alten Israel aus hat dieses Gebet eine unfassbar weite Verbreitung gefunden, bis hierher nach Blumental und weit darüber hinaus. In unzähligen Sprachen und in vielen Formen hat sich die wichtige Nachricht verbreitet: Wir dürfen Vater sagen zu Gott, dürfen ihm unsere Sorgen um Nahrung und Versorgung hinlegen, dürfen um Vergebung bitten, uns dankbar an seine Macht und seinen Einfluss erinnern und ihm gemeinsam die Ehre erweisen, die ihm zusteht.
Und das genau tun wir jetzt, hier in Blumental, die Gemeinde und wir Gäste. Das Gebet, das wir gemeinsam singen, hat hier die gleiche tiefe Bedeutung wie einst am See Genezareth. Mein kleines Lied ist ein Vehikel für die große Botschaft des Gebets. Es erinnert mich und andere an die tiefen Wahrheiten des Vaterunsers. Und hat erstaunlich schnell seinen Weg aus Deutschland bis hierher geschafft.
Diese Erfahrung in Blumental werde ich nie vergessen. Auch wenn es zwischen mir und den Geschwistern aus den Mennonitenkolonien dort einiges an Unterschieden geben mag, auch wenn wir sicher unterschiedlich denken über manchen Musikstil, manche theologische und ethische Frage, selbst über Kleidung und manche Umgangsform. Doch wenn wir miteinander singen, feiern und beten, spüren wir etwas von der Einheit, die Gottes Geist möglich macht.
Wenn ich mich recht entsinne, verließ ich Blumental tief dankbar und zugleich ausgesprochen nachdenklich. Und wenn ich seitdem davon höre, dass die gute Botschaft Jesu auch „die Enden der Erde“ erreicht und „bis ans Ende aller Zeiten“ gelten wird, dann erinnere ich mich gerne an die Überraschung in Blumental. Beinahe am „Ende der Welt“.
Christoph Zehendner (61), Journalist und Liedermacher, Kloster Triefenstein bei Würzburg, www.christoph-zehendner.de
Der Bär, der Frosch und Onkel Jesus
Eine ziemlich alte Ärztin, wahrscheinlich schon eine Legende der Kinderabteilung, lud uns in ihre Praxis ein. Sie betastete meinen Bauch und sagte zu meiner Mutter: „Wissen Sie, ich würde ihn am liebsten hierbehalten!“ Für mich waren das schöne Worte! Warum meine Mutter dabei zu weinen begann, konnte ich gar nicht verstehen. Ich dachte, dass die alte Frau mich so toll findet, dass sie mich gern für sich selbst behalten würde. Erst viel später, als sich schon die zweite Operation näherte, verstand ich, dass „hierbehalten“ bedeutete, noch mindestens zehn Tage im Krankenhaus zu bleiben – mit noch einer zusätzlichen Operation. Schon als ich den Pyjama mit dem Pünktchenmuster, der viel zu kurz für mich war, ausgehändigt bekam, wollte ich am liebsten nach Hause.
Eines Tages wurde ein siebenjähriger Junge zu mir ins Krankenzimmer gebracht. Ich selbst war damals schon acht. Er hatte schwarze, dauergewellte Haare und ich nahm an, dass er sich seine Haare aufwickelte. Man kann ja nie wissen. Heutzutage laufen sehr viele merkwürdige Leute herum und ich dachte, er wäre einer von diesen seltsamen Menschen. Meine Tante hatte auch Lockenwickler und bei jeder passenden Gelegenheit nahm ich ihr einen weg und versuchte, mir damit die Haare aufzuwickeln, um herauszufinden, ob eine solche Frisur zu mir passen würde. Es gelang mir aber nie.
Mit Jure, so hieß mein neuer Nachbar im Krankenzimmer, freundete ich mich schnell an. Noch heute glaube ich, dass es an der Suppe und an dem Tee lag. Ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Suppe war, aber ich bildete mir ein, dass Frösche darin schwimmen würden. Damals mochte ich überhaupt keine Suppen. Deshalb wurde ich von meinem neuen Freund „Frosch“ genannt. Da er häufig vor allen Krankenschwestern aus vollem Halse brüllte, nannte ich ihn „Bär“. So gab es im Krankenhaus nun einen Frosch und einen Bären. Wir waren ein gutes Team!
Oft spielten wir das „Warenwechselspiel“. Er gab mir sein Buch und ich ihm mein Spielzeug. Wir waren beide glücklich. Ich bekam wieder ein neues Buch, er wieder ein neues Spielzeug. Aus seinem Buch, das jetzt ganz mir gehörte, schnitten wir die Bilder aus, ließen aber den Text darin, damit ich ihm vorlesen konnte, und er hörte zu.
Weil wir oft sehr laut waren, schimpfte die Krankenschwester mit uns und sagte, wir seien nicht die einzigen Kranken hier. Sie hatte fettige Haare und war die Oberschwester. Deshalb hatten wir vor ihr ganz besonders Angst. Aber die Tage im Krankenhaus waren nicht immer so schön. Besonders an dem Tag nicht, als die zehn Halbliterflaschen mit Infusion für Jure gebracht wurden. Zytostatika (die Medizin, die das Zellwachstum bzw. die Zellteilung hemmt) flossen mehrere Stunden in seine Adern, ohne dass er sich dabei überhaupt bewegen konnte.
Die Nebenwirkungen waren sehr schlimm. Jedes Mal wenn er sich übergeben musste, hatte er verständlicherweise keine Lust mehr zum Spielen oder zum Lachen. Ich hatte dann auch keine Lust mehr. Manchmal sagte er mit einem sanften Lächeln: „Hey, ich spucke wie ein Reiher.“ Am schlimmsten war es, wenn er sich im halb wachen Zustand übergeben musste. Während er mit einer Infusion ans Bett gefesselt war, las ich ihm das Märchen vom „Wolf und den sieben Geißlein“ vor.
Die erste und stärkste Runde von Jures Chemotherapie dauerte die ganze Woche. Als er langsam wieder essen konnte, befasste er sich meistens mit dem Schälen eines hart gekochten Eis und mit dem Streichen von Pflaumenmarmelade aufs Brot. Er wollte nicht, dass das jemand anderer tut, weil er ganz glücklich war, wenn er es allein schaffte. „Hey, Frosch, ich habe das Ei ganz allein geschält!“, rief er mir zu und ich klatschte. Diese große Freude musste man teilen!
Nach dem Frühstück teilte uns ein Arzt mit, dass man uns am nächsten Tag operieren würde. In dieser Nacht konnten wir nicht schlafen. Wir wälzten uns im Bett hin und her. Gerieten in Panik und fingen an, so laut zu schreien, dass die Krankenschwestern in unser Zimmer liefen, um nach uns zu schauen. Im Morgengrauen bereiteten sie uns auf die Operation vor. Wir bekamen keinen Tee, sondern ein Beruhigungsmittel, lagen in unseren Betten und warteten, dass man uns abholte. Das war ein merkwürdiges Gefühl. Dann erschien eine dicke Krankenschwester und sagte: „Es geht los!“ Auch die anderen Krankenschwestern von unserer Station kamen zu uns und sagten: „Viel Glück und nur nicht nachlassen!“ Ich wusste nicht, was sie uns damit sagen wollten, und denke, dass auch Jure es nicht verstand. Wir sollten nicht nachlassen? Natürlich verließen wir unsere Betten nicht – wir hielten uns sogar daran fest!
Wir wurden in den kleinen Operationssaal gebracht und auf diesem Weg passierte etwas Ungewöhnliches. An den Wänden der langen Gänge waren Gemälde aufgehängt. Damals konnte ich überhaupt noch nicht verstehen, was die Bilder zu bedeuten hatten. Ich dachte, dass viele davon Kinder gemalt hatten. Ich war überzeugt, dass mein damals zweijähriges Schwesterherz auch eine große Malerin sei. Auf manchen Bildern konnte man Menschen sehen. Fast alle hatten Bärte und waren alt. Das letzte war am interessantesten. Die gemalte Gestalt war ganz blutig, mit gesenktem Kopf, und man konnte daraus schlussfolgern, dass diese Person sehr litt.
„Wer ist denn dieser Onkel?“, fragte Jure überrascht. Die dicke Krankenschwester, die uns auf einmal viel freundlicher erschien, antwortete ihm: „Das ist Gott.“ „Das ist unmöglich. Der Gott kann nicht so aussehen. Wenn das der Gott wäre, würde er schön aussehen und er würde lächeln. Dieser da sieht aber nicht so aus!“, bekundete Jure unwillig. Die Krankenschwester fragte dann: „Wen würdest du denn jetzt, wo du krank bist, lieber wählen? Den, der lächelt und fröhlich ist, oder den, der leidet?“ Und Jure, der brüllende Bär, erwiderte: „Zu diesem Onkel!“, und er deutete auf Jesus. „Er will dir sagen, dass er mit dir ist“, sagte die Krankenschwester leise zu ihm und fuhr ihn in den Operationssaal. „Dann ist es in Ordnung!“, antwortete er und wir alle lachten.
Nach zwei Wochen wurden wir aus dem Krankenhaus entlassen. Jesus nannten wir von da an „Onkel Jesus“. Und ich denke, dass es ihm sogar gefiel, denn er hat Kinder gern. Auch heute, als erwachsene Menschen, begleitet uns diese Gestalt. Obwohl sein Kopf auf dem Gemälde ein bisschen gesenkt war, hielt er seine Augen geöffnet und schaute uns an. Heute sehen wir zwei, wie viel Schmerz und Leiden es gibt und wie viele Fehler die Leute machen. Diese mit dem Pinsel gemalten, warmen, orangen Farben, mit denen sein angenagelter Körper dargestellt war, waren so ausdrucksstark, dass uns seine Gestalt mit seiner Nähe und Menschlichkeit sehr berührte und zu jedem von uns beiden sprach: „Nur keine Angst, denn ich bin bei dir!“
Die Krankheit und die damit verbundenen Schmerzen sind heute noch immer nicht weg, aber mit uns beiden, dem Frosch und dem Bären, bleibt seine uneingeschränkte Liebe.
Simon Emri, Jahrgang 1983 († 2013), Student, Mačkovci (Slowenien)
Du glitzerst!
Weihnachten 2021. Und wieder packe ich meine Geschenke ein – Ehrensache! Für Eva, meine Frau, für meine beiden Kinder, die mittlerweile Teenager sind, und für meinen Bonussohn Ben. Dazu muss ich bemerken, dass ich ein miserabler Einpacker bin. Ich besitze eine bemerkenswerte Unfähigkeit, Geschenkpapier halbwegs gerade und für ein Geschenk angemessen groß zuzuschneiden. Und spätestens beim Versuch, die überstehenden Geschenkpapierzipfel elegant einzuschlagen, lande ich zuverlässig in meinem persönlichen Armageddon. Ein einziges Gewurstel ist das Ergebnis. Egal – ich habe es wenigstens wieder mal versucht. Der gute Wille zählt und so … Doch dieses Mal ist etwas anders. Eva hat wunderschönes Geschenkpapier mit Glitzer besorgt. Und als meine Einpackerei beendet ist und ich zufrieden auf mein Ergebnis blicke, bemerke ich aus dem Augenwinkel, dass mein schwarzes Sweatshirt über und über mit Glitzer bedeckt ist. Wunderschön! Und sehr hartnäckig.
Am Ende eines sehr „gebrauchten“ – um nicht zu sagen furchtbaren – Jahres ist dieses Glitzern wie eine Aufforderung an mich, meinen Blick auf das Vergangene zu ändern, zu wandeln, nachzujustieren. Nicht, um das Schwere leichtzureden und das Üble schön. Sondern um es anders zu deuten und es dadurch anzunehmen und zu verarbeiten. Während ich die Geschenke zusammenschiebe, mache ich mir einen Kaffee und setze mich schließlich an unseren überdimensionalen Küchentisch. Die Gedanken beginnen zu fließen …
Wer sich selbst und wunderbare Dinge verschenkt, beginnt selbst zu glitzern. Das habe ich gerade gemerkt. Ich denke, das ist ein Prinzip ganz nach dem Herzen Jesu und seiner frohen Botschaft. Wer sich verschenkt, wird beschenkt. Wer stirbt, wird zum Leben. Wer sich verliert, gewinnt. Das Kind in der Krippe ist König. Die Niederlage am Kreuz ist der größte Sieg aller Zeiten. Kurz: Alles wird auf den Kopf gestellt, wo Jesus auftaucht. Gute Werke und meine Leistung zählen nicht – alles ist Geschenk. Und das Tolle ist: Das gilt auch mir. Und dir natürlich auch. Egal, wie wir uns fühlen.
Du bist lebensmüde? Du glitzerst eigentlich.
Du bist depressiv? Du glitzerst eigentlich.
Traurig? Du glitzerst.
Hast du versagt? Noch mehr Glitzer.
Warum bringe ich diese Beispiele? Weil das meine dominanten Gefühle im Jahr 2021 waren. Und sie kommen alle wieder hoch im Angesicht meiner recht dilettantisch, aber mit Liebe eingepackten Geschenke. Was für ein Jahr! Beruflich ist alles zusammengebrochen – über Monate hinweg immer mehr, immer weiter gehender. Kurz vor Weihnachten dann das endgültige Aus. Als die letzten Monate mir so vor Augen stehen, kommen die ganzen Gefühle erneut hoch. Mir ist durch meine Schuld und die Schuld anderer beruflich einfach der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Und diese Gefühle waren und sind meine Wegbegleiter: Traurigkeit. Wut über das Versagen anderer und über mich selbst. Scham, weil ich auch versagt habe. Schmerz. Apathie. Und manchmal sogar Lebensmüdigkeit. Ein ähnliches Gefühlsspektrum kenne ich sonst nur aus der Zeit der Trennung von meiner ersten Frau. Es ist … dunkel, zäh, klebrig und hat einen Sog nach unten. Aber ich schaue gleichzeitig an mir herunter und: Ich glitzere einfach weiter. Denn wo das Dunkel größer wird, wird auch das Licht noch heller. Und das Dunkel kann das Licht niemals auslöschen.
Heißt das nun, dass der Glitzer mich ablenken will vom Schweren? Dass ich vielleicht nur auf den Glitzer schauen soll und das Schwere ignorieren oder leugnen? Nein! Dann wären wir in einer Art frommen Version des positiven Denkens angelangt. Die Botschaft meiner Geschenkepackerei ist so einfach wie revolutionär: Der Glitzer legt sich mitten hinein in das Dunkle und verwandelt es. Wieder und wieder. Jesus hat keine Scheu vor meinem Versagen, vor meiner Schuld. Auch bei dir nicht. Es ist in Ordnung, auch wenn nichts gut ist – für IHN ist alles gut genug. Es glitzert einfach weiter, und alles, was wir tun dürfen, um das zu erkennen, ist: den Blick weiten und Jesus darum bitten, dass er noch eine Schippe Glitzer über uns ausschüttet. Weil wir es so nötig haben. Und je dunkler es wird, desto heller strahlt Gott. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich am Boden liege (und ich kenne das wortwörtlich) und nur noch kriechen kann, dass ich genau da irgendwann durchbohrte Füße berühre. Diese spannen sich an und ich spüre, wie jemand sich nicht nur hinunterbeugt, sondern sich ebenfalls hinlegt. Mitten hinein in den zähen Bodennebel meines Lebens. Und dann mein Gesicht in seine Hände nimmt und mir einen Kuss auf die Stirn gibt. Ich kann es spüren. Du auch? Er ist da. Immer. Gerade im Dunkel. Vergiss es nie: Du glitzerst. Jesus hat dich „eingeglitzert“. Für immer. Und er legt gerne eine Schippe Glitzer nach.
Christof Lenzen, Theologe, Jahrgang 1967, Gera
Ich bin zumutbar!





























