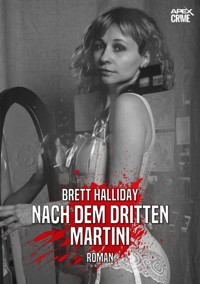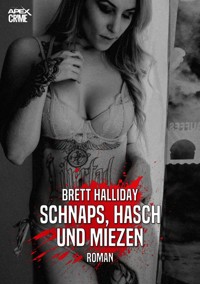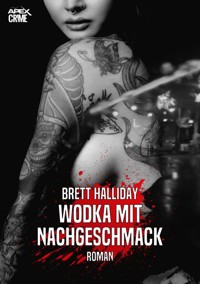5,99 €
Mehr erfahren.
Diamanten sind gefährlich - vor allem, wenn sie nicht im Safe liegen... Das muss ein Juwelenhändler aus New York erfahren, der dem schwerbewaffneten Gangster McQuade in die Hände fällt. McQuade schießt sich nach dem Überfall rücksichtslos den Weg frei - und die hübsche, blonde Michèle dient ihm dabei als lebendes Schild. Aber es sind nicht die Diamanten, an denen McQuade interessiert ist - ihm geht es um einen ganzen Lastwagen voll Rauschgift...
Brett Halliday (eigtl. Davis Dresser, * 31. Juli 1904 in Chicago, Illinois; † 4. Februar 1977 in Santa Barbara, Kalifornien) war ein US-amerikanischer Schriftsteller.
Der Roman Blondes Gift aus Paris erschien erstmals im Jahr 1966; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1970.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
BRETT HALLIDAY
Blondes Gift aus Paris
Roman
Apex Crime, Band 168
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
BLONDES GIFT AUS PARIS
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Das Buch
Diamanten sind gefährlich - vor allem, wenn sie nicht im Safe liegen... Das muss ein Juwelenhändler aus New York erfahren, der dem schwerbewaffneten Gangster McQuade in die Hände fällt. McQuade schießt sich nach dem Überfall rücksichtslos den Weg frei - und die hübsche, blonde Michèle dient ihm dabei als lebendes Schild. Aber es sind nicht die Diamanten, an denen McQuade interessiert ist - ihm geht es um einen ganzen Lastwagen voll Rauschgift...
Brett Halliday (eigtl. Davis Dresser, * 31. Juli 1904 in Chicago, Illinois; † 4. Februar 1977 in Santa Barbara, Kalifornien) war ein US-amerikanischer Schriftsteller.
Der Roman Blondes Gift aus Paris erschien erstmals im Jahr 1966; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1970.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
BLONDES GIFT AUS PARIS
Erstes Kapitel
Das Taxi hielt vor einem hohen, nackten Wohnsilo in der oberen West Side von New York. Der einzige Fahrgast, ein reizvolles blondes Mädchen namens Michèle Guerin, beugte sich vor und studierte angestrengt den Fahrpreisanzeiger.
Sie trug ein beiges Kostüm, die gute Kopie eines französischen Modells, nicht viel Schmuck und kaum Make-up. Sie war Mitte oder Ende Zwanzig. Ihre rauchblauen Augen wirkten amüsiert, als betrachte sie ihr gutes Aussehen und ihre Eleganz als glücklichen Zufall, der genauso gut einer anderen Person hätte zustoßen können.
»Einen Dollar dreißig«, sagte sie mit besonders präziser Betonung. »Okay«, sagte der Fahrer lächelnd. »Ich lass’ Sie mit einsdreißig davonkommen.«
Er nahm die beiden Ein-Dollar-Scheine, die sie ihm reichte, gab ihr das Wechselgeld und reckte sich, um die Tür zu öffnen, was New Yorks Taxifahrer nicht für jeden tun. Er hatte sich seine Gedanken über sie gemacht. Sie passte eigentlich in kein Schema. Sie sprach mit französischem Akzent, und ihre Unsicherheit beim Ablesen der Taxameter-Uhr verriet, dass sie noch nicht lange im Land sein konnte. Trotzdem hatte sie nichts von einer Touristin an sich. Ring trug sie keinen, war also nicht verheiratet. Vielleicht ein Mannequin, dachte er. Die waren aber meistens überaus mager, und dass in der nicht billigen Garderobe eine richtige Frau steckte, stand ganz außer Frage. Bei den Mannequins war ihm auch noch auf gefallen, dass sie oft eine etwas unzufriedene Miene zur Schau trugen, als fänden sie es unerfreulich, Kleider vorzuführen, die sie sich nicht leisten konnten. Aber von Unzufriedenheit war bei diesem Mädchen nichts zu bemerken. Schauspielerin? Nein, auch da fehlte irgendetwas.
Er sah ihr nach, als sie zu der Doppeltür aus Glas stöckelte. Ihre Rückenansicht wirkte nicht weniger attraktiv. Er seufzte - ein einigermaßen gut verheirateter Mann mit drei kleinen Kindern -, legte den Gang ein und fuhr davon.
Michèle hätte auch ein viel eleganteres Apartment beziehen können, in einer vornehmeren Gegend, drüben auf der anderen Seite des Parks, aber sie genoss die Anonymität. Kein Portier, keine Concierge verfolgte ihr Kommen und Gehen. Ein Nachteil war, dass sie die Tür selbst aufsperren musste. Obwohl sie sich schon zwei Wochen in New York aufhielt, war das immer noch ein Problem. Während sie sich damit abmühte, tauchte hinter ihr ein Mann auf und drückte einen der Klingelknöpfe.
»Sie haben ihn ja verkehrt eingesteckt«, sagte er freundlich, nachdem er sie eine Weile beobachtet hatte.
»Ausgeschlossen!«
»Doch. Lassen Sie mal einen Fachmann ran.«
Aus dem Lautsprecher neben der Klingelanlage tönte eine Stimme: »Ja?«
»Jake Melnick«, erwiderte der Mann. »Ich habe ein paar Steine, die ich Ihnen zeigen möchte, Mr. Evans. Darf ich raufkommen?«
»Natürlich.«
Der Summer ließ das Schloss aufschnappen. Melnick schob die Tür mit dem Fuß auf, nahm den Schlüssel, drehte ihn um und steckte ihn richtig ins Schlüsselloch.
»Man darf nur keine Gewalt anwenden.«
Sie lächelte dankbar.
»Technisch bin ich völlig unbegabt.«
Er sah sie forschend an. Für Michèle war das ein vertrauter Vorgang, obwohl sie ihm in diesem Land nicht so oft ausgesetzt war wie zu Hause. Die meisten Männer in New York schienen andere Sorgen zu haben. Sie maß Melnick kurz mit einem abschätzenden Blick. Er war nachlässig, beinahe schlampig gekleidet, was nach ihrer Erfahrung nicht bedeutete, dass er sich nichts Besseres leisten konnte. Er war so mager, dass er beinahe ausgemergelt wirkte. Zwischen seinen Lippen hing eine brennende Zigarette. Lachfältchen umgaben seine Augen, zynische Runen seinen Mund, eine Kombination, die Michèle stets interessierte. Nicht, dass sie jetzt Zeit gehabt hätte, in dieser Hinsicht etwas zu unternehmen.
Sie wichen einer Sitzbank und einer Reihe von Gummibäumen aus. Bis auf einen Mann, der am Ende einer langen Reihe von Hausbriefkästen einen Umschlag aufschlitzte, war das Vestibül leer. Aus verborgenen Öffnungen in der Wand drang leise Musik. Michèle war überzeugt davon, dass ebenso wenig jemand zuhörte, wie sie bisher jemanden auf dem Vestibül-Mobiliar hatte sitzen sehen.
Ein leerer Lift wartete. Sie drückte den Knopf für die elfte Etage.
»Ich hab’ gehört, dass die Mietbedingungen ganz vernünftig sein sollen«, meinte Melnick. »Meine Frau und ich sind am Überlegen. Ist es sehr laut hier?«
Bevor sie etwas erwidern konnte, drehte sich der Mann vor den Briefkästen um und betrat hinter ihnen den Lift. Einen Augenblick lang kam es ihr so vor, als hätte er unter dem Vorwand, seine Post zu lesen, nur auf ihr Auftauchen gewartet. Dummer Gedanke. Der Mann war groß und breitschultrig. Sein zerknittertes Gabardine-Jackett war nicht zugeknöpft, die Krawatte gelockert. Im Ohr trug er den winzigen Knopf eines Hörgeräts. Er war schwarzhaarig, muskulös gebaut und bewegte sich mit der lässigen Grazie eines Berufsboxers in erstklassiger Kondition.
»Sind Sie nicht im Diamantengeschäft?«, fragte er Melnick.
»Ja«, erwiderte Melnick überrascht.
»Jake Melnick, klar. Melnick und Melnick.«
Die Lifttür schloss sich. Der Unbekannte warf einen Blick auf die Anzeigetafel. Es gab siebzehn Stockwerke im Haus. Neben der Nummer elf glomm ein Lämpchen.
»Und für Sie, Jake? Sieben?«
»Hören Sie mal«, sagte Melnick. »Ich kenne Sie nicht und weiß auch nicht, worum es geht. Aber wer Sie auch sein mögen...«
Der Lift hatte sich kaum in Bewegung gesetzt, als der Breitschultrige den Nothalthebel nach unten drückte. Die Bremsen griffen so hart, dass Michèle an die Wand taumelte.
»Sie wissen doch ganz genau, worum es geht«, sagte der große Mann leichthin. »Larry Evans von 8-C will wieder mal einen Stein an eine junge Dame verschenken. Wenn Sie bis morgen warten, kommt Ihnen vielleicht jemand zuvor.«
»Lassen Sie mich hinaus«, drängte Michèle. »Bitte lassen Sie mich hinaus.«
»Du bleibst schön in der Ecke, Kleine«, sagte der große Mann ruhig, ohne Melnick aus den Augen zu lassen. »Außer der Versicherung kommt keiner zu Schaden. Und jetzt zeig’ ich ihm die Kanone, damit er das Ganze auch ernst nimmt.«
Seine große Hand glitt unter den linken Arm und tauchte mit einer schweren Pistole wieder auf. Michèle hatte die Hände auf den Mund gepresst. Bitte nicht wehren, flehte sie Melnick stumm an. Tun Sie, was er verlangt. Sie trug auch ziemlich viel Geld bei sich - das konnte er gerne haben. Sobald er verschwunden war, musste sie Melnick dazu überreden, sie aus dem Spiel zu lassen. Eine Vernehmung durch die Polizei konnte sie sich nicht leisten. Vielleicht gar noch Fotoreporter! Das Ganze war unfassbar. Es konnte einfach nicht wahr sein.
Die Zigarette klebte immer noch an Melnicks Unterlippe. Sie zitterte. Er versuchte etwas zu sagen.
»W-wer...?«
Der große Mann lachte kurz auf und sah Michèle zum ersten Mal an. Seine Augen wirkten hart und gefährlich.
»Ich habe telefoniert und bin in die falsche Leitung geraten. Was sagt man dazu? Der beste Tip meines Lebens, und er hat mich keinen Cent gekostet.«
Abrupt kam er zum Geschäft und richtete die Mündung der Pistole auf Melnick. Der verängstigte Diamantenhändler hob die Arme, und der große Mann betastete seine Taschen von außen. Der Lederbeutel befand sich in einer Innentasche des Jacketts, mit einer kurzen, dünnen Kette an einer stärkeren befestigt, die um Melnicks Leib geschlungen war. Der große Mann riss verärgert daran, bis Melnick vor Schmerz aufstöhnte.
»Vorsicht ist bei euch ganz groß geschrieben, was?«
Er gab der Kette einen Ruck, durch den der Juwelenhändler zur Wand gedreht wurde, legte die gespannte Kette über den verchromten Haltegriff und schlug mit dem Kolben der Pistole zu. Ein Kettenglied zersprang, und der Lederbeutel ließ sich entfernen.
»Und jetzt sehen wir nach, wieviel Geld wir dabeihaben, Jake.«
Der Diamantenhändler zog mit zitternden Händen seine Brieftasche.
»Ein Stein ist noch nicht versichert«, sagte er schüchtern. »Ich bezahle Ihnen mehr, als Sie vom Hehler dafür bekommen.«
»Na klar. Ich warte auf den Scheck. Her mit der Uhr.«
Melnick streifte seine goldene Armbanduhr ab. Der Gangster steckte sie ein. Ohne Warnung trat er auf Melnick zu und hieb ihm seine riesige Faust in den Magen. Melnick gab einen erstickten Laut von sich und fiel nach vorn. Er riss die Arme hoch, um sich an dem anderen festzuhalten. Einen Augenblick lang verharrten sie in einer Art ungeschickter Umarmung. Michèle konnte nur die Hände und die Handgelenke Melnicks sehen. Der große Mann stieß ihn mit einem Fluch zurück und Heß, als der Juwelenhändler zusammensackte, den Kolben der Pistole auf seinen Kopf niedersausen.
Melnick stürzte zu Boden. Der große Mann fuhr herum. Michèle zuckte zurück;.
»Irgendein Kommentar?«, zischte er.
»Nein«, flüsterte sie und hielt ihm die Handtasche hin.
Sein linker Mundwinkel und das linke Auge zuckten krampfhaft, halb zwinkernd, halb ungewollt. Das erschreckte sie. Sie sah, dass er nahe daran war, die Beherrschung zu verlieren.
»Ich habe Geld«, stammelte sie.
Er riss ihr die Handtasche aus den Fingern. Sie wusste genau, wieviel Geld sie bei sich hatte - achthundertdrei Dollar, davon achthundert in neuen Fünfzig- und Hundert-Dollar-Scheinen. Dadurch schien sich seine Laune zu bessern.
»Grün«, bemerkte er. »Meine Lieblingsfarbe.«
Er nahm ihr Uhr und Armband ab. Nachdem er dies zu der übrigen Beute in die Tasche gesteckt hatte, drückte er den Nothaltschalter wieder nach oben und tippte auf den Parterreknopf. Der Lift stieg trotzdem weiter empor. Sein elektronisches Gehirn hatte ihm befohlen, die elfte Etage anzusteuern. Diese Anweisung musste erst ausgeführt werden, bevor der Weg nach unten angetreten werden konnte. Der Mann beobachtete die aufflammenden Lämpchen, den Kopf zur Seite geneigt, als könne er mit seinem Hörgerät den eigenen Gedanken lauschen.
»Sie lassen mich frei?«, fragte sie. »Bitte, ich bin Französin. In zwei Tagen fahre ich nach Hause. Das kann ich Ihnen beweisen. Wollen Sie meinen Pass sehen? Wenn ich wegen dieser Sache zur Polizei muss, versäume ich meine Maschine. Das möchte ich unbedingt vermeiden.«
Der Lift hielt im elften Stockwerk. Sie setzte zu einer Bewegung an.
»Rühren Sie sich nicht von der Stelle!«, fauchte er.
Die Tür öffnete und schloss sich. Der Lift fuhr weiter.
»Es ist wirklich wahr«, flüsterte sie.
Sein Blick züchte zu den Lämpchen. Über der neunten Etage wurde der Lift plötzlich abgebremst. Er trat an die Tür. Sie öffnete sich. Draußen stand eine dicke Dame mit überdimensionalem Hut.
»Unfall«, sagte er brüsk. »Nehmen Sie den nächsten.«
Ihr kokettes Lächeln verschwand, als sie den Blick nach unten richtete. Melnicks lange Beine waren unter ihm zusammengeklappt, und er sah aus, als sei er aus großer Höhe herabgestürzt. Eine Seite seines Gesichts war blutverschmiert. Die Frau riss den Mund auf. Der Gangster drückte wütend auf den Fahrtknopf. Die Tür glitt zu.
»Riechsalz für die Dame«, sagte er verächtlich. »Reg dich ab, Kleine. Ich schlag’ ’ne Puppe selten nieder, wenn wir uns noch nicht richtig kennen. Ich muss den Kerl da wegschaffen. Dann sage ich dir, was du tun musst. Nur einen einzigen Gefallen, dann erwischst du vielleicht dein Flugzeug.«
»Ja«, hauchte sie.
»Kann sein, dass jemand hinter mir her ist. Ich hatte so das Gefühl. Wenn wir hier rausgehen, dann schön langsam. So, als wären wir ein Ehepaar, und ich führte dich zum Essen aus. Wir gehen hinüber zum Central Park West und nehmen uns ein Taxi. Ein paar Straßen weiter lass’ ich dich raus. Dann kannst du das Ganze vergessen.«
»Gut, ich werde mir Mühe geben.«
»Das reicht nicht, Baby. Streng dich an, den einen Rat geb’ ich dir.«
In seinem Gesicht zuckte wieder ein Muskel. Sie sanken an der dritten Etage vorbei. Er drückte den Knopf für das zweite Stockwerk. Als der Lift hielt, steckte er vorsichtig den Kopf hinaus, bevor er den Bewusstlosen auf den Korridor hinauszerrte. Melnick war schlaff wie eine Gliederpuppe. Sein blutiges Gesicht war völlig entstellt. Er ächzte, als der große Mann seinen Fuß zur Tür hinausstieß, damit der Lift weiterfahren konnte.
Michèle bedauerte ihn, aber kümmern mussten sich andere um ihn. Sobald sie wieder in Freiheit war, wollte sie sich in einem Kino verstecken und erst zurückkommen, sobald sich die Aufregung gelegt hatte.
Als der Lift vor dem Parterre bremste, packte der große Mann ihren Arm über dem Ellbogen-und drehte sie mit dem Gesicht zur Tür. Sie versuchte sich ein Lächeln abzuzwingen.
»Zu grinsen brauchst du nicht«, sagte er. »Wir sind schon sehr lange verheiratet.«
»Ihr Griff tut weh.«
»Pech für dich.«
Die Tür ging auf. Er marschierte mit ihr in die Eingangshalle hinaus. Sie war überrascht, aus den Lautsprechern immer noch das Musikstück von vorhin zu hören. In dieser kurzen Zeit waren alle ihre Pläne über den Haufen geworfen worden. Zum Glück ließ sich niemand blicken. Im nächsten Augenblick stockte ihr Atem. Hinter ihnen wurden Schritte laut. Eine Stimme rief: »McQuade!«
Der große Mann drehte sich um, ohne Michèles Arm loszulassen. Der Mann, der hinter der zweiten Reihe der Briefkästen hervorgekommen war, klein, mit rotgeränderten Augen, wirkte unrasiert und müde.
»Wo bist du die ganze Zeit gewesen, Mac?«, fragte er.
»Irrtum«, erwiderte der andere lässig. Michèle spürte, wie sich seine Finger in ihren Arm krallten. »Ich heiße Carl Williams.«
»Soll wohl ein Witz sein, wie?«, meinte der kleine Mann. »Ist zwar schon ein, zwei Jahre her, aber Gesichter vergess’ ich nicht so schnell. Ich weiß bloß nicht mehr, weshalb wir dich geschnappt haben. Lohngelder in Brooklyn, nicht? Ungefähr siebzigtausend?«
»Sie sind betrunken!«, sagte Michèle scharf.
»Ein bisschen«, gab der Kriminalbeamte zu. »Ich bin aber nicht im Dienst, und da macht es nichts aus. Ich gieß’ mir gern ein paar hinter die Binde und fahre dann mit der U-Bahn durch die Gegend, um mir Gesichter anzusehen. Wenn mir eines bekannt vorkommt, geh’ ich dem Burschen nach, wie ich es bei Mac hier gemacht habe. Eine Art Hobby von mir.«
Er trat auf sie zu.
»Und wer bist du, Süße?«, erkundigte er sich. »Mrs. Williams oder die Frau von Francis McQuade?«
Hinter ihm kam der zweite Lift an. Die dicke Dame mit dem gewaltigen Hut stieg aus. Sie sah die drei Menschen und blieb wie angewurzelt stehen. Ihre Augen waren milchig-blau, entdeckten Michèle. Der Mund der dicken Frau öffnete sich, und der Schrei, den sie oben unterdrückt hatte, verschaffte sich freie Bahn. Der Kriminalbeamte wandte den Blick nur für Sekundenbruchteile von McQuade ab, aber als er zurückkehrte, hatte McQuade wieder die massive Pistole in der Hand.
Der Kriminalbeamte erstarrte. Seine Müdigkeit schien verflogen zu sein.
»Wirklich ein Irrtum«, sagte er. »Sie sehen McQuade gar nicht ähnlich. Und selbst wenn - bei dem Überfall ist ja keiner umgelegt worden. Nichts für ungut. Bis zum nächstenmal dann.«
Der Schrei, den die dicke Frau ausstieß, wurde immer schriller, bis er wie abgehackt abbrach, als sie ohnmächtig zu Boden sank. McQuade und Michèle hatten noch fünf Meter bis zur Tür zurückzulegen. Sie beeilten sich nicht. Der Kriminalbeamte stand wie erstarrt, als habe er sich plötzlich in eine Statue verwandelt. Trotzdem war seine Bereitschaft unverkennbar! Er wäre kein Kriminalbeamter gewesen, wenn er nicht eine Schusswaffe im Jackett gehabt hätte. McQuade zog Michèle an sich, so dass sie ihn zum Teil abschirmte, aber würde der Kriminalbeamte darauf Rücksicht nehmen, wenn die Schießerei losging? Michèle machte sich keine Illusionen.
McQuade flüsterte ihr ins Ohr: »Wenn wir an der Tür sind, verpass’ ich ihm eine ins Knie. Von da ab musst du dich selber kümmern. Wenn du mich je nochmals siehst, renn lieber weg.«
Sie atmete krampfhaft ein und aus. McQuade stieß einen Fluch aus und blieb stehen. Auf der anderen Seite der Glastür wurde Michèles Blick magisch angezogen: Ein berittener Polizist steckte einen Verwarnungszettel an ein falsch geparktes Fahrzeug. Sein Pferd starrte Michèle an.
McQuade konnte mit einem Bewaffneten fertig werden, aber kaum mit zwei Mann. Er zögerte. Der Kriminalbeamte außer Dienst sah seine Chance. Er warf sich in Richtung auf eine der Bänke und griff nach der Waffe. McQuade schoss. Der Rückstoß der schweren Pistole stieß Michèle beinahe aus seinem Griff. Der Kriminalbeamte fiel ächzend auf den Teppich und packte seinen Oberschenkel. McQuade trat einen halben Schritt auf ihn zu, umfasste das Mädchen fester und drückte noch einmal ab. Die Wucht des Einschlags ließ den Kriminalbeamten ein paarmal um seine Längsachse rollen.
Eine der hohen Topfpflanzen kippte und fiel um, Blumenerde auf dem Boden verstreuend. Die langen, grünen Blätter hüllten Kopf und Brust des Kriminalbeamten ein. Haltung und Reglosigkeit verrieten Michèle, dass er tot war.
Zweites Kapitel
McQuade, halb geduckt, drehte sich blitzschnell herum. Michèles Schulter berührte seinen Brustkorb und ließ sie das Hämmern seiner Herzschläge spüren. Durch die Glastüren sah sie für Sekundenbruchteile das Gesicht des berittenen Polizisten.
McQuade rannte zu den Aufzügen und zerrte das Mädchen mit. Die dicke Frau war auf den Rücken gefallen und noch immer reglos. McQuade stieß Michèle in den Lift und drückte den Knopf für das Kellergeschoss.
»Bitte lassen Sie mich jetzt gehen«, sagte Michèle. »Sie glauben, dass die Polizei nicht schießen wird, wenn Sie mich als Deckung benutzen. Nein, nein, Sie täuschen sich.«
Er schwieg. Als sie den Keiler erreichten, führte er sie in einen Korridor, der rechts von den Aufzügen endete. In der anderen Richtung versuchten zwei Packer ein Klavier, das auf einem Rollwagen stand, in den Lastenaufzug zu hieven. Eine Ecke des Rollwagens hatte sich in der Tür verhängt, und bis die Packer das Hindernis beseitigt hatten, gab es kein Durchkommen.
McQuade riss Michèle wieder in den Lift und drückte den Knopf für das elfte Stockwerk.
»Elf«, sagte sie. »Wir fahren zu meiner...«
»Schnauze.«
Er beobachtete die Lämpchen, seine Waffe im Anschlag. Wenn es im Erdgeschoss einen Halt gab, stand die nächste Schießerei bevor. Aber sie fuhren unbehindert weiter. Er ließ sie endlich los.
»Ein Kerl, der in seiner Freizeit mit der U-Bahn spazieren fährt!«, sagte er angewidert. »Acht Millionen Menschen gibt es in New York, und ich muss mit dem Kerl in einen Zug steigen! Wissen Sie, dass ich noch kein einziges Mal vorbestraft bin? Im Ernst. Nicht einmal wegen Waffentragens. Und schlagartig läuft mir. das Pech nach.« Er fragte ganz ernsthaft, als wolle er wirklich ihre Meinung hören: »Warum mussten die zwei Idioten mit dem blöden Klavier herumfummeln?«
Sie beobachtete ihn aufmerksam. Sein Mundwinkel zuckte wieder. Seine Augen glitten hin und her.
»In ein paar Minuten wird jeder Polizist in der West Side von Manhattan nur noch einen Wunsch haben: mir ein paar Löcher in den Pelz zu brennen.«
Michèle zwang sich, normal zu atmen. Sie musste nachdenken. Der Kriminalbeamte im Erdgeschoss war nach dem ersten Treffer für McQuade keine Gefahr mehr gewesen. McQuade hatte ein zweites Mal geschossen, weil er erkannt und beim Namen gerufen worden war. Ein Toter mehr oder weniger würde ihm nichts bedeuten. Sie durfte am Leben bleiben, solange sie von Nutzen war, keine Sekunde länger.
»Welche Wohnung ist die Ihre?«
»Elf - H.«
»Wer wohnt noch dort?«
»Niemand. Ich bin allein.«
Er sah sie kurz an.
»Ich bin geschäftlich hier«, erklärte sie. »Die Wohnung gehört einem Kollegen. Dadurch brauche ich nicht im Hotel zu wohnen. Er ist in Los Angeles.«
»Welche Branche?«
»Mode.«
Sie hielten in der elften Etage. McQuade drückte die beiden Knöpfe der nächsthöheren Stockwerke, damit der Lift ohne sie weiterfuhr. Wieder umklammerte er ihren Arm.
»Bitte nicht. Das ist nicht nötig. Ich kann gar nicht flüchten.«
Seine Oberlippe kräuselte sich.
»Was ich zu tun habe, lasse ich mir von keinem vorschreiben. Merk dir das, Kleine.«
Sie führte ihn durch den kurzen Korridor. Die Tür hatte zwei Schlösser, das normale Schnappschloss, mit einem Zelluloidstreifen sogar von einem Amateur zu öffnen, und ein massives Sicherheitsschloss, für das man Spezialwerkzeug benötigte. Wie üblich versuchte sie es zuerst mit dem falschen Schlüssel.
»Verdammt noch mal«, knurrte er und schob sie beiseite. »Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.«
Nachdem er den Riegel zurückgedreht hatte, nahm er Michèle wieder beim Arm, stieß die Tür auf, trat schnell ein und warf sie hinter sich zu.
Sie standen in einem großen Ein-Zimmer-Apartment. Es war gut eingerichtet, wenn das Mobiliar auch den Eindruck machte, per Telefon bestellt worden zu sein. An den Wänden hingen keine Bilder, Bücher gab es nicht. Links befand sich die Kochnische, rechts das Badezimmer. Ohne ihren Arm loszulassen, warf er einen Blick ins Badezimmer und führte sie dann zu den großen Fenstern.
»Wir sind wirklich allein«, sagte sie. »Sie können mich jetzt loslassen.«
Mit der freien Hand ließ er die Jalousien herunter und stellte die Lamellen so, dass er hinausschauen konnte, ohne gesehen zu werden. Die drei Gebäude des Wohnkomplexes waren U-förmig um einen gepflasterten Hof angeordnet, auf dem sich parkende Fahrzeuge drängten.
Eine Sirene heulte.
»Da sind sie«, sagte er, beinahe erfreut.
Er ließ ihren Arm los. Sie rieb die Stelle und hoffte nur, lange genug am Leben zu bleiben, um die blauen Flecke noch sehen zu können.
»Wollen Sie etwas trinken? Ich habe Whisky und Gin.«
Er rieb sich das Kinn mit den Knöcheln.
»Geben Sie mir einen Schluck Whisky.«
Sie trat an den kleinen Kühlschrank. Er verriegelte die Eingangstür und steckte den Schlüssel in die Tasche. Dann griff er nach ihrer Handtasche, öffnete sie und schüttete den Inhalt auf einen niedrigen Tisch. Michèle beobachtete ihn. Er pickte ihre Autoschlüssel heraus, zwei Stück an einer Kunststoffplakette mit New Yorker Nummer und Chevrolet-Zeichen. Er wog die Schlüssel einen Augenblick in der Hand, bevor er sie beiseitelegte. Dann besichtigte er ihren Pass. Nachdem er die Daten auf der ersten Seite überflogen hatte - sie stimmten übrigens alle nicht blätterte er, bis er den Tag ihrer Einreise gefunden hatte.
Er hob plötzlich den Kopf. Ihre Blicke trafen sich. Der seine war kälter als die Eiswürfel in ihren Händen. Michèle fröstelte. Sie musste sich schnell etwas einfallen lassen.
Er wischte alles vom Tisch in die gewölbte Hand und kippte den Inhalt, mit Ausnahme der Autoschlüssel, in die Handtasche zurück. Als sie die Getränke brachte, studierte er gerade die von Jake Melnick im Lift erbeuteten Diamanten. Es waren vier ungeschliffene Steine, jeder für sich in hauchdünnes Papier gewickelt.
»Hat es sich gelohnt?«, fragte sie.
»Einigermaßen.«
Er wickelte die Diamanten wieder ein und verstaute sie in seiner eigenen Brieftasche. Sie gab ihm ein Glas Whisky mit Eis.
»Darf ich bitte etwas sagen?«
»Jetzt nicht«, erwiderte er.
Er trank einen großen Schluck. Das Heulen einer zweiten Sirene wurde laut. In seinem Gesicht zuckte es.
»Ich hätte auf dem Weg nach oben anhalten und diesen Melnick fertigmachen sollen. Sobald er zu sich kommt, haben sie meine Beschreibung.«
»Wenn er überhaupt wieder wird«, meinte sie.
»Ich habe ihm ja nur einen Klaps gegeben, leider.« Er stand plötzlich auf, winkte aber ebenso schnell ab. »Zu spät. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Warum habe ich nicht daran gedacht?«
Sie schwiegen einige Zeit und hörten den Sirenen zu. Er sah sie über das Glas hinweg an.
»Du kapierst wohl langsam, Baby.«
»Ich denke schon«, sagte sie leise. »Ich mache genau das, was Sie verlangen, oder ich bleibe in Amerika, in einem amerikanischen Grab.«
»Baby«, sagte er gutmütig, »von dir würde nicht mal so viel übrigbleiben, dass man es begraben könnte.« Er trank wieder und starrte sie an. »Erwartest du jemanden?«
»Nein, niemanden.«
»Dann können wir ja systematisch Vorgehen. Als erstes werden sie das ganze Haus durchkämmen.« Er zog das Magazin aus seiner Pistole und füllte es mit Patronen, die er lose in der Tasche trug, auf. »Wie genau hat dich der Polizist gesehen? Ich meine den auf der Straße.«
»Er hat mich gar nicht richtig gesehen.«
»Doch, aber wieviel, das ist die Frage. Wenn sie an die Tür klopfen...« - er ging zum Badezimmer, die Waffe in der Hand -, »...bin ich hier drin. Und ich beobachte dich genau. Auf einem Ohr hör’ ich zwar nichts, aber meine Augen sind sehr gut. Versuch lieber nicht, ihm einen Tip zu geben, denn wenn er einen Fuß zur Tür rein setzt...«
»Ich verstehe. Keine Sorge.«