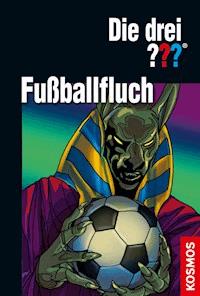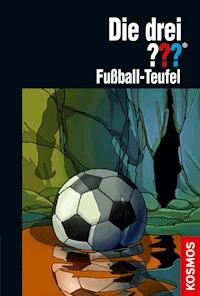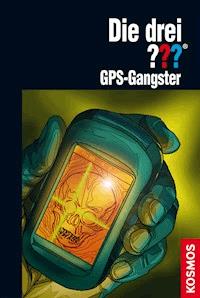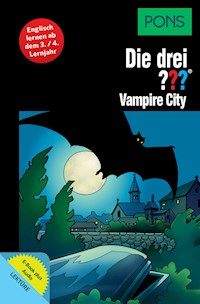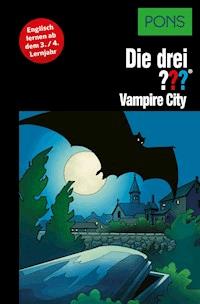Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Kammerlander
- Sprache: Deutsch
Ein bizarrer Mord an einem Finanzbeamten stellt die Münchener Kriminalpolizei vor ein Rätsel. Vielleicht weiß Bartholomäus Kammerlander eine Antwort? Aber der ehemalige Hauptkommissar hat vor Jahren den Dienst quittiert. Doch dann schlägt der Mörder erneut zu - genauso brutal, genauso rätselhaft. Jetzt kann Bartholomäus nicht mehr anders, er muss den Täter finden. Wird er ihn stellen, bevor ein weiterer Mord begangen wird?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marco Sonnleitner
Blutzeugen
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © © Miss X / photocase.com
und © jameek / photocase.com
ISBN 978-3-8392-4118-9
Für meine Frau Barbara
Prolog
18. Juli 1989, Colorado
Es war heiß. Und trocken. Seit Wochen schon. Die Luft über dem rissigen Asphalt flirrte, der Himmel war nahezu farblos. Als hätte die Sonne das Blau weggeätzt. Und wenn man ausstieg, kroch einem sofort die Hitze unters Hemd und starrte mit großen, dunklen Augen aus den Achselhöhlen hervor.
Da nützte es ihnen auch nicht viel, dass sie schon um kurz nach neun Uhr morgens aufbrechen wollten. Als sie auf das Thermometer vor dem Fenster sah, hatte es bereits 84 Grad Fahrenheit, knapp 29 Grad Celsius.
Sie hätten daher sicher den Airport-Shuttle genommen, wenn er ihnen vorher gesagt hätte, dass seine Klimaanlage nicht funktionierte. Aber er hatte es für sich behalten und kurz nach ihrer Abfahrt so getan, als hätte sie eben erst den Geist aufgegeben. Das Autoradio ging ebenfalls nicht, der Beifahrergurt klemmte und der hintere rechte Blinker tat es mal, mal tat er es nicht.
Er hatte ihnen einen Gefallen tun wollen. Oder vielmehr ihr. »Dann habt ihr nicht diese Schlepperei mit dem Gepäck und müsst nicht ewig auf dem Busbahnhof herumstehen. Wir müssen auch erst viel später los, und mein Auto ist echt bequemer.« Et cetera pp. Das war nett von ihm. Nicht, dass er sich ernsthaft Chancen bei ihr ausgerechnet hätte. Er war der Typ, dem es genügte, wenn die anderen nur wussten, dass er sie kannte.
Er kannte sie! Hatte sie unlängst zum Flughafen gefahren! Die Kommilitonen auf dem Campus würden ihm erstaunt zuhören, ihn von oben bis unten mustern und denken: Sieh mal einer an! Oder: Wer hätte das gedacht? Irgendetwas in der Art. Und das war ja so weit in Ordnung. Sollte er sich doch ein klein wenig an ihren Strahlen wärmen.
Aber dass sein Ford schrottreif war, hätte er ihnen trotzdem sagen müssen. Und das andere auch.
Vor zwei Tagen waren die ersten Waldbrände gemeldet worden. Nördlich der Interstate 70, in der Nähe von George Town. Man ging bis jetzt davon aus, dass irgendwelche Teenies dafür verantwortlich waren. Sie hatten heimlich Joints geraucht und sie ins Gebüsch geworfen, als ihnen schlecht geworden war. Passiert war ihnen nichts, aber die Feuerwehr hatte die Brände immer noch nicht unter Kontrolle.
In den 9-Uhr-Nachrichten auf KIBT war noch alles in Ordnung gewesen. Sie hatten zwar nur mit halbem Ohr hingehört, weil sie mit Packen und Frühstücken beschäftigt gewesen waren. Aber einen Waldbrand auf ihrer Route hätten sie sicher mitbekommen. Anschließend waren sie vors Haus gegangen und fünf Minuten später las er sie dort auf.
Sie redeten über das vergangene Semester, ließen ihn am neuesten Klatsch teilhaben und erzählten ihm ein bisschen von der Arbeit, die ihn nach Sioux City führte. Natürlich waren sie verstimmt wegen der Klimaanlage. Aber es ließ sich nicht mehr ändern, und er gab sich ohnehin so schuldbewusst, dass man schon fast ein schlechtes Gewissen bekam, wenn man sich nur den Schweiß von der Stirn wischte.
Als sie Colorado Springs hinter sich gelassen hatten, dünnte der Verkehr allmählich aus. Auf einem Straßenschild stand ›Denver 52‹. 52 Meilen, eine gute Stunde noch, schätzte er. Sie würden rechtzeitig am Flughafen sein. Vorausgesetzt, das Auto machte nicht schlapp. Sie kurbelte das Fenster herunter, damit der Fahrtwind ein wenig Kühlung brächte.
Merkwürdigerweise hörten sie den Rauch, bevor sie ihn sahen. Es war ein feines, gleichmäßiges Fiepen. Als würde jemand sachte auf eines dieser Quietschtiere drücken, die man jungen Eltern und Hundebesitzern schenkte, wenn man sie nicht leiden konnte. Sie bemerkte es zuerst und fragte scherzhaft, ob sich vielleicht irgendwo im Auto eine Maus verkrochen hätte. Sie sah sogar unter sich, ob sie drauf säße, und lachte dabei dieses perlende Lachen, das ihn immer an einen Gebirgsbach erinnert hatte.
Er antwortete nicht und sah sie beide nicht an, verzog das Gesicht nur zu einem starren Lächeln. Und nicht viel später sahen sie sie, kurz hinter Castle Rock. Eine riesige Rauchwolke, die sich von Osten auf die Interstate 25 zuschob. Es war kein Waldbrand. Der Pike National Forest begann erst gut 15 Meilen von hier. Im Westen. Es brannten die Felder. Sie sahen das Feuer nicht, aber es musste so sein. Die Maisfelder standen in Flammen.
Er drückte aufs Gas, fuhr 70, dann sogar 80 Meilen.
»Was ist denn los?«, fragte sie besorgt.
Er sagte nichts, raste weiter. Beugte sich zum Handschuhfach hinüber und kramte hektisch darin herum. Sein Gesicht war seltsam wächsern geworden, fast bläulich.
»Sag doch! Was ist denn?«
»Nichts!«, presste er hervor.
Und dann erkannten sie, woher das Fiepen kam. Er war das. Seine Lunge pfiff wie eine alte Luftpumpe. Er hatte Asthma. Und er versuchte alles, um dem Rauch zu entkommen.
»Das hört sich nicht gut an«, sagte er. »Gar nicht. Kannst du denn überhaupt noch fahren?«
Er nickte.
Sie sah ihn nur entsetzt an und hielt sich die Hand auf die Brust, als wäre sie es, die keine Luft mehr bekam.
Der Inhalator lag ganz hinten im Handschuhfach. Er holte ihn heraus, schüttelte ihn und nahm zwei tiefe Züge. Es wurde nicht besser.
Draußen verdunkelte der Rauch die Sonne. Die Sicht wurde mit jeder Sekunde schlechter, und noch immer rasten sie mit 75 Sachen über den Highway.
»Hey! Das geht doch so nicht. Fahr mal rechts ran!«
Er sah ihn nicht mal an, starrte nur nach vorne. Schweißtropfen standen auf seiner Stirn.
Immer lauter wurde das Pfeifen, seine Atmung verkrampfte sich, er riss den Mund auf und zog die Schultern nach hinten, damit sich der Brustkorb weitete. Doch er fuhr nicht rechts ran. Er musste es zum Flughafen schaffen. Die beiden hatten keinen Führerschein. Und er hatte es ihnen doch versprochen.
»Du hältst jetzt an! Fahr rechts ran! Sofort!« Er legte ihm die Hand auf den Arm.
»Bitte!«, flehte sie. »Um Gottes willen, du erstickst doch!«
Endlich setzte er den Blinker. Er hätte es auch keine Meile weiter geschafft. Auf dem Standstreifen stieg er sofort aus. Er inhalierte ein weiteres Mal, ging auf die Knie und stemmte die Arme in den Boden. Weitete den Brustkorb, keuchte in den Asphalt hinein, das Kinn nach vorne geschoben, die Zunge weit aus dem Mund gestreckt. Es war fürchterlich anzusehen. So musste es sein, wenn man erstickte.
Und sie konnten nichts für ihn tun. Wenn sie ihn fragten, wie sie ihm helfen könnten, schüttelte er nur den Kopf. Sie fing an zu weinen, wollte ihn anfassen, traute sich aber nicht, weil sie Angst hatte, dadurch alles nur noch schlimmer zu machen.
Zwei, drei Minuten kniete er so auf der Straße, während neben ihnen die Autos vorbeidonnerten. Die Hitze und der Rauch verklebten ihnen die Poren und ihre Augen fingen an zu tränen. Er sah schon lange nichts mehr.
Dann endlich wurde es etwas besser. Er atmete weniger krampfartig. Immer noch sehr angestrengt und mit diesem grässlichen Pfeifen, das einem durch Mark und Bein ging. Aber offenbar konnte er ein wenig mehr Luft in seine zugeschnürten Atemwege pressen. Noch fünf weitere Minuten blieb er auf den Knien, atmete, als müsste er es erneut lernen, und hustete nun vermehrt Schleim aus. Spuckte weißliche Brocken auf den Asphalt. Sie standen daneben und dabei sahen sie zum ersten Mal auf die Uhr.
Doch er war noch weit davon entfernt, die Fahrt fortsetzen zu können. Er kroch zum Vorderrad und lehnte sich dagegen. Dort inhalierte er wieder, versuchte, zur Ruhe zu kommen. Irgendetwas sagte er, aber sie verstanden ihn nicht, weil er viel zu leise gesprochen hatte. Sie beugte sich zu ihm hinab und winkte sofort ab. Er hatte sich entschuldigt.
Zwanzig weitere Minuten vergingen. Der Rauch verzog sich langsam, weil sich der Wind leicht drehte. Sie mussten jetzt weiter. Möglichst bald. Ihm war das natürlich bewusst, und sobald er sich wieder auf den Beinen halten konnte, schleppte er sich zur Fahrertür und ließ sich auf den Sitz fallen. Aber so konnten sie ihn nicht fahren lassen, das war viel zu gefährlich. Also warteten sie noch einmal zehn Minuten. Das war das Äußerste, was sie sich noch leisten konnten. Nicht, dass sie ihn unter Druck gesetzt hätten. Sie schlug sogar vor, umzukehren und morgen zu fliegen. Andererseits spielte es keine Rolle, ob sie nun umkehrten oder nach Denver fuhren. Die Entfernung war annähernd die gleiche. Also würden sie versuchen, den Flug noch zu bekommen.
Doch gerade, als er den Zündschlüssel umdrehte, hörten sie die Sirene aufheulen. Einmal nur japste sie, um zu sagen, dass die Highway Patrol hinter ihnen stand.
Sie fuhren heute nicht mehr nach Denver. Die beiden Beamten riefen die Ambulanz und einen Abschleppdienst, um den Wagen vom Highway zu schaffen.
Sie würden also doch morgen fliegen müssen.
1. Kapitel
Anfang November 2010, Starnberg
Starnberg war ein schmucker Ort. Aufgeräumt, sauber, reich. Trotz der grauen Wolken, die regenschwer und tief über das Land zogen, wollte sich hier keine rechte Novemberstimmung einstellen. Die Farben schienen heller als anderswo, der Wind milder, der Winter ferner. Dass die Autos größer und die Häuser schöner waren, verstand sich in der reichsten Gemeinde Deutschlands ohnehin von selbst.
Die Menschen waren hier jedoch nicht weniger mürrisch als im Rest von Oberbayern. Auf den meisten Gesichtern der Menschen, die an diesem Morgen durch die sorgfältig gekehrten Straßen eilten, klebte ein großes Bloß-nicht-ansprechen-Schild. Und die restlichen schauten so griesgrämig drein, dass sie gar kein Schild brauchten. Wobei nur Touristen und Norddeutsche – alle jenseits der Donau – diese Wesensart als mürrisch bezeichnet hätten. Der Oberbayer grantelte. Und Granteln gehörte zu einem echten Oberbayern wie süßer Senf zur Weißwurst.
Er musste über sich selbst lächeln. Das waren Klischees. Er dachte in Klischees. Wie schnell sich doch derartige Allgemeinplätze im Bewusstsein festsetzten. Und eh man sich’s versah, dachte man nur noch in vorgefertigten Hülsen.
Aber eigentlich war ihm das im Augenblick egal. Starnberg, die Menschen, seine Gedanken darüber. Er war nicht hier, um Urlaub zu machen oder Leute kennenzulernen. Ganz und gar nicht. Das hieß – kennenlernen würde er durchaus gleich jemanden. Wenn auch auf eine sehr spezielle Weise.
Der Mercedes glitt nahezu geräuschlos durch den Morgenverkehr. Ein wenig kam es ihm so vor, als säße er im Kino und würde der Welt dort draußen zusehen. Sah umgekehrt jemand ihn? Dachte jemand in diesem Moment: Ein schönes Auto! Wie lebt der Mann in dem Auto wohl? Hat er eine hübsche Frau, was arbeitet er, wo will er hin? Fährt er zum Einkaufen oder will er jemanden umbringen?
Er schmunzelte. Natürlich dachte das keiner. Aber die Vorstellung, dass er an all diesen Menschen vorbeifahren konnte, ohne dass auch nur einer den Hauch einer Ahnung hatte, bereitete ihm einen wohligen Schauder. Er fühlte sich wie der Wolf im weißlackierten Schafspelz, der durch die dröge Starnberger Herde schlich, um gleich eines ihrer Schäfchen zu reißen.
Aber da war noch ein anderes Gefühl. Er spürte, dass er jetzt doch ein bisschen nervös wurde. Das war einerseits unangenehm, andererseits aber nicht verwunderlich. Er hätte es auch durchaus merkwürdig gefunden, wenn er nicht nervös geworden wäre.
Er tippte auf den Schalter am Lenkrad. Vielleicht lenkte ihn die Musik ein wenig ab.
Bayern 3 war voreingestellt. Ein Werbespot irgendeiner Möbelhauskette ging gerade zu Ende, dann meldete sich der Moderator. Ekelhaft gut gelaunt, kündigte er ein Lied von einer Gruppe an, die sich Black Eyed Peas nannte. Schwarzäugige Erbsen.
Er hörte sich die ersten Takte an und versuchte mitzusummen. Das fiel ihm jedoch sehr schwer, weil er das Lied nicht kannte und die Melodie alles andere als absehbar war. Auch mitwippen war nicht einfach. Der Rhythmus wechselte andauernd. Oder er fand nicht hinein.
Er mochte diese Art von Musik nicht. Sie machte ihn nur noch nervöser. Er stellte das Radio wieder ab. Schwarzäugige Erbsen.
Wo er das Auto parken wollte, hatte er sich natürlich vorher angesehen. Er hoffte nur, dass dort auch ein Parkplatz frei war. Aber die Chancen standen recht gut. Die ruhige Seitenstraße lag weit genug vom Zentrum entfernt, und viele Anwohner waren im Augenblick sicher unterwegs zur Arbeit oder beim Einkaufen.
Er hatte Glück. Direkt gegenüber waren zwei Parkplätze frei. Er hielt vor einem gelben Mietshaus und stellte den Motor ab.
Noch ein paar Augenblicke blieb er sitzen und sah starren Blickes durch die Windschutzscheibe. ›Kalender machen‹ hatte sein Vater das immer genannt, wenn man so ausdruckslos vor sich hinstierte. Er wusste bis heute nicht, wieso. Zumindest half es ihm ein wenig gegen die Nervosität.
Die schwarze Ledertasche lag auf der Rückbank. Er drehte sich um und hievte sie nach vorn. Öffnete die Tasche und nahm die Liste heraus.
Der Name stand darüber. Fett, unterstrichen, mittig. Darunter hatte er unter A)Ausrüstung zunächst die benötigten Utensilien aufgereiht. Jeder Gegenstand hatte eine eigene Zeile bekommen. Mit einem dicken, schwarzen Punkt davor.
Elektroschockgerät
Lüsterklemmen
Handschuhe
Haarnetz
Ein Set Elektro-Schraubenzieher
Maulschlüssel …
Er tippte in der Tasche auf jeden einzelnen Gegenstand, als könnte er sich nur so sicher sein, dass er ihn auch wirklich dabeihatte.
Alles war da. Natürlich. Er hatte es ja schon ein Dutzend Mal überprüft.
Als er am Ende der Liste angekommen war, drehte er das Blatt um und las, was er unter B)Vorgehensweise notiert hatte. Er versuchte, sich zu konzentrieren. Wenn er nur an die Aufgabe dachte, alles andere ausblendete, könnte er seine Nervosität in den Griff bekommen. Er vertiefte sich in die Zeilen, murmelte manches leise vor sich hin. Nicht alles. Manche Dinge wollte er nicht hören.
»… und danach runter ins Seerestaurant.« Er ließ das Blatt sinken. Seine Hand zitterte ganz leicht. »Diese Sache noch arrangieren und dann …«
Er hielt inne. Vielleicht das letzte Mal. Lenkte seine Gedanken dorthin, wo alles seinen Ausgang genommen hatte, machte Kalender.
Nein, er war nicht nervös, weil er auf einmal doch Skrupel bekommen hatte. Es war … Er hatte so etwas einfach noch nie gemacht. Da konnte so vieles schiefgehen. Trotz Planung und Liste und dem allen. Insofern war es weniger Nervosität als vielmehr eine Art Lampenfieber, das ihn heimgesucht hatte. Und das wiederum war durchaus zweckdienlich, wie er unlängst in der SZ gelesen hatte. Um Leistung optimal abrufen zu können, hatte es da geheißen, sei ein mittlerer Erregungszustand nötig, der die Sinne anspannte, aber nicht überbeanspruchte, sodass man verkrampfte. Adrenalin und Kortison spielten dabei eine Rolle. Schon seit der Steinzeit. So ungefähr hatte er das verstanden.
Ja, Lampenfieber. Das traf es wohl eher. Und vielleicht sogar ein klein wenig … Vorfreude? Die Art, wie man sie hatte, wenn man gerade in den Urlaub startete? Wenn es gleich losging! Kurz bevor die Rotoren angelassen wurden. Rotoren …
Seine neue Bekanntschaft wartete. Er stieg aus, ging über die Straße und blieb vor dem unscheinbaren dreistöckigen Haus stehen. Hinter den meisten Fenstern hingen Gardinen, in manchen standen Blumen und glotzten traurig auf die Straße. Die Fassade hatte eine Farbe irgendwo zwischen Hellbraun und Schmutzgelb. Ein Kiesweg führte vom Bürgersteig zur Haustür. Rechts und links des Weges ein Streifen grauen Grases, neben der Tür ein verrosteter Fahrradständer. Das gab es also auch in Starnberg.
Er sah sich um. Kaum Menschen in der Nähe, niemand nahm Notiz von ihm. Er straffte sich und ging auf die Haustür zu. Die Steine knirschten unter seinen Schuhen. Als er sich damals das Bein verdreht hatte, bis die Bänder in seinem Knie gerissen waren, hatte sich das Geräusch ähnlich angehört. Ihn schauderte.
Vor dem Haus blieb er stehen. Sein Blick ging zum Klingelschild. Zweiter Stock. ›Alfarth‹ stand da, S. Alfarth. Der Erste auf seiner Liste.
Und auf der anderen.
Er klingelte.
2. Kapitel
Berg am Starnberger See, Mitte Dezember
Das Glöckchen über der Eingangstür der Metzgerei Schöberl bimmelte aufgeregt, als Xaver Eberhartinger eintrat. Er stampfte einmal mit jedem Fuß auf, damit der Schnee auf die Schmutzmatte fiel, und schloss die Tür hinter sich.
»Moign, Fritz.«
»Grias de, Xaver.« Fritz Schöberl stellte die Wanne mit dem frisch durchgedrehten Hackfleisch in die Vitrine. »A rechts Sauwedda hamma, geh?«
»Ja. Des hört gar nimma auf zum Schnein. Aber wirst scho seign, bis Weihnachtn is ois wieder weg.«
»Wia jeds Jahr hoid.«
»Na.« Xaver Eberhartinger machte ein skeptisches Gesicht. »Friara war des anders.«
Fritz Schöberl nickte bedeutungsvoll. »Des is da Klimawandl. In dreißg Jahr kemma bei uns an Wein obaun. Und in Italien werds so hoas wia in da Sahara. Hob i in da Zeidung glesn.«
Während Xavers Blick über die Auslagen glitt, wog er in Gedanken ab, was ihm im Moment lieber gewesen wäre. Dauerschneefall oder 35 Grad im Schatten. Er konnte auf beides verzichten. »Hauptsach, es gibt dann no a koids Hefeweizn.«
»Da hast a wieda recht.« Fritz Schöberl lachte und wischte sich die Hände an seiner fleckigen Schürze ab. »Und? Wos mogst?«
»Ja, an warma Lebakas hoid.« Er sah Fritz erstaunt an. Wieso fragte der? Hatte er sich morgens schon jemals etwas anderes als eine Semmel mit warmem Leberkäse gekauft?
»I hob koan mehr.«
»Wos?« Xavers Blick flog zur Warmhaltevitrine.
»Den andern ham ollan de Handwerker zamgfressn.« Fritz Schöberl zuckte die feisten Schultern. »Woast scho, de do draußn in dera neian Halle rumwerkln. An Haufa Poln, Tschechn und Russn.«
»Koan warma Lebakas mehr?« Xaver starrte immer noch auf die Rotlichtauslage. Ohne einen Laib braunkrustigen Leberkäses ein fast unwirklicher Anblick. Wie eine Fernsehkommode ohne Fernseher. Nur schlimmer. »Ah, geh weida!«
Sein Tag hatte sowieso schon nicht gut begonnen. Erst war er über die Katze der Chefin gestolpert und wäre fast die Stiegen hinuntergefallen, und dann hatte es den Wasserhahn am Geräteschuppen zerrissen, weil es seit Tagen schon so saukalt war und der Rudi vergessen hatte, die Wasserzufuhr ab- und den Hahn aufzudrehen. Das wiederum war der Grund, weswegen er seine Brotzeitpause erst um halb zehn hatte anfangen können und so spät zum Schöberl gekommen war. Der jetzt keinen warmen Leberkäse mehr hatte.
»An grobn Lebakas hob i no.« Fritz Schöberl deutete auf einen Laib neben den Wurstwaren. »Den konn i dir warmmacha in der Mikrowäin.«
»An grobn!« Xaver schüttelte den Kopf. »Des is ja nix Hoibs und nix Ganzs ned.«
»Warum? A Lebakas is a.«
»Aber koa richtiger.«
Fritz Schöberl hob eine Augenbraue, und Xaver blickte düster auf die Salamiringe an der Wand. Polen, Tschechen und Russen. Im Grunde hatte er nichts gegen diese Leute. Aber mussten die jetzt auch noch warmen Leberkäse für sich entdecken? So viel warmen Leberkäs konnte der Schöberl ja nie herbringen.
»Mogst wos anders?«
»I woaß ned.« Ohne rechte Begeisterung wandte sich Xaver Eberhartinger wieder der Auslage zu.
»An koidn Bratn hob i.«
»Ah na.«
»Oder a Wammerl.«
»Na, a koa Wammerl ned.«
Für ein paar Sekunden sagte keiner der beiden etwas. Xaver Eberhartinger sah niedergeschlagen in die leere Leberkäse-Warmhaltevitrine, und der Schöberl stand da und dachte gar nichts. Die Uhr tickte, draußen fuhr ein Auto vorbei, die Welt war leberkäsekalt.
»Gib ma a Semme und an weißn Presssack«, sagte Xaver Eberhartinger schließlich und deutete missmutig auf die Sülzwurst.
»An Presssack. Is recht.« Fritz Schöberl griff in die Wursttheke. »Und? Gibt’s was Neis?«
»Na. Nix.«
»Aha. Bei uns a ned.« Fritz Schöberl schnitt eine dicke Scheibe von dem Presssack ab. »Du, was i di scho lang a moi fragn woid. Wia geht’s denn eigentlich dem Alois?«
Xavers Gesicht wurde noch ein wenig düsterer. Er wollte jetzt nicht auch noch über seinen Bruder reden. »Guad.«
»Werd’s dem ned langsam z’koid da draußn in dera Hüttn?«
»Na.« Xaver wusste genau, was Fritz jetzt dachte. So lange sein schwuler Bruder einen warmen Kameraden neben sich im Bett hatte, würde es ihm in seiner Hütte am See sicher nicht kalt werden.
Mein Gott, der Alois! Ein schwuler Eberhartinger! Das hätte doch wirklich nicht sein müssen! Oder, wenn er seine sexuellen Vorlieben schon nicht unterdrücken konnte, dann hätte er sie doch zumindest für sich behalten können! Aber erst war er im letzten Sommer geschminkt durch Berg gelaufen und dann hatte er vor ein paar Wochen diesen dürren Lurch direkt vor der Kreissparkasse geküsst. Auf den Mund geküsst! Der Alois war ja schon immer ein bisschen anders gewesen, schon als kleiner Bub. Und er hatte ihn ja wirklich gern. Aber er hätte doch nicht gleich schwul werden müssen. Künstler sein hätte doch gereicht. Aber nicht auch noch ein schwuler Künstler! Herrgottsakrament!
»Am Veit geht’s ned so guad.« Fritz Schöberl reichte Xaver die Papiertüte mit der Presssacksemmel über den Tresen.
»Ah, geh weida!« Froh über den Themenwechsel, war Xaver ganz Ohr.
»Zwoa Euro und a Zehnerl. Ja, er sagt, dass er sei Schreinerei nimma lang hoitn ko, wenn’s so weitergeht.« Fritz Schöberl nickte nach hinten, wo sich in einigen Kilometern Entfernung die neue Mehrzweckhalle aus dem Schnee hob. »Die Globalisierung is schuid, sagt da Veit. Von überall her kummas. De Poln, de Tschechn, de Russn und de andern und arbeitn bei uns fürn Hungalohn. Und unseroana konn schaugn, wo er bleibt.«
Xaver reichte ihm das Geld und nahm die Tüte. »Und was mecht er nachad macha? Er hot doch Schreiner glernt!«
»Er woas no ned. Vielleicht ziagt er nach Minga und schaugt, ob er da a Arbeit findt.«
Xaver verharrte nachdenklich. Der Veit. So, so. »Sagst eahm an scheena Gruas von mia, wenn’s d’n siegst.«
»Des mach i.«
»Pfiad de, Fritz.«
»Pfiad de, Xaver.«
Klimawandel, Globalisierung und kein warmer Leberkäse – von dem, was vor neun Uhr bereits passiert war, einmal ganz abgesehen: Xaver Eberhartinger hatte das Gefühl, dass das wieder einer jener Tage wurde, an denen er am besten mit Wiggerl auf dem Kanapee geblieben wäre.
Auch auf dem Weg zurück ins Hotel besserte sich seine Laune nicht, ganz im Gegenteil. Obwohl der Winterdienst im Dauereinsatz war, kam er kaum mit dem Freiräumen und Salzen der Straßen hinterher. Seit zwei Tagen schneite es mehr oder weniger ohne Unterlass, und nur auf der Hauptstraße sah man noch den Asphalt in Form von vier schmalen Fahrspuren. Die Nebenstraßen wiesen eine geschlossene Schneedecke auf, und weil die Winterreifen des hoteleigenen Landrovers auch nicht mehr die jüngsten waren, musste Xaver sehr vorsichtig fahren. Außerdem wollte sich Xaver jetzt ärgern, über was auch immer.
Einen richtigen Grund dazu bekam er dann auch noch. Kurz vor der Abzweigung hinauf zum Hotel kam ihm in der Linkskurve ein Lieferwagen entgegen. Er war viel zu schnell unterwegs. Als er den Landrover sah, bremste er hart, kam ins Schlingern, schleuderte Schneematsch gegen den Kühlergrill des Landrovers und schrammte haarscharf am hinteren Kotflügel vorbei. Und es war ein Wagen einer Münchner Großschreinerei, in dem mindestens sechs Handwerker saßen. Polnische wahrscheinlich und tschechische und russische.
»Bagage, gschlamperte!«, schimpfte Xaver Eberhartinger und sah dem Lieferwagen im Rückspiegel hinterher. »Da-sticka soids an meim Lebakas!« Er warf seiner Presssacksemmel einen bösen Blick zu, biss voller Verachtung hinein und bog rechts ab.
Die Auffahrt zum Hotel Alpenblick führte zunächst durch eine Allee tief verschneiter Weiden und Birken. Linkerhand breitete sich der Golfplatz aus, von dem einige Greens und Fairways fürs Wintergolfen präpariert wurden. Angesichts des fortwährenden Schneefalls ein allerdings ziemlich mühseliges Unterfangen. Rechts erstreckte sich der zugefrorene hoteleigene Weiher, auf dem sich gut Eisstockschießen ließ. Xaver Eberhartinger sah sehnsuchtsvoll hinüber. Dafür würde er wohl erst am Wochenende wieder Zeit haben. Vorausgesetzt, es hörte bis dahin auf zu schneien.
Vor dem Hotel breitete sich ein großer, annähernd runder Platz aus, in dessen Mitte ein imposanter Brunnen stand. Der heilige Florian, überdimensioniert und mit all seinen Muskeln eher an eine griechische Götterstatue als an einen bayerischen Schutzheiligen erinnernd, schüttete seinen Wassereimer über die zu seinen Füßen lodernde Feuersbrunst. Xaver Eberhartinger hatte den Brunnen aber wie jedes Jahr Anfang November abgestellt, so dass im Augenblick nur ein dicker Eiszapfen aus dem eingeschneiten Steineimer quoll.
Direkt vor dem Haupteingang musste er einen riesigen, neongelben Bus umkurven. Lüttmann-Reisen. Mit einem Kennzeichen, das Xaver Eberhartinger nicht zuordnen konnte. BG. Und die Gäste konnte er auch nicht zuordnen.
»Jo, wos is’n des?«, entfuhr es ihm.
Zwei blasse Frauen in wehenden, knallbunten Gewändern warteten darauf, dass der Fahrer ihr Gepäck entlud. Und auch die beiden ganzwollenen Männer, die sich gerade zu ihnen gesellten, ließen Xaver Eberhartinger innerlich auf Distanz gehen.
»Wo sannan de ausbrocha?«
Auf der anderen Seite hatte er schon etliche besondere Menschen gesehen, seit er im Alpenblick als Hausmeister arbeitete. Chinesen gingen ein und aus, letzten Monat hatten zwei lesbische Frauen in der König-Ludwig-Suite logiert, und einmal hatte sogar ein Vegetarierseminar stattgefunden. Pflan-zen-es-ser! Solchen Leuten war er an seiner alten Arbeitsstelle, dem Hotel zur Sonne, draußen am südlichen Ortsrand, nie begegnet. Die hätte sein damaliger Chef, der Alfons, gar nicht erst reingelassen ins Haus. Aber der Bartholomäus und seine Frau hatten gar nichts gegen solche Leute. Ganz im Gegenteil. Je besonderer die waren, desto mehr freute es sie. Vor allem die Wiebke.
»Wiebke!« Xaver Eberhartinger schüttelte den Kopf. Wie konnte man seine Tochter nur Wiebke nennen? Das arme Mädel. Bis heute hatte er das Angebot seiner Chefin, sie zu duzen, nicht angenommen. Weil er den Namen nicht aussprechen konnte, ohne das Gefühl zu haben, sie damit zu beleidigen. Und sicher machte er dabei auch ein Gesicht, als hätte er was Greisliges im Mund. Ein lauwarmes Hefeweizen. Oder a dogade Brezn. Nein, nein, Frau Kammerlander war schon recht. Oder Scheefin. Aber nicht Wiebke.
Wenigstens hatte der Chef einen richtigen Namen. Bartholomäus. Da hätte Xaver Eberhartinger keinen Augenblick gezögert, wenn ihm der Bartholomäus das Du angeboten hätte. Und das, obwohl der Bartl ein Kriminalhauptkommissar war. Ein freier Mitarbeiter zwar, aber doch ein Kriminalhauptkommissar. Aber der hatte es bis jetzt nicht getan. Das Du anbieten.
Freier Mitarbeiter. Während Xaver Eberhartinger den Landrover in die Tiefgarage fuhr, dachte er zum wiederholten Male über dieses freier Mitarbeiter nach. Was bedeutete das jetzt eigentlich? War Bartholomäus Kammerlander ein richtiger Kriminaler? So ein urkundlich verbeamteter Kommissar mit unkündbarer Lebensstelle und Sternchen auf den Schulterklappen seiner Dienstuniform? Oder durfte er aus irgendeinem anderen Grund bei denen mitmachen? Und aus was für einem dann? Er musste nicht regelmäßig ins Präsidium. Oder wohin ein Kommissar morgens eben so ging. Und er arbeitete auch nur selten an einem Fall, soweit das Xaver Eberhartinger beurteilen konnte. Aber wenn, dann war das bestimmt immer was ganz Besonderes und Geheimnisvolles. Einmal, da war der Innenminister eine Woche lang zum Mittagessen ins Alpenblick gekommen, und die beiden hatten sich im Stüberl unterhalten, als wenn sie sich schon ewig lang kennen täten. Und vor zwei Jahren war der Bartl urplötzlich, ohne Wiebke und mit nur einem Koffer, nach Südamerika geflogen und erst sechs Wochen später wiedergekommen. Ein Urlaub war das nicht gewesen, da war sich Xaver sicher. Und im Frühjahr hatte er einen Amerikaner bei sich ins Nebengebäude einquartiert, der um die Schultern breiter war als der Schöberl Fritz um den Bauch. Und kein Gramm Fett.
Worum es da immer gegangen war und ob da wirklich irgendwelche Fälle eine Rolle gespielt hatten, wusste Xaver nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Er vermutete es, weil mit nur einem Koffer flog man ja nicht einfach so nach Südamerika. Und ohne Frau.
Aber irgendwie war das schon alles komisch. Geheimnisvoll, aber komisch. Weil es auch gar nicht nach bayerischem Beamtentum aussah. Und dass so etwas auch noch als freier Mitarbeiter ging, war ja die Merkwürdigkeit schlechthin. Einmal, da hatte er mit dem Kreuzpointner Josef über den Bartl sprechen wollen, weil der Sepp ja auch Kommissar war, wenn auch kein Hauptkommissar. Und bei einem Fall hatte er ja schon mit dem Bartl zusammengearbeitet. Aber so viel der Kreuzpointner auch beim Schafkopfen redete und vor lauter Reden und Erzählen oft gar nicht einmal dazu kam zu sagen, ob er denn jetzt ein Spiel hatte oder nicht, so zugeknöpft war er auf einmal gewesen, als es um Bartl gegangen war. Und er wüsste auch gar nicht so viel über ihn, hatte er gesagt. Was ihm Xaver Eberhartinger wiederum irgendwie abgenommen hatte. Kaum einer schien wirklich etwas über Bartholomäus Kammerlander zu wissen. Außer wahrscheinlich Wiebke. Aber die konnte er ja nicht fragen. Wo er sie doch nicht einmal duzte.
Und dann der Lebenswandel vom Bartholomäus. Und der von Wiebke natürlich auch. Neulich erst, da hatte Xaver Eberhartinger die beiden –
Xaver zuckte zusammen. Sein Parkplatz war besetzt!
»Ja Herrschaftszeitn!«, fluchte Xaver Eberhartinger und haute aufs Lenkrad. »Wos is’n des für a Tag heid!«
3. Kapitel
Mitte Dezember, Berg, Hotel Alpenblick
Damit konnte er etwas anfangen. Bartholomäus Kammerlander übertrug die drei Zeilen aus dem Grimm’schen Wörterbuch in seine Materialsammlung. »Ja freilich, du bist mein ideal, hab dirs ja oft bekräftigt mit küssen und eiden sonder zahl.« Er nickte. »Heine. Schön.« Der Eintrag ging noch weiter, und er scrollte nach unten. »Wieland. Bürger. Lessing«, murmelte er vor sich hin. »Was schreibt der? Der italienische, nein, italiänische Jesuit Francesco Lana, gestorben 1687, scheint der Erfinder des Wortes ideal zu sein.« Er schüttelte den Kopf. »Brauch ich nicht.«
Mit dem Abschnitt von Lessing endete der Text. Bartholomäus Kammerlander nahm einen Schluck Kaffee, der mittlerweile eiskalt war, und lehnte sich zurück. Noch einmal las er sich durch, was er an diesem Morgen geschafft hatte. Einiges. Das meiste Recherche und Materialsammlung, aber zwei neue Zeilen hatte er auch geschrieben.
Des Tages Hüter seiner Acht,
die abends ihre Glut entfacht.
Gefiel ihm richtig gut. Oder doch nicht? Zu schmalzig? Er runzelte die Stirn. Statt GlutLust? Hm. Er horchte in sich hinein und spürte dieses leise Grollen, das ihm immer verlässliches Zeichen dafür war, wenn ihm irgendetwas an seinen Formulierungen nicht zusagte. Wobei ihm dieses Grollen nie verriet, was genau ihm nicht gefiel. War es doch der Hüter? Das entfacht? Oder einfach nur der kalte Kaffee? Die Falten auf seiner Stirn wurden tiefer. Dieses Gedicht hatte es wirklich in sich. Wenn es ihm weiter so zäh von der Hand ging, musste er sich doch ein anderes Weihnachtsgeschenk für Wiebke ausdenken. Diese Ohrringe vielleicht, vor denen sie in der Maximilianstraße unlängst Wurzeln geschlagen hatte. Oder diese sündhaft teure Handtasche. Dabei hatte sie doch schon 20 Handtaschen. Mindestens.
War es vielleicht die Acht? Oder war das ganze Gedicht Mist?
Er stellte die Kaffeetasse hin und stand auf. Das Bild mit den Brüsten war ihm wieder eingefallen. Diese seitlich aufgenommenen Brüste mit den spitzen Nippeln, den Schatten und dem sommerlichen Hintergrund. Das hatte etwas gehabt. Genauso sollte sein Gedicht werden. Nur in Worten. Irgendwie.
Aber wo war dieses Bild? Er konnte sich erinnern, dass er es aus einem Fotoband herausgerissen und dann … Ja, dann … Bartholomäus sog die Unterlippe ein und sah sich um. An den Wänden und Regalen hing es nicht. Soweit er das auf den ersten Blick beurteilen konnte. Was noch nichts heißen musste, denn da hingen so viele Zettel, Bilder und Post-Its, dass man vielleicht erst auf den zweiten Blick fündig wurde. Er blätterte den Stapel mit den Kopien durch – nichts. Hatte er es in ein Buch gelegt? Am wahrscheinlichsten in eines, das er zu jener Zeit gelesen hatte, als er das Bild entdeckt hatte. Aber wann hatte er das Bild entdeckt? Und welche Bücher hatte er da gerade gelesen? Sein Blick schweifte durchs Zimmer. Über Stapel von Büchern. Weil in den Regalen schon lange kein Platz mehr war. War es in die Computerausdrucke geraten? Die durchzusehen hatte er im Moment aber überhaupt keine Lust. Da stieß er mit Sicherheit auf tausend andere Ideen, und dann wurde aus dem Gedicht erst recht nichts. Der Ordner mit den Zeitungsartikeln? Die seit Tagen da hinten in der Ecke verstreut auf dem Boden lagen, weil er sie eigentlich hatte sortieren wollen?
Bartholomäus seufzte. Wiebke hatte vielleicht doch nicht so unrecht. Sein Zimmer war eine Müllhalde. Aber wie anders sollte er immer alles griffbereit haben, was ihn gerade beschäftigte, wenn er es nicht immer – griffbereit hatte? Wobei er dieses blöde Foto trotzdem nicht fand.
Plötzlich musste Bartholomäus grinsen. Und dann lachte er laut auf. Genau so sollte es sein. Ja, zum Teufel! Das war es, was er wollte. Er stand hier an einem Donnerstagvormittag in seinem völlig vermüllten Arbeitszimmer, schlug sich mit Worten herum, die nicht in sein Weihnachtsgedicht passten, verzweifelte an einem Tittenfoto, das er in seinem ganzen Chaos nicht mehr fand, und ärgerte sich über kalten Kaffee. Herrlich!
Bartholomäus Kammerlander setzte sich wieder hin. Atmete durch, sah zum Fenster hinaus. Für solche Tage hätte er gerne eine Art Sammelalbum gehabt. Für Tage, an denen er sich in all den Dingen verlor, die so völlig unwichtig und nutzlos waren. Und gerade deswegen so wesentlich und bedeutend. Jeder einzelne solcher Tage bekäme eine eigene Seite. Und wenn dann einer dieser anderen Tage war, könnte er das Album aufschlagen und sich erinnern, wie es war an solchen Tagen wie heute. Wie er dann war. Vielleicht wäre die Erinnerung irgendwann einmal tatsächlich stark genug.
Bartholomäus sah auf die Uhr. Halb elf. Allmählich bekam er doch Hunger. Außerdem wollte er den Kopf freikriegen. Er würde noch schnell duschen und dann rüber ins Hotel gehen. Frühstücken, vielleicht eine Partie Schach spielen, wenn der Professor da war, ein wenig nach dem Rechten sehen.
Nach dem Duschen stellte er sich auf die Waage. Das letzte Mal war einige Zeit her, und er war gespannt, ob die Waage nach wie vor seine Freundin war. 91 Kilogramm. Bei 193cm Körpergröße okay. Er blickte an sich hinab. Für seine 53 Jahre war er tatsächlich noch immer gut in Schuss. Wiebke sagte das nicht nur, weil sie dachte, dass er das gerne hörte. Obwohl er es natürlich gerne hörte. Aber er tat auch was dafür, zwei-, dreimal die Woche, drüben in Ramersdorf. Es gab allerdings durchaus auch Stellen an seinem Körper, mit denen er nicht mehr ganz so zufrieden war. Die Taille zum Beispiel. Oder die Schultern. Vor allem die linke spürte er jetzt immer öfter.
Bartholomäus wischte den Wasserdampf vom Spiegel und betrachtete sein Gesicht. Er sollte sich rasieren. Aber nicht jetzt. Und zum Friseur musste er auch mal wieder. Andererseits mochte es Wiebke, wenn seine Haare länger waren. Doch er hatte so viele davon. Grau waren sie schon an vielen Stellen geworden. Aber nicht weniger.
Er ging näher an den Spiegel, fuhr sich übers Kinn und den kleinen Höcker auf der Nase. Über die Narbe an seiner rechten Schläfe. Sieben Stiche. Dieser Hinterhof damals in Pasing …
Er wandte sich ab. Daran wollte er jetzt nicht denken. Es sollte ein Albumtag bleiben. Zumindest ein Albumvormittag. Er trocknete sich ab – ein wenig zu grob –, zog sich an und verließ das Haus. Mit feuchten Haaren und einer Erinnerung, die ihm dunkel folgte.
Als Bartholomäus Kammerlander um den Südflügel des Hotels bog, stand der neongelbe Bus noch immer vor dem Haupteingang. Zunächst konnte er sich nicht daran erinnern, dass heute eine Reisegruppe eintreffen sollte. Aber als er das Kennzeichen sah, fiel es ihm wieder ein. Die Reinkarnations-Leute aus Hessen. Wiebke hatte ihm vor ein paar Tagen erzählt, dass ein Paar aus Lübeck einige Zimmer und den Edelweiß-Raum gebucht hatte. Sie wollten im Alpenblick vier Wochenseminare nacheinander abhalten. Erst kamen die Hessen, dann Schweizer über Weihnachten, und weiter konnte sich Bartholomäus nicht mehr erinnern.
Seltsam war, dass sich niemand mehr am oder im Bus aufhielt. Alle Türen waren zu, der Motor aus. Wenn der Bus ausgeladen war, konnte ihn der Fahrer doch drüben auf den Busparkplätzen abstellen. Hatte er aber nicht getan. Bartholomäus betrat die Lobby und sah sich nach Dexter um.
Der englische Concierge stand hinter der Rezeption und schrieb irgendetwas auf. Als er Bartholomäus sah, hob er den Kopf. Gerade so weit, dass er Blickkontakt aufnehmen konnte. Sein Lächeln wirkte verbindlich, und sein »Guten Morgen!« klang wie immer: very britisch und so, als wäre er der Chef des Hauses. Aber Bartholomäus kannte ihn gut genug, um zu bemerken, dass irgendetwas nicht stimmte.
»Guten Morgen, Dexter. Der Bus da vor der Tür.« Bartholomäus deutete über die Schulter. »Wieso steht der da?«
Dexter zögerte den Bruchteil einer Sekunde, bis er antwortete. Das Höchstmaß an Missbilligung, das er sich als Brite erlauben wollte. »Die Herrschaften haben etwas zu klären, das offenbar keinen Aufschub duldet.«
»Die Herrschaften?«
»Der Fahrer des Reisebusses und … ähm …«, er sah auf den Monitor, »Mr Hädrich, der Seminarleiter.«
Er mag ihn nicht, dachte Bartholomäus. Gar nicht. Dexter muss nie in den Belegungsplan sehen, um Namen von Gästen nachzuschlagen. »Und worum geht es?«
»Mrs Hädrich-Wolters Gepäck wurde angeblich während der Fahrt beschädigt.«
Bartholomäus verstand. »Ist Urte mit ihnen …?« Er deutete auf das Rezeptionsbüro hinter dem Frontdesk.
»Yes, Misses Svenjakob ist mit den beiden Herrschaften ins Back Office gegangen, um die Angelegenheit zu klären.«
Bartholomäus nickte. Damit konnte er die Sache auf sich beruhen lassen. Urte hatte alles im Griff. Immer. »Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo meine Frau ist?«
Der Concierge hörte für einen Moment auf zu schreiben. »Meines Wissens ist sie auf der Suche nach Mr Angelosanto.« Ein Anflug von Belustigung lag in seiner Stimme.
Und Bartholomäus ahnte, warum. »Lassen Sie mich raten. Giovanni hat seinen Fiat wieder auf den Parkplatz für den Landrover gestellt, und Xaver hat gedroht, dass er ihm diesmal wirklich den Kopf abreißt? Und meine Frau versucht jetzt, das Schlimmste zu verhindern?«
Dexter lächelte verhalten. Wortlos wandte er sich wieder seinen Schreibarbeiten zu.
Bartholomäus lächelte ebenfalls. Dann nickte er seinem Concierge zu und machte sich auf den Weg in den Frühstücksraum.
Als er am Teezimmer vorbeikam, sah er, dass der Professor, wie ihn alle im Haus nannten, schon da war. Wie immer um diese Zeit, saß er inmitten seiner Unterlagen neben dem Kamin und arbeitete. Bartholomäus wollte eben weitergehen, als der Mann zufällig aufblickte und ihn grüßte. Dann deutete er zu einem Tisch am Fenster und sah ihn fragend an.
Bartholomäus schaute hinüber. Und grinste. Der Professor hatte ihn offenbar schon erwartet und das Schachspiel aufgebaut. Bartholomäus nickte zustimmend und gab dem Mann mit Gesten zu verstehen, dass er nur noch schnell frühstücken wollte und dann zurückkäme. Zumindest hoffte Bartholomäus, dass der Professor sein Herumgefuchtel so verstand.
Zehn Minuten später kam Bartholomäus mit einer großen Tasse Milchkaffee ins Teezimmer.
»Guten Morgen, Professor.« Bartholomäus stellte seine Tasse ab und reichte dem Mann die Hand.
»Guten Morgen, Herr Kammerlander. Ich hatte gehofft, dass Sie heute Morgen ins Hotel kommen, und war schon einmal so frei, die Figuren aufzustellen.«
»Das trifft sich sehr gut. Denn heute Morgen habe ich so ein unbestimmtes Gefühl in der Magengegend, dass ich Sie schlagen kann. Diesmal sind Sie fällig!«
Der Mann lachte. »Ich werde mich vorsehen, mein Lieber, ich werde mich vorsehen!«
Dass ihn der Professor bisweilen mit ›mein Lieber‹ ansprach, hatte Bartholomäus anfangs etwas irritiert. Der Mann, der sich ihm als Dr. Heelmann vorgestellt hatte, war gut zehn Jahre jünger als er. Auf der anderen Seite passte es auch irgendwie zu seinem unzeitgemäßen Auftreten, dem braunen Twillich-Jackett mit den ledernen Ellenbogenflicken und den rotbraunen College-Schuhen.
»Und? Wie kommen Sie voran?« Bartholomäus nickte hinüber zu den Unterlagen und trank von seinem Milchkaffee.
»Es ist schwieriger, als ich dachte. Aber ein Abenteuer.«
»Die Geschichte der oberbayerischen Tracht ist ein Abenteuer?«
»Ja, ja, in gewisser Weise schon. Wissen Sie, mein Lieber, diese Trachten haben sehr viel gemeinsam mit ihren Trägern. Man kommt ihrem wahren Charakter nur auf die Spur, wenn man hinter die dunkle Patina aus Legenden, Stolz und Dickfelligkeit blickt.«
»Aha.« Bartholomäus blickte ihn verwundert an.
»Aber bis man diese Patina abgekratzt hat …« Der Professor setzte eine vielsagende Miene auf. »Lassen Sie uns lieber ein schönes Spiel spielen.«
»Gerne.« Dickfelligkeit. Das Wort hatte etwas. Bartholomäus machte sich im Geiste eine Notiz: Nachher aufschreiben.
»Ah, da fällt mir ein …!« Der Professor ging zurück zu seinem Tisch und kam mit einem Gegenstand zurück, der in ein weiches Tuch eingeschlagen war. »Darauf bin ich unlängst bei meinen Recherchen gestoßen.« Er schlug das Tuch auseinander, und ein kleines Gemälde kam zum Vorschein. Es zeigte eine ländliche Idylle aus dem bayerischen Alpenvorland. »Es ist kein echter Seidel, aber ich vermute, dass es einer seiner Schüler gemalt haben könnte. Ich würde es gerne Ihrer werten Frau Gemahlin schenken, weil sie so überaus freundlich zu mir war. Leider habe ich sie heute noch nicht angetroffen. Darf ich es Ihnen mitgeben?«
»Aber Herr …!«
»Sagen Sie jetzt nicht, das wäre nicht nötig, Herr Kammerlander. Ich bestehe darauf.« Heelmann hielt Bartholomäus das Gemälde hin und nickte nachdrücklich.
Bartholomäus nahm das Bild zögerlich entgegen. Berge, Wiesen, ein blauweißer Himmel und ein Heustadel. Sein Geschmack war es nicht. »Ein Schüler von August Seidel, sagen Sie?«
»Da bin ich mir recht sicher, ja.«
»Dann sage ich Danke. Wiebke wird sich sicher sehr freuen.«
»Das wiederum würde mich wirklich glücklich machen. Denn wissen Sie, nichts gegen die Rosenalm. Es ist sauber dort und gemütlich. Genau die Art von Unterkunft, die mir mein Geldbeutel erlaubt. Aber arbeiten hätte ich dort unten nicht gekonnt. Und dass mir Ihre Frau Gemahlin gestattet, hier in diesem wunderschönen Raum über meinem Manuskript zu brüten, dafür kann ich ihr gar nicht dankbar genug sein. Wenn Sie ihr bitte das noch einmal sagen wollen von mir, da wäre ich Ihnen sehr verbunden, Herr Kammerlander.«
»Das richte ich ihr gerne aus. Wobei ich mir nicht sicher bin, wer hier wem den größeren Gefallen tut.«
»Wie – meinen Sie das?« Der Professor sah ihn erstaunt an.
»Na ja«, Bartholomäus lächelte, »meine Frau findet es sehr aufregend, dass, ich zitiere: ›in unserem Teezimmer ein echter Professor sitzt, der an einem Bestseller schreibt‹.«
Heelmann machte große Augen. »Bestseller? Hat Ihre Frau Bestseller gesagt? Wissen Sie, ich kann froh sein, wenn das Buch eine Erstauflage von 500 Stück hat. Die dann sämtlich in irgendwelchen Bibliotheksregalen verstauben werden, bis sie dereinst ein mitleidiger Bibliothekar ins Altpapier wirft. Und, nebenbei bemerkt«, er zuckte die Schultern und gab sich zerknirscht, »wir beide wissen doch, dass ich gar kein Professor bin, sondern nur einen Doktortitel habe. Aber, Herr Kammerlander«, er winkte ihn mit dem Zeigefinger näher und Bartholomäus folgte ein Stück, »wenn Sie mir eine Freude machen wollen, dann sagen Sie’s nicht weiter. Es ist der reinste Balsam auf meine verkrachte Kunsthistorikerseele, dieses Herr Professor.«
Bartholomäus lachte laut auf. »Keine Sorge. Ich werde schweigen wie ein Grab.« Er zog einen Reißverschluss über seine Lippen. »Und jetzt haben der Herr Professor die Ehre, sich endlich eine deftige Niederlage von einem niederen Beamten beibringen lassen zu wollen.« Er wies zu dem Tisch mit dem Schachspiel. »Sollen wir?«
»Gerne. Beamter? Ich dachte, das alles hier …«, Heelmann machte eine ausladende Handbewegung.
»Ja, schon.« Bartholomäus zuckte die Achseln. »Aber es gab auch ein Leben davor.«
»Jetzt machen Sie mich aber neugierig.«
Bartholomäus winkte ab. »Es ist keine …«
Ein Geräusch unterbrach ihn. Jemand hatte an die Glastür geklopft. Bartholomäus und Heelmann drehten sich um.
»Tschuldigens vielmals, Scheef.« Regina Mösenbichler, eines der Zimmermädchen, steckte ihren wie immer hochroten Kopf durch die Tür. »Ich soi Ihnen sagen, dass der Herr Kommissar Kreuzpointner draußen wäre und gern mit Ihnen reden dadad.«
Kommissar Josef Kreuzpointner wartete in der Lobby. Interessiert rieb er das Blatt eines riesigen Elefantenfußes zwischen Daumen und Zeigefinger. In der anderen Hand hielt er seinen unvermeidlichen grauen Filzhut.
»Guten Morgen, Kreuzpointner«, begrüßte ihn Bartholomäus. Seine Stimme klang abwartend.
»Moign, Kammerlander.« Er deutete auf die üppige Pflanze. »Der is ja echt.«
»Ja. Die sind alle echt.« Bartholomäus nickte zu den anderen Pflanzen in der Lobby.
»Mir haben auch so einen daheim. Aber bei uns schaut der nicht so aus. Der kümmert schon seit Jahren vor sich hin und wird nicht größer.«
»Viel Licht, nicht zu viel Wasser.« Bartholomäus spürte, wie sich seine Nackenmuskeln verspannten.
»Aha. Dann müss ma ihn woanders hinstellen. Ins Wohnzimmer vielleicht.«
Bartholomäus sagte nichts.
Kreuzpointner drehte seinen Hut in beiden Händen. »Können mir uns hinsetzen?« Er sah zu den Ledersesseln am Zeitungstischchen.
»Natürlich.«
Die beiden Männer gingen hinüber, setzten sich schweigend. Dann stand Kreuzpointner noch einmal auf, zog seinen Lodenmantel aus und legte ihn über den Sessel neben sich.
»Damit sitzt’s sich so schlecht.« Ein vorsichtiges Lächeln, das das ohnehin zerknitterte Gesicht wie ein altes Butterbrotpapier aussehen ließ.
»Was ist los, Kreuzpointner?« Bartholomäus blieb auf der Kante der Bank sitzen. Er nahm sich eine der Postkarten von dem kleinen Stapel, der auf dem Tisch lag. Er brauchte etwas, worauf er den Blick heften konnte. Maria und Josef und das Jesuskind als Strichmännchen. Eine Weihnachtskarte. Von der Behindertenwerkstätte in Planegg. Er hatte gar nicht mitbekommen, dass sie die hier ausgelegt hatten.
Kreuzpointner zögerte, strich sich eine Strähne seines dünnen, aschfarbenen Haares aus der Stirn, die aber sofort wieder zurückfiel. »Kammerlander, willst es dir vielleicht nicht doch noch mal überlegn?«
Bartholomäus atmete innerlich auf. Es war nichts passiert. Nichts Neues zumindest. Er schüttelte langsam den Kopf und legte die Karte wieder hin. »Darüber haben wir doch schon geredet, Kreuzpointner.«
»Ja, aber mir kommen nicht weiter. Es geht nichts voran. Gar nichts. Mir haben alle Spuren ausgwertet, sind allen Hinweisen nachgangen, haben mit x Leuten gredet. Nichts. Der Fall ist so kalt, dass ihn sogar die Presse schon längst wieder fallen lassen hat. Nur die Schönhaberin, die macht uns täglich die Hölle heiß.«
»Bist du deswegen gekommen? Wegen der Schönhaber?«
In Kreuzpointners hellbraunen Augen spiegelte sich Erstaunen.
»Entschuldige. War nicht so gemeint.« Bartholomäus lächelte dünn.
Kreuzpointner ließ sich nach hinten sinken, nahm die schwere Brille ab und schaute zur Decke. »Mir wissen nicht mehr weiter. Deswegen bin ich hier. Mir brauchen dich.«
Bartholomäus schlug einen versöhnlicheren Ton an. Er wusste genau, wie schwer Kreuzpointner dieser Besuch gefallen war. »Kreuzpointner, es tut mir leid. Das heißt, eigentlich tut es mir auch nicht leid. Das wäre gelogen. Nimm’s nicht persönlich.«
Kreuzpointner schwieg. Nein, sicher nahm er’s nicht persönlich. Wenn er an Kammerlanders Stelle gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich ganz genauso gehandelt. Wer machte diesen Job schon freiwillig, wenn er erst mal ein paar Jahre dabei gewesen war? Aber Fakt war, dass er keinen Ermittler kannte, der Bartholomäus Kammerlander nur annähernd das Wasser reichen konnte, und genau so einen hätte er jetzt unbedingt gebraucht. Weil er es sich eben nicht aussuchen konnte.
»Oiso guad.« Kreuzpointner nickte und stand auf. »Einen Versuch war’s wert.«
Bartholomäus hatte diesen Satz noch nie gemocht. Einen Versuch war es wert. Fünf Worte, die ihm immer wie Blei im Magen lagen.
»Halt mich auf dem Laufenden.« Er reichte Kreuzpointner die Hand.
»Mach ich.«
»Danke dir.«
»Nichts zu danken.«
Kreuzpointner nahm seinen Mantel, drehte sich um und ging Richtung Ausgang.
Bartholomäus sah ihm hinterher, gleichermaßen bedrückt und zufrieden. Den Impuls, Kreuzpointner hinterherzurufen, nahm er zur Kenntnis. Aber er gab ihm nicht nach.
Die Lust auf Schachspielen war ihm allerdings vergangen.
*
»Diese versoffenen Halb-Assis! Ich kann sie nicht ab, ich kann sie einfach nicht ab!«
Petra Hädrich-Wolters sah sich besorgt um. »Schatz, bitte beruhige dich. Die Leute.«
»Ach, die Leute! Sind mir doch scheißegal. Außerdem kennt uns doch kein Schwein in diesem Kaff.«
»Schatz, es hat sich doch jetzt geklärt.«
Ein paar Meter weiter kramte ein Mann in einer Schraubenkiste, dahinter maß sich ein zweiter ein Stück Seil von der Rolle, und auf der anderen Seite des Regalsein Stück weiter links stand auch jemand. Petra Hädrich-Wolters glaubte zwar nicht, dass sich einer ihrer Seminarteilnehmer in den hiesigen Baumarkt verlief. Aber vielleicht jemand vom Hotelpersonal?
»Geklärt? Gar nichts hat sich geklärt! Deswegen laufen wir ja durch diesen Scheiß-Baumarkt. Und mal wieder ist keiner da, der sich auskennt. Wenigstens das ist wie zu Hause.« Jörn Hädrich lachte spöttisch.
»Wir finden die Teelichter sicher gleich, Liebling.«
»Wir finden die Teelichter sicher gleich!«, äffte Hädrich seine Frau nach. »Am liebsten würde ich sie diesem busfahrenden Baumaffen in den Arsch schieben. Alle auf einmal. Angezündet. Hast du eigentlich irgendeinen von diesen Grunzlauten verstanden, die dem Kerl da aus seinem Bierschlund gefallen sind? Ich nicht.«
Sie schwieg. Lächelte und bemühte sich, dabei nicht allzu devot zu wirken. Das brachte ihn nur noch mehr auf die Palme.
»Dieses Gesockse geht mir immer mehr auf den Geist. Die überfluten uns. Irgendwann laufen da draußen nur noch so Kretins herum, die zu nichts anderem in der Lage sind als zu saufen, zu fressen und hohl zu sein. Und wir finanzieren diese Schmarotzer auch noch.«
»Liebling, bitte!«
»Und diese Hotelmanagerin. Hast du bemerkt, wie die dich angesehen hat? Die tropfte ja schon durchs Höschen, diese alte Lesbe.«
»Schau, Liebling, da sind die Teelichter.«
»Alles Gesockse.«
»Wir haben sie gefunden!«
»Ich frage mich, wie lange das noch so weitergehen soll.«
»Sollen wir gleich zwei Päckchen nehmen?«
»Wie lange noch?«
4. Kapitel
20. Dezember, München, Berg
Abends um acht Uhr brannte das Licht nur noch in wenigen Räumen des sechsstöckigen Gebäudes an der Knorrstraße. Die meisten Mitarbeiter des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz hatten längst Feierabend gemacht. Aber die Leute, die Manfred Teubner, Leiter der Abteilung 3 für Inlandsextremismus, zu dieser Stunde ins Besprechungszimmer gebeten hatte, hatten im Augenblick sicher ganz anderes im Kopf als Fernsehen, Familie oder womit auch immer sie ihre Abende verbrachten. Das heißt, wenn er es recht bedachte, dann kreisten ihre Gedanken vielleicht genau um diese Dinge. Weil es letztlich auch darum gehen würde.
Teubner bat die Anwesenden, sich zu setzen. Er selbst nahm an der Stirnseite des Tisches Platz. Dann holte er den Bericht aus seiner Aktenmappe und legte ihn vor sich hin.
Vier erwartungsvolle Gesichter blickten ihn an. Nein, nicht erwartungsvoll, korrigierte sich Teubner. Beunruhigt, müde, bleich. Und dieser Dings, dieser … Wie hieß er noch mal? Heinrichs, nein, Hinrichs. Der hatte Angst. Zu Recht. Er war nur angestellt und erst seit drei Monaten dabei.
Auch Teubner fühlte sich nicht besonders wohl in seiner Haut. Verständlich. Wer überbrachte schon gerne Hiobsbotschaften? Er musste an den mittelalterlichen Brauch denken, als man den Überbringer schlechter Nachrichten schon mal geköpft hatte. So weit würde es sicher nicht kommen. Aber schön war das alles trotzdem nicht.
Teubner beugte sich nach vorn und verschränkte die Hände. »Wollen wir anfangen?«
Keiner sagte etwas.
»In Ordnung. Ich möchte mich zunächst bei Ihnen bedanken, dass Sie so lange gewartet haben. Ich habe den Bericht eben erst bekommen.« Er tippte auf den Schnellhefter.
Stefan Back, einer der Sachgebietsleiter, nahm einen Schluck Kaffee aus dem Plastikbecher, den er sich vor der Besprechung noch aus dem Automaten gezogen hatte.
»Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden«, fuhr Teubner fort. »Es sieht nicht gut aus, meine Herrschaften, gar nicht gut. Und das alles hat sich ja schon länger abgezeichnet. Die angespannte Finanzlage der öffentlichen Haushalte verschont auch unsere Behörde nicht. Wir werden in Zukunft mit sehr viel weniger Mitteln auskommen müssen. Das heißt, wir müssen uns ganz genau überlegen, wo wir den Rotstift ansetzen können.« Er machte eine Pause, blickte in die Runde.
Back stellte seinen Becher hin. »Gibt es da wirklich noch was zu überlegen?«
Teubner legte die Fingerspitzen aneinander. »Es gibt da durchaus einige Vorschläge, die wir im Einzelnen prüfen müssen.«
»Und dass Sie ausgerechnet meine Leute zu dieser Besprechung gebeten haben, lässt mich zu dem Schluss kommen, dass einer dieser Vorschläge uns betrifft.«
Bäuml und Winberger nickten, Hinrichs schluckte nervös.
»So ist es.« Teubner sah Back an, hielt dessen Blick aber nicht stand. »Es könnte darauf hinauslaufen, dass Ihr Sachgebiet und das von Gentner zusammengelegt werden.«
»Könnte oder wird?«
»Nun, das wird sich in den nächsten Monaten entscheiden.«
»Und ist abhängig wovon?«
Teubner spürte die Feindseligkeit, die ihm entgegenschlug. Und er hatte sogar Verständnis dafür. Natürlich war das alles nicht auf seinem Mist gewachsen. Aber an irgendjemandem mussten sie ihren Frust ja ablassen. Das war Teil seines Jobs als Abteilungsleiter.
»Es ist abhängig von mehreren Faktoren. Davon, wie weit sich Gelder in anderen Bereichen einsparen lassen, davon, wie man den Bedarf an speziell unseren Bemühungen einschätzt, davon, wieweit sich Umstrukturierungspläne verwirklichen lassen, und von etlichen anderen Umständen. Sie wissen selbst gut genug, wie schnell sich die politische Stimmung ändern kann.«
Netter Versuch, dachte Back. Aber er war lange genug dabei, um sich nicht an irgendwelche Strohhalme zu klammern. In die politische Großwetterlage mochte der Blitz einschlagen und die Verantwortlichen vor die Fernsehkameras und Rednerpulte spülen, wo sie dann von ›erschreckenden Entwicklungen‹ und ›historischem Bewusstsein‹ laberten. Auf ihrer Ebene blieb davon vielleicht ein leises Grollen am Horizont übrig.
»Ich würde gerne auf das zweite davon zurückkommen«, sagte Back. »Auf den Bedarf an speziell unseren Bemühungen, wie Sie das genannt haben. Wie wird der augenblicklich eingeschätzt und inwieweit lassen die Prognosen für die nächsten zwei, drei Jahre noch Spielräume zu?«
Teubner nickte und schlug seinen Bericht auf. Blätterte vor und zurück und fand, wonach er gesucht hatte. »Die offizielle Beurteilung der Lage kennen Sie. Aber wenn ich jetzt mal all das weglasse, was für die Öffentlichkeit bestimmt ist, dann geht man davon aus, dass insbesondere in Ihrem Arbeitsfeld eine weitere Beruhigung der Lage zu erwarten ist. Es konzentriert sich, wird aber nicht mehr. Und Konzentration heißt, dass man es leichter im Blick haben kann. Also weniger Ressourcen beanspruchen muss.«
Dorothea Bäuml schüttelte den Kopf. »Das heißt es doch nicht zwangsläufig. Die Rechten konzentrieren sich, ja. Aber das geht oft mit einer stärkeren Radikalisierung einher. Auch untereinander.«
»Außerdem heißt Konzentration in unserem Fall, nicht mehr auf einem Haufen«, warf Winberger ein, »sondern Verdichtung, vor allem im regionalen Sinn. Einige der uns bekannten Treffpunkte gibt es nicht mehr. Wie sich das rein zahlenmäßige Verhältnis der uns bekannten zu den uns unbekannten Treffpunkten verändert hat, weiß keiner. Also auch nicht, ob wir die Rechten eher besser oder schlechter als früher im Blick haben.«
»Und damit lässt sich im Einzelfall auch schwer sagen …«
»Bitte, meine Herrschaften, bitte!«, fiel Teubner Hinrichs ins Wort. »Mir müssen Sie das alles nicht erklären. Ich weiß, dass es viele gute Argumente gibt, die Ihre Arbeit und vor allem die Art, wie Sie Ihre Aufgaben erledigen, rechtfertigen.« Er machte eine Pause, sah an ihnen vorbei. »Aber darum geht es nicht.«
Back verstand. Jetzt verstand er. »Ah! Wir sind die Fleißpünktchen, nicht wahr?« Er lächelte kalt.
Teubner blickte ihn verständnislos an. »Was meinen Sie?«
»Na, die Fleißpünktchen. Im Schulheft. Sie erinnern sich doch?«
»Ich weiß nicht, worauf Sie hinauswollen.«
Back beugte sich nach vorn. »Ich wette, dass der Herr Innenminister oder sein geleckter Staatssekretär in nicht allzu ferner Zukunft vor die Presse treten werden, um zu verkünden, dass der Rechtsradikalismus in Bayern ein gar nicht mehr so furchtbar großes Problem sei.« Backs Stimme troff vor Ironie. »Weil nämlich so tolle Arbeit geleistet wurde. Und diese Arbeit sei so toll gewesen, dass man sogar die eine oder andere Gruppe auflösen und Steuergelder sparen könne. Unsere Gruppe zum Beispiel. Wir«, er zeigte der Reihe nach auf sich und seine Mitarbeiter, »sind die Fleißpünktchen, die sich die Herren Verantwortlichen in ihr Heftchen kleben. Damit man dem drögen Volk da draußen mal wieder klarmachen kann, wie patent unsere Regierung ist.« Back lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. »Und warum macht man das? Weil sich das Innenministerium in jüngster Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, wie wir alle wissen. Daher ist die Sache mit dem Bedarf scheißegal. Die Fleißpünktchen klebt sich der Herr Minister auch dann ins Heftchen, wenn morgen eine Kameradschaft das Rathaus abfackelt.«
Backs Mitarbeiter nickten nur verhalten. Nicht, weil sie anderer Meinung waren, sondern weil sie Angst hatten, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Umstrukturierung war eine Sache, den Job zu verlieren, eine andere.
Teubner schwieg. Back hatte recht. Natürlich hatte er recht. Die Zusammenhänge zu verstehen, war so schwer nicht. Und im Grunde hatte er nicht wirklich damit gerechnet, Back und seinen Leuten etwas vormachen zu können. Aber als Abteilungsleiter musste er die offizielle Lesart beibehalten. Natürlich.
»Es steht Ihnen frei, solche Schlüsse zu ziehen, Herr Back. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen wurden. Ich wollte Sie lediglich darüber in Kenntnis setzen, dass möglicherweise Veränderungen auf Sie zukommen werden. Wann, ob und in welcher Form das dann tatsächlich der Fall sein wird, werde ich Ihnen mitteilen, sobald ich selbst Genaueres dazu erfahre.«
Damit war die Besprechung zu Ende. Teubner nickte in die Runde, steckte seinen Bericht ein und wünschte allen einen schönen Abend. Wobei er nicht vergaß hinzuzusetzen, dass die Umstände das Schöne dieses Abends selbstverständlich relativierten. Auch in der Hinsicht verstand er seinen Job.
Back und die anderen blieben noch im Konferenzraum. Stefan Back beteiligte sich jedoch nicht an der entstehenden Diskussion. Er hörte nur zu, spielte mit dem Plastikbecher, dachte nach. Als Erster verabschiedete sich Hinrichs, dann Dorothea Bäuml und schließlich Winberger.
Um halb zehn war Stefan Back allein im Raum. Noch immer drehte er den Plastikbecher in seiner Hand. Und noch immer dachte er nach. Über die neue Wohnung, die Schwierigkeiten, die seine Frau hatte, einen Job zu finden, die Tatsache, dass Gentner schon sehr viel länger dabei war als er.
Ja, das alles hatte sich schon länger abgezeichnet.
*
Bartholomäus Kammerlander ließ seine Sporttasche neben die Kommode fallen, zog sich Schuhe und Jacke aus und ging in die Küche. Im Kühlschrank stand ein einsamer Orangensaft. Er holte die Flasche heraus und setzte sich damit an den Küchentisch. Drehte den Schraubverschluss ab, trank ein paar kräftige Schlucke und starrte leeren Blickes an die Wand.
Das Training war okay gewesen. Laufband, Bauchmuskeln und Oberkörper. Er fühlte sich angenehm erschöpft. Aber nur körperlich. In seinem Kopf hatte die Anspannung nicht nachgelassen. Insofern war das Training doch nicht okay gewesen. Er war ja in erster Linie hingefahren, damit sich die Wolke in seinem Hirn auflöste.
Hatte sie nicht getan. War eher noch dunkler geworden. Stellte sich die Frage, was er jetzt tun wollte.
Ins Bett gehen und schlafen war keine Lösung. Er würde so lange versuchen, nicht an das zu denken, was ihm im Kopf herumging, bis er schließlich aufstand und irgendetwas anderes machte, was ihn ablenkte. Konnte er gleich was anderes machen. Aber was? Schreiben? An Wiebkes Gedicht weiterarbeiten? Lesen? Dazu fehlte ihm jetzt die Geduld. Wahrscheinlich schmiss er irgendwann das Buch gegen die Wand. Fernsehen? Nein.
Bartholomäus nahm noch einen Schluck. Er spürte, wie sich der Missmut an ihn heranschlich. Dabei war es gar nicht der Missmut. Das sagte er sich nur, damit er hier nicht weiterdachte. Obwohl er gar nicht darüber nachdenken musste, weil er ja ganz genau wusste, was es war. Aber er wollte es nicht wissen, weil ihn das – ach, Scheiße! Warum hatte Kreuzpointner auch im Hotel auftauchen müssen!
Er musste etwas tun, irgendetwas. Ansonsten würde er hier sitzen bleiben und gegen die Wand starren, bis ihm der Schädel platzte. In Momenten wie diesem wünschte er sich bisweilen, dass er dem Saufen etwas abgewinnen könnte. Aber Saufen machte alles nur noch schlimmer. Das hatte er schon ausprobiert. Er war der Ich-häng-mich-auf-Typ, wenn er besoffen war, nicht der Ich-tanz-auf-dem Tisch-Typ.
Bartholomäus stand auf. Er musste raus hier. Am besten rüber ins Hotel, unter Leute. Für irgendetwas konnten sie ihn sicher gebrauchen.
Beim ersten Mal war Detlev Woyke, der Restaurantleiter im Alpenblick, noch aus allen Wolken gefallen. Und auch danach hatte es noch eine Zeit lang gedauert, bis man ihm sein Befremden zumindest nicht mehr ansah. Aber mittlerweile hatte er seinen Gleichmut wiedergefunden. Der Chef wollte mal wieder den Küchenjungen geben? Bitte sehr. Es war sein Hotel. Er konnte auch nackt am Klavier sitzen und Yesterday rülpsen, wenn ihm danach war. Wobei im Haus tatsächlich Gerüchte kursierten, dass …, aber Woyke hatte jetzt keine Zeit, über derlei Unsinn nachzudenken. Das Restaurant war bis auf den letzten Platz besetzt, die Gäste bestellten wie die Weltmeister, die Küche lief auf Hochtouren. Also husch, husch, an die Arbeit.
»Natürlich können Sie uns behilflich sein, Herr Kammerlander, sehr gerne.«
»Irgendein bestimmter Bereich?«
»An der Spüle haben sie im Moment alle Hände voll zu tun.«
»Gut.«
Woyke lächelte schmallippig und wandte sich wieder seinem Reservierungsbuch zu. So richtig geheuer war ihm die Sache dann doch noch nicht.
Bartholomäus machte sich auf den Weg durch das Restaurant Richtung Küche. Der Raum vibrierte von Stimmen und Geräuschen, ertrank in einem Meer von Gerüchen. Lichter spiegelten sich in Gläsern und dunklen Fenstern, sanfte Klaviertöne schwappten durch den Raum, Kellner und Kellnerinnen glitten schemenhaft an den Tischen vorbei, Gäste kamen, Gäste gingen.
Genau das war es, was er jetzt brauchte. Betriebsamkeit, Ablenkung, Menschen. Bartholomäus atmete leichter. Die Wolke wurde kleiner.
Wiebke war auch da. Sie ging von Tisch zu Tisch, unterhielt sich mit diesem, lachte mit jenem, beriet, teilte Komplimente aus, war Gastgeberin. Sie hatte Bartholomäus schon entdeckt, als er vorne bei Detlev Woyke gestanden hatte. Hatte bemerkt, dass er ihr nur mit den Lippen zulächelte, nicht mit den Augen. Hatte in dem Moment gewusst, dass er heute nicht hier war, weil es ihm Spaß machte.
Bartholomäus betrat die Küche durch die Schwingtür mit den beiden Bullaugen und ging hinüber zur Spüle. Er hängte sich eine der weißen Plastikschürzen um, zog sich die Gummihandschuhe an und schnappte sich den erstbesten Stoß dreckigen Geschirrs. Pavel und Herbert, die beiden Küchengehilfen, grinsten sich stumm zu.
Die Arbeit tat Bartholomäus gut. Essenreste entsorgen, Teller grob abwaschen, Spülmaschine einräumen, Spülmaschine ausräumen, Geschirr verstauen. Er hatte das Gefühl, dass mit jedem Rest Soße ein Stück seiner Wolke im Ausguss verschwand.
Plötzlich klirrte es hinter ihm. Bartholomäus drehte sich um. Ein zerbrochenes Glas lag am Boden.
Lisa, die junge und etwas schüchterne Kellnerin, erkannte ihren Chef und erschrak. »Entschuldigung. Mir ist …, ich bin gegen …«
»Ist schon gut, Lisa.«
»Ja. Entschuldigung.«
Lisa wollte sich bücken, um die Scherben aufzuheben, als Bartholomäus den Ausdruck in ihren Augen bemerkte. Verwirrt und ängstlich hatte sie zur Tür geblickt. Nicht zu ihm. Zur Tür.
»Lisa, alles in Ordnung?«
Lisa sah ihn flüchtig an und gleich wieder weg. »Ja, ja. Ist alles in Ordnung.« Ein völlig unglaubwürdiges Lächeln.
Bartholomäus stellte den Teller hin, den er gerade gespült hatte. »Lisa, was ist los?«
»Nichts, Chef. Wirklich nichts.«
In Bartholomäus keimte eine Ahnung. »Lisa, erzähl mir nichts. Ich seh’s doch. Was war?«
Lisa zögerte, knetete ihre Finger. »Der … der Gast an Tisch 17, ich bediene da heute. Und erst hat er mir seine Telefonnummer zugesteckt und dann …« Sie verstummte.
»Und dann?« Bartholomäus’ Blick verfinsterte sich.
»Es, ich mein, es war ja vielleicht nur Zufall …«
»Lisa! Und dann?«
Sie schluckte. »Dann … hat er mir … in den Po gekniffen.«
Bartholomäus nahm Lisa am Arm und schritt mit ihr Richtung Ausgang. Dort stieß er die Tür zum Restaurant auf und blieb stehen. Tisch 17. Da hinten.
»Wer?«, fragte er mit einem Gesicht aus Stein.
»Der da.« Lisa zeigte zaghaft auf einen vielleicht 50-jährigen Perückenträger. Übergewichtig, rot glänzendes Gesicht, fettige Finger. Genau der Typ Mann, den ein Mädchen wie Lisa unruhig werden ließ. Bartholomäus hatte ihn hier noch nie gesehen. Er ließ Lisa stehen und rauschte durch die Tische.
Vor dem Mann machte er Halt. »Sie sind fertig! Raus hier!« Seine Stimme schnitt wie ein Messer durch den Raum.
Der Mann hielt im Kauen inne, sah zur Seite und ließ einen amüsierten Blick an Bartholomäus hinabgleiten. »Bitte? Was war das eben?«
Bartholomäus packte ihn am Kragen und zog ihn vom Stuhl, der polternd nach hinten fiel. »Sie tatschen hier niemanden mehr an!«
»Bist du vollkommen …« Der Mann japste nach Luft, der Saal verstummte. Alle sahen zu ihnen her.
»Raus mit dir, Freundchen!«, sagte Bartholomäus ganz leise. Dann schleifte er den Mann mit einer Hand durch die Tischreihen.
»Was erlaubst du dir?«, krächzte die Perücke, die kaum die Füße auf den Boden brachte. »Ich will sofort mit deinem Chef sprechen! Sofort!«
»Mit meinem Chef?« Bartholomäus blieb abrupt stehen. »Kannst du haben.« Er drehte auf dem Absatz um und schleifte den Mann in die andere Richtung.
»Lass mich runter! Hilfe!«
Die Gäste machten bereitwillig Platz. Keiner wollte Bartholomäus und seiner zeternden Fracht im Weg sitzen. Zumal Bartholomäus nicht den Eindruck machte, als ließe er sich von irgendetwas aufhalten. Wie eine Dampframme walzte er durchs Restaurant, stieß die Tür zum Personalbereich auf, zog den Mann hinter sich den ganzen Flur entlang und machte erst vor seinem Büro halt.
»Was soll das? Wo sind wir?«