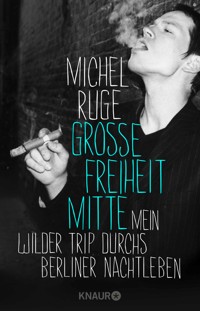9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Michel wird 1969 auf Sankt Pauli geboren. Der Vater: Zuhälter, abgehauen. Die Mutter: Blutjung, Kellnerin in einer Bar – oder so was. Seine Jugend ist wild. Den ersten Sex hat er mit 12 – in einem Bordell. Und kurz darauf geht es nicht um die Frage, ob er sich einer Gang anschließen sollte, sondern: welcher … Um Respekt geht es hier, auch um Männlichkeit und das Gefühl dazuzugehören. Und schließlich steht er vor der Kernfrage, auf die alles zuläuft: Werde ich Zuhälter oder nicht? "Bordsteinkönig" ist ein beeindruckendes und ungeschminktes Bekenntnis zur eigenen Herkunft. "So authentisch kann nur jemand schreiben, der dort war. Ich muss es wissen, denn ich bin noch da." Thomas »Karate Thommi« Born "Ein ehrlicher Einblick in den Alltag eines jugendlichen Gangmitglieds auf dem Hamburger Kiez, aber auch eine Hommage an das St. Pauli der 80er Jahre. Lesenswert!" Philipp Grütering, Deichkind
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Michael Ruge
Bordsteinkönig
Meine wilde Jugend auf St. Pauli
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Michel wird 1969 auf Sankt Pauli geboren. Der Vater: Zuhälter, abgehauen. Die Mutter: blutjung, Kellnerin in einer Bar – oder so was. Seine Jugend ist wild. Den ersten Sex hat er mit zwölf – in einem Bordell. Und kurz darauf geht es nicht um die Frage, ob er sich einer Gang anschließen sollte, sondern: welcher … Um Respekt geht es hier, auch um Männlichkeit und das Gefühl dazuzugehören. Und schließlich steht er vor der Kernfrage, auf die alles zuläuft: Werde ich Zuhälter oder nicht?
Bordsteinkönig ist ein beeindruckendes und ungeschminktes Bekenntnis zur eigenen Herkunft.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
1 En passant mit meiner Mutter
2 Kalle und Joschi haben im Betten Voss kellneriert. Meine Mutter, glaube ich, auch …
3 Ich pass nicht in meine Cousine rein!
4 Der Würger von St. Pauli
5 Kinder von St. Pauli!?
6 Allein zu zweit
7 Die Breakers lassen grüßen
8 Wladimir und der politische Untergrund
9 Halbe Stärke, großes Maul
10 Der Mülleimer war voll mit Kondomen, das Geschäft lief gut
11 Pimmel im Anker
12 Zigeuner-Fritz
13 Es muss klatschen, das Blut muss strömen
14 Glatzköppe klatschen
15 Heißkalt!
16 Der Wahnsinn wird endlich wahnsinniger!
17 Wer hat Angst vor Zuhältern?!
18 Wir sind die hungrigen Wölfe
19 Fließband oder Strich?
20 Raus aus der Gosse!
21 Schwester Heroin und der Tod
22 Das kalte Lächeln vom Kiez
23 Endlich ein Mann
24 Eine neue Welt
25 Ausflug an die Alster!
26 Geld
27 Die Geister, die ich rief
28 Wahnsinnigster Wahnsinn!
29 Fritz ohne Grenze
30 Die letzte Schlacht
Dank
Für Claudia
I still hang around
neither lost nor found
Hear the lonely sound
of music in the night
Nights are always bright
That’s all that’s left for me, yeah
I play the street life
Because there’s no place I can go
Street life, it’s the only life I know
Street life, and there’s a thousand parts to play
Street life, until you play your life away
Street Life,
Randy Crawford & The Crusaders (1979)
1 En passant mit meiner Mutter
Die Sonne schien. Keine Wolken. Ich lief. Die Schultasche schlug mir beim Laufen gegen den Oberschenkel. Ich hatte gute Laune. Immer, wenn ich in den Straßen von St. Pauli unterwegs war, hatte ich gute Laune. Der Himmel über mir, der Asphalt unter mir. Die Häuser, die Menschen, der Geruch: St. Pauli, meine Freiheit. Ich sah die Menschen an den Bus- und Bahnhaltestellen. Die traurigen Gesichter, in denen sich die Ödnis ihres Lebens festgeschrieben hatte, machten mir Angst. Angst, dass mir auch solch ein Leben drohen könnte. Morgens: aufstehen, dann malochen. Abends: vor dem Fernseher mit einem Bier, dann ins Bett. Am nächsten Morgen wieder derselbe Stuss. Das ganze Leben lang. Ab und an mit der Frau, die zum besten Freund geworden ist, Liebe machen. Bumsen, ficken, vögeln, wie auch immer. Den kümmerlichen Rest des animalischen Triebs, der sich in einem erhalten hat, heimlich im Dunklen ausleben. Leise, vorsichtig, allein. Am Wochenende geht man zum Fußball oder in die Kneipe an der Ecke und kommt besoffen nach Hause, legt sich in die Kiste, schläft. Wenn das Leben dann endlich in Windeseile an einem vorbeigelaufen ist, sind’s am Ende Verachtung und Krankheit, die einen am Leben halten. Erst wird man fett, dann zieht die Schwerkraft mit Gewalt alle Jugendlichkeit nach unten, wirft Falten und schreit: »Hier – ich bin’s! Ich hab gelitten, jahrelang! Ich arme Sau!« Bis endlich der Deckel zufällt. Dann wird’s dunkel; und das Einzige, was man bereut, ist, was man versäumt hat im Leben. Dass man sein Leben nicht angepackt hat, als man noch jung war. Als man noch hungrig war.
Mir drehte sich der Magen um bei diesen Gedanken, die mich überfielen, wenn ich die Leute beobachtete, die das sogenannte normale Leben ertrugen.
Ich kam an die Reeperbahn. Ein weißer Mercedes stoppte, keine Ahnung, was für ein Modell es war. Aber es war ein großer Mercedes. Ein großer Mercedes für große Jungs. Die Tür öffnete sich, und heraus trat ein hochgewachsener Typ mit Föhnwelle. Er trug eine rote Lederhose, dazu ein flatterndes weißes Hemd, das weit aufgeknöpft war, darüber ein schwarzes Jackett mit Schulterpolstern. Seine kräftigen Beine steckten in Wildlederstiefeln. Das offene Hemd gab den Blick auf eine kräftige, rotbraun gebrannte Brust frei. Eine goldene Cartier-Panzerkette schmückte den wulstigen Hals, klobige Goldringe zierten seine Finger, eine Sonnenbrille verbarg den Blick auf seine Augen. Unverkennbar ein Lude, ein großer Lude. Solche wie ihn sah man nur noch selten im St. Pauli der Achtziger. Mit weitaufgerissenen Augen stand ich da und beobachtete, wie dieser Lude über den Bordstein schwebte. Mit dieser unbeschreiblichen Leichtigkeit. Mit diesem gewinnenden Lächeln.
Damals musste keiner seine Muskeln mit Steroiden aufpumpen. Die Jungs, die was draufhatten, waren alle durch Kampfsport gestählt. Sie lebten die Lässigkeit. Sie waren nicht verbissen. Sie waren die Autorität auf der Bühne namens St. Pauli. Sie nahmen sich sogar selbst auf die Schippe, was ihr Selbstbewusstsein noch betonte. Alles war easy! Im Gegensatz zu der heutigen Gewaltfraktion auf dem Kiez mussten die Luden von früher keine Glatze tragen und ihre Tätowierungen am Hals präsentieren. Auch grölten sie nicht herum wie die Proleten. Man agierte souverän. Wenn man einen Tisch in einem Restaurant bestellte, reservierte man die Bedienung für den Abend gleich mit. Dafür bekam sie ein sehr gutes Trinkgeld. Natürlich wurde auch dem Türsteher mal ein Tausender in die Hand gedrückt. Dafür wurde dann der rote Teppich ausgerollt, wenn die Luden mit ihren Schlitten angerollt kamen. Jeder hatte was von dieser Show.
Schon früh eiferten wir den Luden nach. Wir trugen Jogginganzüge, weiße Boxerstiefel von Leone, Dauerwelle, Goldkettchen, dazu die obligatorischen Ray-Ban-Pilotenbrillen. Und natürlich Bomberjacken. Indianer Joe, ein Boutique-Besitzer auf der Reeperbahn, hatte sie für uns umgestylt und mit Lederapplikationen und Schulterpolstern versehen. So hingen wir auf der Reeperbahn ab.
Der Lude grüßte ein paar Typen, die ihm entgegenkamen. Ein Handschlag, ein kurzer Satz. Sein Mund verzog sich zu einem coolen, süßen Lächeln. Ich hatte mir schon als Kind gerne diese charismatischen Männer mit ihren Rolls-Royces, Ferraris oder Porsches angeschaut. Für mich waren sie die wahren Abenteurer und Gewinner auf St. Pauli. Nun stand ich da und kam mir wieder vor wie der kleine Butsche, der sich nichts sehnlicher wünschte, als ein Lude zu werden. Mir gefielen die Rolex, die Maßanzüge, wie sich die Luden mit Gold und Diamanten schmückten, um zu betonen, dass sie wichtig und erfolgreich waren, dass sie aus einer anderen Welt stammten. Eine Welt, die für die Soliden unerreichbar schien. Wenn etwa der Schöne Klaus mit seinem Lamborghini durch dem Kiez fuhr, dann war der Kiez seine Bühne. Klaus schwebte geschmeidig-kraftvoll das Kopfsteinpflaster entlang, hinter ihm geheimnisumwoben und stolz seine Frauen, mit unglaublich langen Beinen und die aufregenden Körper in teure Pelze gehüllt. Ich auch! Haben wollen, dachte ich damals. Die Lakaien hielten respektvoll Abstand zu ihrem Boss. Dann kamen seine Freunde auf ihn zu. »Karate« Tommy und wie sie alle hießen. Mit Küsschen hier und Küsschen da und allerlei Trubel begrüßte man sich, die Passanten guckten und staunten. Es war ein Schauspiel, ein Spektakel, das den Zuschauern den Atem raubte. Mir auch.
Ich sah die glitzernde, schillernde Welt von St. Pauli, die Lichter, den Glamour, das Abenteuer, und mir war klar, was ich wollte. Ich lief und ich kam pünktlich in der Schule an, ausnahmsweise. War ja auch Montag. Ich fühlte mich frisch und ausgeschlafen. Ich hatte die Hoffnung, dass die Schule vielleicht doch spannend sein könnte. Am Wochenende hatte ich alles Schlechte über die vergangene Schulwoche vergessen. Meine Mitschüler waren schon da. Der Lehrer noch nicht. Sobald ich die Klasse betrat, fiel mir wieder alles ein – all das Schlechte. Es stank. Nach Schulbroten in Plastikdosen, in denen die eingesperrte Luft zu stinken begann, von der schwitzenden Wurst, von dem schwitzenden Käse. Es stank nach billigen Holzmöbeln, nach Langeweile, nach Kleinkariertem, nach Spießern, nach Furzen. Es stank nach Siechen, nach Tod. Es widerte mich an. Ich setzte mich auf meinen Platz und versuchte, mich wegzudenken.
St. Pauli war mein Zuhause. Mit zwölf hatte ich dort das erste Mal Sex mit einer Nutte. Mit vierzehn wurden Schlägereien mein täglich Brot. In den Achtzigern gehörte ich den Gangs von St. Pauli an. Wir schlugen uns mit Skins, Poppern und Mods. In unseren Bomberjacken und Leone-Boxerstiefeln von Crazy Jeans zogen wir durch den Kiez. Sechzig Mann, eine Armee – die Straßen gehörten uns. Die Gangs waren eine eigene Subkultur, heute vollkommen in Vergessenheit geraten. Wir waren eine Bruderschaft, kamen uns vor wie die Warriors aus dem gleichnamigen Film, hatten ein starkes Gefühl für Autorität und Macht. Aber auch wir waren Underdogs – wie die Punks –, auch wir waren gegen das Establishment, gegen die Spießer und die Kleinbürger, die einem die Luft zum Atmen rauben. St. Pauli war unser Abenteuerspielplatz und der Ort, wo unsere Träume und Sehnsüchte tanzten. Doch in den Achtzigern veränderte sich unsere Welt. Die Drogen kamen nach St. Pauli, Aids lähmte das Rotlichtgewerbe, es kamen die Waffen, die Morde. Der Kiez geriet auf die schiefe Bahn. Die Grenzen verschoben sich. Die Menschen veränderten sich. Wie Zigeuner-Fritz, mein bester Freund, der voller prallem, geilem Leben steckte. Mit Fritz war ich unterwegs. Wir wollten Männer werden. Männer, die sich schlagen, lieben und die frei sind. Fritz aber wurde irgendwann zum Terrier. »Haltet mich endlich zurück. Haltet mich fest«, schrie er mir bei einem Streit zu, damit ich ihn zurückhielt. Wenn es dann eskalierte, klatschte es zweimal. Einmal im Gesicht und einmal auf’m Asphalt. Zickzack!
Ohne Grenzen spürt man sich nicht. Ohne Grenze spürt man nicht, dass man lebt. Wir wollten Grenzen verschieben, über die Grenzen hinaus, bis keine Grenze mehr zu sehen war und wir mitten im Nichts, haltlos, ohne Horizont, schwindelig, ohne Ziel neue Grenzen suchten. Damals veränderte sich alles auf St. Pauli. Der Kiez wurde wahnsinniger, der Wahnsinn wurde wahnsinniger. Was aber blieb: Der Kiez war eine eigene Welt, mit eigenen Gesetzen. Und ich war ein Kind dieser Welt. Dies ist die Geschichte dieser Welt. Es ist meine Geschichte.
Vor einer Stunde war ich noch auf der Reeperbahn gewesen. Jetzt saß ich in dieser toten Zone, in diesem hohlen, sehnsuchtsfernen Schulraum. Ich hatte noch den Geruch von Pisse, Kotze und Currywurst in der Nase. Und den geilen, süßen Geruch von Parfum, Sex und Frauen. Mein Geist war noch auf’m Kiez. Dann schockte das grelle Licht der Neonröhren im Klassenzimmer mein Bewusstsein. Ich war wieder in der Hölle.
Ich schaute an mir runter. Meine zu enge Jeans stand vor Dreck. Meine Beine kribbelten vor Nervosität und Ungeduld. Ich war dünn, hatte nie wirklich Zeit zu essen. Fürs Kacken hatte ich auch keine Zeit. Wenn ich auf der Toilette saß, hatte ich immer das Gefühl, etwas zu verpassen. Keine Zeit! Der Kiez war spannender. Ich wollte raus, etwas erleben. Immer trieb es mich raus. RAUS! Dieses Gefühl brannte in mir. Wie ein Hunger, den ich nie stillen konnte. Sosehr ich das Leben auch in mich hineinschaufelte und es hinunterschlang, dieses geile, pralle Leben. Leben will sich verschwenden. Ich wollte mich verschwenden!
Der Lehrer kam rein. Frustriert, blass, ohne Haltung, lustlos, ein nervöser Waschlappen. Ein Spießer! Er war voller Verachtung für uns Kinder aus den sozial niederen Schichten. Er knallte seine Tasche auf den Tisch, und bevor er was sagte, ließ der Stress seinen Kopf rot aufleuchten. Wir waren die Geier an seinen sterbenden Nerven. Wir warteten und beobachteten. Unser Tag würde kommen!
Fünfundvierzig Minuten auf einem Holzstuhl sitzen. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist gegen alle Natur. Gegen alle Kraft. Gegen alle Liebe. Ich schaute aus dem Fenster. Blauer Himmel. Ich blickte zur Reeperbahn hinüber, wo ich mich seit meiner Kindheit herumtrieb. St. Pauli war mein Abenteuerspielplatz. Der Kiez war immer schon ein Ort gewesen, der im Handumdrehen Sehnsüchte und Träume erschuf, nur um sie im nächsten Augenblick zum Platzen zu bringen. Er war ein Ort, wo das pralle Leben gärte und brodelte. Ich dachte an den Kiez, an meinen Kiez. Ich wollte kämpfen. Ich wollte schreien, lachen, weinen, ficken. Ich wollte leben!
Ich blickte nach vorne. Ich sah volles braunes Haar. Ich sah Claudia Meyer! Sie war der Grund, weshalb ich in die Schule kam. Nur für sie! Der Nachname war eine Finte. Claudia war alles, nur nicht langweilig. Sie war nicht meyer. Sie war das blühende Leben, sie war schon damals ein Star. Sie war keine klassische Schönheit. Sie war ein Junge in einem Mädchenkörper, aber sie war äußerst attraktiv. Und sie hatte dieses gewisse Etwas. Ein Blick, eine Bewegung – und man war ihr verfallen. Ich war ihr verfallen. Claudia hatte Sommersprossen. Ihre Augen strahlten blau. Mit ihren zwölf Jahren bewegte sie sich schon besser als die meisten Frauen auf dem Kiez. Sie tanzte durch die Straßen, sie schwebte über den Boden. Wenn sich ihre schönen Beine beim Gehen geschmeidig aneinanderrieben und sie verstohlen auf den Boden blickte, wenn sie mich im Vorbeigehen ansah und verschmitzt grinste, blieb mein Herz stehen. Claudia, meine heimliche Liebe.
Ich lernte Claudia schon sehr viel früher kennen. Bevor ich in die Schule ging. Als die Schule mich noch nicht gepackt hatte mit ihren gierigen Klauen. Da begann mein Leben, vor der Schule, wie bei jedem – und doch ganz anders.
Das war 1969.
2 Kalle und Joschi haben im Betten Voss kellneriert. Meine Mutter, glaube ich, auch …
Meine Mutter war sechzehn. Ihre Klamotten waren eng und knapp. Langes, volles schwarzes Haar. Lange Beine. Lange Lederstiefel. Nur der Rock und ihre Kindheit waren kurz. Sie lebte im Eiltempo. Sie ging mit Günther Kaufmann und Mario Amtmann in eine Klasse. Kaufmann wurde Schauspieler bei Fassbinder. Amtmann wurde Rocker und gründete die Hells Angels in Deutschland. Beide machten Karriere, jeder auf seine Weise. Auch meine Mutter machte Karriere. Sie wurde die Ruth von der Feuerbachstraße. Weil meine Oma mit all den Widerworten nicht klarkam, steckte irgendwann eine Gabel im Rücken meiner Mutter. Danach ging es schnurstracks ab in ein berüchtigtes Heim für Schwererziehbare. Ein Paradies für die Schwersten unter den Schwererziehbaren.
Nachts rückten sie regelmäßig aus – und meine Mutter war dabei. Sie wollte das Erwachsenenspiel lernen – schnell, zügig, zack, zack. Mit dreizehn war es endlich so weit. Sie spielte das Spiel, das sie so liebte seitdem. Von da an war auch für sie St. Pauli ein Abenteuerspielplatz. Mit ihrer Schwägerin Mona ging’s auf’n Swutsch. Tanzen. Auf die Reeperbahn oder ins Schanzenviertel, ins Ballhaus in der Flora auf dem Schulterblatt. Dort lernte sie einen ausgesprochen charmanten, gutaussehenden Mann kennen: Heinz Peter, meinen Vater. Der war zwar erst 32, hatte aber schon eine beachtliche Karriere hingelegt. Er war Bordellbesitzer, dreifacher. Das klingt in meinen Ohren wie dreifacher Weltmeister im Schwergewicht – nur besser. Es muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein, und weil es beide – wohl aus Karrieregründen – sehr eilig hatten, fuhren sie zu Mona und machten das Erwachsenenspiel.
Die beiden kannten sich zwar erst ein paar Stunden, aber das reichte mir, um mich bei meiner Mutter einzunisten. Ich war also ein Kind der Liebe. Meine Mutter, die Ruth von der Feuerbachstraße, war erst siebzehn, als sie mich mit aller Gewalt aus ihrem Körper presste. Sie wollte mich loswerden. Man riet ihr: Du bist zu jung. Gib ihn zu vornehmen Eltern. Doch als ich auf ihrem Bauch lag, da sagte sie: »Das kann man doch nicht machen! Das macht man nicht!« Ich hab sie ausgetrickst. Ich tat so, als könnte ich nicht alleine. Also blieben wir zusammen, und meine Mutter suchte einen Namen für mich. Den hatte sie schnell gefunden: Michel. Aber nicht nach dem Hamburger Michel. Meine Mutter liebte die französischen Filmstars der Sechziger, deshalb wird mein Name französisch ausgesprochen. Mit siebzehn ist man anfällig für große Bilder, für große Sehnsüchte. Besonders die französischen scheinen in den eigenen Träumen zu glitzern wie Brillanten. Das Französische war die Sehnsucht meiner Mutter nach einem anderen Leben, nach einem anderen Ich. Sie wünschte sich, dass ich nicht so ein Leben hätte, wie sie es führte. Ich sollte nicht in der schattigen Halbwelt von St. Pauli wohnen und arbeiten. In dieser Welt wird man ohne das rechte Glück und eigene Stärke zum Gefangenen seiner Umgebung, seiner eigenen Schwächen und Sehnsüchte. So legte mir meine Mutter die Sehnsucht nach einem anderen Leben also schon ins Nest: MICHEL!
Die Geburt war das intimste Erlebnis, das ich mit meiner Mutter haben sollte. Danach entfernten wir uns rasch voneinander. Wir hatten keine Zeit zu verlieren. Sie mit ihrer Karriere, ich mit meiner. Ich war meinem Vater im Wesen und Aussehen zu ähnlich, als dass meine Mutter mich hätte bedingungslos lieben können.
Mein Vater verdiente vierzig- bis fünfzigtausend Mark im Monat. In den frühen Siebzigern war das Geschäft mit der Liebe prall und reich. Es war der historische Orgasmus des liegenden Gewerbes. St. Pauli glühte und glänzte. Doch meine Mutter verdiente erst mal nichts. Deswegen musste ich zunächst sechs Monate im Krankenhaus bleiben. Dann holte meine Oma uns zu sich ins Hotel. In den »Budapester Hof«. Ein Stundenhotel. Die nächste Zeit meines jungen Lebens verbrachte ich im Heizungskeller des Hotels. Wie zur gleichen Zeit die RAF, ich ging in den Untergrund.
An der Ecke des Hotels gab es eine Kneipe namens »Voss«, damals bekannt als Betten Voss. Durch einen Gang waren Betten Voss und das Hotel miteinander verbunden. Es kam ja vor, dass die Kneipengäste müde wurden, ein Nickerchen halten wollten oder aus irgendeinem anderen Grund, den ich nicht kannte, ins Bett mussten. Dann konnten sie durch diesen Gang schnell das Hotel erreichen. Tatsächlich erinnere ich mich noch, wie ich hinten in der Küche vom Betten Voss gewickelt wurde, von Martha, einer Putzfrau.
Im Betten Voss war es lustig. Morgens war es dort bereits rummsvoll. Da gab es die »Christel von der Post« und »Linchen«, die für ’n Korn ihren Rock hochzog, um zu zeigen, dass sie keine Unterwäsche trug. Beide waren schon damals über siebzig und beide tanzten noch immer jeden Tag im Betten Voss auf den Tischen. Es gab eine Frau, die alle nur »Kommpott Hüttchen« nannten. Die ging mit den Männern immer aufs Zimmer. Dann gab es noch eine andere Ruth. Die war auf einmal nicht mehr da, von heute auf morgen verschwunden, weg. Später hat man sie dann gefunden. Bei Honka, dem Frauenmörder, der auch Stammgast im Betten Voss war. Honka hatte Ruth eingemauert. Niemand hat nach Ruth gesucht oder sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Erst als ein halbes Jahr später in Honkas Haus ein Feuer ausbrach, fand man die Leiche.
Es trieben sich eine Menge komischer Leute im Betten Voss herum. Zum Beispiel der Besitzer der »Köllnflocken«-Werke. Er kam jedes Wochenende; und weil sein Geld so schön locker flockig in seiner Tasche lag, nannte man ihn die »Goldflocke«. Oder »Vossi, der Millionendieb«. Bei ihm kaufte meine Oma für Mona und meine Mutter immer die schönsten Sachen: Pelze, Lederjacken, Schmuck und alles, was Vossi sonst noch so in den Villen von Blankenese fand. Der reinste Basar im Betten Voss. Vossi bot meiner Oma immer alles zuerst an. Es war eine lustige Welt, und sie gefiel mir. Ich lief den Erwachsenen durch die Beine, auf dem Holzfußboden und unter den Rauchschwaden herum, von der Jukebox bis hinter den Tresen und zurück. Alle kannten mich. Ich war eine Berühmtheit auf’m Kiez.
Joschi kellnerierte im Voss, Kalle kellnerierte dort, und meine Mutter, die kellnerierte dort, glaube ich, auch. Sie war jedenfalls immer im Betten Voss. Kalle war der stärkste von allen Kellnern. Wenn der wütend war, dann konnte er in kürzester Zeit (er hatte es wohl auch immer eilig – aus Karrieregründen), den ganzen Laden kurz und klein hauen. Das ging ganz schnell und wech damit. Dann sagte keiner mehr was. Für Widerworte gab’s was aufs Maul. Ganz direkt. Und weil meine Mutter sich beschützt fühlen wollte, verliebte sie sich in den starken Kalle. Mein neuer Vater war nicht besonders groß, 1,75 nur. Aber er war schnell mit den Fäusten, ein ehemaliger Boxer ohne Angst und manchmal auch ohne Selbstkontrolle. Ein Straßenkeiler und Einzelkämpfer aus Passion. Ein sportlicher Showtyp, der sich nach außen immer lustig gab. Aber Kalle war auch jähzornig, er hatte eine ständige Wut auf die Welt. Es brodelte in ihm, da war irgendwas mit seiner Hormon-Adrenalin-Mischung nicht in Ordnung. Die Mischung war gefährlicher als Nitroglyzerin. Kalle war ein Kind des Krieges. Aufgewachsen zwischen Lügen, Selbstbetrug, Tod und Zerstörung, aufgebracht von einer kalten, gewaltbereiten, dem Untergang geweihten Gesellschaft. Friss oder stirb! Kämpf oder stirb! Kalle lebte, wie er es von klein auf gelernt hatte. Mit Gewalt kannte sich Kalle aus – er war ein starker Krieger! Gegen alle!
Irgendwann verließen meine Mutter und ich den Untergrund im Budapester Hof und wir zogen in die Hein-Hoyer-Straße. Zunächst wohnten wir dort zusammen mit Picco und einer Bardame aus einer Oben-ohne-Bar. Picco war ein lustiger Mitbewohner. Er konnte die Stimme von Mickymaus nachmachen und brachte mich immer zum Lachen. Viel, viel später schrieb man auf St. Pauli sogar ein Musical über ihn.
Um ihren Kalle öfter sehen zu können, arbeitete meine Mutter im Betten Voss immer in derselben Schicht wie er. Das klappte so gut, dass beide beschlossen zusammenzuziehen.
Kalle, meine Mutter und ich zogen also in den Alten Steinweg 25. Unser Haus befand sich direkt am Großneumarkt, wo Pimmel (er hieß so, weil er, wenn er besoffen war – also immer – seinen Pimmel rausholte) den »Anker« hatte. Damals war es noch eine richtige Hafengegend. Dort trieben sich Hafenarbeiter, Seeleute und Ganoven herum. Es wurde getanzt, gelacht, geschrien, geliebt und geschlagen, wild und heftig. Nur eins tat man nicht: die Polizei rufen. »Das macht man nicht!«, erklärte mir meine Mutter. Nur einmal erlebte ich, dass jemand sich freiwillig an die Polizei wandte. Komischerweise war es meine Mutter. Eines Abends kam Kalle nach Hause. Er war sauer, er war im Krieg, so wie immer. Er brodelte, er explodierte. Er schlug die Küche in alle Einzelteile, schnell und akkurat. Mann, war der stark. Meine Mutter liebte Kalles Stärke, aber in diesem Moment war sie ihr wohl nicht ganz geheuer. Denn sie packte mich und lief im Pyjama mit mir hinüber zur Wache am Großneumarkt.
»Na, der beruhigt sich schon wieder«, raunte der massige Polizist auf der Wache meiner aufgebrachten Mutter entgegen. »Sollen wir mal mit rüberkommen?« Es waren andere Zeiten. Die Atmosphäre war etwas rauher, in den Kneipen und zu Hause. Frauen wurden ab und an geschlagen. Es war eine Zeit, in der Körperlichkeit und Kraft für die Männer noch eine ganz andere Bedeutung hatten. Vor allem auf St. Pauli.
Als wir schließlich mitsamt der Polizei in der Wohnung ankamen, lag Kalle im Bett und machte ’n Nickerchen. »Sehen Sie«, sagte der Beamte, »kein Grund zur Sorge. Ist doch alles im Lack.« Für mich hatte die ganze Geschichte vor allem Auswirkungen auf meinen Wortschatz. Immer dann, wenn Kalle mal wieder laut wurde, rief ich: »Ich polimonier die Polizei.« Das sollte heißen: »Ich rufe die Polizei.«
So entwickelte ich schon früh einen ausgeprägten Beschützerinstinkt, der für das Leben auf St. Pauli angemessen war.
3 Ich pass nicht in meine Cousine rein!
Der Budapester Hof hat mich nie richtig losgelassen. Als Kind spielte ich dort jeden Tag in den Gängen und Zimmern, deren Türen offen standen wie die Türchen an einem alten Adventskalender. Meine Oma lebte im Hotel. Sie war die Seele unserer Familie, eine starke, großherzige, lustige, lebenstüchtige Frau, die noch ihr letztes Hemd hergegeben hätte für uns. Während des Kriegs saß sie mal im Gefängnis, weil sie Essen besorgen wollte für ihre Familie. Ihre vier Kinder waren von vier verschiedenen Männern. Der Vater meiner Mutter war ein echter Steuermann und Seefahrer. Er war nur kurz mit meiner Oma zusammen gewesen. Später, da war ich so fünf Jahre alt, haben wir ihn mal besucht. Er war schon dement. Meinen Namen wusste er nicht mehr. Auch seine Tochter erkannte er nicht mehr. Stattdessen hat er versucht, sie anzubaggern. Geil war er noch, der alte Seemann. In jedem Hafen eine Braut, dachte er wohl.
Der Opa, den ich »Opa« nannte, war Salvatore, ein Sizilianer, der in den Sechzigern nach Hamburg gekommen war und der zeit seines Lebens nur gebrochenes Deutsch mit starkem italienischem Akzent sprach. »Allo, wasse due make, eeee?« Oder: »Bisse due varrukte? Diä A-uto viele zu teure, eee!?« Die Männer meiner Oma wechselten, aber Salvatore blieb. Er war ein großer, kräftiger Mann, der schöne Anzüge trug und riesige Segelohren hatte. Salvatore war das geborene Schlitzohr, und dafür liebte ich ihn als kleiner Butsche. Von ihm habe ich wohl mein Faible für das Luxuszeugs, für gute Klamotten, schöne Taschen, teuren Glitzerschmuck. Meine Eitelkeit und der Hang zur Promiskuität kommen von meiner Oma.
Es gab so viel zu entdecken im Budapester Hof, und es roch so süß, so geheimnisvoll nach Abenteuer. Vorn im Betten Voss hab ich immer beobachten können, dass Männer gern mit Frauen reden, und dass andere Männer dann nicht reinquatschen sollten. Nur ich durfte immer Quatsch machen, auch wenn Joschi, Kalle, Heiner oder sonst wer mit einer Frau redete.
Kurz nachdem wir aus dem Heizungskeller ausgezogen waren, eröffnete im Budapester Hof jemand einen Nachtclub. Das »Kit Kat«. Alle waren aufgeregt. Jeder wollte zur Eröffnung. Der ganze Kiez. Die Luden, die großen Mädchen, alle! Dann war es so weit. Auch ich war aufgeregt und konnte nicht schlafen, weshalb ich mit zur Eröffnung durfte. Es war laut, rauchig und dunkel. Aber ich konnte genau erkennen, dass meine Mutter mit dem Mann aus dem Fernsehen redete. Rudi Carrell war extra zur Eröffnung auf den Kiez gekommen, oder war er wegen meine Mutter da? Es machte fast den Anschein, denn die beiden redeten die ganze Zeit miteinander.
Mir war die Musik im Kit Kat bald viel zu laut, und die Großen hatten anderes im Sinn, als mit mir zu spielen. Also machte ich mich auf in den Heizungskeller – wo ich mich ja bestens auskannte – und schlief ein. Morgens, als alle nach Hause gegangen waren, fand meine Oma mich. Sie behielt mich gleich das ganze Wochenende bei sich. Von da an war ich jedes Wochenende bei ihr. Von Freitag- bis Sonntagabend – meine Mutter hatte eine Sorge weniger.
Ich durfte alles bei meiner Oma. Essen, wann ich wollte, Musik hören und fernsehen. Samstags versammelten sich meine Mutter und ich, Onkel Peter mit seiner Frau Mona und deren Töchter Nicole und Yvonne bei Oma. Nicole und Yvonne waren ungefähr so alt wie ich. Nicht jedes, aber fast jedes Wochenende durfte Yvonne auch dort übernachten. Wir schliefen zusammen auf der Couch, im Wohnzimmer. Weil meine Oma um eins in der Nacht runter zur Nachschicht an der Rezeption musste, legte sie sich schon am späten Nachmittag ins Bett und schlief. Für uns bedeutete das quasi sturmfreie Bude.
Das ganze Hotel roch nach den Großen, nach diesem unbeschreiblich Süßen, nach diesem Verbotenen, das so irre wichtig schien für die Erwachsenen und das vor uns verborgen wurde. Niemand sprach jemals darüber, aber es hing in der Luft. Im ganzen Viertel und vor allem im Hotel nahm ich den süßlichen Geruch wahr. Er steckte in jeder Ecke, in jedem Winkel, in jeder Ritze von St. Pauli. Yvonne roch auch so. Immer, wenn wir die Pyjamas anzogen, konnte ich ihn ganz deutlich riechen – diesen süßlichen Geruch. Ich sog ihn mit der ganzen Kraft meiner Lungenflügel ein und hielt die Luft an, als hätte ich gerade dieses süße, blonde, blauäugige Ding da vor mir eingeatmet. Ich war verliebt. Glatte, dünne, blonde Haare und strahlend blaue Augen. Zarte, leicht gebräunte Haut, mit etwas Flaum bedeckt. Sie war so schön, so edel.
Irgendwann durchwühlte ich vor lauter Langeweile die Schränke meiner Eltern und entdeckte Unglaubliches! Wahre Schätze an Büchern mit Fotos von diesem geheimnisvollen Spiel der Erwachsenen. Sie lutschten und leckten sich überall. Spielten mit Bällen und Bananen. Küssten sich, und manchmal hatten sich ganz viele auf einmal lieb. Es war das Paradies. Das musste die wahre Liebe sein!
Als ich wieder einmal allein mit Yvonne bei meiner Oma war, erzählte ich ihr davon. Ich saß vor ihr und atmete den Geruch, der aus ihrer Pyjamahose kam, immer wieder ganz tief ein, bis mir schwindelig wurde. »Wollen wir das mal ausprobieren?«, fragte sie, als ginge es um eine neue Sorte Lakritz.
Langsam ging ich zur Schlafzimmertür, hinter der Oma schlief. Sie machte die Tür nie ganz zu, so dass sie hören konnte, was wir machten. Alles war still. Sie schnarchte leise. Vorsichtig drückte ich den Türgriff hinunter und zog die Tür ganz langsam ran, um sicherzugehen, dass sie nicht hören konnte, was im Nebenzimmer abging. Dann drehte ich mich zu Yvonne und sagte: »Okay.«
Wir zogen uns aus, ganz langsam und behutsam. Dann streichelte ich ihre samtene Haut – endlich. Überall dort, wo ich sie streichelte, stellten sich ihre Härchen auf und wehten wie Gräser im Wind. Ich konnte ihr kleines Herz durch ihre flache Brust spüren. Bei jedem Herzschlag bebte ihr ganzer Körper. Vollkommen, nackt, rein – und dieser unbeschreiblich süße Duft. Ich sog sie auf. Ich wollte sie in mir haben. Wir küssten uns, und ich spürte ihre warme kleine Mädchenzunge. Es war die reinste Offenbarung. Es war, als wäre sie ich und ich sie. Ich streichelte sie, und meine Hand fuhr über ihren Venushügel, zu ihren kleinen Schamlippen, hinunter in ihre warme, feuchte Öffnung. Meine Finger verströmten ihr Aroma. Ich leckte meine Finger ab. Ich machte alles genauso, wie ich es in den Büchern studiert hatte. Ich öffnete ihre Schenkel. Mein Penis musste in ihre Öffnung, das war mir klar. Genau dafür war sie gemacht. Plötzlich ein Geräusch. Wir erstarrten wie Kaninchen im Lichtkegel eines Autos. Minutenlang. Wir warteten ab. Nichts geschah, kein Geräusch mehr. Es ging weiter. Ich presste meinen Unterleib an ihren. Ich presste und presste, sie sah mich an. »Mach!« Wie schön ein einziges Wort sein kann, dachte ich. »Mach!«, wiederholte sie.
Ich presste immer weiter, bis ich mir ihre Öffnung genau ansah. Ganz nah war ich ihren Schamlippen – und überlegte, wo denn da der Eingang war. Ihr Geruch raubte mir tatsächlich alle Sinne. Doch ich wollte mehr. Mit den Fingern fuhr ich langsam zwischen ihre Schamlippen und war erstaunt, wie rosa diese Spalte war. Ich guckte und guckte, und mir war klar: Michel! Da musst du rein!
Ich nahm meinen Schwanz und versuchte ihn hineinzudrücken. Aber er war zu weich und zu klein. Er war schlaff. Ich schwitzte. Ich wurde nervös. Mir schossen Tränen in die Augen. »Ich pass da nicht rein«, schrie ich. »Ich pass da nicht rein.«
»Was???«, hallte es plötzlich aus dem Schlafzimmer. Yvonne und ich prusteten los, wir konnten nicht mehr aufhören. Wir mussten lachten. »Macht da keinen Unsinn, ihr beiden«, schrie meine Oma im Halbschlaf. Wir schauten uns an. Wir lachten, lagen nackt nebeneinander, und wir schauten uns in die Augen. Dieses Spiel der Erwachsenen, das Rein-raus-Spiel, das völlige Verschmelzen, das Alles-miteinander-Wollen, das Sich-Hingeben bis zur absoluten Glückseligkeit – das wollte ich. Mir war klargeworden: Das war alles, worum es im Leben ging.
4 Der Würger von St. Pauli
In den frühen Achtzigern begann das pralle Leben. Ich war jung, ich war neugierig, ich wollte Abenteuer. Die Straßen von St. Pauli waren mein Zuhause, meine Freiheit. Ich lebte auf der Straße, mehr oder weniger. Verwahrlost, ja, das ist das Wort, das mir einfällt, wenn ich heute an die Zeit denke. Damals wäre mir das nie über die Lippen gekommen. Aber es stimmte.
Die Wohnung meiner Mutter war nicht mein Zuhause. Ständig herrschte dicke Luft. Kalle war wütend und meine Mutter hilflos, unsicher, verloren. Geborgenheit gab es dort für mich nicht. Meinen Eltern war es egal, wer meine Freunde waren, wie es in der Schule lief, was ich in meiner freien Zeit trieb, was mir durch den Kopf ging. Stattdessen: Kalle war ein Meister darin, alles schlechtzureden. Als ich Gitarre lernen wollte, lächelte er nur darüber. Jemand hatte mir eine kaputte Gitarre geschenkt, die ich in eine Werkstatt brachte. Doch Kalle machte sich jeden Tag so sehr darüber lustig, dass ich mich letztlich für meinen Wunsch schämte und die Gitarre nicht abholte.
Zweimal im Jahr machten meine Eltern Urlaub, meist in Österreich oder Bayern. Aber ohne mich. Doch was andere als fehlende Fürsorge bezeichnen würden, war für mich die große Freiheit. Alleine, mein Ding durchziehen. Das war Urlaub!
Die Schule war ein fremder Raum für mich. Sie war ein Gefängnis, in dem man nichts fürs Leben auf der Straße lernte. Wenn ich mit der Morgenlatte, die verzweifelt versuchte, sich einen Weg durch meine Jeans ins Freie zu bahnen, im Unterricht saß, hatte ich die ganze Zeit dasselbe im Kopf wie mein Pimmel: raus hier! Nach der letzten Stunde rannte ich los – der Himmel über mir, der Wind im Gesicht.
Ich war ein sehr mittelmäßiger Schüler. Hausaufgaben machte ich nie (wo hätte ich die Zeit hernehmen sollen?), was irgendwann auch den Lehrern klar zu sein schien. Zu Hause kontrollierte eh niemand, ob ich lernte oder nicht. Anfangs hatte ich mich noch auf die Schule gefreut, aber schon bald merkte ich, dass sie mich nicht interessierte. Mich interessierte das Leben auf St. Pauli. Nicht irgendein unnützes Wissen. Die Leute im Kiez schlugen sich durchs Leben, sie arbeiteten irgendwas, drehten irgendwas. Nichts davon stand auf dem Lehrplan. Und für das, was ich werden wollte, brauchte ich weder Differenzialrechnung noch eine Ahnung von den Punischen Kriegen. Ich wollte Zuhälter oder Ganove werden. Das waren glamouröse Jobs. So stellte ich mir das als kleiner Junge zumindest vor. Die Luden führten ein tolles Leben. Sie trugen teure Anzüge, waren wie italienische Gigolos behangen mit Rolex, Goldketten und Ringen. Sie hatten lange, lockige Haare und immer ein paar tausend in der Tasche. Sie bestimmten, wo es langging.
Aber ab und zu ließ ich mich doch in der Schule blicken. Bei den Normalbürgern. Denn für die war die Schule. Dort wurden die Normalbürger auf ihr normales Leben vorbereitet. Jungs wie ich lernten auf der Straße. Das Leben war unsere Schule. Für den Normalbürger waren wir Underdogs. Das aber gefiel mir. So wollte ich gesehen werden: ein Underdog. Ich wollte anders sein. Dafür war ich bereit zu kämpfen.
Nur der Sportunterricht in der riesigen Halle machte mir zuweilen Spaß. Meine stinkenden Socken, die ich seit Tagen trug, meine schon ewig ungewaschenen Sportsachen – das hielt mich nicht davon ab, zumindest hin und wieder zum Sport zu gehen. Es war die Zeit von Ronald Reagan, von Rambo und von den Grünen. Es war die große Zeit der Underdogs, der Einzelkämpfer, der Helden, die sich gegen das System auflehnten und dann später selber zum System wurden. In dieser Zeit wurde ich groß. Aber bis auf Rambo ging mir der ganze Kram am Arsch vorbei.
Als ich zehn Jahre alt war, kam ich auf die Bruno-Tesch-Gesamtschule, unweit der Reeperbahn. Die Mädels dort waren wild und knutschten miteinander, schon lange bevor Madonna und Britney Spears das auf der Bühne taten. Ich wusste: Hier wehte ein anderer Wind als auf der Grundschule. Hier musste ich gleich zeigen, wer die Schelle hat, wenn ich nicht ganz unten in der Hierarchie landen wollte. Es ist immer besser, gleich am Anfang den Harten zu machen, bevor die anderen auf die Idee kommen, einen stetig auszutesten und zu piesacken. Also machte ich in den Pausen Kung-Fu-Übungen, die ich aus Filmen kannte. Die Kranichstellung und die Tigerkralle konnte ich schon recht gut, wie ich fand. Ich hatte mir das alles selbst beigebracht. Seitdem ich denken kann, fühle ich mich zum Kampfsport hingezogen. Später wurden die Sonntagsvorstellungen im Aladin-Kino auf der Reeperbahn zu meinem Unterricht. Meine Oma kannte den Besitzer des Kinos, und so durfte ich mir dort auch die ganz harten Filme anschauen. Zu jener Zeit waren Kung-Fu und Karate noch so neu in unserer Welt, dass niemand wusste, ob sie wirklich etwas taugten – im harten Kampf auf der Straße. Als ich anfing, belächelte man mich noch. Aber das war mir egal. Ich trat und schlug weiter während der Pausen in die Luft und machte dabei ein sehr böses Gesicht. Immerhin, es war das erste Mal, dass meine Eltern sich Gedanken über mich zu machen schienen, denn sie schickten mich mit Verdacht auf ADHS zur Kur.
Der Schule begegnete ich mit demonstrativer Gleichgültigkeit. Auf der Gesamtschule gab es einige linke Lehrer, die ein Herz für Underdogs wie mich hatten. Immer wieder versuchten sie, mich aus der Reserve zu locken und zu fördern. Aber Erfolg hatten sie damit nicht. Ganz im Gegenteil. Mehr und mehr schwänzte ich. Meinen Ranzen versteckte ich unter Treppen, in Hinterhöfen und zog durch St. Pauli, klaute Platten und Klamotten und hing auf der Straße ab.