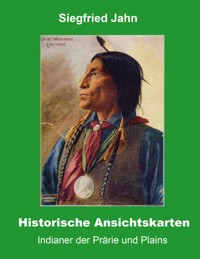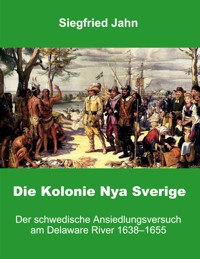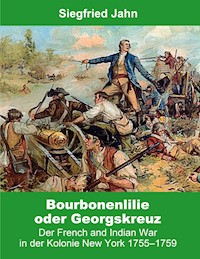
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Buchedition Amerindian Research
- Sprache: Deutsch
Von 1754 bis 1763 fand im östlichen Nordamerika der sogenannte "French and Indian War" statt, in welchem sich Großbritannien und Frankreich um den Besitz der nordamerikanischen Kolonien stritten. Entscheidende Kampfhandlungen fanden auf dem Territorium der englischen Kolonie New York statt. Die europäischen Kolonialmächte wurden dabei von Kriegern verschiedener indianische Ethnien unterstützt. Der Autor arbeitet die Ursachen des Konflikts heraus und schildert detailliert die Ereignisse dieser kriegerischen Auseinandersetzung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Übersichtskarte
Zu Dank verpflichtet ist der Autor Frau Nadja Millahn, Eixen, für die Übersetzung des Großteils der Zitate und Herrn Rudolf Oeser, Zwickau, für die Erarbeitung der Karten.
Alle Abbildungen stammen aus dem Archiv und der Sammlung des Autors
Inhaltsverzeichnis
01 Das Werden der Kolonie New York
Der Beginn der europäischen Invasion
Die geordnete Welt der Irokesen
Zwischen den europäischen Mächten
Die Pfälzer Siedler in der Kolonie New York
Ein Ire am Mohawk-River
02 1755 – Die ersten Gefechte
Die Schlacht am Lake George
03 1756 – Der große Krieg beginnt
Irritationen
Der Verlust der Forts Bull, Ontario und Oswego
04 1757 – Das Trauma
Robert Rogers Kommandounternehmen
Fort William Henry im Visier
Sabbath Day Point
Die Belagerung und Eroberung von Fort William Henry
Attacke auf die Pfälzer Siedler im Mohawk-Tal
05 1758 – Erneutes Scheitern – Erste Erfolge
Das zweite Gefecht auf Schneeschuhen
Erneuter Angriff auf German Flatts
Der erste Angriff auf Fort Carillon
06 1759 – Neu-Frankreich am Ende
Die Belagerung und Eroberung von Fort Niagara
Die Franzosen verlieren ihre Forts Carillon und Frederic
07 Verwendete Literatur
01 Das Werden der Kolonie New York
Der Beginn der europäischen Invasion
Am Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert begann sich im westlichen Europa eine Entwicklung von der feudalen Grundstruktur hin zu einem frühen Kapitalismus abzuzeichnen, Die bisherige Naturalwirtschaft wurde immer mehr durch eine Ware-Geld-Beziehung ersetzt, die schließlich die dominierende Wirtschaftsform werden würde. Die Produktion von Waren entwickelte sich vom bisher vorrangigen bedachten Gebrauchswert hin zum nunmehr wichtigen Tauschwert. Die Manufakturen fertigten mehr Produkte als benötigt und brauchten neue Absatzmärkte. Der Handel erreichte eine neue, bestimmende Bedeutung.
Förderlich für diese Entwicklung waren die Entdeckungsfahrten zwischen 1450 und 1550. Es zeigten sich dem Handelskapital ungeahnte neue Möglichkeiten. Gleichzeitig förderten diese Entdeckungen technische Entwicklungen und wissenschaftliche Erkenntnisse. Den Handelsunternehmen boten sich Gewinnmöglichkeiten ungeahnten Ausmaßes an. Die Ausplünderung der neu entdeckten Gebiete in Afrika, Asien und Amerika begann. Portugal und Spanien beschränkten sich auf die Ausbeutung der Ressourcen der Neuen Welt, ohne dass in den Mutterländern durch diese Reichtümer neue ökonomische Werte geschaffen wurden. Diese Länder blieben sozusagen reine "Verbraucher". Um Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden katholischen Mächten zu vermeiden, teilte Papst Alexander IV. die damals bekannte Welt (Vertrag von Tordesillas 1494) in eine portugiesische und eine spanische Einflusssphäre. Die aufstrebenden Länder Frankreich, England und die Niederlande wollten von dieser Aufteilung nichts wissen. Nach spanischen Protesten gegen Entdeckungsfahrten der Franzosen in den Norden Nordamerikas und nach Florida ließ Franz I. dem Gesandten Karls V. von Spanien lakonisch mitteilen:
"Die Sonne scheint für mich wie für die anderen, und ich möchte wohl den Artikel in Adams Testament sehen, der mich von der Teilung ausschlösse." (FUCHS/HENSEKE 1988, S. 11)
Die Händler des bis zu diesem Zeitpunkt ökonomisch recht rückständigen England dagegen erreichten mit der Einschränkung der Macht der Krone durch das Unterhaus Freiheiten in ihrem Tun. Durch Großgrundbesitzer wurden die Landbevölkerung und durch Manufakturproduktion die Handwerker in Abhängigkeitsverhältnisse getrieben. Sie waren gezwungen, ihre Arbeitskraft als billige Lohnarbeiter zu verkaufen. Auf der anderen Seite häuften sowohl die Besitzer der Manufakturen als auch die Kaufleute Kapital an, während die einfache Bevölkerung immer mehr verarmte. Es kam zur Gründung von Handelsgesellschaften (an denen oft die Herrscher der jeweiligen Länder Anteile hatten), die sich auf die Suche nach neuen Rohstoffquellen, Absatzmöglichkeiten, und Handelsstützpunkten machten. Als weiterer wichtiger Aspekt sollte die Möglichkeit, die Entwurzelten der Gesellschaft nach Übersee zu verbringen, nicht unterschätzt werden. Ein spanischer Minister, der zu Besuch am englischen Hof weilte, versuchte seinen König mit der Nachricht zu beruhigen:
"Der Hauptgrund für die Kolonialisierung dieser Gebiete besteht darin, ein Ventil für so viele müßige, erbärmliche Menschen zu schaffen, um dadurch den Gefahren zu begegnen, die von ihnen zu befürchten sein könnten." (WIBICH/WINTER 1988, S. 11)
Die mittel- und südamerikanischen Länder waren in spanischer Hand. So wandten sich Franzosen, Niederländer und Engländer dem Norden des Kontinents zu. Die englischen Handelsgesellschaften gingen davon aus, dass
"Wer den Handel beherrscht, herrscht über die Reichtümer der Welt und damit über die Welt selbst." (WIBICH/WINTER 1988, S. 12)
An der Ostküste Nordamerikas trafen die Europäer auf die einheimische Bevölkerung, die sie Indianer nannten und die den unterschiedlichsten Völkern angehörten und verschiedene Sprachen benutzten. Im Norden, entlang des Sankt-Loren-Stromes gründeten die Franzosen Siedlungen und Handelsposten. Sie waren hauptsächlich am einträglichen Pelzhandel interessiert und stellten relativ freundliche Kontakte zu den Ureinwohnern her. Sie erschütterten damit aber die überlieferten Gesellschaftsstrukturen und das ökonomische System der eingeborenen Bevölkerung. Die mächtige Irokesen-Liga war versucht, das Pelzhandelsgeschäft mit den Europäern zu dominieren.
Weiter südlich ließen sich die sogenannten englischen "Pilgerväter" nieder, die sowohl im Handel als auch im Grunderwerb ihre Aufgabe sahen. Nach und nach gründeten die Engländer weitere Kolonien entlang der Ostküste Nordamerikas. An der Südspitze der Halbinsel Manhattan bauten die Niederländer ein Fort, um das die Siedlung Nieuwe Amsterdam entstand.
Auch sie wollten durch den Pelzhandel reich werden und gerieten dadurch in mehrere Auseinandersetzungen mit den dort wohnenden Munsee-Völkern. Noch weiter südlich, an der Mündung des Delaware-River gründete das im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) zu Bedeutung gelangte Schweden einige Niederlassungen. All diese Kolonialmächte waren über die Konkurrenz nicht erfreut. Da Schweden bald nicht mehr in der Lage war, seine Kolonie zu versorgen, besetzten die Niederländer sie kurzerhand. Lange konnten sie sich nicht an ihrem Gebietszuwachs erfreuen. In drei Kriegen (1652-54, 1664-67 und 1672-74) erlitten sie trotz ihres außergewöhnlichen Admirals de Ruyter gegen England eine Niederlage. So fiel auch Nieuwe Amsterdam 1664 an die Engländer und wurde von diesen in New York umbenannt. Im Hinterland dieser Stadt breitete sich die Kolonie New York aus. Zusammen mit anderen Kolonien wie zum Beispiel Virginia im Süden und Massachusetts im Norden beanspruchten die Engländer fast die gesamte Ostküste Nordamerikas. Vom König eingesetzte Gouverneure verwalteten diese überseeischen Besitzungen zusammen mit Kolonialbeamten. So blieben also noch Frankreich und England als Kolonialmächte auf dem nordamerikanischen Teilkontinent übrig. Es war vorauszusehen, dass es bald zu einer Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Mächten kommen würde.
Abb. 1: Das frühe Nieuwe Amsterdam (Holzstich)
Mit dieser Situation mussten die Ureinwohner klarkommen. Die verschiedenen Völker schlossen Bündnisse mit der jeweiligen Kolonialmacht, um sowohl von den Handelsgütern der Fremden zu profitieren, als auch ihre Territorien zu behaupten. Für die Kolonialverwaltungen Englands stellten die Eingeborenen zuallererst ein Hindernis für die Expansion ins Hinterland Nordamerikas dar. Die Franzosen betrachteten sie als Pelzlieferanten und wichtiges Ziel für christliche Bekehrungsversuche (Jesuiten). Aber ein Volk auf dem Gebiet, dass die New Yorker Kolonie beanspruchte hatte eine gesellschaftliche Entwicklung erreicht, die sich nicht so leicht den europäischen Vorstellungen unterordnen würde – der Bund der Sechs Stämme, die Liga der Irokesen.
Die geordnete Welt der Irokesen
Die Irokesen genannten Indianer lebten ursprünglich im Westen des heutigen Bundesstaates New York südlich des Ontario-Sees. Sie gehörten zum Kulturareal der Waldlandvölker. Es ist umstritten, wann sich die verschiedenen Stämme zu einem Bund, der sogenannten Irokesenliga zusammenschlossen. Ihre Nachfahren heute sagen, dass wäre in grauer Vorzeit geschehen, viele euroamerikanischen Wissenschaftler meinen die Zeit um 1560 als richtig ansehen zu können. Dem Bund, der entstanden war, um die andauernden verlustreichen Kämpfe untereinander zu beenden, traten die Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga und Seneca bei. Von nun an bezeichneten sie sich als Haudenosonee, "das Langhausvolk". Anfang des 18.Jahrhunderts baten die in den südöstlichen Gebieten der heutigen USA in Bedrängnis geratenen Tuscarora um Aufnahme in die Liga und wurden deren sechstes Mitglied. Alle diese Völker verbanden kulturelle, ökonomische und sprachliche Gemeinsamkeiten. Als Irokesen wird sowohl der Bund als auch eine Sprachfamilie bezeichnet, zu der unter anderen auch die Huronen und die Cherokee gehören.
Abb. 2: Langhaus der Irokesen (Holzstich)
Die Angehörigen des Bundes lebten in festen, in früher Zeit von Palisaden geschützten Dörfern. Diese Siedlungen bestanden aus mehreren großen Langhäusern, die jeweils von einem Clan bewohnt wurden. Durch ihre sesshafte Lebensweise waren sie in der Lage, die Bevölkerung durch intensiven Feldbau nachhaltig zu ernähren. Hauptnahrungsmittel waren der Mais, die Bohne und der Kürbis (die "drei heiligen Schwestern"). Dazu kamen noch Tabak, Hanf und Sonnenblumen. Die Irokesen ergänzten ihre Nahrungsmittelpalette durch Fischfang, Jagd und das Sammeln von Wildfrüchten. Aufgrund ihrer gesicherten Lebensgrundlage waren die Irokesen in der Lage, überschüssige Produkte über Handelswege, oft kilometerlange Indianerpfade, die die Siedlungen verbanden, bis in die Subarktis bzw. zu den Küstenvölkern zu bringen. Noch öfter benutzte man die zahlreichen Wasserläufe, oft durch Tragestellen (Portages) verbunden, mit den Kanus aus Ulmenrinde.
Jedes der einzelnen Irokesenvölker war in Clans, also Großfamilien, organisiert. Jeder dieser Clans führte seinen Ursprung auf einen tierischen Urahnen zurück. So gab es bei den Mohawk die Clans Schildkröte, Wolf und Bär. Den Angehörigen dieser Großfamilien war es verboten, innerhalb ihres Clans zu heiraten. Sie mussten sich einen Partner aus einer anderen Großfamilie suchen. Die Clans waren matrilinear (Matriarchat) organisiert. Jedes Kind folgte dem Clan seiner Mutter. Die älteste bzw. geachtetste Frau stand einem Langhaus vor, teilte zur Arbeit ein, organisierte die Verteilung der Erträge und berief die Männer ihres Clans in bestimmte Ämter, die die jeweilige Großfamilie verwaltete. Die Männer vertraten den Clan, das Dorf, den Stamm oder den Bund nach außen hin, berufen dazu wurden sie von den Frauen. Der Bund kam um das große Ratsfeuer, das bei den Onondaga brannte, zu Beratungen zusammen. Hier berieten 50 Sachems über die Belange der Liga. Jeder Stamm entsandte dazu eine bestimmte, immer gleichbleibende Anzahl Sachems, die einen besonderen Namen trugen, der wie ein Amtstitel immer weitergegeben wurde. Oberste Direktive, eine Art Verfassung, war das "Große Gesetz des Friedens", dem alle Völker des Bundes zugestimmt hatten. Mit allen Stämmen, die das "Große Gesetz" nicht anerkannten, betrachteten sich die Irokesen im Kriegszustand. Aufgrund ihrer durch den Feldbau gesicherten Vorratswirtschaft konnten sie mehr Krieger auf längere Kriegszüge schicken als alle ihre Nachbarn. Dadurch wurden sie für die europäischen Kolonialmächte als Bündnispartner interessant. In den sogenannten Biberkriegen, in denen es um das Handelsmonopol mit Pelzen ging, unterwarfen bzw. vernichteten die Irokesen mehrere Völker im Gebiet der Großen Seen und kompensierten ihre Verluste durch die Adoption von teilweise ganzen Dörfern ihrer ehemaligen Feinde. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht kontrollierten sie fast den gesamten Nordosten der heutigen Vereinigten Staaten.
Nach dem Glauben der Irokesen ruhte die Insel Amerika auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte. Auf ihr gebar die mythische Urmutter die Zwillinge Feuerstein und Ahornschössling. Diese gestalteten die Welt der Irokesen, wobei der eine (Feuerstein) die schlechten, und der andere die guten Dinge auf der Schildkröteninsel schuf. Bemerkenswert ist, dass beide nicht das absolut Gute bzw. absolut Schlechte symbolisierten, sondern durchaus differenziert auftraten. Mit dieser Dualität sind die Irokesen in der Lage, auch heutige Probleme in ihr Weltbild einzupassen und zu erklären. Breiten Raum im religiösen Leben der Irokesen nahmen Träume und Visionen ein. Bei vielen Entscheidungen jeder Art wurde die Deutung von Träumen zu Rate gezogen. Außerdem gab es verschiedene Geheimbünde wie die Falsch- bzw. die Maisgesichter. Diese Maskenbünde hatten großen gesellschaftlichen Einfluss und waren für die Krankenheilung (Falschgesichter) und die Aussaatzeremonien (Maisgesichter) zuständig. Mit zahlreichen Zeremonien im Festkreis des Jahres wurde den in der Natur innewohnenden Kräften durch Tänze und Gebete um den Erhalt des Lebens gebeten bzw. dafür gedankt. Anfang des 19. Jahrhunderts erstand den Irokesen in dem Seher Handsome Lake ein Reformator, der ihren Glauben der neuen Zeit anpasste. Bis heute existiert seine Langhaus-Religion auf den Reservationen.
Zwischen den europäischen Mächten
Die Haudenosonee wussten nichts von der Aufteilung der Welt durch Papst Alexander VI. Während Spanien in Mittel- und Südamerika brutal und erfolgreich nach Schätzen suchte, wandten sich die anderen Länder dem nördlichen Teil des neuen Kontinents zu. Dabei kam es immer wieder zu Interessenkonflikten, die zu zahlreichen Auseinandersetzungen führten. Frankreich und die Niederlande waren hauptsächlich an den Gewinnen aus dem Pelzhandel interessiert. Die englische Krone dagegen suchte für ihre überschüssige Bevölkerung Siedlungsgebiete, Bodenschätze, Absatzgebiete für englische Waren und Holz für ihre Flotte.
Die Mohawk, die sich selbst Kanienkehaka (Feuersteinvolk) nannten, waren die ersten Angehörigen des Irokesenbundes, die mit den Europäern zusammentrafen. Nachrichten über diese seltsamen Leute, die wundersame Dinge besaßen, erreichten sie schon lange vorher. Möglicherweise waren es ein Teil der Kanienkehaka, mit denen Jaques Cartier (1491–1557) am Sankt-Lorenz-Strom 1603 zusammentraf und die ihn und seine Leute vor dem Tod durch Skorbut bewahrten. Als Gegengabe ließen die weißen Männer ihre Infektionskrankheiten zurück. So gab es, als sich die Franzosen in diesem Gebiet 1608 unter Samuel de Champlain (ca.1567–1635) niederließen und es "Neufrankreich" nannten, dort keine Kanienkehaka mehr. Ihren Platz hatten Algonkin-Völker eingenommen. Wenig später entstanden weitere französische Siedlungen wie Montreal oder Trois Rivieres, wohin bald Indianer aus den entlegensten Gebieten (z.B. Huronen und Abnaki) reisten, um ihre Felle gegen die erstaunlichen Handelsgüter der Ankömmlinge zu tauschen. Die französische Krone hatten wenig Interesse, das Land zu besiedeln. Beteiligt an den Pelzhandelsgeschäften ging es ihr in erster Linie darum, Gewinne aus der neuen Kolonie zu ziehen. Die Franzosen verbündeten sich mit den Völkern ihrer Pelzlieferanten und gerieten so in deren Auseinandersetzungen mit den Kanienkehaka hinein.
Nach anfänglichen Niederlagen gegen die überlegenen Feuerwaffen der Europäer lernten die irokesischen Krieger schnell, stellten ihre Kampftechnik um und es gelang ihnen, die Franzosen und ihre Verbündeten zurückzudrängen. Die Hauptlast dieser Auseinandersetzungen trugen die Kanienkehaka.
Als sich die Niederländer auf Manhattan niedergelassen und Nieuwe Amsterdam gegründet hatten, sahen die Kanienkehaka eine Chance. Die Holländisch Westindische Company, die ebenfalls fast ausschließlich an dem Erwerb von Pelzen interessiert war, verbündete sich mit den Mahican und mussten nach einer deftigen Niederlage mit den Kanienkehaka Frieden schließen. Die Mahican wurden vertrieben und die Kanienkehaka kontrollierten nun das Pelzhandelsgeschäft mit Nieuwe Amsterdam. So gelangten sie an Feuerwaffen und versuchten, den Fell-Zwischenhandel nicht nur mit den Niederländern, sondern auch mit den Franzosen zu kontrollieren. Einen Rückschlag bei diesen Bestrebungen erlitten die Kanienkehaka durch eine Masern- und Pocken-Epidemie, von der sie 1634 heimgesucht wurden. Durch Adoptionen von Angehörigen verschiedener Völker füllten sie ihre Reihen nach und nach wieder auf. So nahmen sie ihre Bestrebung, den Pelzhandel zu kontrollieren wieder auf und gerieten dabei mit den Huronen aneinander. Dieses Volk war mit diesem Handel wohlhabend geworden und stand den Bekehrungsversuchen der französischen Jesuiten aufgeschlossen gegenüber. Die Auseinandersetzungen zogen sich über Jahre hin. Um 1645 schlossen die Haudenosonee mit den Niederländern den "Zwei-Reihen-Wampum-Vertrag" zum gegenseitigen Beistand ab. Die immer größere Abhängigkeit von europäischen Waren führte dazu, dass Pelztiere, besonders der begehrte Biber, im Land der Haudenosonee immer seltener wurden. Ausgerüstet mit niederländischen Feuerwaffen begannen die sie nun die sogenannten "Biberkriege" gegen alle Völker nördlich des Ontario-Sees. Nacheinander besiegten sie die durch europäische Krankheiten geschwächten Huronen, danach die Petun, die Neutrals und die Erie. Große Teile dieser Völker, teilweise ganze Dörfer, wurden von den Haudenosonee adoptiert. Bei dem Versuch, auch die weit entfernt lebenden Ottawa vom Pelz-Zwischenhandel auszuschalten, scheiterten sie jedoch.
Abb. 3: Champlain im Kampf gegen die Irokesen (historische Postkarte, Sammlung des Autors)
Nun wandten sich die Haudenosonee ihren wichtigsten Feinden zu, den Franzosen. Ab 1657 erfolgten verstärkte Angriffe der Liga auf die französischen Siedlungen. Die Folge war, dass sich fast zehn Jahre lang kein Franzose ohne Gefahr für Leib und Leben außerhalb der befestigten Niederlassungen aufhalten konnte. Neufrankreich stand kurz vor dem Ruin. Inzwischen hatte die aufstrebende Wirtschafts- und Kolonialmacht England, dass seit 1620 eine Kolonie um Plymouth unterhielt, in drei Kriegen die Niederlande besiegt. So wurde Nieuwe Amsterdam 1664 englisch und hieß von nun an New York. Geschickt ließen die Engländer den hier lebenden Niederländern ihren Besitz und ihre Privilegien im Pelzhandel. Die Steuern dafür flossen aber nun an die Krone.
Die Kanienkehaka mussten mit neuen Verhandlungspartnern klarkommen, obwohl die Kontakte zu den niederländischen Pelzhändlern intakt blieben. Um ihre Kolonie und die Gewinne aus dem Pelzgeschäft zu schützen, begannen die Franzosen ab 1666 mit mehreren Feldzügen gegen die Irokesen-Liga. Nach verschiedenen Gefechten, in denen kaum ein Haudenosonee sein Leben, aber dafür viele ihre Heimstätten und ihren Besitz verloren, kam es zu einem Friedensschluss. Jesuiten gelang es, einige Kanienkehaka zu bekehren und dazu zu überreden, mit ihnen auf französisches Gebiet zu ziehen und dort die Siedlung Kahnawake (Caughnawaga) zu gründen. Wenig später kamen die Dörfer Akwesasne (St. Regis) und Kanasatake (Oka) dazu.
Weiter im Süden war es den Haudenosonee nach Jahren vergeblicher Angriffe endlich gelungen, die mit ihnen verwandten Susquehanna (Conestoga) mit Hilfe der Engländer zu besiegen. Bis ins Gebiet des heutigen Illinois stießen die Krieger des Bundes vor und viele Völker unterstellten sich dem Schutz der Liga. Aber all das nutzte wenig, denn die Franzosen fanden immer neue Wege, um ihre Handelsrouten um das Land der Liga herumzuführen. So stießen sie über die Großen Seen hinaus bis zum Mississippi und zu dessen Mündung in den Golf von Mexiko vor. Die Haudenosonee mussten einsehen, dass sie den Pelzhandel mit den Europäern nicht vollständig kontrollieren konnten. Dazu kamen erneute Attacken der Franzosen, die wieder zu neuen Friedensverhandlungen führten. Die Engländer versuchten diese Verhandlungen zu hintertreiben. Aber die Liga, die den Zwei-Reihen-Wampum-Vertrag auf die neuen Herren New Yorks übertragen hatten, ließ sich nicht beeindrucken. Während solcher Verhandlungen, die auf Vermittlung der katholischen Kanienkehaka zustande gekommen waren, ließ der französische Gouverneur die Ligahäuptlinge der Haudenosonee gefangen nehmen und einkerkern. Zusammen mit den Kanienkehaka-Katholiken griff er danach Haudenosonee-Siedlungen an und verbrannte sie. Das führte zu einem anhaltenden Hass auf die Kahnawake-Kanienkehaka und man verbannte sie aus der Liga. Die Reaktion der Haudenosonee erfolgte 1689. Etwa 1.500 Krieger der Liga marschierten auf Montreal zu und vernichteten auf ihrem Weg alles französische Leben. Ungesicherte Quellen sprechen von bis zu 1.000 toten Franzosen. Die Haudenosonee belagerten Montreal und erreichten die Freilassung ihrer gefangenen Häuptlinge. Triumphierend teilten sie dem englischen Gouverneur in Albany mit:
"Die Franzosen haben keinen Rechtstitel auf jene Orte, die sie nicht besitzen, nein weder auf Cadarachqui [heute Kingston] und Mount Royal [Montreal] noch auf unsere anderen Ländereien bis hinauf zu den Ottawa … denn worauf wollen sie ihre Ansprüche begründen? Darauf, daß sie früher in das Gebiet der Mohawk kamen und nun, später, in das Land der Seneca, und darauf, daß sie einige Rindenhäuser niederbrannten und unser Getreide niederschnitten? – Wenn das ein guter Rechtstitel sein soll, dann können wir alle Kanada beanspruchen, denn wir … haben dem französischen Heim so sehr zugesetzt [bis] sie nicht mehr dazu in der Lage waren, auch nur über die Türschwelle zu treten, um pissen zu gehen." (WRIGHT 1992, S. 147)
Die Engländer bemühten sich sehr, die Haudenosonee zum Eingreifen auf ihrer Seite in den von 1689 bis 1697 andauernden King Williams Krieg zu bewegen. Denn alle auf dem europäischen Festland ausbrechenden Kriege, in diesem Fall der Pfälzische Erbfolgekrieg (1688–1697), fanden ihr Gegenstück auf nordamerikanischem Boden. Nach einem erneuten, diesmal erfolglosen Vorstoß auf Montreal beschlossen die Irokesen, mit Frankreich Frieden zu schließen. Ihre Delegation wurde aber unterwegs angegriffen und einige Häuptlinge verloren ihr Leben. Neue Pläne des französischen Gouverneurs für einen Feldzug kamen durch dessen Tod nie zur Ausführung. Da der Pelzhandel und die Jagd für die Existenz der kanadischen Franzosen überlebenswichtig waren, fanden sie sich 1701 zu einem Friedensschluss bereit. So versuchten sich die Haudenosonee in ihrer Lage zwischen den Kolonialmächten einzurichten, sich von beiden Seiten hofieren zu lassen und Neutralität zu bewahren. Gegen die Tücke englischer Landspekulanten nutzte das wenig. Robert Livingston (1654–1728) lud Kanienkehaka zu einer Verhandlung ein und ließ sie in volltrunkenem Zustand ein Papier unterzeichnen, mit dem sie große Ländereien am Mohawk-River abtraten. Dieses Papier sollte auf Jahre das Verhältnis zu den Engländern belasten.
Ihre Neutralität zu bewahren gelang den Haudenosonee in dem von 1701 bis 1713 stattfindenden Queen Annes Krieg (der Spanische Erbfolgekrieg 1701–1714) einigermaßen. Queen Anne ließ vier wichtige Indianer-Häuptlinge (davon drei Kanienkehaka) nach London einladen, um ihnen die Macht und Bedeutung Englands vor Augen zu führen und sie so zur Parteinahme zu bewegen. In Begleitung von Colonel Peter Schuyler d. Ä. (1657–1724) reisten die "Four Indian Kings" auf die Insel, wo ihnen mit allen Ehren ein Empfang gegeben wurde:
"Sie greifen herzhaft zu, und von allen Speisen, die ihnen vorgesetzt werden, schmeckte ihnen das englische Rindfleisch am besten. Sie scheinen unser feines helles Ale den besten französischen Weinen vorzuziehen. Sie leiden weder an Gicht noch an Wassersucht und haben auch keinen Harngrieß, und trotz ihrer großen Unbeherrschtheit im Trinken wirft kein Fieber sie je nieder." (O‘NEIL 1980, S. 78)
Die Häuptlinge erhielten eine Audienz bei Queen Anne, ließen sich dort von dem holländischen Künstler Jan Verelst (1648–1719) porträtieren und gaben ihre Zusage, dass die Engländer auf ihrem Land eine Festung (Fort Hunter) und eine anglikanische Mission unterhalten dürften. Im Frühsommer 1713 kehrten die Häuptlinge in ihre Heimat zurück. Im gleichen Jahr gestatteten die Kanienkehaka die Ansiedlung verarmter Pfälzer Siedler am Schoharie.
Queen Anne starb 1714 und ihr folgte George I. aus dem Haus Hannover auf dem Thron. Die kriegführenden Parteien schlossen ein neues Friedensabkommen in Utrecht, das wieder nicht alle Beteiligte zufriedenstellte. Allein England – seit 1707 in einer Union mit Schottland (und darum nun Großbritannien genannt) – konnte Erfolge verzeichnen. Admiral George Rooke (1650–1708) hatte den strategisch bedeutsamen Felsen von Gibraltar erobert und Frankreich und Spanien mussten Handelsverträge unterzeichnen, der England das Monopol in der Lieferung von Sklaven nach Spanisch-Amerika einräumte.
Immer mehr Auswanderer strömten in die Kolonien und verlangten nach Siedlungsland. Die Algonkin-Völker der Küstenregionen waren längst vertrieben. Der Druck auf die weiter im Landesinneren lebenden Indianer wuchs und wuchs. Viele unterstellten sich dem Schutz der Sechs Nationen, die das Ohio-Gebiet als Zufluchtsort für diese Völker betrachteten. In Verhandlungen mit den englischen Abgesandten betonten sie immer wieder, wie wichtig das Land am Ohio für den Frieden mit den Indianern wäre. Denn schon zeichneten sich neue kriegerische Auseinandersetzungen mit den Franzosen am Horizont ab.
Unter dem Eindruck dieses Erfolges bemühten sich die Kolonialbehörden erneut, unterstützt von dem Dolmetscher Conrad Weiser (1696–1760), die Haudenosonee auf ihrer Seite zum Eingreifen in die Kämpfe zu bewegen. Zumindest erreichten die Unterhändler, dass sie ihnen Land westlich des Susquehanna-Rivers verkauften. Dieses gehörte zwar den Lenape (Delaware), brachte den Verkäufern aber Handelswaren im Wert von 1.100 Pfund ein. So erhofften die Haudenosonee, weiterhin ihre bisher verfolgte Neutralitätspolitik verfolgen zu können. Übrigens geschah es bei diesen Verhandlungen in Lancaster, dass der Onondaga-Sprecher Canasatego (ca.1684–1750), der führende Unterhändler der Haudenosonee, den Vertretern der britischen Kolonien zum ersten Male nahelegte, sich doch zu einem Bund ähnlich dem seines Volkes zusammenzuschließen.
Bei diesen Unterhandlungen war kein wichtiger Abgesandter der Kanienkehaka dabei gewesen.
"Als östliche Torhüter zwischen Albany und Quebec eingekeilt, hatten die Mohawk den engsten Kontakt sowohl zu den Engländern als auch zu den Franzosen. Das bescherte ihnen zwar einerseits eine große Hebelkraft im Bereich der Diplomatie und des Handels, setzte sie zugleich aber dem schwersten Ansturm solcher Grenzlandübel wie Seuchen, Rum und Siedlerinvasionen aus" (WRIGHT 1992, S. 152)
Die Kanienkehaka hatten sich mehr und mehr aus dem südlichen Mohawk-Tal zurückgezogen und ihre Siedlungen im Norden in der Nähe der Franzosen bereits aufgegeben. Dort blieb nur Kahnawake (Caughnawaga) zurück, dessen Bewohner Christen geworden waren und mit den Franzosen sympathisierten. Auf diese Weise hatten die Kanienkehaka ihren Fuß in beiden kolonialen Türen, was aber die übrigen Mitglieder der Sechs Nationen misstrauisch beobachteten.
Bei Ausbruch des Krieges 1740 (der Österreichische Erbfolgekrieg) waren die Kanienkehaka durchaus gewillt, zusammen mit den Briten gegen die Franzosen zu kämpfen. Allerdings hatten sie Bedenken, mit den Kriegern Kahnawakes zusammenzustoßen. Zwar waren diese Kanienkehaka keine Angehörigen der Liga mehr, aber durch zahllose familiäre Bande mit der Mehrheit des Volkes verbunden. Jedem Haudenosonee war es ein Graus, etwa Verwandtenblut zu vergießen. Verschiedene Gerüchte über betrügerische Landverkäufe heizten die Atmosphäre auf, die von King Hendrick (1692–1755) geschürt wurden. So sollte den Briten aufgezeigt werden, dass das Verhalten der Pelzhandelslobby die Indianer in die Arme der Franzosen treiben könnte.
Einen Vertrauten gewannen die Kanienkehaka in dieser Zeit mit dem 1738 ins Mohawk-Tal gekommenen William Johnson (1715–1774). Er erwies sich als fairer Handelspartner und die Indianer brachten ihm mehr und mehr Vertrauen entgegen. Johnson erlernte ihre Sprache und sie gaben ihm den Namen "Warraghiyagey". War er in den Dörfern der Kanienkehaka, kleidete und bemalte er sich wie diese. Zuneigung erfuhr Johnson auch durch die unverheirateten Töchter der Indianer. Die jungen ledigen Frauen lebten sexuell freizügig und "unerwünschte" Schwangerschaften gab es nicht, da jedes Kind in den Clan seiner Mutter hineingeboren wurde. Johnson hatte mehrere Söhne und Töchter mit verschiedenen Frauen. Die Führer der Kanienkehaka sahen das nicht ungern, denn nichts zählte mehr als familiäre Bindungen, die Vorteile für den Handel und Bündnistreue brachten.
Die französischen Befehlshaber in Montreal sandten freundliche Botschaften und reichliche Geschenke an die Kanienkehaka und diese sahen weg, als Ende 1745 145 französische Soldaten, kanadische Miliz und einige profranzösische Kanienkehaka ungehindert das Land der Haudenosonee passierten und Saratoga angriffen. Saratoga lag nur 50 Kilometer nördlich von Albany und diese Aktion setzte die Briten in Panik. In einem Brief hieß es:
"Bei Tagesanbruch tauchten 400 Franzosen und 220 Indianer auf und umzingelten alle Häuser, verbrannten und zerstörten alles, was ihnen in den Weg kam, ließen nur eine Sägemühle stehen, da diese anscheinend etwas aus ihrem Weg lag; an Beute nahmen sie, was ihnen zusagte; töteten und nahmen 100 oder 101 Personen gefangen, schwarz und weiß." (FLEXNER 1981, S. 46)
Die den Hudson entlang fliehende Bevölkerung beunruhigte Gouverneur George Clinton (1686–1761) dermaßen, dass er beschloss, einen Indianerkongress nach Albany einzuberufen.
Noch unruhiger registrierten die Liga, wie nach dem Tode des alten Diplomaten Canasatego der Kanienkehaka Tiyanoga (King Hendrick) dessen Rolle übernahm. Besonders die Seneca, die die meisten Krieger stellen konnten und seit Jahrzehnten unter dem Einfluss der französischen Pelzhandelsdynastie Joncaire standen, misstrauten ihm. Zwar wurden King Hendrick immer wieder Sympathien für die Franzosen nachgesagt, aber er war, vor allem nach seinem zweiten Besuch in London und einem Empfang durch König George II. 1740, ein Freund der Briten.
Aber auch King Hendrick erschien nicht zu der von New Yorks Gouverneur Clinton nach Albany einberufenen Konferenz. Die Ratsversammlung in Onondaga hatte ihn darauf hingewiesen, dass die Politik des Bundes die einer strikten Neutralität wäre. Trotzdem gelang es Johnson, Kanienkehaka-Krieger mit Geschenken und Zusagen dazu zu bringen, mit ihm nach Albany zu ziehen und sich dort Gouverneur Clinton als Bundesgenossen anzubieten.
Nach ausführlichen Zeremonien, Geschenkübergaben und mit Wampum untermalten Reden hörten die Indianer die Vertreter der Kolonien über herannahende große britische Armeeverbände und bereitstehende Milizsoldaten berichten. Nach vier Tagen Verhandlungen erklärten sich die Haudenosonee bereit, gemeinsam mit den britischen Soldaten gegen die Franzosen zu ziehen. Sie nahmen die bereitliegenden Geschenke und zogen ab, wohl wissend, dass ein großer Teil der Reden nur leere Luft gewesen war.
Ein unerwartetes weiteres Geschenk hatten die Haudenosonee in Albany erhalten, die Pocken. Viele von ihnen erkrankten schwer, eine große Anzahl starb. An Krieg war vorerst nicht zu denken. Erst im Herbst unternahmen die wieder Genesenen erste Angriffe auf das französische Kanada.
King Hendrick allerdings suchte den französischen Gouverneur Vaudreuil (1698– 1778) in Montreal auf, ließ sich bewirten, beschenken und hofieren und besuchte anschließend die Verwandten in Kahnawake. Er kam mit den Bewohnern überein, dass Keiner dem anderen im Wege stehen solle, sofern dessen Unternehmen auf Skalpe weißer Männer ausgerichtet wäre.
Zu seinem Erstaunen erfuhr King Hendrick nach seiner Rückkehr, dass Johnson bei Gouverneur Clinton vorstellig geworden war, um den Protest der Kanienkehaka gegen den Anfang des 18.Jahrhunderts betrügerisch von Livingstone erwirkten Landvertrag zu unterstützen. Clinton leitete das Anliegen nach London zum König weiter. Damit war endlich erreicht, woran King Hendrick bisher immer gescheitert war. Der Häuptling betrachtete Johnson nun mit anderen Augen.
Die Kanienkehaka warteten weiter auf die große Armee des Königs. Derweilen unternahmen sie selbst immer wieder Angriffe auf französische Ziele, brachten Gefangene und Skalps mit und kassierten die dafür ausgesetzten Prämien.
Abb. 4: Irokesenpaar (Kolorierter Kupferstich 18.Jh.)
Die Franzosen bauten derweilen weitere Forts entlang der Linie Montreal – Illinois – New Orleans. Außerdem schlossen sie eine Reihe von Schutzbündnissen mit den Lenape und Shawnee an den Grenzen von Virginia und Pennsylvania, genau wie es die Haudenosonee befürchtet hatten. Immerhin kamen die Kriegsparteien nach einigem Hin und Her 1748 zum Frieden zu Aachen und beendeten damit King Georges Krieg. Die Ergebnisse waren für die beteiligten Herrscherhäuser nicht überwältigend. So mussten die Briten das mühevoll eroberte Louisbourg zurückgeben, was in den Kolonien für Empörung sorgte. Überall wurde an Plänen zu einer Revidierung der Verhandlungen gearbeitet. 1746 hatte England die Schotten in der Schlacht bei Culloden endgültig besiegt und den letzten Widerstand der Clans gebrochen.
Die Friedenszeit nutzten britische Landspekulanten dazu, Kundschafter in bisher nur von Indianern bewohntes Gebiet zu schicken, es zu vermessen und die Zahl der Bewohner in Erfahrung zu bringen. Das trieb viele Indianervölker noch mehr in die Arme der Franzosen und verärgerte die Haudenosonee. Johnson, der diese Entwicklung vorausgesehen hatte, trat vom Amt des Kommissars für Indianerangelegenheiten zurück und widmete sich intensiv dem Landerwerb.
1753 traf sich King Hendrick mit dem Gouverneur New Yorks George Clinton und brachte die Aktivitäten der Franzosen im Ohio-Gebiet, wo diese Befestigungen errichteten, zur Sprache. Hendrick wies darauf hin, dass die Briten sich nicht um diese Bedrohung kümmern würden und stattdessen weitere betrügerische Landkäufe tätigten. Die Spekulanten brachten mit Versprechungen und vor allem Alkohol immer wieder indianische Gebiete an sich. Clinton fertigte den Häuptling kurz und knapp ab und verwies ihn an die Landspekulanten in Albany. Erzürnt sagte Hendrick:
"Als wir hierherkamen, um unser Leid zu berichten, das unser Land betrifft, erwarteten wir, daß etwas geschehen würde … und, Bruder, Ihr sagt uns, daß uns in Albany Recht widerfahren soll. Doch wir kennen sie so gut, daß wir ihnen nicht trauen werden, denn das sind keine Menschen sondern Teufel … Die Bundeskette ist zerbrochen … erwartet nicht, noch einmal von mir zu hören, und, Bruder, wir wünschen auch nicht mehr, von Euch zu hören." (WRIGHT 1992, S. 154)
Die Bemerkung Henricks, er betrachte den Vertrag mit den Briten als gebrochen, erreichte auch die Vertreter der Krone in London.
"Das entsetzte Handelsministerium befahl allen Kolonisten, die englisch-irokesischen Beziehungen aufrechtzuerhalten und sich gemeinsam mit den Fünf Stämmen zu treffen und eine kontinentale indianische Politik zu entwerfen, wodurch der Bund an die Krone gebunden werden sollte. So entstand 1754 der berühmte Kongress in Albany." (FLEXNER 1981, S. 111)
Sofort beauftragte man William Johnson damit, das "Missverständnis" auszuräumen. Immerhin erreichte Johnson eine Beruhigung der Lage. Die Praktiken der Landspekulanten änderten sich aber nicht. Während des ersten Kongresses in Albany geschah es übrigens, dass die Haudenosonee Benjamin Franklin (1706–1790) den Rat gaben, dass sich die Kolonien zu einem Bund, ähnlich dem der Sechs Nationen, zusammenschließen sollten. Benjamin Franklin schrieb an Thomas Jefferson (1748–1826):
"Es ginge schon mit seltsamen Dingen zu, wenn sechs Nationen unwissender Wilden fähig sein sollten, die richtige Staatsform für eine solche Union zu finden und sie zudem in einer solchen Weise zu praktizieren, daß sie Jahrhunderte überdauerte und absolut unzerstörbar erscheint – und eine solche Union nicht auch für zehn oder zwölf englische Kolonien anwendbar wäre…" (LÄNG 1989, S. 111)
So wandten sich immer mehr Indianervölker den Franzosen zu, die zuerst an Handelsbeziehungen interessiert schienen und nicht an Landverkäufen.
Durch ihre Neubauten an Forts im Ohio-Gebiet und ihren Einfluss auf die Indianer sahen sich die Briten in Bedrängnis gebracht. Darum entsandte der Gouverneur Virginias Ende 1753 den jungen George Washington (1732–1799) zum französischen Oberbefehlshaber Jaques Legardeur de Saint Pierre (1701–1755) ins Fort Le Boeuf um gegen das Vordringen der Franzosen zu protestieren. Die folgenden Verhandlungen brachten nichts als leere Worte. Beide Kolonialmächte forcierten ihre Aufrüstung. Und die Ohio-Company, zu deren Hauptaktionäre die Familie Washington gehörte, meldete nach der Rückkehr Georges Anspruch auf 200.000 Acres Land am Ohio an.
Um der Präsenz der Franzosen am Ohio entgegenzuwirken, begannen die Briten am Zusammenfluss von Allegheny und Monongahela zum Ohio ein Fort zu bauen. Als Washington mit Verstärkung für die Befestigung nahte, erreichte ihn ein Bote der Haudenosonee, der vermeldete, dass das unfertige Fort von den Franzosen erobert worden wäre. Washington beschloss, weiter vorzurücken, stieß dabei auf eine französische Abteilung, die er angreifen und vernichten ließ. Vor den darauffolgenden Angriffen der Franzosen mussten die Briten aber zurückweichen und schließlich kapitulieren. Von französischer Seite erhoben sich später Vorwürfe, Washington habe mit seinem Angriff eine Friedensdelegation getroffen. Der französische Philosoph Voltaire (1694–1778) hielte dazu später fest, dass ein Schuss in Amerika Europa in Flammen gesetzt hätte. Sowohl auf britischer wie französischer Seite liefen die Aufrüstungsarbeiten auf Hochtouren.
Im Mai/Juni 1755 gelangte ein französischer Konvoi durch die Seeblockade der Briten und brachte 3.000 Soldaten der Bataillone La Reine, Languedoc, Bearn und Guyenne nach Kanada. An Neuenglands Westgrenze wiederum liefen die Vorbereitungen des neuen Oberbefehlshabers General Edward Braddock (1695–1755) für einen Angriff auf das von den Franzosen eroberte Fort am Ohio, dass diese jetzt Duquesne nannten. Außerdem bestand der Plan, die Forts Niagara und Frontenac anzugreifen. Dazu kam ein Vorstoß nach Nova Scotia. Dort gelang Colonel Robert Monckton (1726–1782) immerhin die Eroberung zweier französischer Befestigungen, darunter das starke Fort Beausejour. Durch diesen Sieg geriet die französische Bevölkerung, die ihre Heimat Acadien nannten, unter die Kontrolle der Briten. Diese vertrieben kurzerhand die Acadier aus Nova Scotia, wobei rücksichtslos Familien auseinandergerissen und über alle Kolonien verteilt wurden. Des Weiteren sollte mit irokesischer Hilfe Crown Point am Champlain- See attackiert werden.
Allerdings wurde der erste Vorstoß auf die Festung Duquesne für General Braddock zum Desaster. Alle irokesische Hilfe ablehnend lief er mit seinen Truppen in einen geschickt von den Franzosen und den mit ihnen verbündeten Indianern gelegten Hinterhalt. Der große Teil der britischen Truppen verblutete auf dem Schlachtfeld. Die Überlebenden gelang die Flucht aufgrund der Deckung durch die Virginia-Miliz unter George Washington.
Die Auswirkungen dieser verheerenden Niederlage waren katastrophal. Alle noch zögerlichen Indianervölker schlossen sich den Franzosen an und begannen einen erbitterten Kleinkrieg gegen die Grenzsiedlungen Pennsylvanias und Virginias. Die Haudenosonee erhoben starke Vorwürfe gegen die Führung des britischen Militärs. Der Oneida Scarouady (?–1757) sagte:
"Bruder! Es ist inzwischen wohl bekannt, wie unglücklich wir von den Franzosen geschlagen wurden … Wir müssen Euch wissen lassen, daß Schuld daran der Stolz und die Unwissenheit jenes großen Generals war, der aus England kam. Er ist nun tot, doch er war ein schlechter Mensch, als er noch lebte. Er betrachtete uns wie Hunde und wollte niemals auf etwas hören, was man ihm sagte. Wir versuchten oft, ihn zu beraten und ihm von der Gefahr Mitteilung zu machen, in der er schwebte … doch nie schien er über uns erfreut zu sein, und das war der Grund, weshalb sehr viele unserer Krieger ihn verließen und sich nicht seinem Befehl unterstellen wollten … Jene, die über die Meere kommen … sind unfähig, in den Wäldern zu kämpfen. Laßt uns allein hinausziehen, die wir von dieser Erde stammen. Dann könnt ihr sicher sein, daß wir die Franzosen besiegen werden." (WRIGHT 1992, S. 155)
Der Kampf um die Vorherrschaft in Nordamerika hatte begonnen.
Die Pfälzer Siedler in der Kolonie New York
War Nieuwe Amsterdam schon zum Anziehungspunkt für Auswanderer aus den verschiedensten Ländern (selbst nordafrikanische Mauren kamen), so wurde die Kolonie New York erst recht Anlaufpunkt für Menschen, die aus den verschiedensten Gründen ihre Heimat verlassen wollten oder mussten.
Ende des 17.Jahrhunderts hatten sich verschiedene Konflikte in Europa dermaßen zugespitzt, dass sie sich in einem Krieg entluden. König Ludwig XIV. von Frankreich trieb seine Expansionspolitik (die sogenannte Reunionspolitik) voran, beanspruchte das Elsass und ließ Luxemburg und die Stadt Straßburg besetzen. Viele deutsche Reichsstädte und -gebiete fühlten sich bedroht und rückten näher an den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches heran. Anlass für den Krieg gab nach dem Tod von Kurfürst Karl II. von der Pfalz dessen Testament. Ludwig der XIV. erkannte es nicht an und ließ es für ungültig erklären. Zudem wollte er verhindern, dass William III. König von England wurde und unterstützte dessen Gegner, die Stuarts. So stand Frankreich Spanien, England, den Niederlanden, Savoyen und dem Heiligen Römischen Reich gegenüber.
In den folgenden Kämpfen wurden besonders große Teile Süddeutschlands, Gebiete am Niederrhein und die Kurpfalz in Mitleidenschaft gezogen. Die Städte Speyer, Heidelberg und Mannheim fielen der Zerstörung anheim. Französische Truppen verwüsteten die Pfalz und stürzten die Bevölkerung in Armut und Hoffnungslosigkeit. Der Krieg fraß die Ressourcen Frankreichs und schließlich kam es zum Frieden von Rijswijk, der aber keine der beteiligten Nationen zufriedenstellte. Das führte 1701 zum Ausbruch des Spanischen Erbfolgekrieges (in Amerika Queen Annes Krieg 1701–1713), der erneut Not und noch mehr Elend in die bereits zerstörten Ländereien trug. Der letzte spanische Habsburger-König Karl II. starb 1700 ohne Erben. Kurz vor seinem Tode hatte er den französischen Kandidaten Philipp V. zu seinem Nachfolger bestimmt. Dieser war ein Enkel Ludwig XIV. und wurde der Begründer der Bourbonen-Dynastie. Der damit zu erwartende Machtzuwachs Frankreichs ließ die anderen europäischen Mächte unruhig werden. Besonders der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Leopold I., die Niederlande und England sahen sich bedroht. Zudem starb der englische Exkönig James II. 1702 im Exil und Ludwig XIV. wollte dessen Sohn, James F. Edward (der sogenannte Prätendent), auf dem englischen Thron sehen.
Stattdessen kam nach dem Tode von William III. 1702 Queen Anne aus dem Hause Stuart an die Macht. Sie warb in den vom Kriege verheerten Gebieten um Auswanderungswillige. Sie ließ Land und Steuervorteile versprechen. Dafür kursierten verschiedene Werbeschriften in den deutschen Ländern. Die erfolgreichste stammte von Pfarrer Josua Harsch (1664–1722). Dieser war schon 1708 mit einigen Auswanderern auf der "Globe" nach Amerika gekommen. Dort gründete er den Ort Neuenburg (heute Newburgh) am Quassaick-Creek im Hudson-Tal. Harsch kehrte nach London zurück und es gelang ihm, Königin Anne zu überzeugen weitere Pfälzer als Siedler für die Kronkolonie New York anwerben zu dürfen.
Abb. 5: Queen Anne (historische Postkarte, Sammlung des Autors)