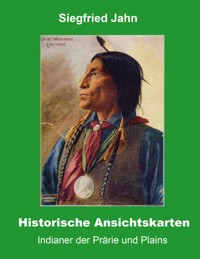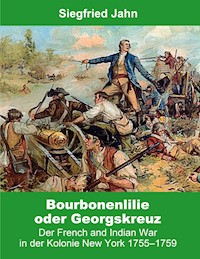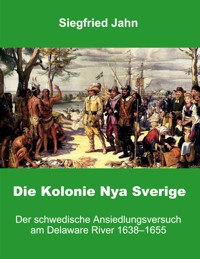
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Buchedition Amerindian Research
- Sprache: Deutsch
Im 17. Jahrhundert stieg das Königreich Schweden zur dominanten Macht im Ostseeraum auf. Das mit diesem Aufstieg einhergehende gesteigerte Selbstbewusstsein des schwedischen Adels, der Bürger und der Kaufleute führte dazu, dass diese sich in die Reihe der anderen europäischen Kolonialmächte wie England, Frankreich oder die Niederlande zu stellen gedachten. Man gründete eine Handelskompanie mit dem Ziel, am Delaware-River in Nordamerika Siedlungen zu gründen, um am lukrativen Pelz- und Tabakhandel teilzuhaben. Von 1638 bis 1655 existierte diese schwedische Kolonie im Gebiet der Delaware- und Susquehannock-Indianer unter dem Namen Nya Sverige - Neu-Schweden. In seinem nunmehr achten Buch (bereits erschienen sind u. a. "Die Irokesen", "Die Delaware-Indianer", "Die Seminolen Floridas" und "Indianer Nordamerikas auf historischen Postkarten" - letzteres zusammen mit Rudolf Oeser) erzählt Siegfried Jahn die Geschichte einer Kolonie, über die in Deutschland kaum etwas bekannt ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karte 1: Die Ostküste Nordamerikas mit den von europäischen Mächten beanspruchten Kolonialgebieten
Am 6. Juni 2023 feierte das Königreich Schweden seinen 500. Geburtstag – diesem Anlass ist dieses Buch gewidmet
Alle Abbildungen entstammen der Sammlung oder dem Archiv des Autors, der sich an dieser Stelle bei Herrn Rudolf Oeser, Zwickau, für die Erstellung der Karten bedanken möchte
Inhaltsverzeichnis
Indianer in Schweden?
Der Aufstieg Schwedens im 17. Jahrhundert
Koloniale Ambitionen Schwedens
Die europäische Invasion der Ostküste Nordamerikas
Die eigentlichen Eigentümer
Die Gründung von Nya Sverige
Die Ära Printz
Das Ende von Nya Sverige
Und danach?
Verwendete Literatur
Das Wappen des Hauses Wasa
Indianer in Schweden?
Das Erstaunen unter den Philatelisten auf der ganzen Welt war riesengroß, als die schwedische Post 1938 einen Briefmarkensatz (Michel-Nr. 245–249) mit fünf Werten herausgab, dessen Marke zu 5 Öre einen Indianer zusammen mit einem Europäer des 17. Jahrhunderts zeigte. Was sollte das bedeuten? Beim näheren Betrachten konnte der Sammler als Anlass dieser Ausgabe erfahren, dass es vor 300 Jahren die Gründung einer Auswanderer-Kolonie, genannt Nya Sverige, am Delaware River gegeben hatte. Eine Kolonie Schwedens in Nordamerika? Dass Spanien, England und Frankreich Gebiete im Norden Amerikas als ihre Kolonien beanspruchten, war ja soweit bekannt. Einige Interessierte hatten wohl auch davon gehört, dass New York eigentlich eine niederländische Gründung war und die Holländische Westindische Kompanie Gebiete entlang des Hudson für sich beanspruchte, bis sie diese an die Engländer verloren. Aber Schweden?
Dieses Königreich war im Laufe des 17. Jahrhunderts zur dominierenden Macht im Ostseeraum aufgestiegen. Mit dem Eintritt in den Dreißigjährigen Krieg festigte Schweden seine Stellung noch und zeigte Interesse, es anderen bedeutenden europäischen Staaten nachzutun und eine Kolonialmacht zu werden. Siebzehn Jahre bestand Nya Sverige am Delaware River und hier soll die kaum bekannte Geschichte dieser Kolonie erzählt werden.
Abb. 1: Schwedische Briefmarke 1938
Der Aufstieg Schwedens im 17. Jahrhundert
Anfang des 16. Jahrhunderts war Schweden ein kleines Agrarland, vorrangig dominiert durch Dänemark. Erst durch den Sieg in der Schlacht am Brunkeberg 1471 konnte Schweden teilweise eine Selbständigkeit erreichen und Ende des Jahrhunderts endgültig die dänische Fremdherrschaft abschütteln (König Gustav I. Wasa). 1523 gilt als das Gründungsjahr des Königsreichs Schweden. Zu dieser Zeit hatte das Land, zu dem auch große Teile Finnlands gehörten, etwa 850.000 Einwohner. Auf dem Reichstag von Västeras 1527 erreichte der schwedische König Gustav I. Wasa die Zustimmung zur Einziehung kirchlichen Besitzes zu Gunsten der Krone und die Einführung der lutherischen Reformation. Durch diese Entscheidungen wurden die Macht des Königs gestärkt und die Entwicklung Schwedens zu einem Nationalstaat vorangetrieben. Die Übersetzung der Bibel aus dem Lateinischen 1541 förderte die Verbreitung des Neuschwedischen als Nationalsprache. Der König trieb die Zentralisierung voran und bewegte die Stände auf dem Reichstag von 1544 einem erblichen Königtum zuzustimmen. Allerdings hatte das aufstrebende Schweden bei seiner Entwicklung mit einer Reihe von Hemmnissen zu kämpfen. Die südliche Ostsee wurde von der Handelsmacht Lübeck dominiert, Dänemark war zu jeder Zeit in der Lage, den Zugang zur Ostsee zu sperren und im Osten kontrollierten die baltischen Handelsstädte den Handel mit Russland. So begann das schwedische Königreich den Kampf um die Herrschaft über die Ostsee (Dominium maris Balticae).
Nach einer Niederlage im Nordischen Siebenjährigen Krieg (1563–1570) konnte Schweden die angestrebte Eroberung Estlands erst vollenden, als der polnische König als Sigismund I. 1587 in Personalunion auch Herrscher über Schweden wurde. Als dieser aber den Katholizismus wieder in Schweden einführen wollte, vertrieb ihn sein Onkel, Herzog Karl (ab 1607 als König Karl IX.). Den sogenannten Kalmar-Krieg (1611–1613) gegen Dänemark verlor sein Nachfolger, Gustav II. Adolf, erreichte aber in Stolbowa 1617 im Frieden mit Russland, dass das Zarenreich den Zugang zur Ostsee einbüßte. Im Landeinneren gelang es dem König, den aufmüpfigen Adel mit dessen Einbindung in den Staat als Beamte und Offiziere ruhigzustellen. So festigte Gustav II. Adolf seine absolute Macht. Eine umfassende Heeresreform (1618–1625) befähigte den König nunmehr, auf eine schlagkräftige Armee zurückgreifen zu können. Erste Erfolge dieses neuen Machtmittels zeigten sich bei der Eroberung Livlands (1621–1629) und Teilen von Preußen, was zum Friedensschluss mit Polen führte.
Ermöglicht wurden diese Erfolge durch die gleichzeitige Entwicklung Schwedens von der Agrar- und Export-Ökonomie (Kupfer, Eisen) hin zur Manufakturproduktion. Es entwickelte sich in dieser Zeit ein immer selbstbewussteres Bürgertum und Handelsgesellschaften zeigten Interesse an überseeischen Kolonien, um neue Absatzmärkte und Rohstoffquellen zu erschließen. Nun war das Land in der Lage, den Bedarf von Armee und Flotte selbst abzudecken. Zu diesem Aufschwung trugen auch von den neuen Möglichkeiten angelockte niederländische, deutsche und wallonische Auswanderer bei. Diese brachten gleichzeitig auch Wissen auf anderen wirtschaftlichen Gebieten mit. Innerhalb kurzer Zeit erreichten bestimmte schwedische Produkte einen guten Ruf (Kanonen, Schiffszubehör) und wurden zu begehrten Exportschlagern. Hochfliegende Pläne von König Gustav II. Adolf, die auf diesen neuen Möglichkeiten fußten, hatten beispielsweise den Bau des Kriegsschiffes “Wasa” zur Folge, welches im um Livland geführten Krieg gegen Polen zur Blockade der Weichsel-Mündung vorgesehen war und das eine für die damalige Zeit gewaltige Größe aufwies. Allerdings sank das Schiff während seiner Jungfernfahrt am 10. August 1628. (Das Schiff wurde 1961 von den Schweden gehoben und ist heute im Vasa-Museum Stockholm zu sehen.) Trotz des Desasters zeigte sich bei diesem Schiffsbau, wie weit die schwedische Ingenieurskunst inzwischen fortgeschritten war. Außerdem begann die landwirtschaftliche Erschließung Mittel-Schwedens und Norrlands. Finnische Bauern wanderten in die Wälder im Norden ein und begannen mit Brandrodungen neues Ackerland zu gewinnen. Allerdings wurde diese Methode 1647 von der Krone verboten, da eine Forstwirtschaft sich als gewinnbringender zeigte. Auch der Abbau von Kohle erwies sich als lukrativ.
1630 schloss Schweden ein Bündnis mit Frankreich und wurde so, unterstützt mit Geldern aus Russland, zur Partei im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648). So gedachte Gustav II. Adolf den von Wallenstein im Namen Habsburgs erhobenen Ansprüchen auf die Ostsee entgegenzutreten. Nach der Landung der schwedischen Armee an der Oder-Mündung siegte sie in der Schlacht von Breitenfeld 1631 und ein Jahr später bei Lützen. Allerdings fiel dort König Gustav II. Adolf.
Die zu dieser Zeit besonders geförderte Rüstungsindustrie war in der Lage, alles Benötigte – ob Blankwaffen, Harnische, Helme, Feuerwaffen, Kanonen, Pulver und Geschosse – in ausreichender Menge bereitzustellen. Zu den schwedischen Erfolgen trug auch die Neuerung bei, Infanterie, Kavallerie und Artillerie aufeinander abgestimmt agieren zu lassen. Für Gustav II. Adolfs unmündige Tochter Kristina übernahm nach dem Tod des Königs eine adlige Vormundschaftsregierung unter Führung des Kanzlers Axel Oxenstierna die Regierungsgeschäfte und führte die begonnene Expansionspolitik weiter. Bei den Verhandlungen, die schließlich zum Westfälischen Frieden (1648) führten, bekam das schwedische Königreich einen Teil Hinterpommerns, Stettin, Vorpommern mit Rügen, das Zollrecht von Warnemünde, Wismar und die Bistümer Bremen (ohne die Stadt selbst) und Verden zugesprochen. Im vorher siegreich beendeten schwedischdänischen Krieg (1643–1645) erhielt Schweden nach dem Frieden von Brämsebro Gotland, Ösel, Halland, Jämtland und Härjedalen. Schweden stand auf dem Höhepunkt seiner Macht.
Abb. 2: Gustav II. Adolf vor der Schlacht bei Lützen (historische Postkarte)
Allerdings nötigten die gewaltigen Kriegskosten Königin Kristina und ihre Berater dazu, Krongüter an den Adel zu geben. Dadurch fühlten sich die Geldgeber in ihrer Macht gestärkt und versuchten, ihre Geltung auszuweiten. Kristinas Nachfolger Karl X. Gustav konnte mit der Hilfe der anderen Stände den Einfluss des Adels wieder etwas zurückdrängen. Die Expansionspolitik Schwedens verschlang immer mehr Ressourcen, noch dazu bei Niederlagen durch einen neuen Krieg mit Polen. Zwei Feldzüge gegen Dänemark waren erfolgreicher und brachten nach dem Friedensschluss von Roskilde 1658 neben Schonen einige andere kleine Gebietsgewinne. Wichtiger jedoch zeigte sich, dass Schweden erreichen konnte, dass die Dänen keinen Sund-Zoll mehr von ihren Schiffen erheben durften. Diese und weitere Kriege sorgten dafür, dass die schwedische Krone mit fortwährenden finanziellen Problemen zu kämpfen hatte.
Die europäische Invasion der Ostküste Nordamerikas
Die Geschichte der Entdeckung und Eroberung Nordamerikas durch die Europäer ist lang und wechselvoll. Schon im 11. Jahrhundert u.Z. erreichten die großartigsten Seefahrer Nordeuropas, die Wikinger, die Küsten Neufundlands, Labradors und Neuenglands. Es gibt verschiedene ungesicherte Indizien, dass auch andere Seeleute, meist unfreiwillig, ans nordamerikanische Festland gelangten. Aber ihre Entdeckungen blieben unbeachtet, gerieten in Vergessenheit und wurden zu Legenden.