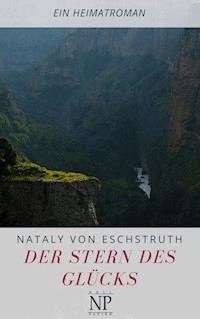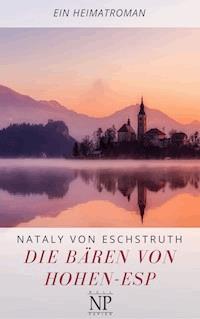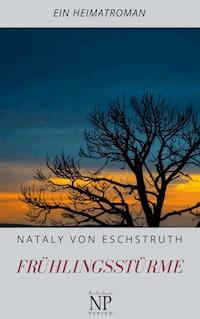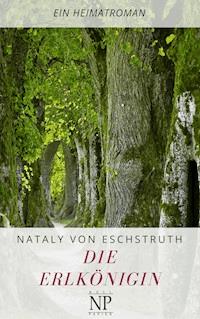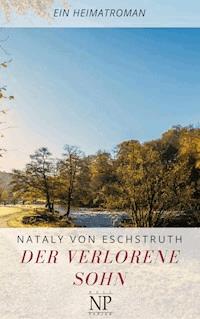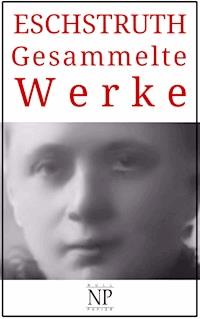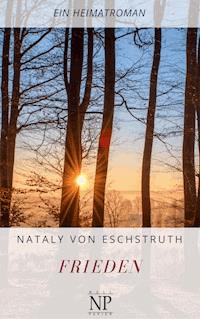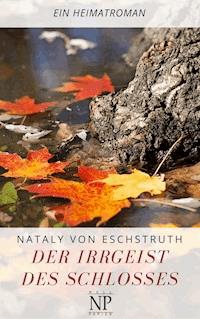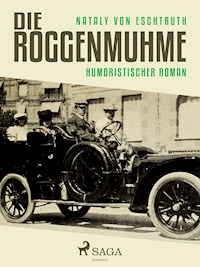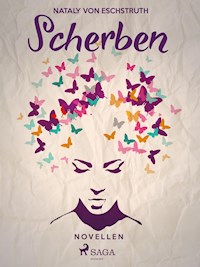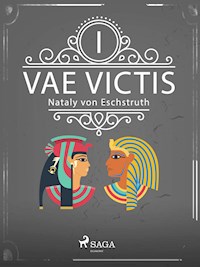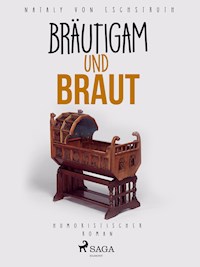
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerda ist ein stilles, ernstes Mädchen. Als die Mutter stirbt, wird sie zu einer unentbehrlichen Hilfe für den Vater, denn sie ist sein einziges Kind. Als der Vater jedoch wieder heiratet und mit ihrer Stiefmutter ein Kind bekommt, ist es ausgerechnet ein Sohn. Der Sohn, den ihr Vater sich immer gewünscht hatte! Gerda fühlt sich fortan im Hause ihres Vaters unerwünscht und macht sich auf in die Fremde, um endlich ihr eigenes Schicksal zu suchen ... in welches am Ende auf verrückte Weise auch ihr Stiefbruder Amadeus verwickelt sein soll ... Eine Doppelhochzeit, eine fast shakespearsche Verwechslung und viel Liebe!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nataly von Eschstruth
Bräutigam und Braut
Humoristischer Roman
Erste Auflage
Saga
Bräutigam und Braut
© 1920 Nataly von Eschstruth
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711472910
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Kapitel 1
Da kam mal ein Prinz,
mit dem ward sie getraut —
und er war der Bräutigam
und sie war die Braut! —
Quickborn
Bald heissts „Bräutigam und Braut“
Freischütz
Die Sonne ging auf. — Ein sieghaft strahlendes Licht.
Durch das Gewirr des im ersten Grün sprossenden wilden Weins flutete sie hinein in das stille Erkerstübchen, in welchem soeben eine schlanke Mädchengestalt mit ernsten, übermüdeten Augen an das Fenster trat, es zu öffnen. Ein tiefer Seufzer hob die flache Brust. — Sie strich noch einmal mit der Hand über die feuchten Wimpern und blickte wie in stiller, schwermütiger Ergebung zu dem Himmel empor. Leuchtende Strahlen zuckten über denselben wie verheissende Botschaft von Keimen, Wachsen, Blühen und Fruchttragen.
Noch wogten die knospenden Baumzweige im entscheidenden Wipfelkampf, aber sie reckten sich in der kommenden Ruhe schon jetzt so gewaltig empor, als seien sie das Wahrzeichen jener wonnesamen Verheissung: Die Glocken läuten von fern und nah — sie wollen frohlocken, der Lenz ist da!
Wird er auch für sie kommen? Für sie, das einsame alternde Mädchen, welchem das Leben nur Sturm gebracht bisher, von dem ersten Frühlingsbrausen bis zu dem grausamen Eiseshauch des Winters, welcher so manches — für sie wohl jedes grüne Blatt der Hoffnung unbarmherzig von dem Lebensbaum gerissen?
Was hatte sie erreicht? — Was hatte sich von all den goldenen Jugendträumen erfüllt? Sie war so einsam gewesen inmitten der lauten, bunten, geselligen Welt.
Ihr Vater, als Rechnungsrat, hatte wohl sein gutes Auskommen, aber kein Vermögen. Jahrelang eine kränkelnde Frau und wenig Hoffnung auf eine Aufbesserung seiner Verhältnisse. Da galt es sparen, sich einrichten, abknapsen wie und wo es nur anging. Die Tochter! — es war so gut, dass sie die einzige blieb, denn der Vater hatte kein Geld und Interesse für den Luxus, Bräute ausstatten zu müssen; ein Sohn wäre ihm als Erfüllung seines ehrgeizigsten Wunsches willkommen gewesen, denn so einem flotten Streber steht die Welt offen, und die Eltern haben Aussicht, von ihm — vielleicht noch einmal in glänzendster Weise — bedacht zu werden.
Aber sie, die so wenig hübsche, ernste, zu allen Sorgen neigende und im Schatten verkümmernde Gerda, — sie kostete nur Geld, als sie ihr Lehrerinnenexamen machte und alsdann nicht einmal eine Stelle annehmen konnte, wo sie die Ausgaben wieder einzubringen vermochte!
Die Mutter starb.
Schon seit den letzten Jahren hatte Gerda den Haushalt geführt, und nun war sie in ihrem kleinen Wirkungskreis unentbehrlich geworden, denn der Vater verlangte seine gewohnte Bequemlichkeit. Da ging alles in der alten Tretmühle weiter, und Gerda war zufrieden und Gott dankbar, dass sie noch ein Plätzchen auf der Welt hatte, was ihr Zuflucht gab. — Bis vor kurzer Zeit war es so gewesen, dann kam ein furchtbarer Tag, welcher in wildem Schicksalsbrausen abermals über sie dahinfegte, als wolle er auch den letzten Rest eines friedlichen Daseins im Vaterhause vor ihr niederreissen.
Ihr Vater hatte eine junge Dame kennen gelernt, sehr gute Familie, — jung, hübsch, anspruchsvoll, ein wenig kokett, aber ohne alle Existenzmittel, — und diese allerliebste kapriziöse, kleine Ballkönigin — verlobte sich mit einem stillen, verknöcherten Zahlenmenschen, dessen Haar und Bart bereits ergrauten!
Es gibt wunderliche Rätsel im Leben, welche oft nur die Zukunft löst, welche auch gar manchmal ungelöst bleiben wie etwas Dunkles, Unheimliches, welches das Kainsmal auf der Stirn trägt.
Wie ein schneidender Schmerz ging es durch die Seele der Tochter.
Sie konnte nicht an ein Glück glauben, welches nicht da war.
Wenn sie in das hagere Angesicht des Vaters sah, in welchem Eitelkeit und Ehrgeiz sich stritten, und die kleine Braut ansah, welche mit wissenden Augen den betagten Bräutigam anlächelte, als ob sie ihn auslachte, — dann — ja dann presste sie die Hände auf das wehe Herz und seufzte: „um wie wenig bin ich abermals von einem grausamen Schicksal verschachert!“
Da oben aber ging die Sonne auf wie das grosse leuchtende Auge Gottes, welches auch auf sie herabschaut und mit segnendem Strahl versichert: „Ich übersehe auch das kleinste, unscheinbarste Wegkräutlein nicht, wenn es mich nicht übersieht!“
Und nun sass sie schon die ganze lange Nacht hier in ihrem Zimmerchen und wartete auf die Entscheidung, wie die Würfel fallen würden.
Als der Vater sich verheiratete, sollte sie fürerst im Hause bleiben, um die leidende junge Frau, bis sie Mutter geworden, zu pflegen.
Sie hatte es treu und aufopfernd getan, obwohl sie wenig Dank, geschweige denn herzliche Sympathien von ihrer lebenslustigen Stiefmutter dafür erworben hatte.
Heute nacht sollte das Kind geboren werden. Auf dem Korridor ein heftiges Hin- und Herlaufen, zweimal schlagende Türen, dann wieder alles still.
Jetzt ein lautes jubelndes Lachen, ein ungestümes Herzueilen im Nebenzimmer: „Gerda! — Gerda! — ein Sohn!!“
Der Vater steht auf der Schwelle, sein Angesicht gerötet wie vom Wein.
„Gerda! ein Sohn!“
Er schreit es ihr zu, er wirft die Arme in die Luft und keucht: „endlich! endlich, das einzige, was ich mir zu dem Leben gewünscht habe! — Prachtjunge! ein Prachtjunge!!“
Er sieht nicht, wie seine Tochter erblasst und die Hände qualvoll zusammenschlingt.
Nein, — sie war nie seine Sehnsucht, nie sein Stolz — nie sein Glück gewesen.
Und die Sonne steht über den knospenden Wipfeln und wirft plötzlich einen Mantel von Gold und Licht um die arme Paria — und ein Windstoss kommt und beugt die triumphierenden Baumkronen tief hernieder.
Die Taufe von dem kleinen Amadeus Freienfeld hatte stattgefunden.
Ein Vetter des Rechnungsrats, der sehr repräsentabele junge Hauptmann Amadeus Freienfeld war zum Gevatter des Kleinen erkoren, und zwar hatte die sehr übermütige, junge Mama den Ausschlag dabei gegeben.
„Er heisst Amadeus!“ lachte sie. „Das ist, soviel ich weiss, in freier Übersetzung ‚Liebesgott‘ — nun, und welch ein Name wäre mir für unsern süssen Jungen lieber wie der? — Nomen est omen!“
So geschah es, und der kleine, blondlockige Bub lachte mit so grossen, „göttlich“-schönen Blauaugen in die Welt, dass er nach allgemeiner Ansicht den wundervollen Namen mit Fug und Recht trug!
Nur der Patenonkel hatte sich in längerem, sehr wissenschaftlichem Schreiben an die Taufeltern energisch dagegen verwahrt, dass er mit Amor in irgendwelchen verwandtschaftlichen Beziehungen stünde, denn nach § 20 des Deutschen Reichsgesetzbuches sei das unerlaubte Tragen von Schiesswaffen, vorsätzliche Körperverletzung, sowie Vagabundieren in aller Herren Länder und Strafentziehung durch Fahnenflucht für einen strengen Haudegen wie ihn etwas direkt Kompromittierendes!
Der Onkel konnte sehr amüsant sein, aber manchmal ward seine Originalität doch etwas schrullenhaft, denn obwohl er bei der Taufe sah, dass alle Anverwandten dem kleinen Liebesgott zum mindesten einen silbernen Löffel in den Kinderwagen legten, — tat er gar nicht desgleichen, sondern schmunzelte nur die Anwesenden an mit der wohl gut gemeinten, aber doch etwas allzu sparsamen Versicherung: „Ich schenke dem Schlingel meine Freundschaft, legt sie ihm man auf Zinsen!! Geld spielt bei mir ja gar keine Rolle — denn ich habe keins.“
„Schade, schade!“ ironisierte der Rechnungsrat. „Meine kleine Frau überlegt meist erst nach Torschluss! Wenn sie schlau gewesen wäre, hätte sie sich für ihren Amor den Paten auch aus der Mythologie holen sollen, — am besten den leistungsfähigen Pluto als Inhaber aller Stammaktien von Gold-, Silber- und Kohlenbergwerken!!“ — Da lachten alle hell auf, nur der Hauptmann lächelte.
— — — Wieder sass Gerda in ihrem Stübchen am Schreibtisch und schloss einen Brief. — Ihres Bleibens war nicht länger in ihrem Vaterhause.
Das Benehmen ihrer Stiefmutter ward von Tag zu Tag beleidigender, und es war nicht das erstemal, als sie ihr heute morgen als Antwort auf die Frage: ob Gerda Mutter und Kind noch nach dem Stadtgarten begleiten solle? — die satirische Bemerkung gab: „Amadeus ist noch zu klein — und ich bin schon zu gross für eine Gouvernante!“ —
Auch der Rechnungsrat schien von ihr beeinflusst, dass es doch unerträglich für eine selbständige Frau sei, Tag und Nacht beobachtet und gegängelt zu werden, was solch alte Jungfer wie sein Fräulein Tochter wohl als Berufsnotwendigkeit auf dem Seminar mit gelernt habe? — Die Zeit war um. — Gerda musste der neuen Herrin im Hause Platz machen.
Der Zufall spielte ihr eine Zeitungsannonce in die Hand.
Eine Holländerin, nahe beim Haag auf dem Lande lebend, geborene Deutsche, suche liebenswürdige, junge Dame aus nur bester Familie zur Gesellschafterin mit Salär. Antritt der sehr angenehmen, familiären Stellung am liebsten sofort.
Welch ein Glück, wenn sie solch ein anscheinend glänzendes Unterkommen finden könnte.
Soll sie ihre Photographie mitschicken? Ist das vorteilhaft? — Sie hat so wenig Äusseres, sieht auf allen Bildern so elend und vergrämt aus. Eine Gesellschafterin soll lachen, fröhlich sein! Alle Ängste und Sorgen verscheuchen, nicht aber ihre Stempel auf dem Antlitz ins Haus tragen!
Und doch! — Es ist so viel ehrlicher, wenn sie sich selber, ihr Äusseres, ihr Wesen und Charakter vorher decouvriert, damit die Leute nicht den Hasen im Sack kaufen. Sie schreibt einen kurzen, sachlichen Brief, legt seufzend ihr Bild ein und trägt das Schreiben, welches für sie ein Spiel um die Zukunft bedeutet, selber zur Post.
Tage qualvollen Harrens vergehen. Die Zeit scheint stillzustehn, wenn man jede Sekunde zählt.
Endlich kommt ein dicker Brief, auf steifes, elegantes Büttenpapier mit sehr grossen, etwas eckigen Buchstaben geschrieben. Es ist schon ein gutes Zeichen, wenn überhaupt eine Antwort kommt.
Und Gerda liest.
„Mein liebes Fräulein. — Das freut mich und meine Frau, dass Sie kommen wollen. Sie scheinen älter zu sein, nehmen das Leben, wie es ist. — Ernst, sehr ernst. — So kann man sich verstehen ohne grosses Larifari, was nur die Grossstadt hat; — hier auf dem platten Land sind wir alle von unserm Herrgott auf Vorposten gestellt, — jeder tut seine Pflicht. — Auf einliegendem Papier schrieb meine treue Hausfrau Eliza noch Näheres über Gehalt und Beschäftigung von Ihnen, — ist alles nicht schwer. Nur guter, braver Wille. So schreiben Sie, wann Sie abreisen wollen, — deutscher Konsul im Haag ist unser Wohlbekannter, da wenden Sie sich zuerst hin. So grüsse Sie Gott. Wir warten wohl nicht lang. Mit Respekt vermeldet sich
Willem van de Eskenboom.
Gerda liest voll atemloser Erregung. Sie faltet die Hände, blickt empor zum Himmel und dankt Gott.
Droben leuchtet die Sonne.
Als Fräulein Freienfeld abreist, ist eigentlich niemand da, von dem sie Abschied nehmen kann, oder der ihr noch einen letzten Gruss nachwinkt.
Ihre Stiefmutter ist mit dem Kleinen ausgefahren, das Wetter schien ihr unbestimmt, sie musste den günstigen Augenblick benutzen.
Von dem Kind hätte sie gern noch einen letzten lachenden Blick zur Erinnerung mitgenommen. Amadeus war der einzige, welcher sie freundlich ansah, nach ihrer Hand haschte und sich daran festhielt. Aber die Mutter war eifersüchtig.
„Es ist nicht praktisch, wenn er sich so sehr an dich gewöhnt, — er muss ja auch später mit mir allein fertig werden!“
So nahm sie ihr bescheidenes Gepäck und trug es sich selber zur Droschke hinab.
Ein paar Leute, welche obere Etagen und das Hinterhaus bewohnten, kamen und gingen, schauten gleichgültig über sie hin und schlugen die Haustür schmetternd ins Schloss.
Da schien es ihr, als wäre sie auf ewige Zeiten für eine Verwaiste geschlossen.
Was liess sie in der Heimat zurück? — Scherben.
Zertrümmertes Hoffen, zerschelltes Glück. Ein Jugendtraum ging wohl noch mit ihr, ein bleiches, tränenbetautes Blümlein, in kurzer Ballnacht erblüht, ein kleines Weilchen unter Qual und Herzweh gehegt und gepflegt, bis das Schicksal mit knöcherner Hand die welkenden Myrten von dem Zweig schlug und nur das Bild eines schlanken, eleganten, jungen Offiziers wie aus weiter Ferne ein Lebewohl zu ihr herüberwinkte.
Dazwischen aber lag ein Grab, — dahinein hatte sie ihre Jugend und Liebe gelegt.
Nun bahnte sie sich einen neuen Weg; in die Fremde.
Wird er rauh und steinig sein? Stürmisch und voller Dornen?
Sie weiss es nicht.
Wenn er nur nicht so kalt, so lieblos-einsam ist wie derjenige, welchen sie seit Kindesbeinen an wandeln musste, — wenn diesmal wenigstens eine einzige dauernde Blume darauf blühen möchte — diejenige der Vergessenheit.
„Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt!“
Wie oft hatte sie dieses schöne Zitat von Menschen sagen hören, welche nach genussreichen Reisen oder „Fahrten ins Blaue“ voll köstlicher Erinnerungen und Eindrücke heimkehrten und dem blassen Hausmütterchen Gerda gar nicht genug erzählen konnten, wie schön es da draussen in Wald und Feld oder in den eleganten Sommerfrischen, Grossstädten und auf Sportplätzen sei! — Und nun sass sie selber in der Eisenbahn und sauste vorüber an neuen Wundern, welche wie im Kaleidoskop an ihr vorüberwirbelten. — Zum erstenmal hatte sie keine Sorgen, denn Herr van de Eskenboom hatte ihr im Namen seiner Frau ein sehr generöses Reisegeld geschickt, welches ihr, der so sparsam Beanlagten, sogar ermöglichte, ein paar notwendige Anschaffungen in Wäsche und Kleidung zu machen.
So war ihr schon das Bittere erspart geblieben, den Eltern noch Kosten zu verursachen, und hätte ihr das etwas missgünstige Forschen der jungen Stiefmutter nicht die Freude vergällt, so wären schon die Vorbereitungen für die Reise ein seltener Genuss für sie gewesen.
Aber die Stiefmama hatte seit kurzer Zeit ersichtlich schlechte Laune, versicherte ihrem Gatten in recht taktloser Weise, das Geschrei eines kleinen Kindes bei Tag und Nacht sei wahrlich kein Vergnügen, und wenn Gerda ginge, müsste sie unbedingt eine Bonne für den Kleinen haben!
Ja, sie seufzte ein paarmal recht rücksichtslos auf, dass es doch eine Torheit sei, sich so früh zu binden, und dass sie besser getan hätte, auch erst mal ins Ausland zu gehn, um zu erleben und zu geniessen, sich in moderner Freiheit auszuleben!
Wenn geheiratet werde, — dann nur eine reiche glänzende Partie, alles andere sei ja doch nur Misere in der Potenz, der leidige Katzenjammer nach kurzer Verblendung!
Der Rechnungsrat hörte gelassen zu, zuckte ein wenig ironisch die Achseln und sagte nur zum Schluss: „Ganz meine Ansicht, liebes Kind, — und ich hätte doch durch meine Studentenzeit, wo man allerhand Damen kennen lernt, gewarnt sein müssen!“
Das nahm Geheimrats Töchterlein nun vollends übel, und es deuchte Gerda, als werde das Verhältnis der Ehegatten täglich kühler.
Der kleine Amadeus aber bekam eine Bonne, denn seine hübsche, kleine Mama hatte ein enormes musikalisches Talent bei sich entdeckt und nahm ohne die mindesten Rücksichten auf die erheblichen Kosten Gesangunterricht bei einer der ersten Bühnenkünstlerinnen.
„Um alles in der Welt! wem willst du denn als verheiratete Frau vorsingen, Luzie?“ fragte der Rechnungsrat entsetzt, als seine kapriziöse Gattin ihm die erste Monatsrechnung für Gesangstunden überreichte. „Du weisst’s, ich bin gar nicht musikalisch, Musik macht meinen überanstrengten Kopf nur nervös und eine Geselligkeit, welche derartige Kunstleistungen verlangt, haben wir nicht.“
„Das ist es ja!“ — tobte Frau Luzie entrüstet. „Auf alle und jede Freude muss ich in diesen vier Gefängniswänden des ‚home-sweet home‘!“ — sie lachte scharf und ironisch auf — „so wie so schon verzichten, — und nun soll ich auch noch meine einzige Passion, welcher in meinem Elternhaus unbedingt Vorschub geleistet wäre, opfern, weil mein Herr Gemahl zu nervös und ... unmusikalisch ist um schöne Künste zu würdigen!“
„Wenn die schönen Künste nicht zu teuer und ich nicht zu elend wäre, würde ich gewiss nichts dagegen haben —.“ Der Sprecher hustete krampfhaft auf und tastete, wie in letzter Zeit öfter, zerstreut nach seiner schmalen Brust, als schmerze sie ihn. „Dein Vater war mein Vorgesetzter, Luzie! Er kannte mich und meine Verhältnisse, und doch machte er mir Mut, um dich zu freien!“
„Ja, ja! er wusste, dass du kränklich — sogar recht bedenklich asthmatisch seist —“ antwortete sie kurz, voll grausamer Rücksichtslosigkeit, „darum nahm er wohl bestimmt an, dass du alles tun würdest, um mich sicherzustellen, falls ich Witwe werde und für deinen Sohn sorgen muss. Frag ihn nur! Er wird dir schon klar machen, dass es deine Pflicht ist, mich zur Sängerin ausbilden zu lassen, denn dies wäre doch der einzige Beruf, durch welchen ich noch mein Brot verdienen könnte!“
Der alternde Gatte der jungen Frau blickte schweigend vor sich nieder. Er verzichtete auf eine derartige Rücksprache mit seinem „Brotherrn“.
Wie gern hätte er mal etwas für seine angegriffene Gesundheit getan!
Der Arzt hatte schon im vergangenen Winter, als er sich so schwer erkältet hatte, davon gesprochen, dass ein Aufenthalt in Görbersdorf doch recht zu empfehlen sei. — Je nun, es war bei den vielen Ausgaben seines neuen Hausstandes nicht möglich.
Sein Schwiegervater hatte ihn übertaxiert, man verlangte soviel ... und ihm war es peinlich, dem hohen Herrn, welcher von Anfang an eine Gnade daraus gemacht hatte, ihn in die Familie aufzunehmen, reinen Wein einzuschenken.
Mit Spott und scharfen Anzüglichkeiten kam er weder bei Luzie noch Geheimrats durch, das hatte er bald erkannt, — bei Gerda war das etwas anderes, da war er noch Respektsperson im Hause, — aber jetzt?
Nur keine Szenen!
Es war ja zum Verzweifeln, wenn der Schwiegerpapa ihn vor den missgünstigen Kollegen en canaille behandelte!
Also Luzie verlangte die rasend teuren Gesangstunden, und Herr Freienfeld bezahlte sie.
Das war der letzte, so jammervolle und trübselige Eindruck, welchen Gerda aus dem neuen Eheleben des Vaters mit in die Fremde nahm.
Und nun wehte eine andere frische Luft daher!
Durch die offenen Kupeefenster strich sie wie tröstend um ihre Stirn, und das blasse Mädchen atmete auf, als seien ihr plötzlich viel schwere Lasten von den Schultern genommen.
Noch wusste sie nicht, was ihr für ein neues Kreuz aufgebürdet werden sollte, — aber die Not um das Geld, die grausige tägliche Sorge, jedes Schwefelhölzchen und jede Kartoffel angstvoll berechnen zu müssen, die war wohl für lange Zeit von ihr genommen, wenn sie treu und rechtschaffen ihre Pflicht tat, wie Eskenbooms dies von ihr erwarteten.
Welch ein neues, fremdes Leben in Holland!
Wie ist da alles und jedes so interessant, selbst bei kurzem Aufenthalt auf den Bahnhöfen, wie schon die eigenartige Sprache sie in eine unbekannte Welt versetzt.
Im Haag! Welch eine Flut köstlicher, hochinteressanter Eindrücke!
Gerda ist auf das angenehmste überrascht, eine geradezu freundschaftliche Aufnahme im Hause des deutschen Konsuls zu finden. Welch hochgeachtete und allgemein geehrte Familie müssen die Eskenbooms sein! Um ihretwillen bereitet man der Tochter des deutschen Beamten eine so scharmante Aufnahme!
Frau Eliza — die ehemals auch deutsche Reichsangehörige und Tochter eines Grosskaufmanns, welchen überseeische Beziehungen nach Holland geführt, hatte Herrn Willem im Hause des Konsuls kennen gelernt. Da es ein Ausflug an die See war, welcher in grösserer Gesellschaft unternommen wurde, und Jupiter Pluvius gerade an diesem Tage alle Schalen, Krüge und Wannen voll konzentrierten Platzregens über die fröhlichen Naturschwärmer ausgoss, so flüchtete die sylphenhafte zarte, allerliebste Eliza unter den gewaltigen Düffelmantel des Herrn Willem van de Eskenboom — und dieser fand, dass es doch gar reizend sei, so ein ängstlich flatterndes Vöglein schützend unter die kraftvollen Schwingen zu nehmen.
„Jongfru Eliza,“ sagte er feierlich: „wann es Ihnen gefällt, bei mir unterzukriechen, so schlage ich Ihnen hochachtbar und in Ehren vor, bleiben Sie in dieser Formation als meine sehr liebe Hausfrau bei mir, — ich will Sie allzeit mit meinem Mantel vor jedem Sturmwind und mit diesen starken Armen vor allem Erdenleid beschützen, soweit dies in Menschenwillen steht!“
Es regnete furchtbar! So rasend nasses Wasser brauste um sie her, dass Eliza ganz schelmisch unter dem prachtvoll warmen, weichen Mantel zu dem blonden Riesen emporlächelte und flüsterte: „Wenn die Liebesflammen in Ihrem Herzen selbst bei diesem Wolkenbruch nicht gelöscht sind, Herr Willem, riskiere ich es in vollster Überzeugung und bleibe bei Ihnen!“ — Da lachte er, denn ihre Fröhlichkeit hatte es ihm angetan, und lachte noch mehr, als sie ihm erst mit ihrem duftenden Taschentüchlein die Rieselbäche aus dem Bart trocknete und ernsthaft sagte: „Du bist ein Landwirt, Willem, mit deiner Kuhmilch kannst du planschen, — was ich auch nicht hoffe — bei Liebesküssen aber wird nicht gestreckt!! — Das merke dir für alle Zeiten!“ — Und er merkte es sich und küsste seinen so lustigen Schatz, und sie küsste ihn, — wie oft? — Das hat niemand gezählt, aber erzählt hat man es sich in der ganzen Gegend, dass es kaum ein glücklicheres Paar gäbe, wie Herrn Willem van de Eskenboom und seine übermütige Frau! Deren Fingerchen war zwar nur fünf Zentimeter lang, aber sie wickelte den grössten Mann Hollands von bald zwei Metern Länge und einem Gewicht von schier zwei Zentnern glatt um dieses Liliputchen herum und bewies dadurch aufs neue, dass der wahren Liebe allerdings nichts unmöglich ist!!
Diese kleinen Vorgeschichten ihres zukünftigen Hausgenossen erzählte man Gerda schon am ersten Abend, als man gemütlich beim Tee sass und draussen abermals gewaltige Regenböen gegen die Fenster gepeitscht wurden.
„Sie haben das grosse Los gezogen, mein bestes Fräulein, dass Sie unserer allerliebsten Freundin Eliza nunmehr als freundlich helfender und sorgender Geist zur Seite stehen sollen! Sie müssen nämlich wissen, dass der Klapperstorch auf dem Gutshaus von Esken sein Nest gebaut hat, und dass er in nicht allzuferner Zeit wohl Hoflieferant bei dem glücklichen Paar wird! — Neulich war dasselbe bei uns zum Essen, und da es Schalmandeln zum Dessert gab, ass die junge Frau alsobald ein Vielliebchen mit dem Gatten.
‚Wenn ich gewinne, ist’s ein Junge — und wenn du gewinnst, Willem — ist’s ein Mädchen!‘
‚Ja, ja Liebling! Aber was soll ich dir schenken, wenn du gewinnst?‘
Da lächelte sie so schalkhaft, wie es eben nur Frau ‚Eliza‘ kann, nahm seinen Kopf zwischen die Hände und zog sein Ohr ganz nah zu sich heran.
Sie flüsterte ihm etwas hinein.
Eskenboom aber schrie laut auf vor glückseligem Gelächter, starrte meinen Mann und mich an wie verklärt und wiederholte atemlos: ‚Noch eens!!‘ sagt sie! ‚Damit wir uns nicht zanken!‘ — Diese Geschichte aber nur à discretion erzählt, sie fällt mir gerade ein, da ich an Ihre künftigen Obliegenheiten denke, Fräulein Freienfeld!“
„Wie heiter beanlagt muss die junge Frau sein,“ nickte Gerda. „Da wird es mir beinah Angst, ob ich mit meinem ernsten, stillen Wesen zu ihr passen werde?“
Ein feines Lächeln spielte um die Lippen der Frau Konsul.
„Ich will einmal ganz ehrlich zu Ihnen sprechen, mein liebes Fräulein: Herr van de Eskenboom ist ein Original. In heutiger Zeit findet man wohl kaum ein Pendant zu ihm. Goldehrlich! So treu, so aufrichtig, so angstvoll bemüht, auch nie mit einem Gedanken von dem Pfad der Tugend zu weichen und seiner vergötterten Frau das Gelübde zu halten, welches er ihr getan. Das sind die Grundzüge seines Charakters. Nun hat er sich in den reizenden Humor seines schelmischen Weibchens bis über die Ohren verliebt. — Er weiss es selber, dass nichts eine solche zärtliche Gewalt über ihn hat wie die Fröhlichkeit. Seine Eliza ist für ihn der Inbegriff alles Entzückenden, und er bringt jeder andern Dame, welche es ihm durch ihre Heiterkeit antun könnte, das grösste Misstrauen entgegen. — Gerade Ihr ernstes Wesen hat bei ihm den Ausschlag gegeben, Sie an die Seite seiner Frau zu rufen. Er möchte sich nicht unnötig in Gefahr bringen und den Verkehr mit jedweder andern Dame so ungefährlich für sich und sein Glück gestalten wie möglich! Solche Ansichten sind so edel, dass man sie gar nicht genug bewundern kann! — Also jedes ernste, nicht witzige Wort von Ihnen ist für den wackern Eskenboom ein sanftes Ruhekissen! Das wird auch Ihnen lieb sein!“
Kapitel 2
Da Gerda die freundliche Einladung der Frau Konsul von Lehnsdorf angenommen, ein paar Tage bei ihnen auszuruhen, um auf Wunsch des so liebenswürdigen Eskenboomschen Ehepaars Haag kennen zu lernen, so harrten ihrer Genüsse, welche sie daheim sehr selten, fast nie kennen gelernt hatte. Nach der Oper sollte noch ein elegantes Restaurant besucht werden, was für das so sparsam gewöhnte alternde Mädchen ein ganz neuer, reizvoller Eindruck war. Die Anregung dazu hatte ein auf dem Konsulat viel verkehrender Grosskaufmann gegeben, welcher auch in der Loge den Platz neben Frau von Lehnsdorf eingenommen.
Schon sein Äusseres verriet den Bonvivant und schien das Original, nach welchem verschiedene moderne Lustspieldichter so köstlich kopiert hatten.
Friedrich Karl Rösing war ein kleiner, sehr beweglicher Herr, trotz seiner Wohlbeleibtheit voll nervösem Temperaments, sehr gern witzig, anspruchsvoll die Unterhaltung führend und sich als massgebend in derselben behauptend.
Man musste ihm zuhören, zu rechter Zeit lachen oder empört sein über das, was just von dem Sprecher angestrebt ward, denn Widerspruch regte ihn auf, wirkte schädlich auf seinen Appetit und war ihm daher bei den Mahlzeiten ganz besonders verhasst.
Er ass gern, sehr gut und recht viel und konnte sich zur Raserei erregen, wenn ein Tischgenosse eine Speise, welche er schätzte, gleichgültig oder gar widerwillig ass, — dieselbe zu verweigern, würde einen Riss selbst in die älteste und beste Freundschaft gemacht haben, welcher als Gegenleistung und Schadenersatz selbst durch indische Vogelnester und märchenhafte Kabinettweine nicht wieder gutzumachen war.
In seinem Freundeskreis behauptete man daher, lediglich diese so stark entwickelte Eigenheit trage die Schuld an seiner Ehelosigkeit, denn noch hätte Herr Friedrich Karl Rösing trotz ungeheurer Anstrengungen seiner- und andererseits noch nicht diejenige gefunden, welche er voll Überzeugungstreue zum Altar führen konnte.
„Um alles in der Welt, Kinder! keine so lustige, fidele, kleine Schraube, die einen Tag und Nacht nicht zur Ruhe kommen lässt! Fremde Witze sind mir niemals egal, denn in der Regel ärgert es mich, dass ich sie nicht gemacht habe, und wenn ich kribbeliger Kerl auch noch ununterbrochen angeregt werde, gehe ich vollends aus der Tüte! — Also Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Geld, Familie — Äusseres, Alter — das ist mir nun tatsächlich schnuppe, denn dies erachte ich für Nebensache, weil ich darin auch die Hauptsache repräsentieren möchte. Wo nun eine Frau finden, welche trotzdem meinem grossen Haushalt vorstehen und ihn voll guten Verständnisses repräsentieren kann?“
Ja, da war guter Rat teuer, denn Herr Rösing war eine glänzende Partie, und wie Mückenschwärme wurden ihm die jungen Damen aus aller Herren Länder zur Brautschau zugeführt.
Aber wer so viel begehrt ist, wird mit der Zeit misstrauisch, und kam nun eine Heiratsaspirantin, auf deren vorzügliche passende Eigenschaften er von vornherein aufmerksam gemacht wurde, so war dies verfehlt. — Lachte und scherzte sie, so wandte sich Friedrich Karl indigniert ab, und war sie grüblerisch, sinnend, jeder Zoll Tragödie oder Charakterrolle, so fuchtelte der Vielbegehrte nur mit hellem Gelächter beide Hände durch die Luft und wehrte jeden weiteren Ansturm mit der Versicherung ab: „Euch Gauner durchschaue ich! Nichts wie Bluff!! War wohl ein sauer Stück Arbeit, die allerliebsten Mädels auf den Mann zu dressieren?! Nee, nee, auf den Leim krieche ich nicht! Und ausserdem — alle viel zu hübsch! viel zu jung! — Geht mir zu sehr auf die Nerven! Besten Dank für weitere Bemühungen — ich wachse mich täglich mehr zum Erbonkel aus!!“
Da musste man es eben dem guten Zufall anheimgeben, dem scharmanten Sonderling freizustellen, ob ihm das Glück auch einmal ein wattiertes Pantöffelchen in den Schoss warf!
Heute nun hatte er in der Theaterloge neben Frau von Lehnsdorf gesessen um durch sein Monokel die neue Erscheinung Gerda in ihrem sehr schlichten dunkelblauen Reisekleid mit der wohl modernen, aber doch recht anspruchslosen Frisur anzustarren. So viel Resignation im Äusseren und Wesen hatte er lange nicht gesehen.
Das wirkt verblüffend.
„Wie heisst die Dame neben ihren, Gatten, gnädige Frau?“
„Fräulein Gerda Freienfeld!“
„Also schwarz-weiss-rot — obwohl sie blau aussieht?“
„Stimmt; vom Scheitel bis zur Sohle deutsch.“
„Hm. Eltern in Öl?“
„Schämen Sie sich! — Halbwaise.“
„Geld?“
„Vakat. Gesellschafterin bei Eskenbooms.“
„Alle Donner! — — Familie?“
„Ausgezeichnet. Vater Rechnungsrat.“
„So—so! Noch viel Anhang?“
„Ach nein, sie steht wohl ganz allein im Leben, da die junge Stiefmutter den Platz im Hause für sich allein beansprucht.“
„Also Frau Rechnungsrat!! Hat sie auch noch weitere Stiefkinder zu berechnen?“
Selbstredend pruschtete die Frau Konsul vor Lachen über die drastischen Bemerkungen, was Herrn Rösing herzlich freute.
„Nein, sie ist einzig in ihrer Art!“
„Uff! Das wäre die erste! Sonst doch immer im Dutzend billiger!! Na — und ist sie immer so stillvergnügt wie heute?“
„Ob vergnügt, weiss ich nicht, still allem Anschein nach sehr!“
„Sie scheint sich königlich zu amüsieren! Hat glührote Wangen vor Entzücken über den Schnädderedeng da unten, — aber sie belästigt niemand damit! Neulich war ich Zeuge, wie so ein hysterischer Backfisch beinah den Veitstanz vor Fröhlichkeit bekam und den Vater jeden Bühnenwitz noch einmal extra in die Ohren krisch, dieweil sie der schwergeprüften Mutter die Ärmel dabei vom Leibe riss! — Grässlich! Ich sage Ihnen — grässlich! Ebenso nachher bei Tisch — das Kapitol mit sämtlichen Alarmgänsen muss die Insel der Vergessenheit dagegen gewesen sein!“
„Sollten Sie nicht ein klein wenig übertreiben, bester Herr Rösing?“
„I wo! Ich passte auf! Der kleine Lork sollte ja zur Attacke auf mich gehetzt werden! Übrigens — wie alt ist denn die Germania da neben Ihrem Gatten?“
„Ich taxiere auf Mitte der Dreissiger!“
„Also doch! Glaubte, sie sähe nur so ein bisschen verhungert aus.“
„Das wird sich bei Eskenbooms wohl bald begeben!“
„Will sie denn lange da im Haus bleiben? Man bloss nicht so ein Dauer- und Trauergelöbnis mit bindender Haft!“ — Herr Friedrich Karl hatte das Augenglas eifrig mit dem eleganten Battisttuch poliert, klemmte es wieder ein und starrte mit dem andern unbehinderten Auge ungeniert auf Gerda hin, welche ihn vollkommen ignorierte und in selig verklärter Ruhe die wonnigen Melodien auf sich wirken liess.
„Ich finde, Musik macht hungrig!“ fuhr Rösing nachdenklich fort. „Mir ist’s, als haute mich der Kerl da unten an der grossen Pauke immer auf den Magen! Finden Sie nicht auch, gnädige Frau? Solche Püffer ins Gekröse wirken wie Massage. Ich schlage vor, wir fahren nachher alle zu dem ‚leckeren Mintepottje‘ im Konigin-Restaurant und studieren die Speisekarte!“
„Wenn mein Mann einverstanden ist, sehr gern!“
„Mann einverstanden!!“ rang Friedrich Karl die Hände. — „Was die Frau will, das will Gott! Also auch Ihr vergötterter Haustyrann! Wenn Sie ihm jetzt erklären, der liebe, nette, gute, appetitliche — das heisst, der mit Appetit gesegnete — Freund Rösing hat uns eben alle, — Logierbesuch dito — zu einem Ohnmachtshappen eingeladen, dann möchte ich mal den sehn, welcher seine Gattin hungern liesse!!“
Und so war es tatsächlich.
Als Herr von Lehnsdorf hörte, dass Rösing summa summarum deutsches Konsulat zu einem seiner bekannten einfachen, kleinen Ohnmachtshappen eingeladen, lockerte er unbemerkt die zu engen Knöpfe an der Weste und nickte: „Aber selbstverständlich! Wir haben Zeit, dass Sie Umstände machen können!“
So fuhr man zum Souper.
Gerda war so plaziert, dass der Gastgeber sie ungeniert beobachten konnte.
Und das tat er.
Er bestellte sich gleich nach dein Hühnerfrikassee nach eine zweite Portion.
Das war ja etwas Entzückendes, wie es dem Mädel da drüben schmeckte!!
Und wenn er eben von einer Mastsitzung aus der Bar riche gekommen wäre, der Anblick von Gerda Freienfeld hätte ihn zum ausgehungerten Tiger gemacht. Seltsam! Wie solch ein Essen voll verständnisinnigen Genusses bei dem Zuschauer den Appetit anregt!
Und wenn er irgend was Ulkiges sagt, dann lachen ihre Augen — innig! Fabelhaft! Er hat das Empfinden, als schüttelten sich ihre sonst so ernsten Augen ordentlich vor Lachen, — aber reden tat sie nicht dabei.
Merkwürdig! Höchst merkwürdig!
Ein Heiterkeitserfolg, welcher ihm wohltut und nicht geniert.
Ob das wohl immer so bei ihr ist?
Er hat nie so recht begriffen, warum es Männer gibt, die „maulfaule“ Weiber um solcher Tugend willen missachten. Das sind meistens Stösel, welche selber nicht viel goldene Worte zuzusetzen haben! — Er denkt anders darüber.
Nur ein einziges mal redete er Fräulein Freienfeld an.
„Gar nichts Besonderes, — so vielleicht — ob es heute Dienstag wäre?“
Für gewöhnlich blitzen ihn dann die Augen der Interviewten an, empört — ironisch, gelangweilt — oft recht indigniert.
Das ist so sein Barometer.
Bei Fräulein Gerda bleibt er auf „beständig“ stehen.
Sie sieht ihn freundlich an und versichert, dass es heute Dienstag ist.
Er zieht die Uhr.
„Sie irren sich, — es ist schon Mittwoch, — fünf Minuten über zwölf.“
Die meisten nehmen so was übel. Selbst die Frau Konsul klappt ihn mit ihrem Tulpenstengel auf die Hand und sagt schmollend: „Sie Unverbesserlicher!“