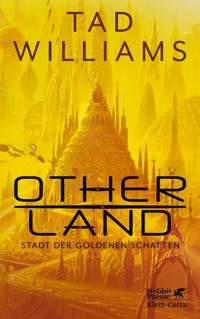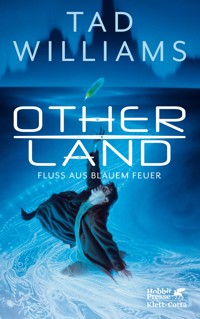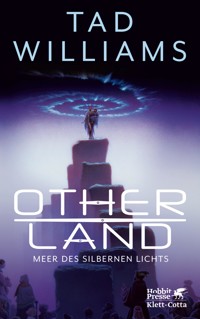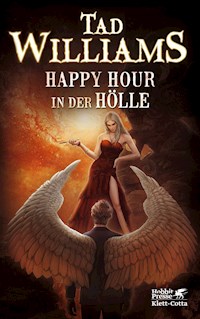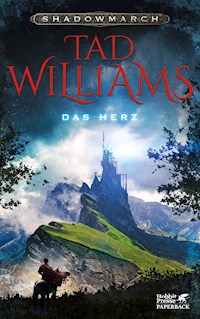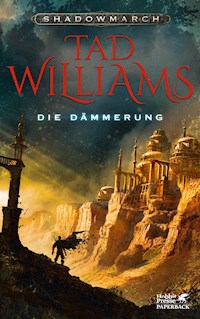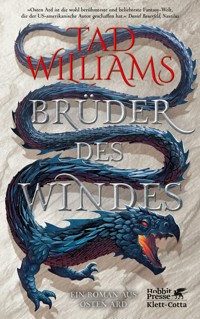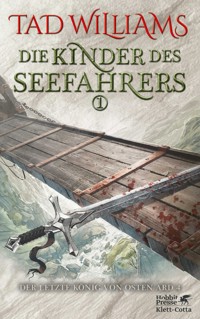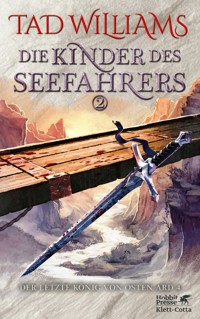
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ganz große Fantasy, die an Der Herr der Ringe heranreicht.« Cincinnati Post Die Geschichte Osten Ards umspannt viele Zeitalter. Sie zu erzählen brauchte viele viele Jahre. Aber jetzt hat Tad Williams, der große Meister der Fantasy, das Werk um den einstigen Küchenjungen Simon, der König wird, vollendet. Die Fantasywelt ist um ein großes abgeschlossenes Epos reicher! Und in Tanakirú, dem Tal der Nebel, ist die Bindung zwischen Prinz Morgan und Nezeru, einer abtrünnigen Norne, ernster und seltsamer geworden, als beide es erwartet hätten. Sie dringen immer tiefer in das Herz des geheimnsivollen Tales ein, begegnen Wundern und Schrecken und stehen schließlich dem uralten Rätsel gegenüber, das den Krieg der Nornenkönigin entfacht hat – ein Mysterium, das Unsterbliche und Menschen gleichermaßen bedroht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tad Williams
Die Kinder des Seefahrers 1
Der letzte König von Osten Ard 4
Aus dem Amerikanischen vonCornelia Holfelder-von der Tannund Wolfram Ströle
Klett-Cotta
Impressum
Wegen des großen Textumfangs erscheint Die Kinder des Seefahrers.
Der letzte König von Osten Ard 4 in zwei Teilbänden.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Navigator’s Children.
The Last King of Osten Ard, book 4« im Verlag DAW Books, New York
© 2024 by Beale Williams Enterprise
© Karte by Isaac Stewart
Für die deutsche Ausgabe
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg,
unter Verwendung einer Illustration von © Max Meinzold, München
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96603-9
E-Book ISBN 978-3-608-12481-1
Widmung
Alle Bände der Reihe Der letzte König von Osten Ard widme ich meinen Lektorinnen/Verlegerinnen Betsy Wollheim und Sheila Gilbert sowie meiner Frau und Partnerin Deborah Beale.
Inhalt
Widmung
27
Ein Ogernest
28
Der Meerstein
29
Ein letzter Sonnenuntergang
30
Yedades Kasten
31
Stummes Lachen
Hakatri
Intermezzo
32
Illumination
33
Kaltes Herz und kalte Klinge
34
Das Versprechen des Endes
35
Witwen
36
Der Spielzug
37
Unter der Maske
38
Lebensblut
39
Ein feuriger Strahlenkranz
40
Neuigkeiten
41
Verhandlung
42
Unangenehme Erkenntnis
43
Alter Groll
Dritter Teil
Hexenholzkrone
44
Der nähere Wolf
45
Zwei Pferde auf einer Wiese
46
Ein ruhiger Ort
47
Die Öffnung unter dem Stein
48
Eine lange Nacht
49
Vermächtnis
50
In Maßen
51
In der Dachsstraße
52
Das auferstandene Königspaar
53
Die Reise einer Bücherlaus
54
Familienangelegenheiten
55
Ein Engel, der aus Sternen gemacht ist
Glossar
Personen
Erkynländer
Hernystiri
Rimmersgarder
Qanuc
Thrithingbewohner
Nabbanai
Perdruineser
Wranna
Sithi (Zida’ya)
Nornen (Hikeda’ya)
Tinukeda’ya
Andere
Geschöpfe
Orte
Sonstige Namen und Begriffe
Sterne und Sternbilder
Die Feiertage
Die Wochentage
Die Monate
Wurfknöchel
Die Acht Schiffe
Orden der Hikeda’ya
Die Clans der Thrithinge (und ihr Thrithing)
Wörter und Sätze
Qanuc
Sithi (Zida’yaso)
Nornen (Hikeda’yasao)
Anderes
27
Ein Ogernest
Zunächst war es für Morgan leicht, der Spur des Uro’eni zu folgen. Sooft der Oger von einer Höhlenkammer in eine andere schlüpfte, wetzte er Steinbröckchen vom Rand des Durchgangs ab. Manche dieser Öffnungen schienen verblüffend klein für eine so gewaltige, massige Kreatur, aber die Häufchen von frisch losgebrochenem Stein sagten Morgan, dass das Monster immer noch vor ihm war. Die Höhlenkammern und Gänge, durch die es sich bewegte, schienen endlos weiterzugehen, als wäre der Berg, der vom Deck des Schiffs aus so massiv gewirkt hatte, kaum mehr als ein riesiger Kaninchenbau im Kalkstein.
An vielen Stellen liefen Wasserrinnsale die Wände herab oder über den Boden. Morgans Stiefel waren durchweicht, noch ehe er weit gekommen war. Manchmal saßen an den Höhlenwänden Klumpen von Kristall wie in den vom Wasser gegrabenen Gängen, durch die sie zu dem großen Schiff gelangt waren. Mit jedem Schritt tiefer in den Tunnel hinein verstärkte sich Morgans Gefühl, die Welt, die er kannte, hinter sich zu lassen.
Idiot, schalt er sich. Du hast in einem magischen Sithi-Schiff gehaust. Die Halb-Unterbliche, die du zu finden versuchst, wurde von einem kirchturmgroßen Oger entführt. Und Nezeru selbst ist eine Soldatin der Königin. Die Welt, die du kanntest, ist schon lange nicht mehr da.
Und das Ich, das ich kannte, auch nicht, wurde ihm jäh klar. Ich werde nie wieder jener Morgan sein.
Während er beharrlich dem Oger folgte, begann Morgan sich zu fragen, ob nicht das Monster selbst weite Strecken des Bergs ausgehöhlt hatte. Die großen Höhlen, die ihn durchsetzten wie die Zellen einer Bienenwabe, waren eindeutig natürlichen Ursprungs, aber die weiten Gänge, die sie verbanden, schienen oft mit schierer, roher Gewalt durchs Gestein gegraben worden zu sein. Vielerorts hatten die Wände Rillen wie von riesigen Krallen.
Wenn auch die Spuren von etwas so Großem leicht zu finden waren, war es doch, wie Morgan bald feststellen musste, nicht immer leicht, ihnen zu folgen. Manche der steilen Stellen, über die er hinabgelangen musste, waren für den Oger sicher nur flache Stufen gewesen, aber für Morgan waren sie wie Felskliffs, und er war froh, dass er im letzten Jahr so viel in Bäumen und über glitschige Höhlenkristalle geklettert war. Mehr als einmal hing er plötzlich nur noch mit den Fingern oder mit einer Hand und einer Stiefelspitze am Stein. Der Abstieg dauerte weit länger, als er gedacht hatte, doch er beeilte sich nach Kräften, denn mit jedem Moment, der verging, fürchtete er mehr um Nezeru. Dann jedoch stieß er auf ein Hemmnis, das er auch durch noch so geschicktes Klettern nicht überwinden konnte.
Er befand sich vor einem bröckelnden, bogenförmigen Durchgang zu weiteren Höhlenkammern. Das Loch war eindeutig groß genug, selbst für etwas von der Größe eines Ogers, und der Höhlenboden darunter war mit Kalksteinbröckchen übersät, die das Monster beim Hindurchschlüpfen abgebrochen haben musste – das hier war sichtlich ein von dem Oger vielbenutzter Durchgang. Das Problem war nur, dass in der gegenüberliegenden Wand der weiten, niedrigen Höhlenkammer noch ein Loch war, fast genauso groß und ebenfalls mit den Steinbröckchenspuren des Uro’eni.
Barmherziger Gott und alle Heiligen, helft mir! Es ist nicht nur ein Tunnel unterm Berg, dieses Etwas hat hier unten ein ganzes Labyrinth. Wie soll ich erraten, welchen Weg es genommen hat? Auf die schreckliche Entdeckung folgte unmittelbar die mit Scham und Schmerz verbundene Erkenntnis: Nezeru, es tut mir so leid, ich lasse dich im Stich.
◆
Nur wenige Augenblicke waren vergangen, und doch war alles anders. Tzoja konnte nur fassungslos dastehen und auf die immer noch wackelnden Äste starren, da, wo Jarnulf und Goh Gam Gar verschwunden waren.
»Komm raus«, sagte sie zu Vordis. »Der Riese ist weg. Sie sind beide weg.«
Vordis tastete sich aus ihrem Versteck hervor. »Beide?«
»Jarnulf ist ein Freund des Riesen. Oder sein Schoßtierchen.« Tzoja war wütend, obwohl sie wusste, es war nicht allein seine Schuld. Aber nicht genug damit, dass Jarnulf und sein Monster sie hier mitten in einer völlig fremden Gegend alleingelassen hatten, – er hatte es auch noch getan, nachdem er ihr gerade gestanden hatte, dass er, der Mann, den sie vor Folter und Tod gerettet hatte, derjenige war, der ihre Tochter Nezeru in Schande gebracht hatte, sodass sie aus dem Orden der Opfermutigen ausgestoßen worden war.
»Was tun wir jetzt?«
Tzoja schüttelte den Kopf, und dann erst fiel ihr ein, dass ihre Freundin es ja nicht sehen konnte. »Ich weiß nicht. Ihnen folgen vermutlich.«
»Ihnen folgen? Aber sie wollten Hikeda’ya-Soldaten töten! Das habe ich den Riesen sagen hören!« Vordis’ Stimme zitterte. »So eine Stimme habe ich noch nie gehört. Ausnahmsweise bin ich froh, dass ich blind bin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so eine grässliche Kreatur sehen zu müssen. Wie konnte Jarnulf mit dem Monster mitgehen und uns alleinlassen?«
»Er hat gesagt, er schuldet dem Riesen einen Gefallen.« Aber sie wollte diesen Mann nicht entschuldigen – wollte ihren eigenen Zorn nicht aufgeben. »Hier sind wir nun, egal warum. Wir können versuchen, den Weg zurückzugehen, den wir gekommen sind, aber da bin ich Jarnulf gefolgt – ich weiß nicht, ob ich zurückfinden könnte. Und außerdem, zurück wohin? In diese Festung, wo man uns zuerst festgehalten hat, Naglimund? Das liegt jetzt in Trümmern.«
»Wir können im Wald etwas zu essen finden«, sagte Vordis, aber das Zittern ihrer Stimme untergrub ihre zuversichtlichen Worte etwas.
»Ja, das können wir, und zum Glück habe ich Jahre unter Heilerinnen verbracht und viel über Pflanzen gelernt. Aber wer weiß, was noch in diesen Wäldern lebt? Bären? Weitere Riesen? Jarnulf mag ja einen Riesen kennen, doch ich bezweifle, dass er sie alle kennt – die Königin hat viele in ihrem Heer.«
»Aber wenn wir Jarnulf folgen, gehen wir doch genau auf die Leute zu, die uns gejagt haben.«
»Ja, aber wenigstens haben wir eine deutliche Spur, der wir folgen können. Der Riese geht nicht um irgendetwas herum, er geht mitten hindurch. Und vielleicht müssen sie ja mal Halt machen. Der Riese war verwundet, hatte Schmerzen …« Sie verstummte. In Wahrheit schien nichts davon überzeugend, aber einfach nur warten, konnten sie nicht. Die Wolfsmondnächte würden eiskalt werden, und Jarnulfs Geschick als Jäger würde ihnen schmerzlich fehlen. Außerdem war er es auch gewesen, der ihre Unterschlupfe gefunden oder errichtet hatte. »Ich weiß es nicht«, gestand sie. »Aber mir fällt nichts Besseres ein. Ich glaube, wir müssen ihnen folgen.«
Vordis weinte leise. Sie wischte sich die Wangen ab. »Tut mir leid, Tzoja. Es ist beängstigend, nicht sehen zu können und weit weg von allem zu sein, was man kennt, aber ich werde tapfer sein wie du.«
»Mir tut es leid, dass wir in diese Situation gekommen sind, aber wir müssen das Beste daraus machen. Lass uns unsere Sachen zusammenpacken und losgehen, bevor ihr Vorsprung zu groß ist. Wir haben noch ein paar Stunden Tageslicht.«
»Du bist erschöpft, Liebes«, sagte sie zu Vordis. »Du stolperst schon.«
»Ich hätte nichts gegen eine Ruhepause, nur kurz.«
»Dann bleib hier. Ich gehe bloß ein kleines Stück weiter, schauen, ob da ein besserer Platz ist, um Halt zu machen.«
»Gehe nicht zu weit weg, bitte, Tzoja.«
Sie schwieg einen Moment nachdenklich. »Ich frage mich, ob ich diesen Namen behalten soll.«
Vordis hob den Kopf. »Das verstehe ich nicht. Bitte mach mir keine Angst. Du bist Tzoja.«
»So meine ich es nicht. Tzoja ist der Name, den mir Magister Viyeki gegeben hat. Die längste Zeit meines Lebens hieß ich anders – Derra.«
»Aber ich kenne dich als Tzoja.« Vordis schien wieder den Tränen nahe. »Es wäre zu seltsam, dich jetzt anders zu nennen.«
»Musst du nicht. Du kannst mich nennen, wie du willst. Es ist nur etwas, worüber ich nachdenke. Setz dich hin und ruh dich aus.«
Sie war erstaunt über sich selbst, während sie den gebrochenen Ästen und verschrammten Baumstämmen folgte, die die Spur des Riesen bildeten. Warum jetzt dieser Gedanke? Ich bin schon seit Jahren nicht mehr Derra. Ich nenne mich nicht mal im Geist so. Sie war von Viyeki umbenannt worden, und Viyeki war weg. Sie war von Jarnulf hierhergebracht worden, und Jarnulf war weg. Ich bin es leid, irgendjemandes irgendwas zu sein, ging ihr auf, und der Gedanke war wie eine unerwartete Brise an einem heißen Tag. Wenn ich das hier überlebe, tue ich nur noch, was ich will – was Derra wollte, bevor ihr alles genommen wurde, zuerst von den Skalijar-Banditen, dann von den Hikeda’ya.
Auf einer Lichtung blieb sie stehen. Ein aus dem Boden ragender keilförmiger Stein bot Schutz vor dem Wind, wenn auch nicht vor der Kälte, und die Spuren des Riesen waren auf der anderen Seite der Lichtung deutlich zu sehen. Wir haben nur noch wenige Stunden Tageslicht, dachte sie, und wir sind beide so müde. Wenn ich Vordis bis hierher bringe, können wir hier übernachten und morgen früh weitersuchen. Das wird reichen.
Sie war vielleicht zwei Dutzend Schritt zurückgegangen, als zwei dunkle Gestalten lautlos aus dem Schatten hervorglitten und ihr den Weg versperrten. Sie kannte diese Rüstung und brauchte die knochenweißen Gesichter der Soldaten nicht zu sehen, um zu wissen, wer sie erwischt hatte.
»Eine Nachzüglerin«, sagte einer der Opfermutigen. »Wir haben diesen verfluchten Riesen zwar nicht eingeholt, aber wenn wir diese streunende Ziege zur Herde zurückbringen, lässt uns die Anführerin vielleicht gnädig davonkommen.«
»Ich würde mich sowieso lieber auspeitschen lassen, als diesen Riesen zu finden«, sagte der andere und packte Tzoja grob am Arm. »Hast du seine Spuren gesehen? Es muss einer der größten sein, die wir haben.«
Plötzlich hörte sie Vordis rufen: »Tzoja, bist du das?«
»Noch mehr Nachzügler«, sagte der erste Opfermutige und packte Tzoja fester. »Wie viele sind da noch? Sind welche bewaffnet?«
Tzoja schüttelte den Kopf, geschlagen und ohne Hoffnung. Ihre Freiheit hatte keinen halben Tag gedauert, nachdem Jarnulf fortgegangen war. »Nur die eine. Sie ist blind – tut ihr nichts. Wir sind beide Anachoretinnen – wir dienen der Königin persönlich –«
»Unsere Anführerin wird sich das alles anhören«, sagte der zweite Soldat. »Ihr könnt ihr eure Geschichte erzählen. Wenn ihr Glück habt, macht sie euch nicht einfach einen Kopf kürzer fürs Weglaufen.«
»Wir sind nicht weggelaufen!«, sagte Tzoja. »Wir … wir wurden entführt. Gegen unseren Willen. Von einem entflohenen Gefangenen.« Sie zögerte, weil sie nicht einmal jetzt Jarnulfs Identität preisgeben wollte. »Und dann kam der Riese, und die beiden sind zusammen losgegangen.« Sie zeigte auf die Spur von gebrochenen Zweigen. »Da lang.«
Die Soldaten wechselten einen Blick, dann wandte der erste sich an sie. »Der Riese, sagst du. Warum seid ihr ihnen gefolgt, wenn euch dieser Gefangene gezwungen hat, euch vom Rest der Kolonne der Königin zu entfernen?«
Sie hatte kurz vergessen, dass es sehr wenig dumme Hikeda’ya gab, selbst in den niedrigeren Rängen der Opfermutigen. »Weil wir dachten, dass wir ohne sie verhungern würden. Der Mann hat für uns gejagt.«
Der erste Opfermutige sah sie lange an und nickte dann seinem Kameraden zu, der im Unterholz verschwand. Kurz darauf kam er mit Vordis wieder, die verständlicherweise verwirrt und verängstigt war.
»Alles ist gut«, erklärte ihr Tzoja mit einem möglichst subtilen Unterton. »Diese Soldaten bringen uns zu den anderen zurück. Wir sind jetzt in Sicherheit.«
Vordis nickte nur, aber ihre Miene war verzweifelt.
◆
Jarnulf holte den Riesen nicht so bald ein, aber nachdem er längere Zeit so schnell gerannt war, wie er nur konnte, sah er die mächtige Kreatur in einem Ring von Bäumen auf ihn warten.
»Zu langsam«, sagte Goh Gam Gar. »Nochmal warte ich nicht auf dich.«
»Wie soll ich dir dann zurückzahlen, was ich dir immer noch schulde?«
Der Riese bleckte grimmig-amüsiert die Zähne, streckte dann eine mächtige Hand aus und packte Jarnulf um die Taille. Bevor Jarnulf irgendetwas anderes tun konnte, als sich bange zu fragen, ob die Kreatur plötzlich beschlossen hatte, ihn zu töten, wurde er hochgerissen. Der Riese rannte wieder los, talaufwärts, diesmal in noch furchterregenderem Tempo, Jarnulf im Klammergriff seiner Riesenhand wie ein hilfloses Kätzchen.
Jarnulf fühlte sich, als wäre er von einem mächtigen Wind emporgehoben worden wie ein dürres Blatt und würde jetzt dahingeweht. Der Wald sauste an ihm vorbei, Bäume erschienen und verschwanden, und Zweige peitschten ihm ins Gesicht. Goh Gam Gar trug ihn dahin, wie jemand einen Stock oder einen Stein tragen würde, etwas, bei dem es ihn nicht kümmerte, ob es durchgerüttelt wurde oder kaputtging. Jarnulf wollte dem Riesen sagen, er solle ihn absetzen, war aber zunächst ganz damit beschäftigt, der aufkommenden Übelkeit zu wehren.
»Lass mich runter!«, rief er, als er wieder sprechen konnte. »Ich kann das so nicht.«
Der Riese verlangsamte sein Tempo, blieb schließlich stehen, hob Jarnulf vor sein Gesicht und starrte ihn an. Nicht zum ersten Mal dachte Jarnulf, dass Goh Gam Gar ihm so mühelos den Kopf abbeißen könnte, als bisse er in eine gekochte Rübe. Es war immer noch schockierend, wie groß diese Kreatur war, wie sie mit einer Hand die Taille eines ausgewachsenen Mannes umspannen konnte. »Runter?«, knurrte der Riese. »Nein. Ich sagte doch, du bist zu langsam.«
»Zu langsam wofür? Haben wir es eilig?«
Die flache Stirn des Riesen runzelte sich, als käme eine Lawine ins Rutschen. »Alles endet. Ich fühle es tief drinnen. Die maskierte Higdaja-Königin will es. Das Ende von allem. Wenn wir zu langsam sind, verpassen wir es.«
Denken war schwer gewesen, solange er in der Luft herumgeschwenkt worden war wie eine gepflückte Pusteblume, aber jetzt ging Jarnulf auf, dass er sich vielleicht doch übereilt dafür entschieden hatte, Goh Gam Gar auf dessen Mission zu begleiten. »Was soll das heißen – alles endet? Und woher weißt du das?«
»Der alte Gam hat es gehört, von seinesgleichen im Higdaja-Lager. Wir alle fühlen es. Das Ende kommt, jetzt, im Tangaru, dem Tal, das singt.«
»Setz mich einfach ab. Ich renne sehr schnell. Ich kann mithalten.«
Goh Gam Gars Gesicht drückte deutlich aus, was er von der Selbsteinschätzung Sterblicher hielt. »Nein. Nicht nur wegen Schnellsein. Bald erreichen wir die Higdaja-Soldaten. Da wird viel Töten sein. Zu Fuß wärst du verloren. Im Nu in Stücke gehackt, keine Hilfe für den alten Gam. Vergiss nicht, Menschenmann-Fleisch, du schuldest mir viele Gefallen.«
»Zwei, glaube ich.« Jarnulf war sich jetzt sicher, dass er eine schlechte Entscheidung getroffen hatte. »Dann setz mich auf deine Schultern. Ich reite auf deinem Joch.«
Die seltsamen grün-gelben Augen verengten sich. »Du kannst den alten Goh Gam Gar zu nichts zwingen. Nur der mit dem Stab kann mich verbrennen.«
»Ich will dich zu nichts zwingen. Ich will nur nicht gegen jeden Ast zwischen hier und wo auch immer knallen.«
Wieder betrachtete ihn der Riese prüfend. Der Atem der Kreatur war grässlich, aber das war Jarnulfs geringste Sorge. Schließlich nickte Goh Gam Gar mit dem riesigen Kopf, hob Jarnulf hoch und setzte ihn auf seine mehr als breiten Schultern. Nach einigem Herumrutschen fand Jarnulf schließlich eine einigermaßen bequeme Sitzposition auf dem Hexenholzjoch, wenn es sich auch wegen des breiten Nackens anfühlte, als ritte er auf einem extrem dicken Pferd. Aber es war immer noch besser, als ständig gegen die Waldvegetation zu krachen. Das gewaltige Geschöpf war es eindeutig nicht gewohnt, irgendetwas zu umgehen, statt einfach mitten hindurch zu stürmen.
»Kann losgehen«, sagte Jarnulf, als er richtig saß. »Ich muss wahrscheinlich manchmal in dein Fell greifen, um mich festzuhalten.«
Ein tiefes, grollendes Lachen erschütterte Jarnulfs Sitz. »Versuch, dem alten Gam nicht allzusehr wehzutun.«
Während der Riese nordwärts die steilen oberen Hänge des Dunkelschmal-Tals entlangrannte, dem Quellgebiet des Flusses entgegen, dachte Jarnulf über sich selbst nach: Eilte er auf etwas zu oder vor etwas weg? Er schämte sich ein bisschen, Tzoja und Vordis in einer so fremden, gefährlichen Umgebung alleingelassen zu haben, aber nach seinem Geständnis, welche Rolle er dabei gespielt hatte, dass Tzojas Tochter Nezeru zur Verräterin erklärt worden war, konnte ja wohl von ihrer Freundschaft, wenn man es überhaupt so hatte nennen können, nichts mehr übrig sein.
Ich habe ihnen geholfen, sie haben mir geholfen – weiter nichts. So ist es nun mal in Kriegszeiten, egal, ob es ein großer Krieg ist wie der, den laut dem Riesen die Hikeda’ya-Königin führt, oder mein privater Krieg gegen sie. Da kann es keine Versprechen geben. Und außerdem, Gott der Herr weiß, dass ich keine Zukunft habe. Wenn ich Glück habe, bekomme ich noch eine letzte Chance, die Hexenkönigin zu töten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es überlebe. Ohne mich sind die beiden besser dran.
Nur Augenblicke später stießen sie auf einen Trupp von Hikeda’ya-Opfermutigen. Als der Riese aus den Bäumen hervorbrach, sahen die Soldaten auf der Lichtung überrascht auf, erwachende Furcht in den Augen, doch der Riese ließ weder ihnen noch Jarnulf Bedenkzeit. Mit einem Gebrüll, das durch den Wald hallte, stürzte er vorwärts; im nächsten Moment war er inmitten der Nornensoldaten, und seine mächtigen, fleischigen Hände packten und zerrissen gepanzerte Körper, als äße ein ausgehungerter Sklave aus Nakkiga Höhlenkrabben. Eine kurze Bewegung des Monsters aus dem Handgelenk, und ein behelmter Kopf flog und kullerte hangabwärts. Noch ein knapper Rückhandschlag, und ein Opfermutigen-Offizier und sein Pferd waren nur noch blutige Brocken von Knochen und Fleisch und zerkleinertem Hexenholzpanzer.
Der kleine Trupp hatte mindestens eine halbe Zwanzigschaft bewaffneter Opfermutiger umfasst, allesamt zum Töten ausgebildet, aber keine zwei Dutzend Herzschläge später waren sie alle tot, die meisten zerdrückt und zerstückelt und kaum noch als das zu erkennen, was sie gewesen waren. In seinem ganzen Leben und all seinen Kämpfen hatte Jarnulf so etwas noch nie gesehen. Sosehr er die Hikeda’ya und insbesondere die Opfermutigen hasste, fiel es ihm doch schwer hinzuschauen.
»Warte mal«, sagte er, als er sich wieder im Griff hatte. »Setz mich ab.«
»Willst du auf sie pissen?«, fragte der Riese. »Das ist keine schlechte Idee.«
»Nein. Nein! Ich brauche einen richtigen Bogen und Pfeile. Wir werden doch sicher noch öfter kämpfen müssen, wenn wir uns der Königin nähern, und es erscheint mir nicht fair, dass du alle Opfermutigen allein tötest. Auf deinen Schultern, nur mit einem Schwert, kann ich dir keine große Hilfe sein.«
Goh Gam Gar grunzte und setzte ihn ab. Jarnulf suchte zwischen den blutigen Überresten herum, bis er einen Bogen fand, der ihm gefiel, nahm dann einen rotverschmierten Köcher an sich und begann, Pfeile einzusammeln. Es dauerte eine Weile, weil der Riese mehrere Hikeda’ya-Bogenschützen an den Beinen durch die Luft geschwungen hatte, bevor er ihnen den Garaus machte, und dabei ihre Pfeile in alle Richtungen geflogen waren.
»Beeil dich«, grollte Goh Gam Gar. »Higdaja warten darauf, getötet zu werden.«
Als er mindestens zwei Dutzend Pfeile in seinen neuen Köcher gesteckt hatte, ließ Jarnulf sich von dem Riesen wieder auf das Hexenholzjoch heben.
»Ganz bald, jetzt«, sagte der Riese und leckte sich die blutigen, krallenbewehrten Finger. »Ich verteile Higdaja-Blut überall von hier bis nach Nakkiga. Ich habe lange auf das hier gewartet.«
Dies also ist der Anfang meines Endes, o Herr, dachte Jarnulf. Aber du weißt es am besten. Mein Leben und meine Seele sind in deiner Hand. Laut sagte er nur: »Es ist Zeit, eine Königin zu töten.«
Von da an wurde das Vorankommen schwieriger und nur noch blutiger. Während der Riese dem Ende des Tals entgegeneilte, Jarnulf auf seinem Hexenholzjoch, trafen sie auf drei weitere Hikeda’ya-Trupps, jeder größer als der vorige. Goh Gam Gar bahnte sich seinen Weg durch die ersten beiden Trupps ohne größere Probleme, wenn auch mit ein paar Pfeilen im zottigen Fell. Jarnulf hatte Glück: Der Kampf war zwar jeweils erbittert, aber schnell vorbei, und keiner der Pfeile ihrer Gegner traf ihn. Der dritte Trupp jedoch hatte einen eigenen Riesen.
Noch während Goh Gam Gar auf die verblüfften Opfermutigen losstürmte, richtete sich der andere Hunë hoch auf und stieß ein wütendes Gebrüll aus. Das Fell dieses Riesen hatte das gelbliche Weiß von frischem Rahm, und er konnte es von der Größe her fast mit Goh Gam Gar aufnehmen, der bei Weitem der größte Riese war, den Jarnulf je gesehen hatte. Diese Kreatur war zudem mit Leder gepanzert, trug einen Bronzehelm von den Ausmaßen eines Kochkessels und eine Kampfkeule, so groß wie Jarnulf, die er sofort schwang, als sie sich ihm näherten. Goh Gam Gar wich der mächtigen Keule mit einem Satz zur Seite aus und blieb dann so jäh stehen, dass Jarnulf von seinem Nacken flog. Jarnulf schlug auf dem Boden auf, rollte noch ein gutes Dutzend Schritt hangabwärts und verstreute dabei Pfeile. Bemüht, den Schmerz des Aufpralls zu ignorieren, rappelte er sich in die Hocke hoch, legte den ersten Pfeil ein, den er erreichen konnte, spannte, schoss und fällte den vordersten der Hikeda’ya-Soldaten, die auf ihn losstürmten.
Die beiden Riesen gingen aufeinander los, so laut knurrend und brüllend, dass es Jarnulf in den Ohren wehtat. Die meisten der panischen Opfermutigen versuchten, von den kämpfenden Monstern wegzukommen, andere wurden in den ersten Momenten des Gerangels erdrückt. Ein tapferer Nornensoldat setzte noch an, auf Goh Gam Gar einzustechen, als er auf diesen zurollte, aber eine Pranke des Riesen schlug zu und schleuderte ihn durch die Luft.
Jarnulf erkannte, dass er für die verbliebenen Hikeda’ya eine wesentlich geringere Bedrohung und damit ein weit weniger wichtiges Ziel darstellte als sein riesiger Kamerad. Er raffte rasch so viele am Boden liegende Pfeile zusammen, wie er konnte, und schoss sie in schneller Folge auf die sich wieder berappelnden Opfermutigen ab, während Goh Gam Gar auf den Rücken des jüngeren Riesen sprang. Er presste dem Gegner das Knie ans Rückgrat und packte mit seinen Krallenhänden den Rand von dessen Helm. Verblüfft sah Jarnulf, wie Goh Gam Gar den Kopf des anderen Riesen nach hinten zog, immer weiter und weiter, bis das gelbweiße Genick brach und die mächtige Bestie erschlaffte.
Jarnulf sammelte hastig noch weitere Pfeile auf, während Goh Gam Gar sich umdrehte, die Keule des toten Gegners jetzt in der eigenen behaarten Riesenhand, und sich daranmachte, jedes Lebewesen in seiner enormen Reichweite zu zerschmettern – Soldaten, Pferde und selbst die nächststehenden Bäume. Ein paar Opfermutige befolgten die verzweifelten Befehle ihres Offiziers und versuchten, mit Schwertern oder Spießen auf den Riesen einzustechen – ein halbes Dutzend Nornenpfeile wackelten schon ergebnislos in Goh Gam Gars grauem Fell –, doch binnen weniger Augenblicke waren auch sie und ihr Kommandeur zu einer stummen, blutigen Masse zerschlagen.
Goh Gam Gar war mit zwei langen Schritten bei Jarnulf, schnappte ihn sich mit einer blutigen Riesenhand und setzte ihn wieder auf das schwere Joch. Der Riese keuchte, aber er lachte auch, ein tiefes, befriedigtes Grollen, das über den Hang hallte und Jarnulf auf dem Joch hüpfen ließ.
»Ja! Ja!« Das Brüllen des Monsters musste meilenweit tragen. »Zeit jetzt! Die Higdaja-Königin töten!«
Den ganzen langen Nachmittag, während der Riese auf mächtigen, unermüdlichen Beinen das Tal entlangrannte, war der Nebel am Boden dicht gewesen und in der Luft über ihnen nur unwesentlich lichter, Schwaden von weißer Feuchtigkeit, die wie Öl auf Wasser dahinflossen. Doch als sie sich dem Ende des Tals näherten und immer lauteres Rauschen von Wasser hörten, schien der Nebel dünner zu werden. Tatsächlich klarte der Himmel erstmals seit Stunden so weit auf, dass Jarnulf die sinkende Sonne über den Gipfeln im Westen sehen konnte. Als der Riese, etliche abgebrochene Bäume in seiner Kielspur hinterlassend, an den Rand eines Kieferngehölzes kam und einen Felsvorsprung erklomm, erblickte Jarnulf endlich das Endziel ihrer Reise.
Sein Herz gefror. Vor ihm befand sich ein riesiges Heer von Opfermutigen – tausend oder mehr.
Auf all seinen Reisen hatte Jarnulf nie so etwas gesehen wie das Tanakirú. Das lange Flusstal, das stellenweise fast eine Meile breit gewesen war, verengte sich hier zu einem schmalen Einschnitt zwischen steilen, felsigen Berghängen und war – bis auf die Hänge der Westseite – fast ganz vom tosenden Dunkelschmal ausgefüllt. Der Fluss entstand aus Wasser, das vom nördlichen Waldhelm herabkam und sich in einer Serie von Wasserfällen über die Felswände des Tanakirú ergoss. Der größte dieser Fälle, ein mächtiges weißes Band, überwand einen solchen Höhenunterschied, dass ein Gutteil des Wassers sich unterwegs in wirbelnden Dampf auflöste, und landete schließlich am Ostrand des Tals, wo er den Beginn des Flusses zu springendem Schaum aufwühlte. Doch obwohl dieses ewig herabstürzende Wasser eine tiefe Schlucht in den Talgrund geschnitten und auch die Flussrinne gegraben hatte, war doch hinter der Flussschlucht ein felsiges Plateau bestehen geblieben, am Fuß der hohen Felswände, die das Ende des Tals bildeten. Geschützt von den wütenden, unpassierbaren Wassern des Dunkelschmal, hätte dieses Plateau vor jeglichen Angreifern sicher sein sollen, doch obwohl der Talgrund weitgehend von dem tosenden Fluss ausgefüllt war, ragte aus dem westlichen Berghang ein einzelner Felssporn hervor, nicht bis an das Plateau selbst, aber doch weit genug, um von strategischem Interesse für jeden zu sein, der die Schlucht überqueren wollte; aus diesem Grund hatten die Sithi-Verteidiger an dem Rand des Plateaus, der dem Felssporn gegenüberlag, eine Mauer errichtet. Jarnulf sah einige Verteidiger von der Brustwehr aus hinüberspähen; sie trugen Rüstungen in so vielen verschiedenen Farben, dass sie aussahen wie ein blühender Garten. Die Hikeda’ya-Armee schien bereits eine Belagerungsmaschine an der Spitze des Felssporns in Stellung gebracht zu haben, eine lange Brücke, die bis an die Wehrmauer reichte, und was Jarnulfs Inneres hatte gefrieren lassen, war die riesige Streitmacht von Hikeda’ya – mindestens tausend Soldaten –, die auf die Brücke zurückte.
Diese Schlacht ist schon so gut wie entschieden, dachte er. Es sei denn, die Zida’ya haben tausend versteckte Bogenschützen. Doch nur wenige Pfeile kamen von der Mauer, genug, um ein paar Hikeda’ya-Schilde zu befiedern, aber nicht, um den Vormarsch der Opfermutigen in Richtung Brücke zu verlangsamen. Es war ihm ein Rätsel, warum sie noch nicht hinübergestürmt waren, um ihre Feinde zu erledigen.
»Was tun wir jetzt?«, fragte er den Riesen.
»Noch mehr Higdaja töten«, sagte Goh Gam Gar.
»Sie sind zu viele, um –«, setzte Jarnulf an, hielt aber jäh inne. »Halt mal – was ist das?« Ein Wirbel von weißen Formen drang aus den Höhlen am Fuß der Felswand hervor. Die helle Flut bewegte sich so schnell, dass Jarnulf einen Moment lang glaubte, ein neuer Wasserfall sei aus dem Berg hervorgebrochen und ergösse sich jetzt schäumend auf das felsige Plateau. »Bei Gott und seiner Mutter«, sagte er, als er begriff, was da geschah. »Das sind die Zähne der Königin – sie sind in den Rücken der Zida’ya gelangt!«
Noch während Jarnulf das sagte, setzte sich Goh Gam Gar abrupt wieder in Bewegung, brach aus den schützenden Bäumen ins Freie hinaus und stürmte dann bergab wie eine Lawine auf zwei mächtigen, zotteligen Beinen. Jarnulf konnte sich nur mit Mühe am Joch festhalten. »Was tust du?«, rief er.
»Die Königin!«, knurrte der Riese, und seine langen Schritte verkürzten die Entfernung rasch. Die nächststehenden Hikeda’ya-Soldaten hörten ihn heranstampfen, drehten sich um und glotzten verwirrt. »Ich sehe die verfluchte weiße Königin selbst auf der anderen Seite des Wassers. Sie ist hier!«
Jarnulf wurde dermaßen durchgeschüttelt und musste sich so verzweifelt festklammern, dass er kaum etwas sehen konnte. Goh Gam Gar erreichte die hintersten Reihen der Opfermutigen, die jetzt blitzschnell um den Fuß der Sturmbrücke herum ausschwärmten. Erste Hikeda’ya-Pfeile schwirrten an Jarnulf vorbei, aber der Riese beachtete sie gar nicht. Seine mächtige Kampfkeule schwang hin und her, hieb Opfermutigen-Körper in Stücke, schleuderte Leichen durch die Luft und ließ Helme mit Hikeda’ya-Köpfen darin über den Boden hüpfen. Goh Gam Gar stieß jetzt ein Geheul aus, ein ohrenbetäubendes Hinausschreien blutdurstiger Kampfeslust, das ihnen fast so schnell freie Bahn verschaffte wie die blutige, bronzebeschlagene Keule des Riesen. Was auch immer die Opfermutigen auf der Südseite der Schlucht nach Königin Utuk’kus Erscheinen auf dem Plateau erwartet hatten – das plötzliche Auftauchen eines rasenden Riesen, der doppelt so groß war wie sie, sicher nicht. Obwohl die Disziplin der Opfermutigen groß war und viele Hikeda’ya sich dem Kampf zu stellen versuchten, waren ihre Chancen wie die eines Rudels Ratten gegen einen Mastiff. Flüchtende Opfermutige stolperten über die zertrümmerten Körper ihrer Kameraden, während Goh Gam Gar mit freudigem Gebrüll vorwärtswatete und Leichen und Leichenteile nach allen Seiten schleuderte.
Jarnulf musste erkennen, dass er keinen einzigen Pfeil abzuschießen vermochte, aber das war seine geringste Sorge: Er hängte sich den Bogen um den Hals, um sich mit beiden Händen an dem Hexenholzjoch festhalten zu können. Während sie sich durch Reihen chancenloser Opfermutiger Bahn brachen und in Richtung Schlucht stürmten, konnte Jarnulf nur den Kopf an Goh Gam Gars borstigen, stinkenden Nacken pressen, um den schwirrenden Pfeilen zu entgehen. Er begann, das Mansa sea Cuelossan zu murmeln – das Totengebet.
Obwohl von mindestens einem Dutzend Pfeilen getroffen, erreichte Goh Gam Gar rasch die mächtige Maschine mit der Sturmbrücke; ohne Zögern sprang er darauf. Jarnulf wurde wieder beinah abgeworfen, doch im nächsten Moment fühlte er die robuste Brücke unter dem Gewicht des Riesen wackeln und wippen.
Sein zweibeiniges Reittier torkelte über die schwankende Brücke und sprang auf die Wehrmauer. Bei seiner Landung spritzten Steine umher und mehrere Zida’ya-Verteidiger wurden zu Boden geschleudert, aber für sie interessierte sich die gewaltige Kreatur nicht. Wie im Traum blickte Jarnulf von seinen verzweifelt am Joch festgekrallten Händen auf und sah, eine halbe Ackerlänge entfernt auf der anderen Seite des Plateaus, eine schlanke Gestalt, ganz in wallendem, geisterhaftem Weiß. Die helle, aufrechte Gestalt stand inmitten eines Trupps ihrer weißbehelmten, weißgepanzerten Wachen.
Sie ist es wirklich, dachte Jarnulf. Die Hexe selbst! Danke, Herr, dass du mir noch eine Chance gibst, ihr sündiges Leben zu beenden.
Doch noch während Goh Gam Gar von der Mauer sprang und auf die Ansammlung schimmernd weißer Gestalten zurannte, noch während Jarnulf versuchte, sich festzuhalten und gleichzeitig seinen Bogen freizubekommen, um dieses Gottesgeschenk nutzen zu können, wandte sich die weißgekleidete Gestalt auf dem Felsplateau dem Riesen zu. Ihre glänzende Maske reflektierte einen Moment lang rotes Sonnenuntergangslicht, dann erhob die Königin die Hände.
Etwas überfiel Jarnulf, ein brennender Schmerz, der durch seine Hände fuhr und seinen ganzen Körper zusammenzupressen und zu schütteln schien, ein Griff, stärker als der des Riesen. Es brannte wie Feuer. Sein Bauch fühlte sich an, als kochte es in ihm, sein Herz schwoll, bis es jeden Moment bersten musste.
Das Joch, begriff er, das verfluchte Joch des Riesen –
Aber er konnte es nicht loslassen, es war, als wären seine Hände eins mit dem Hexenholz. Dann wurde der Schmerz zu viel, und Jarnulf fühlte, wie er von den Schultern des Riesen kippte, aber er spürte den Aufprall auf dem Boden nicht.
◆
Während Viyeki sich aufrappelte, voll Dreck und Steinstaub, und sich fühlte wie ein Sack mit etwas Zerbrechlichem darin, den man von einem Felskliff geworfen hatte, fielen immer weiter Gesteinsbrocken von der Tunneldecke. Als ein scheffelgroßer Stein direkt hinter ihm herabkrachte, gefolgt von einem Hagel kleinerer, aber immer noch tödlicher Stücke, wurde Viyeki klar, dass er zwar den Haupteinbruch des Tunnels überlebt hatte, aber noch immer in Lebensgefahr war. Klingeln in den Ohren, humpelte er, der Königin und ihrer Kolonne folgend, den Gang hinunter Richtung Talgrund, so schnell ihn seine zerschundenen Beine trugen. Da und dort sah er blasse Arme oder Beine unter Haufen von Gesteinstrümmern hervorragen, und er wusste, manche mussten Hikeda’ya-Adligen und -Soldaten gehören, aber er konnte immer noch nicht ganz begreifen, was das bedeutete – was er getan hatte. Das Klingeln in seinen Ohren war schmerzhaft, und seine Gedanken fühlten sich seltsam freischwebend an, als wäre das alles nur ein Traum. Doch irgendwo tief drinnen wusste er, er hatte die Tunneldecke zum Einsturz gebracht und Königin Utuk’ku vom größten Teil ihrer Streitmacht getrennt. Er hatte den Verrätertod reichlich verdient, und nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Familie und wahrscheinlich seinen ganzen Clan.
Niemand hat je so etwas getan, dachte er, auf dumpfe, traumartige Weise staunend, dass ausgerechnet er eine solche Grenze überschritten haben sollte. Aber ich wollte nur ein guter Magister sein. Ich wollte nur das Beste für mein Volk und für die Mutter Aller.
Er hörte jetzt den Trupp der Königin vor sich, hörte Leute anderen befehlen, in Reih und Glied zu bleiben, hörte sie versuchen, Opfermutigen-Disziplin gegenüber dem durchzusetzen, was ein panischer Haufen sein musste. Viyeki blieb ein gutes Stück hinter den anderen, als die sich dem unteren Ende des roh durchs Gestein gehauenen Gangs näherten, gelenkt und getrieben von den Zähnen der Königin, die kein einziges Mal ihr gespenstisches Schweigen brachen. Trotz des Tunneleinsturzes führten Utuk’ku und ihre ergebenen Anhänger den geplanten Angriff fort. Viyeki hörte General Kikiti seinen Hammerschwingern befehlen, das letzte Gestein am Tunnelende wegzuschlagen. Der Stein riss, brach und fiel, und dann strömten die Zähne der Königin in jähes Licht hinaus. Das Draußen erschien Viyeki so leuchtend hell wie eine Offenbarung, während er, sich versteckt haltend, mit zusammengekniffenen Augen zusah, wie die Sänften der Königin und Hakatris hinter den Wachen hinausgetragen wurden.
Er hörte Überraschungslaute und Alarmrufe von den Zida’ya draußen, als sie die weißen Plattenpanzer der Wachen sahen. Er wartete, bis alle draußen waren, und schlich dann weiter den Tunnel entlang bis zu der Stelle, wo die Wachen den Durchbruch zum Plateau vollzogen hatten. Noch immer verwirrt und seltsam unbeteiligt, schlich Viyeki ein bisschen weiter, duckte sich hinter Gesteinstrümmer und blickte hinaus zu den anderen Hikeda’ya.
Was habe ich getan?
Mitten auf dem Plateau halfen zwei Wachen von den Zähnen der Königin jetzt der Mutter Aller aus ihrer Sänfte. Utuk’ku wirkte langsam und nicht bei Kräften, aber sie stand kerzengerade und hocherhobenen Hauptes da, der Hochzeitsschleier um sie herum wie eine Wolke. Die Wachen halfen ihr auf einen großen Stein, sodass sie sie alle überragte, und sie erhob die Hände zum Himmel, die Finger gekrümmt, als wollte sie das Firmament selbst herabziehen. Viyeki konnte nur wie betäubt hinstarren.
Keine Macht kann sich ihr entgegenstellen. Was habe ich nur gedacht?
Er hörte Schreie, dann ein tiefes Grollen, das er mehr fühlte als hörte, und kurz dachte er, der furchterregende Uro’eni des Tals sei erschienen, obwohl die Sonne noch nicht untergegangen war. Der Gedanke schien nicht sonderbarer als alles, was er sah, und obwohl er ihm Angst machte, war es nur eine gedämpfte Angst, als wäre sie in mehrere Schichten Leinentuch gehüllt.
Jetzt stürmte eine ohrenbetäubend laut brüllende Gestalt über eine Sturmbrücke, die in Stellung gebracht worden war, damit die Opfermutigen auf das Plateau gelangen konnten. Der Riese sprang von der Sturmbrücke auf die Mauer und von der Mauer auf das Felsplateau hinab. Es war ein Riese, ja, aber kein Oger: Dennoch war es der größte und schrecklichste Riese, den Viyeki je gesehen hatte. Er trug etwas vage Mannförmiges auf den Schultern, doch bevor Viyeki erkennen konnte, was es war, schien sich die Luft über dem Plateau zu wellen und zu bewegen, als waberte sie über einem Feuer. Das, was der Riese auf den Schultern getragen hatte, fiel hinunter, aber die mächtige Bestie stürmte nur weiter auf die Königin zu, brüllend vor Wut oder Schmerz oder beidem. Die Mutter Aller rührte sich nicht – ließ nicht einmal erkennen, dass sie ihn bemerkt hatte –, doch ihre Wachen senkten die Spieße und formierten sich zu einem dichten Verteidigungsring um sie herum.
Im nächsten Moment sah Viyeki, wie der Riese Feuer fing – Feuer aus dem Nichts. Flammen leckten sein zotteliges graues Fell empor, bis sein Hals und Kopf brannten und Rauch verströmten, während er noch weiter auf die Königin zuwankte. Vor Pein schreiend machte er ein halbes Dutzend Schritte, stolperte dann und konnte sich kaum noch aufrecht halten. Er schlug vergebens auf die Flammen ein, die jetzt seinen Kopf fast völlig verhüllten, und torkelte – noch immer brüllend – auf die Königin zu, bis er schon fast die äußeren Wachen des Verteidigungsrings erreicht hatte. Noch immer rührte Utuk’ku sich nicht, stand nur mit erhobenen Armen da. Der Riese machte noch einen taumelnden Schritt, die obere Körperhälfte zum großen Teil in Flammen, dann schien er endlich nicht mehr weiterzukönnen und kam nur wenige Schritt vor Utuk’ku und ihren Wachen zum Stehen. Einen Moment lang stand das monströse Etwas da, die langen Arme hängend, die Krallenhände zuckend, Kopf und Oberkörper ganz von Feuer umlodert. Dann brach der Riese mit einem grässlichen Stöhnen in die Knie und fiel hin, lag als rauchender, regloser Haufen vor den Wachen.
Die Königin nahm langsam die Arme herunter, drehte sich dann und richtete den Blick aufs Tal. Sie sprach, und Viyeki hörte ihre triumphierenden Gedanken in seinem Kopf, so schmerzhaft laut, als schrie ihm jemand direkt ins Ohr: Ihr werdet gehorchen, alle, die ihr mich hört. Ihr werdet euch meinem Machtwort beugen. Dann sagte sie etwas mit ihrer physischen Stimme – ein einziges Wort, einen hauchigen Strang von Lauten, den Viyeki zuerst nicht hörte, der aber immer lauter und lauter widerhallte, bis die Felswände selbst zu erzittern schienen. Er erkannte das Wort nicht – wenn es denn ein Wort war –, aber es traf ihn wie ein Blitzschlag. Er wollte nur fliehen, so weit wie möglich weg von diesem überwältigenden, wuchtigen Wort, das so schmerzhaft in seinen Ohren und seinem Denken hallte – aber er konnte nicht. Sein Körper tat nicht mehr, was er wollte. Er brach hilflos in die Knie und sank dann gegen den Rand der Tunnelöffnung. Keines seiner Glieder gehorchte ihm. Er konnte die Augen bewegen, konnte atmen, aber jede andere Bewegung schien ihm versagt.
Auf dem übrigen Plateau bewegte sich auch nichts mehr, obwohl die Königin und ihre Wachen noch aufrecht standen. Die Zida’ya-Verteidiger waren auf das Machtwort der Königin hin allesamt kraft- und hilflos zu Boden gesunken.
Die Mutter des Volkes hat endlich, was sie will, dachte Viyeki verzweifelt. Wir alle sind ihre Sklaven.
28
Der Meerstein
Ayaminu und Dunao hatten einen Halt befohlen, diesmal nicht nur, um die Pferde zu tränken, sondern auch, um zu entscheiden, wie es weitergehen sollte. Endlich einmal aus dem Sattel gekommen, ging Tanahaya durch das neblige Gehölz, auf der Suche nach Ki’ushapo. Als sie ihn fand, sah sie zu ihrer Überraschung Bruder Etan neben Ki’ushapo knien und dessen Wunde mit einem nassen Lappen säubern.
»Euch habe ich hier nicht erwartet, Bruder«, sagte sie.
»Ich wollte nachsehen, wie es Ki’ushapo geht.« Er wirkte ein wenig verlegen, als hätte man ihn bei etwas Unrechtem ertappt.
Ki’ushapo, noch immer schwach, aber endlich wieder imstande, selbst zu reiten, machte eine Grußgeste, doch seine Zähne waren krampfhaft zusammengebissen, während der Mönch sich an der Pfeilwunde in seinem Rücken zu schaffen machte. Sie kannte Ki’ushapo gut – er war wohl Jirikis bester Freund, stand ihm fast so nah wie Jirikis Schwester Aditu und Tanahaya selbst – und konnte nur ahnen, wie stark der Schmerz sein musste, wenn er sich auf seinem gewöhnlich so gelassenen Gesicht abzeichnete.
»Wenn der Schmerz dir zu sehr zusetzt«, sagte sie, »hat Ayaminu noch etwas kei-vishaa.«
»Hebt es fürs Schlachtfeld auf«, sagte er, »für die wirklich Verwundeten. Ich bin schon fast wieder in Ordnung.«
Das bezweifelte sie – jede seiner Bewegungen verriet erhebliche Beschwerden –, aber sie wusste, es war sinnlos, ihm das kei-vishaa aufdrängen zu wollen. In dieser Hinsicht war Ki’ushapo wie Jiriki, fest entschlossen, nichts zu nehmen, was ein anderer benötigen könnte, egal, ob er selbst litt.
Der bloße Gedanke an ihren Liebsten schien das Leben in ihr – das Leben, das er gezeugt hatte – spürbar zu wecken. Ein weibliches Kind, hat Aditu gesagt. Sie legte sich eine Hand auf den Bauch. Ein unbekanntes, wunderbares weibliches Kind. Sie holte tief und zittrig Luft. Bitte, wenn dieses Leben irgendeinen Sinn hat, wenn diese Welt noch etwas bedeutet, lasst es geboren werden! Lasst es sein Leben frei und glücklich leben! Aber es schien nicht sehr wahrscheinlich, dass das geschehen würde.
»Herrin Ayaminu und Herr Dunao besprechen, was wir jetzt tun sollen«, erklärte sie Ki’ushapo. »Sie fragen, ob du in der Lage bist, dazuzukommen.«
»Bin ich.« Er zog sein Rüsthemd herunter und legte dann, mit Hilfe Tanahayas und des Mönchs, seine Rüstung an. Etan war so taktvoll, ihm unauffällig auf die Beine zu helfen. Mit Sorge sah Tanahaya, wie schwach Ki’ushapo noch immer war. Wie Jiriki war er für seine kriegerischen Fähigkeiten bekannt, obwohl er – auch darin wie Jiriki – kaum stolz darauf war und keine Freude am Kämpfen hatte. Tanahaya konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass er im Moment gar nicht in der Lage war, groß zu kämpfen.
Aber wir schließen uns einer zum Scheitern verurteilten Sache an, dachte sie. Ich bin nicht mal eine Kriegerin, doch auch ich werde kämpfen müssen. Ach, Jiriki, Liebster, warum ist dies unsere Zeit? Warum konnten wir einander nicht in einer Zeit des Friedens finden?
Und welche Zeit hätte das sein sollen?, fragte eine düstere innere Stimme. Unser Volk schrumpft und scheitert schon fast seit den Tagen, da uns die Schiffe in diese Lande brachten.
»Bin ich auch zu diesem … diesem Rat bestellt?«
»Ich glaube nicht. Aber Ihr wärt sicher willkommen.«
»Und dann müsstet ihr alle meine Sprache sprechen. Selbst Ki’ushapo, der sie so barbarisch entstellt, dass es mir in den Ohren wehtut. Nein, danke, ich werde mir ein sonniges Plätzchen suchen und mich dort hinsetzen.«
»Barbarisch?«, knurrte Ki’ushapo. »Für diese Beleidigung sollte ich dich erschlagen, sterblicher Hund!«
Kurz war Tanahaya schockiert. Noch nie hatte sie Jirikis Vetter etwas so Rohes sagen hören. Dann begriff sie, dass der sonst so ernste Ki’ushapo scherzte. Etans gespieltes Stirnrunzeln und Kopfschütteln sagten, dass es auch ihm klar war. Beim Garten, sind die beiden Freunde geworden?
Falls die Welt nicht endete, schien sie sich doch auf jeden Fall zu verändern. Tanahayas Hand legte sich wieder über die immer noch unauffällige Präsenz in ihrem Leib. Was erleben wir wohl als Nächstes? Dass Utuk’ku die Zida’ya und die Hikeda’ya zur Versöhnung aufruft? Dass die Neun Städte wiederaufgebaut werden?
Es war ein sehnsuchtsvoll-amüsanter Gedanke, aber natürlich glaubte sie keinen Moment daran.
»Warum verschwenden wir Zeit mit Reden?«, beschwerte sich Dunao. »Die Pferde sind getränkt. Die Sonne steigt empor. Lasst uns losreiten!«
»Mit welchem Ziel genau?«, fragte Ayaminu. »Wir haben noch nicht gehört, was die Kundschafter am Ort der Kämpfe gesehen haben.«
Dunao machte ein Handzeichen für Frustration – von Wind betäubt, eine uralte Landgeborenen-Geste, die Tanhaya noch nie gesehen, nur in Büchern beschrieben gefunden hatte. »Die Kundschafter haben bestätigt, was ich Euch schon gesagt habe. Ensumes Hikeda’ya haben das ganze Tal eingenommen, bis auf das Tanakirú-Plateau am Nordende, unterhalb des Neunten Schiffs. Sie sind mindestens ein Dutzend Mal so viele wie unsere Verteidiger. Sie haben Riesen, Kriegsmaschinen, alles, was die unseren nicht haben. Es ist nur eine Frage von Stunden – nicht Tagen –, bis sie über die Quellschlucht des Dunkelschmal vordringen und uns vernichten. Warum also reiten wir nicht?«
»Weil wir, selbst wenn wir ohne anzuhalten zum Tanakirú reiten, unsere Pferde totschinden und zwar Rückenwind haben, doch nicht rechtzeitig dort sind, um eine entscheidende Rolle zu spielen.« Ayaminu sprach, als hätte sie es bereits geschehen sehen.
Tanahaya fror plötzlich am ganzen Leib. Jiriki war dort – sie fühlte es so deutlich, wie sie das Kind fühlte, das in ihr wuchs. »Das kann doch nicht wahr sein!«
»Unsinn«, sagte Dunao. »Wie könnt Ihr so etwas sagen, Ayaminu? Unsere Leute verteidigen das Tal seit vielen Jahren, und selbst nach dem Fall des Hornissennests haben sie die Hikeda’ya seit dem Feuerritter-Mond aus dem Tal ferngehalten. Zweifelt Ihr an der Tapferkeit Eures eigenen Volkes?«
»Niemals«, sagte Ayaminu, doch ihre Miene war steinern.
»Ich weiß, wie weise Ihr seid, Ayaminu«, sagte Ki’ushapo. »Wir alle wissen es. Aber Eure Worte machen mir das Herz schwer. Warum glaubt Ihr, dass es so ist?«
»Weil dieser Kampf gewaltiger ist, als Ihr ahnt«, sagte sie, »und er nicht nur im Tanakirú ausgetragen wird. Ich bin keine Sa’onsera, aber ich habe Gaben, die ihr Übrigen nicht habt. Und diese Gaben – obwohl sie mir in diesen elenden Tagen eher wie ein Fluch erscheinen – sagen mir, dass die Schlacht um das Tanakirú heute bei Einbruch der Dunkelheit vorbei sein wird. Ich würde statt ›vorbei‹ gern sagen, ›gewonnen oder verloren‹, aber Utuk’ku wird nach dem greifen, was sie haben will, und ich bin mir schmerzlich sicher, dass sie es, wenn nicht etwas passiert, das ich nicht vorhersehen oder mir auch nur vorstellen kann, bekommen wird.«
»Was ist das für ein …?«, setzte Dunao an.
Ayaminu hob die Hand, die Finger gespreizt. »Bitte«, sagte sie. »Ich habe nicht die Kraft zu streiten, Grauer Reiter, und in einem habt Ihr wohl recht – wir müssen so schnell wie möglich dorthin, um eventuellen Überlebenden unseres Volkes zu helfen, auch wenn wir keinen Einfluss darauf haben, ob Hamakhos gierige Erbin erlangt, worauf sie es abgesehen hat. Also halte deine Fragen und ärgerlichen Einwände zurück.« Sie blickte ihn eindringlich an, und erstmals sah Tanahaya, wie müde und angestrengt Ayaminu war. »Ihr wisst doch alle, was heute für ein Tag ist, oder?«, fuhr Ayaminu fort. »Heute Nacht, wenn die Sonne untergegangen ist, wird die Jahrfackel das letzte Mal am Himmel stehen. In Anvi’janya wird Aditu die Jahrtanz-Zeremonie abschließen. Jeder Adept wird euch erklären, dass die mächtigen Gesänge noch mächtiger werden, wenn man nicht nur die richtigen Worte wählt, sondern auch die richtige Stunde. Unsere Feindin Utuk’ku weiß das, und das Ende eines Großjahrs ist ein solcher Zeitpunkt – einer der allerwirksamsten und allergefährlichsten.«
Dunao war immer noch starr vor Zorn. »Ayaminu, meinetwegen verbringt Eure Zeit mit solchen Gedankenspielen. Ich werde unsere Kämpfer nehmen und schnellstens ins Tanakirú reiten.«
»Es steht außer Frage, dass wir alle gemeinsam ins Tanakirú reiten«, sagte sie, allenfalls mit einer Andeutung von Ärger. »Die Pferde werden bereits fertig gemacht. Aber selbst, wenn sie Flügel hätten, würden wir das Ende des Tals nicht rechtzeitig erreichen, um Utuk’ku aufzuhalten. Ich fühle das ganz eindeutig, auch wenn es mir das Herz zusammenpresst, dass ich fürchte, es bleibt stehen.«
»Aber was ist dann unsere Aufgabe?«, wollte Dunao wissen. »Die Toten zu begraben? Der Hexe von Nakkiga unsere Kapitulation anzubieten?«
Ayaminu schüttelte den Kopf. »Ich wollte, ich könnte das beantworten, Reiter. Aber ich habe Euch alles gesagt, was ich weiß.«
Während sie am Westrand des Tals nach Norden preschten, flatterte die Erinnerung, die die Ränder von Tanahayas Denken die ganze Zeit gekitzelt hatte, endlich so nah heran, dass sie sie zu fassen bekam. Als die Pferde in einer Reihe hintereinander lautlos einen langen bewaldeten Hang hinuntertrabten, hörte sie in der Ferne Wasserrauschen, und es erinnerte sie an ihre erste Bekanntschaft mit dem Dunkelschmal-Tal, als sie dem Sterblichenprinzen Morgan gefolgt war. Die Seltsamkeit dieser Gegend hatte sie selbst bei jenem kurzen Vorstoß beeindruckt. Mit diesen Gedanken kam jetzt alles wieder.
»Herrin Ayaminu«, sagte sie leise. »Kennt Ihr das Hikeda’yasao-Wort zhin’ju? Ist es das gleiche wie unser Wort shin’iu?«
»Ja, ist es – der Geist eines Ortes, die Essenz, die ihn zu dem macht, was er ist. Warum?«
»Weil es etwas war, das mich in Anvi’janya umgetrieben hat, und ich habe die ganze Zeit versucht, mich zu erinnern, warum. Zum ersten Mal darauf gestoßen bin ich im Archiv, in den Aufzeichnungen über den Prozess gegen Sa-Ruyan Mardae.«
»Ging es Utuk’ku und ihren Unterlingen um die Entstehung des Neunten Schiffs? Sprich, Kind, woran erinnerst du dich?«
»Dass Yedade den Gefangenen Mardae danach zu befragen begann – barsch und aggressiv –, dann jedoch von Utuk’ku selbst gestoppt wurde. Yedade hatte den Gefangenen aufgefordert: ›Sag mir alles über den zhin’ju des großen Schiffs‹, aber dann wurde die Frage zurückgezogen, und es war nicht mehr die Rede davon.«
»Und doch hat es dich umgetrieben«, sagte Ayaminu. »Es blieb dir im Kopf.«
»Ja.« Sie blickte auf die Reihe von Reitern vor ihnen, die ohne Klagen oder auch nur sichtbare Betrübtheit auf etwas zuritten, von dem niemand zu glauben schien, dass sie es überleben würden. »Es ergab damals für mich keinen Sinn und ergibt immer noch keinen. Wenn zhin’ju dasselbe bedeutet wie shin’iu, wie kann ein Schiff so etwas haben? Es ist doch nichts Natürliches wie ein Hain oder ein senkrecht stehender Stein oder ein Wasserfall.«
Ayaminu wirkte nachdenklich. »Vielleicht gebrauchen die Hikeda’ya das Wort ja etwas anders als wir.«
»Da ist noch etwas.« Tanahaya zögerte. »Aber ich schäme mich. Ich habe versehentlich etwas aus dem Archiv von Anvi’janya mitgenommen und es erst gemerkt, als wir schon unterwegs waren. Hier. Kennt Ihr den Dichter Fololi Unshun?«
»Den barfüßigen Fololi? Ja, den kenne ich. Er lebte und starb vor langer Zeit. Angeblich war er einer der Seltsamsten unseres Volkes – ein Vertrauter der berüchtigten Edlen Azosha, einer ihrer Lieblingsphilosophen. Manche halten ihn für einen wunderbaren Dichter, andere urteilen weniger freundlich über seine extravaganten Phantasien. Ist das etwas von ihm?« Sie nahm das Pergament mit einem leichten Stirnrunzeln. »Es ist sehr zerknittert, Gelehrte. Archivar Dineke wird äußerst ungehalten sein, wenn er das sieht.«
»Bitte, Herrin. Ich habe schon genug Gewissensbisse.« Die Kette mit Aditus Meerstein war aus Tanahayas Halsausschnitt gerutscht und klackerte jetzt beim Reiten auf ihrer Rüstung. Sie griff nebenbei hin, um ihn festzuhalten, damit er sie nicht ablenkte. »Seht Euch das Gedicht an, bitte. Das hier ist der Teil, der sich in meinem Kopf festgesetzt hat.«
Ayaminu nickte und las vor.
Und so fuhren sie hinaus auf die große See, dieunbeständige Allmutter,
So wie die lebenden Sterne, von Ihrer Hand berührt,durch den Himmel tanzen.
Gelenkt von Ihren bewegenden Kräften und getragen vomMühen ihrer vereinten Geister,
Trotzten unsere Schiffe dem Großen Dunkel auf der Suchenach einer neuen Zuflucht für die Vertriebenen desGartens.
Ayaminu sah von dem Pergament auf. »Ich sehe des Wort shin’iue – ›Geister‹, ›Essenzen‹ –, nach dem du mich gefragt hast.«
»Ja, aber das ist nicht alles. Beim Prozess gegen den Tinukeda’ya-Anführer Mardae fragte Yedade diesen nach den ›bewegenden Kräften‹ des Neunten Schiffs, zog dann aber die Frage zurück. Und dieselbe Formulierung steht in Fololis Gedicht, das viele Großjahre früher geschrieben wurde.«
»Ah.« Ayaminu nickte. »Sehr seltsam, aber ich erkenne die Bedeutsamkeit nicht.«
»Warum fragte Yedade nach etwas so Entlegenem?«, sagte Tanahaya, die noch immer den Meerstein umfasste, als könnte Aditus Erbstück eine Antwort liefern. »Und warum sollte Fololi genau diese Formulierung in einem Gedicht benutzen, das lange vor dem Prozess geschrieben wurde – einem Gedicht nicht über das Neunte Schiff, denn von dem konnte Fololi nichts wissen, sondern eine Lobpreisung der berühmten Acht Schiffe, die uns aus dem Garten hierherbrachten? Und warum spricht er von deren shin’iue? Welche Art Geist kann ein lebloses Schiff haben?« Doch noch während sie sprach, fand sich Tanahaya plötzlich durch den starken Geruch von etwas Brennendem abgelenkt. »Was riecht hier so …?«
Ayaminu schien jetzt weiter weg. Ihr Mund schien sich sehr langsam zu bewegen, und ihre Worte waren schwach, als hätten sie eine große Entfernung zurückgelegt. »Was meinst du, Kind?«
Doch der scharfe Geruch wurde noch stärker, und Tanahayas Finger waren da, wo sie den Meerstein berührten, plötzlich heiß – nein, nicht heiß, sondern voll von Licht, von etwas, das sie nicht benennen konnte –
Und dann fiel sie aus der Welt.
◆
Snenneq erholte sich schnell von seinem Kampf mit dem Nornensoldaten und dem Treppensturz, aber Qina wollte ihn nicht aufstehen lassen, bevor sie die blutige Beule an seinem Kopf befühlt hatte.
»Mir geht es gut«, sagte er. »Wir müssen schleunigst hinter Morgan her!«
»Und was tun?«, fragte Qina. »Du hast ja das Etwas gesehen, das Nezeru entführt hat. Was könnten wir denn tun? Wie Mäuse gegen einen Bären wären wir doch.«
»Wir können Morgan nicht im Stich lassen.« Er rappelte sich auf. »Du sagst ja selbst, der Oger hat Nezeru entführt. Wir wissen doch beide, dass Morgan ihm folgen wird, bis das Monster ihn tötet.«
»Und uns auch, wenn wir ihm folgen«, sagte sie, aber sie wusste, dieses Argument war vergebens.
»Das ist noch nicht die ganze Katastrophe«, sagte Kuyu-Kun auf Quanuc, der Sprache der Trolle. Der alte Tinukeda’ya erhob sich mit Tih-Rumis Hilfe vom Boden der Schiffskabine und stand dann auf wackligen Beinen. »Die Hikeda’ya haben das Herz des Schiffs gestohlen.«
Snenneq sah Qina an, dann wieder den alten Tinukeda’ya. »Ich gestehe, was Ihr da sagt, ist mir ein Rätsel.«
»Keine Zeit jetzt dafür.« Der schüchterne, zurückgezogene Kuyu-Kun schien auf einmal verwandelt, voller verzweifelter Intensität. »Wir brauchen all eure Seile und Steigeisen. Schnell!«
Snenneq schüttelte den Kopf, nicht verneinend, sondern verwirrt. »Aber was ist denn das Herz des Schiffs?«
»Seile! Schnell!«
Snenneq blickte hinauf zu dem Kuppeldach, das jetzt zerbrochen war wie eine Eierschale, nur noch Kristallsplitter und zertrümmerte Hexenholzbalken. »Ist der Oger wegen der Hikeda’ya gekommen?«, fragte er. »Er hat uns doch bis jetzt in Ruhe gelassen.«
»Ja. Der Große Beschützer kam wegen der Hikeda’ya-Soldaten«, sagte Kuyu-Kun, aber sein Gesicht hatte einen seltsamen Ausdruck. »Er hat gespürt, dass sie das Herz des Schiffs suchten.«
»Großer Beschützer?«, sagte Snenneq. »Herz des Schiffs? Wo kommt das denn jetzt her? Das hast du doch vorher nie gesagt.«
Kuyu-Kun sah kurz Tih-Rumi an und wandte sich dann wieder den Trollen zu, bekümmert das haarlose Haupt schüttelnd. »Wirklich, ich weiß es nicht. Es war auf einmal in meinem Denken, als das alles passierte. Ich habe selbst von beidem noch nie gehört.« Er sah furchtsam drein. »Aber es stimmt. Ich weiß es. Ich fühle es. Das Etwas, das ihr einen Oger nennt, beschützt das große Schiff. Es ist Teil des Schiffs, irgendwie – vielleicht ist es das Schiff.«
»Genug jetzt«, sagte Qina. »Wir müssen uns beeilen. Sie sind weit vor uns. Man sieht ja, wo das riesige Etwas entlanggelaufen ist.« Sie zeigte auf die Spur der Verwüstung, die sich über das Deck zog: fragile improvisierte Unterschlupfe zertrampelt, Kriechgewächse und kleine Bäume ausgerissen und beiseitegefegt.
»Ich sehe, ihr seid nur wenige«, rief ihnen jemand auf Westerling zu. »Wenn ihr vorhabt, eurem Freund und dem Beschützer zu folgen, dann zählt auch auf uns. Die Hikeda’ya haben uns etwas gestohlen, und die Herrin des Schiffs ist unglücklich.«
Qina drehte sich um und sah den Mann namens Jek Fischer herankommen, gefolgt von mindestens einem Dutzend der Leute, die sich in der Kabine befunden hatten, als die Eindringlinge erschienen waren. Sie hob an, auf Quanuc zu antworten, merkte aber, dass diese Leute es nicht verstanden, und fluchte innerlich, weil sie wieder in der Flachländersprache radebrechen musste. »Warum ihr kämpfen für uns?«, fragte sie.
»Nicht nur für euch – für das Schiff. Fühlt ihr es denn nicht? Der Alte da fühlt es!« Jek Fischer zeigte auf Kuyu-Kun. »Er weiß, das Schiff hat seinen Geist verloren – sein Herz.«
»Ihr nennt mich den Ädon«, sagte eine würdevoll klingende Stimme aus der Schar hinter ihm. »Aber ich bin auch sterblich wie ihr. Fürchtet euch nicht, denn selbst wenn ich sterbe, werde ich doch immer mit euch sein.«
»Es ist noch schlimmer als der Verlust des Herzens dieses Schiffs«, sagte Kuyu-Kun, ohne den bizarren religiösen Spruch zu beachten. Er war so leicht in die Sprache der Sterblichen übergewechselt, als wäre er nur aus einem Mantel in einen anderen geschlüpft. »Viel, viel schlimmer noch.«
»Was soll das heißen?«, fragte ihn Snenneq, während die Schar zu Jek Fischer aufschloss. Qina verzog missmutig das Gesicht, als sogar ihr Liebster jetzt Westerling sprach.
Die Stimme des Träumenden Meeres hob eine zitternde Hand. »Ich kann es nicht sagen. Es ist wie … ein schlechter Traum. Aber ich fühle es. Etwas Schreckliches ist im Gang, und wir müssen das Herz des Schiffs wiedererlangen, oder alles ist verloren!« Er schüttelte den Kopf, so hilflos wie jemand, der von Stechfliegen geplagt wird. »Seine Stimme schreit in meinem Kopf – nein, ihre Stimme, die von Ruyan Ká. Hört es denn außer mir niemand?«
»Nein, aber ich fühle es, Meister«, sagte Tih-Rumi. »Eine schreckliche Leere. Das Schiff liegt im Sterben.«
»Sterben?« Qina riss jetzt der Geduldsfaden. »Was du sagst? Schiff ist lebendig?«
»Das ist jetzt egal«, erklärte Snenneq auf Qanuc. »Wir müssen hinter Morgan her, Liebste, und wir können es uns nicht leisten, irgendwelche Hilfe abzulehnen.«
Sie blickte auf die zerlumpte, weitäugige Schar um Jek Fischer. »Du willst also dieses schreckliche, riesige Monster ohne jeden Plan verfolgen, Snenneq? Dein Leben diesen Leuten anvertrauen, die wir kaum kennen? Und mein Leben auch?«
»Nichts ist mehr sicher, Liebste.« Er griff nach ihrer Hand. »Morgan ist verschwunden. Nezeru ist verschwunden, und ein Riese, so groß wie der Berg Mintahoq, hat das Herz eines Schiffs gestohlen. Wer soll da noch wissen, wem oder worauf er vertrauen kann? Aber ich vertraue auf uns beide, wenn wir zusammen sind.«
»Dann soll es so sein«, sagte sie seufzend. »Obwohl ich Angst habe, wie es enden wird. Aber ich lasse dich nicht ohne mich gehen.«
◆
Zuerst hatte Tanahaya keine Ahnung, was passiert war, und selbst wer sie war, wusste sie kaum noch. Sie driftete in einem Dunkel dahin, das von Streifen trüben Lichts durchzogen war, Streifen, die langsam heller wurden.
Der Meerstein, erinnerte sie sich. Ich hatte den Meerstein in der Hand. Kühne Hoffnung keimte in ihr auf. Aditu hat doch gesagt, er sei ein Teil des Steins, aus dem der Nebellampenzeuge erschaffen wurde. Ist Utuk’ku also erledigt? Hat sie ihre Kontrolle über die Straße der Träume eingebüßt, sodass die Zeugen wieder zum Leben erwacht sind?
Der Gedanke, wieder mit Jiriki sprechen zu können, war etwas, woran sie sich festhalten konnte und was half, die Angst zurückzudämmen. Das Dunkel um sie herum verdünnte sich zu bloßem Schattengrau. Die Lichtstreifen wurden Baumstämme.
Shisae’ron. Zuhause. Diesmal war es nicht so überraschend, den Ort vor sich erscheinen zu sehen, wo sie aufgewachsen war, den Ort, wo Generationen ihres Volkes in den Großjahren des Friedens zwischen der Trennung und der Eroberung Asu’as durch die Nordmänner ihr Leben verbracht hatten. Doch wenn das Traum-Shisae’ron, das Tanahaya zuletzt gesehen hatte, in voller Blüte gewesen war, so wie es sich in den glücklichen Tagen vor dem Verfall ihrer Mutter dargeboten hatte, sah das, was jetzt vor ihr Gestalt annahm, verstörend öde und trostlos aus. Ihr Zuhause hatte doch wohl keinen solchen Niedergang durchgemacht, nicht einmal, nachdem ihre Mutter gestorben war und der Rest des Clans Shisae’ron verlassen hatte. Die Bäume waren allesamt kahl, die Birken nur noch weiß wie gebleichte Knochen, die blattlosen Weidenzweige schlaff wie erschöpfte Schlangen. Und wo sie auch hinsah, war der fruchtbare, lehmige Erdboden ausgetrocknet und rissig.