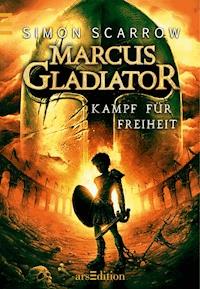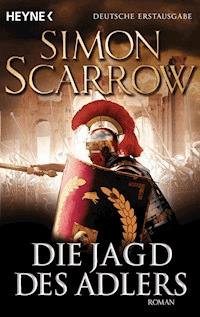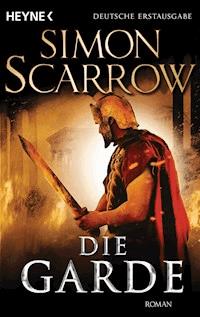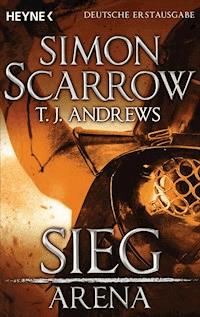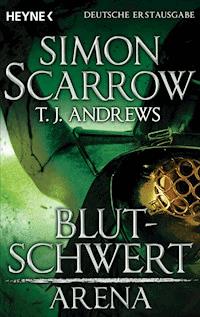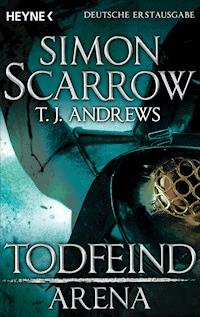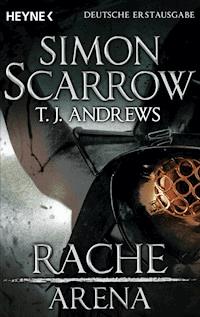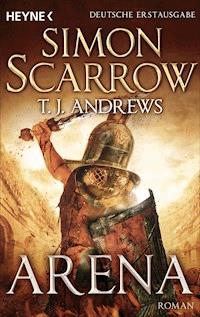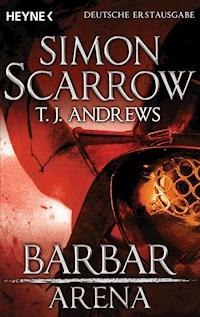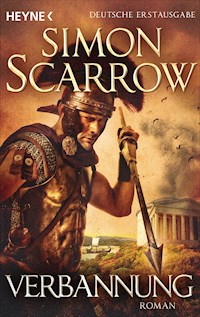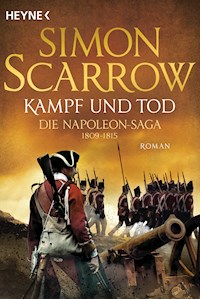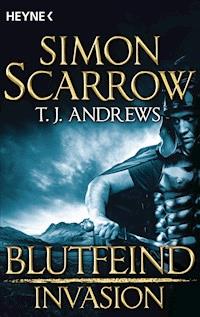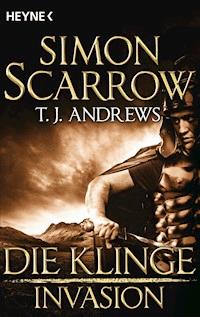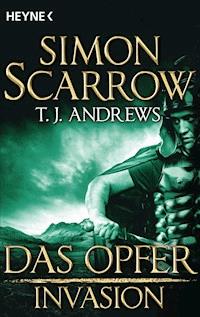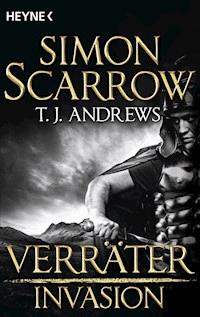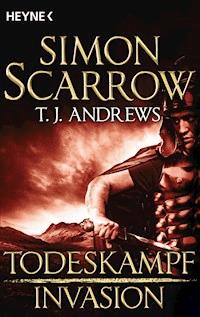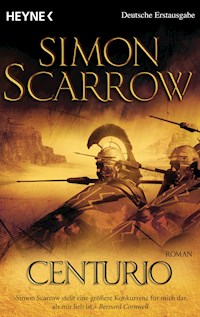
9,99 €
9,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rom-Serie
- Sprache: Deutsch
Im ersten Jahrhundert nach Christus steht nur das kleine Königreich Palmyra zwischen dem römischen Imperium und seinem Erzfeind, dem Reich der Parther. Als die Parther in Palmyra einfallen, um eine Invasion vorzubereiten, werden die beiden Veteranen Macro und Cato mit der Aufgabe betraut, die scheinbar unbesiegbare Übermacht aufzuhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2010
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
DAS BUCH
DER AUTOR
Widmung
DIE RÖMISCHE ARMEE
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
ANMERKUNGEN DES AUTORS
BLUTSCHULD
Copyright
DAS BUCH
Im ersten Jahrhundert nach Christus stellt das mächtige Partherreich die größte Gefahr für den östlichen Teil des römischen Imperiums dar. Die beiden Erzfeinde werden lediglich durch das kleine Königreich Palmyra getrennt, dem es bisher gelungen ist, seine Neutralität zu wahren. Als ein römischer Spähtrupp von den Parthern vernichtet wird, scheint der Krieg unvermeidlich. Die beiden kampferprobten Soldaten Macro und Cato werden nach Palmyra entsandt – der Emporkömmling Artaxes hat mit Hilfe der Parther einen blutigen Aufstand angezettelt, um den Stadtstaat unter seine Kontrolle zu bringen. Der rechtmäßige Herrscher dagegen musste sich in seiner Festung verschanzen. Wird es Macro und Cato gelingen, das Blatt zu wenden und den scheinbar übermächtigen Gegner aufzuhalten?
Mit einer exklusiven Bonusgeschichte!
DER AUTOR
Simon Scarrow wurde in Nigeria geboren und wuchs in England auf. Nach seinem Studium arbeitete er viele Jahre als Dozent für Geschichte an der Universität von Norfolk, eine Tätigkeit, die er aufgrund des großen Erfolgs seiner Romane nur widerwillig und aus Zeitgründen einstellen musste.
Besuchen Sie Simon Scarrow im Internet unter www.scarrow.co.uk
Dieses Buch ist all meinen ehemaligen Studenten gewidmet, die ich zu meiner großen Freude unterrichten durfte. Danke für alles, was Sie mich Ihrerseits gelehrt haben!
DAS ÖSTLICHE REICH IN DER MITTE DES ERSTEN JAHRHUNDERTS
PALMYRA IM ERSTEN JAHRHUNDERT
DIE RÖMISCHE ARMEE
Kurze Vorbemerkung zu den Legionen und den Hilfskohorten
Die Soldaten von Kaiser Claudius dienten in zwei verschiedenen Truppenteilen, den Legionen und den Hilfseinheiten, wie zum Beispiel der Zehnten Legion und der Zweiten Illyrischen Kohorte des vorliegenden Romans.
Die Legionen waren die Eliteeinheiten der römischen Armee. Mit römischen Bürgern bemannt, waren sie schwer bewaffnet, gut ausgerüstet und unterlagen einer extrem harten Ausbildung. Die Legionen waren nicht nur die Hauptwaffe des römischen Militärs, sondern nahmen auch große Bauprojekte wie Straßen- und Brückenbau in Angriff. Jede Legion hatte eine nominelle Stärke von etwa fünfeinhalbtausend Mann. Diese waren in neun Kohorten mit je sechs Centurien à achtzig Mann unterteilt (und nicht etwa hundert, wie man annehmen könnte); hinzu kam eine weitere, die erste Kohorte, die doppelt so groß war wie die anderen und die Aufgabe hatte, in der Schlacht die verwundbare rechte Flanke zu schützen.
Im Gegensatz zu den Legionen rekrutierten die Hilfskohorten ihre Soldaten aus den Provinzen und verliehen denen, die zwanzig Jahre Dienstzeit überlebt hatten, nach ihrer Entlassung das römische Bürgerrecht. Die Römer waren nicht in der Lage, gute Kavallerieeinheiten oder Bogenschützentruppen aufzustellen, doch als praktisch denkendes Volk ließen sie viele dieser Spezialaufgaben von den nicht über das Bürgerrecht verfügenden Hilfskohorten erledigen. Die Hilfstruppen wurden ebenso professionell trainiert wie die Legionen, waren aber leichter ausgerüstet (und schlechter bezahlt!). In Friedenszeiten beschränkten sich ihre Pflichten auf Garnisons- und Polizeiaufgaben, während sie auf den Feldzügen als Späher und als Unterstützungstruppen agierten, deren Hauptaufgabe darin bestand, den Feind an Ort und Stelle zu binden, während die Legionen heranrückten und zum tödlichen Schlag ausholten. Hilfskohorten bestanden im Allgemeinen aus sechs Centurien, wobei es allerdings einige größere Kohorten gab, wie die Zweite Illyrische, die außerdem noch über eine berittene Einheit verfügten. Im aktiven Dienst wurden die Hilfskohorten üblicherweise mit den Legionen zu einer einzigen Truppe vereinigt.
Was die Hierarchie betrifft, so wurden die Centurien der Legionen und der Hilfstruppen jeweils von einem Centurio befehligt, dem ein Optio als zweiter Befehlshaber zur Seite stand. Die Kohorten der Legionen wurden von einem ranghohen Centurio befehligt und die Kohorten der Hilfstruppen von einem Präfekten, der in der Regel ein aus den Legionen dorthin beförderter, sehr erfahrener Offizier war. Die Legionen wurden von einem Legaten kommandiert, der über einen Stab von Tribunen verfügte, jungen, aristokratischen Offizieren, die ihre ersten militärischen Erfahrungen sammelten. Wenn eine Armee aufgestellt wurde, war ihr Kommandant in der Regel ein Mann von erprobter militärischer Kompetenz, der vom Kaiser ausgewählt wurde. Dieser Mann hatte oft noch andere Ämter inne, zum Beispiel das des Provinzstatthalters, wie das auch bei Cassius Longinus der Fall ist, der in diesem Buch auftritt.
KAPITEL 1
Während die Dämmerung sich herabsenkte, spähte der Kommandant der Kohorte die Klippe zum Fluss hinunter. Ein leichter Nebel bedeckte den Euphrat, breitete sich zu beiden Seiten des Ufers aus und verschluckte sogar die Bäume, die entlang des Flusses wuchsen. Der Anblick erinnerte an einen glatten Schlangenleib. Bei diesem Gedanken sträubten sich Centurio Castor die Nackenhaare. Er zog seinen Mantel enger um die Brust, kniff die Augen zusammen und blickte auf das Land, das sich auf der anderen Seite des Euphrat ausbreitete: das Gebiet der Parther.
Es war über hundert Jahre her, dass die römische Macht zum ersten Mal mit den Parthern in Berührung gekommen war. Seitdem spielten beide Reiche ein gefährliches Spiel um die Kontrolle Palmyras und des Landes östlich der römischen Provinz Syrien. Inzwischen verhandelte Rom über engere Bündnisbeziehungen mit Palmyra, und der römische Einfluss hatte sich bis zum Ufer des Euphrat ausgeweitet. Zwischen Rom und dem Partherreich gab es keinen Pufferstaat mehr, und es bestand kaum ein Zweifel, dass die brodelnde Feindseligkeit schon bald zu einem offenen Konflikt aufflammen würde. Als der Centurio und seine Männer aus den Toren von Damaskus marschiert waren, hatten sich die Legionen in Syrien bereits auf einen Feldzug vorbereitet.
Bei diesem Gedanken verfluchte Centurio Castor erneut den aus Rom erhaltenen Befehl, eine Kohorte von Hilfstruppen weit über Palmyra hinaus durch die Wüste zu führen und hier auf den Felsen über dem Euphrat ein Kastell zu errichten. Palmyra lag acht Tagesmärsche entfernt im Westen. Die nächsten römischen Soldaten waren sechs Tagesmärsche jenseits Palmyras in Emesa stationiert. Noch nie in seinem Leben hatte Castor sich so isoliert gefühlt. Er und seine vierhundert Männer befanden sich am äußersten Rand des Imperiums. Sie waren auf diesem Felsen stationiert, um Alarm schlagen zu können, sobald parthische Truppen den Euphrat überquerten.
Nach einem anstrengenden Marsch durch die kahle, felsige Wüste hatten sie ihr Lager in der Nähe der Felsenanhöhe aufgeschlagen und die Arbeit an dem Kastell begonnen. Dort würden sie sich verschanzen, bis irgendein Beamter in Rom endlich entschied, sie ablösen zu lassen. Auf dem Marsch hatte die Kohorte tagsüber unter der sengenden Sonne gelitten. Nachts, wenn die Temperaturen schlagartig fielen, hatten sich die Männer in ihren Mänteln verkrochen. Das Wasser war streng rationiert gewesen, und als sie endlich den Strom erreichten, der die Wüste durchschnitt und das fruchtbare halbmondförmige Gebiet entlang seiner Ufer bewässerte, hatten seine Männer sich ins flache Wasser gestürzt, um ihren Durst zu löschen. Wie verrückt hatten sie das kühle Nass an ihre gesprungenen Lippen geschöpft, bis ihre Offiziere sie wieder zur Ordnung riefen.
Castor hatte drei Jahre lang in der Garnison der Zehnten Legion in Kyrrhos Dienst getan, wo es schöne, gut bewässerte Gärten und all die Freuden des Fleisches gab, die ein Mann sich nur wünschen konnte. Daher betrachtete er seine zeitweilige Versetzung mit wachsendem Entsetzen. Die Kohorte hatte die Aussicht, Monate, wenn nicht gar Jahre in diesem abgelegenen Winkel der Welt zu verbringen. Die Parther würden sie gewiss umbringen – wenn sie nicht zuvor an Langeweile starben. Sobald sie eine Stelle auf dem Felsen gefunden hatten, von der aus man die Furt und die hügeligen Weiten des Partherreichs gut überblicken konnte, hatte der Centurio deshalb seine Männer zur Arbeit an den Befestigungen angetrieben. Castor wusste, dass die Anwesenheit der Römer dem Partherkönig bald zu Ohren kommen würde, und es war von entscheidender Bedeutung, dass die Kohorte starke Befestigungen errichtete, bevor die Parther den Entschluss fassten, gegen sie vorzugehen. Mehrere Tage lang hatten die Hilfstruppen bis zur Erschöpfung geschuftet, um den Boden einzuebnen und die Fundamente für die Mauern und Türme des neuen Kastells zu legen. Dann hatten die Steinmetze eilig die Felsbrocken behauen, die mit Wagen von den rundum errichteten provisorischen Steinbrüchen hergeschafft worden waren. Die Stützmauern waren bereits hüfthoch, und ihre Zwischenräume waren mit Geröll und Steinabfall verfüllt. Als er im abnehmenden Licht über die Baustelle blickte, nickte Centurio Castor zufrieden. Noch fünf Tage, dann wären die Verteidigungsmauern hoch genug, um das Lager in das neue Kastell zu verlegen. Bis dahin aber würden die Männer jede Stunde Tageslicht zur Arbeit nutzen.
Die Sonne war vor einer Weile untergegangen, und am Horizont schimmerte nur noch ein schwacher rötlicher Lichtstreifen. Castor wandte sich an Centurio Septimus, seinen Stellvertreter. »Zeit, für heute Schluss zu machen.«
Septimus nickte, holte tief Luft und brüllte mit trichterförmig vor den Mund gelegter Hand einen Befehl über die Baustelle.
»Kohorte! Werkzeug beiseite und zurück zum Lager!«
Überall auf dem Bauplatz sah Castor die undeutlichen Schemen der müden Männer, die Hacken, Schaufeln und Weidenkörbe aufeinanderstapelten, bevor sie ihre Schilde und Speere an sich nahmen und sich vor der Mauerlücke, die einmal das Haupttor werden würde, schwerfällig in Reih und Glied aufstellten. Als der Letzte von ihnen seinen Platz eingenommen hatte, wehte aus der Wüste ein Windstoß heran. Mit zusammengekniffenen Augen sah Castor im Westen eine dichte Staubwolke, die sich stetig auf sie zu bewegte.
»Ein Sandsturm zieht auf«, knurrte er. »Wir müssen im Lager sein, bevor er uns erreicht.«
Septimus nickte beipflichtend. Er hatte den größten Teil seiner Laufbahn an der östlichen Front gedient und wusste nur zu gut, wie schnell man die Orientierung verlieren konnte, war man erst einmal von dem erstickenden, schmirgelartigen Sand umgeben, den die Stürme dieses Landstrichs mit sich führten.
»Diese Glückspilze unten im Lager müssen sich darüber keine Sorgen machen.«
Castor lächelte kurz. Eine halbe Centurie war zur Bewachung des Lagers zurückgeblieben, während ihre Kameraden oben auf dem Felsen schufteten. Er konnte sich gut vorstellen, dass sie sich jetzt schon in die Wachtürme zurückzogen, wo sie Schutz vor dem beißenden Sandsturm finden würden. »Also, dann lass uns die Männer in Bewegung setzen.«
Er gab den Befehl zum Abmarsch. Die Männer stapften den gewundenen Pfad hinunter, der zu dem provisorischen Lager führte, das gut eine Meile vom Kastell entfernt lag. Der Wind legte an Stärke zu, das Dämmerlicht wurde immer düsterer, und die Umhänge der Soldaten flatterten peitschend, während sie den mit Steinen übersäten Pfad hinabstiegen.
»Mir wird es nicht besonders leidtun, wenn wir diesen Posten hier wieder verlassen dürfen, Herr«, knurrte Septimus. »Hast du eine Ahnung, wie lange es dauern wird, bevor wir abgelöst werden? Auf die Männer und mich wartet in Emesa ein warmes Quartier.«
Castor schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Ich bin so begierig darauf, diesen Ort zu verlassen, wie du. Alles hängt von der Lage in Palmyra ab. Und davon, was unsere parthischen Freunde als Nächstes zu tun gedenken.«
»Verdammte Parther«, schnaubte Septimus. »Diese Drecksäcke sorgen immer wieder für Ärger. Schließlich steckten sie auch hinter dieser Sache in Judäa letztes Jahr, oder nicht?«
Castor nickte in Erinnerung an den Aufstand, der damals östlich des Jordans aufgeflammt war. Die Parther hatten die Rebellen mit Waffen und einer kleinen Truppe berittener Bogenschützen unterstützt. Nur dank des Heldenmuts der Garnison von Kastell Bushir waren die Rebellen und ihre parthischen Verbündeten daran gehindert worden, ganz Judäa zum Aufstand gegen Rom aufzustacheln. Jetzt hatten die Parther ihre Aufmerksamkeit der Oasenstadt Palmyra zugewandt – einem wichtigen Knotenpunkt auf der Handelsstraße nach Osten und Puffer zwischen dem Römischen Reich und den Parthern. Palmyra genoss große Unabhängigkeit und war eher ein Protektorat als ein unterworfener Staat. Doch der König von Palmyra war alt, und die rivalisierenden Mitglieder seines Hofstaats bereiteten sich schon auf den Kampf um seine Nachfolge vor. Einer der mächtigsten Prinzen Palmyras machte kein Geheimnis aus seinem Wunsch, sich mit den Parthern zusammenzutun, sofern er der neue Herrscher wurde.
Castor räusperte sich. »Es obliegt dem Statthalter von Syrien, die Parther davon zu überzeugen, dass sie die Finger von Palmyra lassen.«
Centurio Septimus hob die Augenbrauen. »Cassius Longinus? Glaubst du, er ist dem gewachsen?«
Castor schwieg einen Moment lang und dachte nach. »Longinus wird das schon schaffen. Er ist kein imperialer Speichellecker, sondern hat sich seine jetzige Position redlich verdient. Falls er den diplomatischen Kampf nicht gewinnt, wird er die Parther gewiss in der Schlacht zur Räson bringen. Falls es so weit kommt.«
»Ich wünschte, ich könnte dein Zutrauen teilen, Herr.« Septimus schüttelte den Kopf. »Nach allem, was ich gehört habe, hat Longinus ziemlich schnell Reißaus genommen, als er das letzte Mal in Schwierigkeiten steckte.«
»Wer hat dir das gesagt?«, fuhr Castor ihn an.
»Ein Offizier der Garnison von Bushir, Herr. Anscheinend war Longinus im Kastell, als die Rebellen auftauchten. Der Statthalter war schneller im Sattel und von dort verschwunden, als eine Hure aus der Subura einem den Geldbeutel klauen kann.«
Castor zuckte mit den Schultern. »Er wird seine Gründe gehabt haben.«
»Gewiss.«
Castor blickte seinen Untergebenen mit gerunzelter Stirn an. »Es steht uns nicht zu, über die persönlichen Beweggründe des Statthalters zu spekulieren. Insbesondere nicht in Hörweite der Männer. Behalt das also für dich, verstanden?«
Centurio Septimus spitzte einen Moment lang die Lippen. »Wie du wünschst, Herr.«
Die Kolonne marschierte weiter den Felshang hinunter, und als der Wind stärker wurde, zogen die ersten Staubwirbel über den Pfad. Momente später war jede Kontur der sie umgebenden Landschaft verschwunden, und Castor marschierte langsamer. Mit gebeugten Schultern schoben sich die Männer vorwärts, bemüht, sich hinter ihren Schilden vor den Sandböen zu schützen. Schließlich erreichten sie den Fuß des Abhangs, wo der Pfad eben verlief. Obgleich das Lager inzwischen dicht vor ihnen lag, verbargen der Sand und die zunehmende Dunkelheit es vor ihren Blicken.
»Jetzt ist es nicht mehr weit«, brummte Castor vor sich hin.
Septimus hörte ihn. »Gut. Sobald ich in meinem Zelt bin, spüle ich mir als Erstes meine eingetrocknete Kehle mit einem Tropfen Wein aus.«
»Gute Idee. Macht es dir etwas aus, wenn ich dir dabei Gesellschaft leiste?«
Septimus biss ob dieser unerwarteten Frage die Zähne zusammen und fand sich nur widerwillig damit ab, den letzten Beutel Wein, den er durch die Wüste aus Palmyra mitgebracht hatte, zu teilen. Er räusperte sich und nickte. »Es wäre mir eine Freude, Herr.«
Castor lachte und schlug ihm auf die Schulter. »Braver Kerl! Wenn wir nach Palmyra kommen, geht der erste Becher Wein auf meine Kosten.«
»Jawohl, Herr. Danke.« Septimus blieb unvermittelt stehen und spähte angestrengt über den Pfad vor ihnen. Dann gab er der Kolonne mit erhobener Hand das Zeichen zum Anhalten.
»Was ist los?«, fragte Castor, der dicht neben seinem Untergebenen stehen geblieben war. »Was ist?«
Septimus nickte zum Lager hinüber. »Ich habe etwas gesehen, unmittelbar vor uns. Einen Reiter.«
Beide Offiziere spähten angestrengt in die Sandwirbel vor ihnen, doch es war niemand zu sehen oder zu hören, weder beritten noch zu Fuß. Man sah nur die verschwommenen Flecken verkrüppelter Büsche, die zu beiden Seiten des Pfades wuchsen. Castor schluckte und zwang seine verkrampften Muskeln, sich zu entspannen.
»Was genau hast du gesehen?«
Septimus, der den Zweifel in der Stimme seines Vorgesetzten hörte, sah ihn verärgert an. »Einen Reiter, wie schon gesagt. Ungefähr fünfzig Schritt vor uns. Der Sand hatte sich für einen Moment gelichtet, und da habe ich ihn kurz gesehen.«
Castor nickte. »Bist du dir sicher, dass es nicht einfach nur ein Hirngespinst war? Es könnte ohne Weiteres einer dieser schwankenden Büsche gewesen sein.«
»Wenn ich es dir doch sage, Herr. Es war ein Pferd. Ohne jeden Zweifel. Ich schwöre es bei allen Göttern. Dort vor uns.«
Castor wollte gerade antworten, als beide Männer über das Heulen des Windes hinweg ein leises metallisches Klirren hörten. Das Geräusch war für jeden Soldaten unverkennbar: das Kreuzen von Schwertklingen. Einen Moment später war ein gedämpfter Schrei zu hören – und dann nichts mehr außer dem Heulen des Windes. Castor spürte, wie ihm das Blut in den Adern gefror. Mit gesenkter Stimme befahl er Septimus: »Gib den anderen Offizieren Bescheid. Die Männer sollen sich in dichter Formation aufstellen. Aber leise.«
»Ja, Herr.« Centurio Septimus salutierte und ging zurück, um den Befehl weiterzugeben. Während die Männer sich zu beiden Seiten des Pfades auffächerten, trat Castor ein paar Schritte näher an das Lager heran. Eine Laune des Windes gestattete ihm einen kurzen Blick auf das Torhaus, wo er eine gegen dessen Balken gesunkene Leiche erblickte, in der mehrere Pfeile steckten. Dann verbarg ein Staubschleier das Lager wieder vor seinen Blicken. Castor zog sich zu seinen Männern zurück. Die Hilfssoldaten hatten sich vierfach gestaffelt quer über dem Pfad aufgestellt, die Schilde erhoben und die Speere nach vorn gerichtet, während sie nervös zum Lager blickten. Septimus erwartete seinen Kommandanten bereits an der Spitze der rechten Flanke der Centurie. Neben ihnen lag der Abhang, ein Gewirr aus Felsen und Gestrüpp.
»Hast du irgendetwas gesehen, Herr?«
Castor nickte und trat direkt neben den anderen Offizier. »Das Lager ist angegriffen worden«, sagte er leise.
»Angegriffen?« Septimus hob die Augenbrauen. »Von wem denn? Von den Parthern?«
»Von wem sonst?«
Septimus nickte. Seine Hand glitt zum Griff seines Schwertes. »Wie lauten deine Befehle, Herr?«
»Sie sind noch immer in der Nähe. In diesem Sandsturm können sie überall auf uns lauern. Wir müssen versuchen, das Lager zurückzuerobern, sie zu vertreiben und das Tor zu schließen. Das ist unsere beste Wahl.«
Septimus lächelte grimmig. »Unsere einzige Wahl, wolltest du wohl sagen, Herr.«
Castor antwortete nicht, sondern warf sich den Umhang über die Schultern zurück und zog sein Schwert. Er streckte es gen Himmel und blickte die Formation entlang, um sicherzugehen, dass die anderen Offiziere seinem Beispiel folgten und das Signal weitergaben. Castor hatte keine Ahnung, mit wie vielen Feinden sie es zu tun hatten. Wenn sie kühn genug gewesen waren, das Lager zu erstürmen, mussten sie auch in einer gewissen Stärke angegriffen haben. Der Nebel über dem Fluss und der heraufziehende Sandsturm mussten die anrückenden Feinde verborgen haben. Es war nur ein schwacher Trost für Castor, dass derselbe Sandsturm nun dem Rest seiner Kohorte eine gewisse Deckung bieten würde, während sie sich dem Lager näherte. Mit etwas Glück konnten die Hilfstruppen nun ihrerseits den Feind überrumpeln. Langsam senkte er den Schwertarm und führte die Spitze der Klinge dabei im Bogen auf das Lager zu. Das Signal wurde entlang der Formation wiederholt und gelangte so zu den Männern zu seiner Linken, die vom Dämmerlicht und vom Staub vor seinen Augen verborgen waren.
Castor führte das Schwert zurück, bis es mit der flachen Klinge auf dem Schildrand ruhte, und marschierte los. Die Hilfssoldaten folgten ihm im Gleichschritt und marschierten in fester Formation über den unebenen Boden auf das Lager zu. Das Tempo, das die Offiziere vorgaben, war langsam genug, um die Reihen geordnet zu halten. Je weiter sich die Centurie von der Felsanhöhe entfernte, umso mehr wich der abschüssige Hügel ebenem Boden. Auf der Suche nach einem Hinweis auf den Feind oder die Befestigungen des Lagers spähte Castor mit zusammengekniffenen Augen nach vorn. Dann entdeckte er das Haupttor, das sich im wirbelnden Staub und Sand abzeichnete. Der Umriss der Palisade trat zu beiden Seiten deutlich hervor, als die Hilfssoldaten sich dem Lager näherten. Abgesehen von der Leiche, die am Torpfosten lehnte, war niemand zu sehen, weder tot noch lebendig.
Zu seiner Rechten hörte er Hufschläge. Castor drehte sich genau in dem Moment um, als einer seiner Männer am Ende der Kampfreihe mit einem Aufschrei nach dem Schaft eines Pfeils tastete, der sich in seine Brust gebohrt hatte. Undeutliche Gestalten näherten sich durch den Schleier des Sandsturms. Mehrere berittene Bogenschützen der Parther galoppierten auf die Hilfssoldaten zu und durchbohrten die ungeschützten rechten Körperseiten der römischen Soldaten mit Pfeilen. Vier Männer wurden getroffen und taumelten zu Boden; ein weiterer krümmte sich vor Schmerz, versuchte aber, auf den Beinen zu bleiben, während er mit einem Pfeil kämpfte, der durch seinen Oberschenkel gedrungen war und diesen an das andere Bein geheftet hatte. Die Parther rissen ihre Pferde herum und stürmten davon, während die überrumpelten Hilfssoldaten ihnen entsetzt nachstarrten.
Beinahe unmittelbar danach ertönte ein Schrei aus der linken Flanke. Der Feind ritt einen erneuten Angriff.
»Bewegt euch!«, rief Castor, der hörte, wie sich weitere Reiter von hinten der Kohorte näherten. »Lauft, Männer!«
Die geordneten Reihen der Kohorte lösten sich zu einem Durcheinander von Soldaten auf, die auf das Haupttor zueilten, Castor unter ihnen. Dann sah er, wie die Tore sich schlossen, und sofort tauchten über der Palisade Dutzende von Gesichtern auf. Bogen wurden angelegt, wieder schwirrten Pfeile durch die Luft, weitere Hilfssoldaten wurden niedergestreckt. Hilflos kam die Truppe vor dem Lager zum Stehen. Der Pfeilhagel ließ nicht nach. Die Geschosse prallten klappernd von den Schilden ab oder gruben sich mit einem schmatzenden Laut in Fleisch. Von allen Seiten ertönten Schreie. Mit einem elenden Gefühl in der Magengrube wurde Castor klar, dass das Schicksal seiner Männer besiegelt war, wenn er nichts unternahm.
»Zu mir!«, schrie Castor. »Versammelt euch um mich!«
Eine Handvoll Männer befolgten den Befehl. Sie hoben die Schilde um Castor und reckten die Standarte der Kohorte in die Höhe. Weitere Männer schlossen sich ihnen an und wurden von Septimus, der ebenfalls zu seinem Kommandanten eilte, in die richtige Gefechtsposition gestoßen. Als etwa fünfzig Männer mit erhobenen Schilden einen engen Kreis gebildet hatten, rief Castor den Befehl, sich über den Pfad zum Felsen zurückzuziehen. Langsam wichen sie in die Dämmerung zurück und ließen ihre verwundeten Kameraden zurück, die sie verzweifelt anflehten, sie nicht den Parthern zu überlassen. Castor stählte sein Herz. Es gab nichts, was er für die Verwundeten tun konnte. Den einzigen Schutz für die Überlebenden der Kohorte bot nun einzig das halbfertige Kastell auf dem Felsen. Wenn sie es erreichen konnten, hatten sie eine bessere Ausgangslage für das letzte Gefecht, das ihnen bevorstand. Die Kohorte war dem Tode geweiht, aber sie würde so viele Parther wie möglich mit sich nehmen.
Die kleine Truppe erreichte den Fuß der Anhöhe, bevor der Feind ihre Absicht durchschaute und die Verfolgung aufnahm. Reiter preschten aus der Dunkelheit heran, zügelten ihre Pferde und schossen einen Pfeil nach dem anderen ab, nachdem sie begriffen hatten, dass der Vorteil eines Überraschungsangriffs nicht länger auf ihrer Seite war. Während die Kohorte sich langsam den Pfad hinaufbewegte, bot sie dem Feind ein nur wenig lohnenswertes Ziel; eine Wand von Schilden schützte die kleine Schar von Überlebenden. Die Parther folgten ihnen so dicht, wie sie es wagen konnten, und schossen ihre Pfeile ab, sobald sich zwischen den Schilden auch nur die kleinste Lücke zeigte. Als sie die Sinnlosigkeit dieses Unterfangens bemerkten, änderten sie ihre Taktik und nahmen die ungeschützten Beine der Verfolgten ins Visier, wodurch sie diese zwangen, so tief in Deckung zu gehen, dass sie nur noch langsam und mühselig vorankamen. Fünf weitere Männer wurden verwundet, ehe die kleine Kolonne von Hilfssoldaten den Rand des Felsplateaus erreichte. Hier oben wehte der Sturm noch immer heftig, aber wenigstens wurden sie nicht mehr von den Staubwolken eingehüllt und konnten frei über den dahinfegenden Sand hinwegblicken, der die Umgebung verdunkelte.
Castor ließ Septimus als Befehlshaber der Nachhut zurück und führte die verbliebenen Männer durch die Lücke des Haupttors. Die bereits errichteten Mauern waren viel zu niedrig, um die Parther abzuwehren, und der einzige Ort, an dem die Soldaten sich dem Feind entgegenstellen konnten, war der beinahe fertiggestellte Wachturm am hinteren Ende des Kastells unmittelbar vor der Klippe.
»Hier entlang!«, brüllte Castor. »Folgt mir!«
Sie hasteten über das Labyrinth aus geraden steinernen Linien, die die Grundrisse der für das Kastell geplanten Gebäude und Durchgangswege markierten. Vor ihnen ragte der dunkle Wachturm vor dem sternenübersäten Nachthimmel auf. Sobald sie den Holzbau erreicht hatten, stellte Castor sich am Eingang auf und winkte seine Männer hinein. Sie waren nicht mehr als zwanzig, und er wusste, dass sie sich glücklich schätzen konnten, wenn sie am nächsten Morgen noch lebten. Castor schlüpfte als Letzter durch das Tor und erteilte seinen Männern den Befehl, die Aussichtsplattform und die Schießscharten im ersten Stock zu bemannen. Er selbst behielt vier Soldaten bei sich, um den Eingang zu verteidigen. Dann warteten sie auf Septimus und die Nachhut. Es dauerte nicht lange, dann rannten mehrere undeutliche Gestalten durch das unfertige Torhaus und stürmten auf den Wachturm zu. Gleich darauf tauchte eine Horde feindlicher Krieger auf und jagte mit Triumphgeschrei hinter ihnen her.
Castor legte die Hand an den Mund. »Sie sind direkt hinter euch! Lauft!«, rief er.
Die Männer der Nachhut, die schwer an ihren Rüstungen schleppten und zudem durch den langen Arbeitstag erschöpft waren, stolperten durch das sich noch im Bau befindliche Lager. Einer der Männer wurde von einem losen Stein zu Fall gebracht und stürzte mit einem durchdringenden Schrei zu Boden, doch keiner seiner Kameraden sah sich auch nur nach ihm um. Gleich darauf spülte eine Welle von Parthern über den Gestürzten hinweg und wälzte sich auf den Wachturm zu. Im Schwarm fielen sie über den Soldaten her und hieben mit ihren geschwungenen Klingen grausam auf ihn ein. Sein Tod erkaufte seinen Kameraden die nötige Zeit, um den Wachturm zu erreichen. Sie drängten sich hinein, senkten die Schilde und schnappten nach Luft. Septimus befeuchtete sich die Lippen, zwang sich, Haltung anzunehmen, und erstattete heftig keuchend Bericht.
»Zwei Männer verloren, Herr … Den einen hinten auf dem Pfad und den anderen gerade eben.«
»Das ist mir nicht entgangen.« Castor nickte.
»Was jetzt?«
»Wir kämpfen, solange es uns möglich ist.«
»Und dann?«
Castor lachte. »Dann sterben wir. Aber vorher schicken wir noch mindestens vierzig von denen voraus auf den Weg zum Hades.«
Septimus zwang sich um der Männer willen, die das Gespräch mit anhörten, zu einem Grinsen. Dann warf er einen Blick über Castors Schulter, und seine Miene verfinsterte sich. »Da kommen sie, Herr.«
Castor drehte sich um und hob seinen Schild. »Wir müssen sie aufhalten! Formiert euch!«
Septimus stellte sich neben ihn. Die vier Männer hinter ihnen hoben ihre Speere, um damit über die Köpfe der beiden Offiziere hinweg nach dem Feind zu stechen. Vor dem Turm stürmten die Parther in einer dunklen Masse über den geröllübersäten Boden und warfen sich gegen die Schilde, die die Tür blockierten. Castor hatte nur einen Augenblick lang Zeit, sich zu sammeln, bevor der Andrang des Feindes seinen Schild gegen ihn presste. Er grub die eisenbeschlagenen Schuhsohlen in den Boden und hielt dagegen, wobei er sein ganzes Gewicht hinter den Schild verlagerte. Die scharfe Speerspitze eines Soldaten jagte über Castors Schulter hinweg, und ein Schmerzensschrei ertönte. Als der Speer zurückgerissen wurde, spritzte Castor ein Sprühregen warmer Tröpfchen in die Augen. Er blinzelte, während von außen ein Schwerthieb auf seinen Schild krachte. An seiner Seite presste Centurio Septimus seinen Schild gegen die Masse der herandrängenden Feinde und stieß sein Schwert in jeden ungeschützten Flecken Fleisch, den er zwischen Schildrand und Türstock entdeckte.
Solange die beiden Offiziere die Stellung hielten und von den Männern hinter ihnen mit stoßbereiten Speeren unterstützt wurden, konnte der Feind nicht durch den Eingang dringen. Einen Moment lang hob sich Castors Mut, da der Kampf nun zum ersten Mal zugunsten der Römer verlief.
Zu spät bemerkte er die Bewegung am Boden, als einer der Parther sich unmittelbar vor den Eingang kauerte und seine Klinge unter dem Rand von Castors Schild hindurch schwang. Die Schneide drang tief in Castors Knöchel und durchtrennte Leder, Fleisch und Muskelstränge, bevor sie auf den Knochen traf. Mit einem lauten Schrei, der gleichermaßen von Schmerz und Wut zeugte, taumelte Castor zurück.
Septimus blickte sich rasch um und sah seinen Kommandanten neben dem Eingang zusammenbrechen. »Der nächste Mann! Neben mich!«, rief er.
Tief geduckt, um seine Beine zu schützen, schob sich ein Soldat an Septimus’ Seite, während seine Kameraden den Feind mit groben Speerstößen vom Eingang zu vertreiben suchten. Da ertönte plötzlich ein Warnschrei in der Dunkelheit, und ein schwerer Baustein krachte vor dem Wachturm auf den Boden. Castor, der sich zur Seite beugte, um am Türrahmen vorbeispähen zu können, sah, wie ein behauener Stein auf die Parther hinunterfiel, einem Mann den Schädel einschlug und ihn zu Boden warf. Weitere behauene und unbehauene Steine gingen auf die Angreifer nieder und töteten oder verstümmelten mehrere von ihnen, bevor sie sich in sichere Entfernung zurückziehen konnten.
»Großartig, bei den Göttern!«, knurrte Septimus, zufrieden bei diesem Anblick. »Jetzt spüren sie am eigenen Leib, wie es ist, getroffen zu werden, ohne sich wehren zu können. Die Bastarde.«
Als der Feind sich außer Wurfweite zurückgezogen hatte, ließ der Steinhagel nach. Der Kampflärm wich dem höhnischen Geschrei und Gejohle der Soldaten im Wachturm und dem Stöhnen und Schreien der Verwundeten vor dem Eingang. Septimus warf einen letzten Blick nach draußen und winkte dann einen seiner Männer zu sich, seinen Platz einzunehmen. Er lehnte den Schild gegen die Wand und kniete sich hin, um Castors Wunde im matten Schein des durch den Eingang leuchtenden Sternenhimmels zu untersuchen. Sanft tastete er mit den Händen die Wunde ab und spürte die Knochensplitter im aufgerissenen Fleisch. Castor, der gegen den Drang ankämpfte, laut aufzuschreien, holte tief Luft und biss die Zähne zusammen.
Septimus sah zu ihm auf. »Ich muss dir leider sagen, dass deine Tage als Soldat gezählt sind.«
»Ich glaube, das weiß ich bereits«, zischte Castor.
Septimus lächelte kurz. »Ich muss die Blutung stoppen. Gib mir dein Halstuch, Herr.«
Castor knotete das Tuch auf, nahm es ab und reichte es Septimus. Dieser legte ein Ende unter die Wade seines Befehlshabers. »Das wird wehtun. Bist du bereit?«
»Mach einfach weiter.«
Septimus wickelte das Tuch um die Wunde und band es über dem Knöchel fest zusammen. Der schneidende Schmerz war schlimmer als alles, was Castor je erduldet hatte, und als Septimus mit dem Knoten fertig war und aufstand, schwitzte er trotz der kalten Nacht heftig.
»Ihr müsst mich aufrecht gegen die Treppe lehnen, wenn die Zeit für unser letztes Gefecht gekommen ist.«
Septimus nickte. »Ich werde dafür sorgen, Herr.«
Die beiden Offiziere sahen sich einen Moment lang an, während sie über die wahre Bedeutung ihrer letzten Worte nachdachten. Jetzt, da sie das Unvermeidliche akzeptiert hatten, spürte Castor, wie sich seine Besorgnis um das Wohlergehen der Truppe legte. Trotz der Qualen, die seine Wunde ihm bereitete, war er von einem Gefühl schicksalsergebener Gelassenheit erfüllt und fest entschlossen, im Kampf zu sterben. Septimus spähte durch die Tür und sah den Feind in Gruppen um den Turm stehen, außer Reichweite der Steine, die die Soldaten vom Wachturm geworfen hatten.
»Was haben sie vor?«, überlegte er laut. »Wollen sie uns aushungern?«
Castor schüttelte den Kopf. Dafür kannte er die Natur von Roms altem Feind zu gut – schließlich hatte er lange genug im Osten gedient. »Darauf werden sie nicht warten. Darin liegt keine Ehre.«
»Was dann?«
Castor zuckte mit den Schultern. »Das werden wir bald genug erfahren.«
Es folgte ein Moment der Stille, bevor Septimus sich vom Eingang abwandte. »Nun, womit haben wir es zu tun? Mit einem einfachen Überfall? Oder mit dem Beginn eines neuen Feldzugs gegen Rom?«
»Spielt das noch eine Rolle?«
»Ich möchte den Grund für meinen Tod kennen.«
Castor dachte mit gespitzten Lippen über die Situation nach. »Es könnte ein einfacher Überfall sein. Vielleicht betrachten die Parther den Bau dieses Kastells als einen Akt der Provokation. Möglicherweise beabsichtigen sie aber auch, ihrer Armee einen Weg über den Euphrat zu bahnen. Dieser Vorstoß könnte ihr erster Zug sein, um die Kontrolle über Palmyra zu übernehmen.«
Castors Gedanken wurden durch einen Ruf von draußen unterbrochen.
»Römer! Hört mich an!«, rief eine Stimme auf Griechisch. »Das Partherreich fordert euch auf, die Waffen niederzulegen und euch zu ergeben!«
»So ein Unsinn!«, schnaubte Septimus.
Der Mann draußen im Dunkeln ging nicht auf den höhnischen Ruf ein und fuhr mit gleichmütiger Stimme fort. »Mein Kommandant fordert euch auf, euch zu ergeben. Wenn ihr die Waffen niederlegt, werden wir euch verschonen. Darauf gibt er euch sein Wort.«
»Verschonen?«, wiederholte Castor leise, bevor er seine Antwort rief. »Ihr verschont uns und gestattet uns, nach Palmyra zurückzukehren?«
Es folgte eine kurze Pause, bevor die Stimme antwortete. »Wir werden euer Leben verschonen, euch aber nichtsdestotrotz gefangen nehmen.«
»Sklaven werden wir sein«, knurrte Septimus und spuckte auf den Boden. »Ich werde nicht als ehrloser Sklave sterben.« Er wandte sich Castor zu. »Herr? Was sollen wir tun?«
»Sag ihm, er soll zum Hades gehen.«
Septimus lächelte schmallippig. Seine Zähne schimmerten im Mondlicht. Er wandte sich dem Eingang zu. »Wenn ihr unsere Waffen wollt, kommt und holt sie euch!«, rief er.
Castor lachte. »Nicht gerade originell, aber trotzdem schöne Worte.«
Die Offiziere grinsten sich an, und die anderen Männer lächelten nervös.
»Nun gut. Dann wird dieser Ort euer Grab sein. Oder besser … euer Scheiterhaufen«, rief die Stimme.
Auf der anderen Seite der Baustelle war jetzt ein schwacher Lichtschein zu sehen. Septimus beobachtete, wie eine kleine Flamme aufloderte, vor der sich die Silhouette eines über einen Zundervorrat gebeugten Soldaten dunkel abhob. Die Flamme wurde sorgfältig genährt, so dass schnell ein kleines Feuer entstand, um das die Parther sich versammelten. Hastig entzündeten sie aus dem umliegenden Gestrüpp gebrochene Äste. Dann näherten sich die Krieger dem Wachturm. Septimus sah, wie der erste der Brandpfeile an eine Fackel gehalten wurde, bis die in Öl getauchten Lumpen, mit denen die Spitzen umwickelt waren, in Flammen aufgingen. Sofort spannte der Schütze seinen Bogen und schoss auf den Wachturm. Der Pfeil flog lodernd durch die Dunkelheit und schlug mit so gewaltiger Kraft in das Holzgerüst ein, dass die Funken sprühten. Sofort schossen weitere lodernde Pfeile auf den Turm zu, gruben sich splitternd und krachend ins Holz und blieben brennend stecken.
»Bei den Göttern!« Septimus umklammerte den Griff seines Schwertes. »Sie wollen den Turm niederbrennen.«
Castor wusste, dass sie kein Wasser zur Verfügung hatten, und schüttelte den Kopf. »Dagegen sind wir machtlos. Ruf die Männer vom Wachturm herunter.«
»Ja, Herr.«
Als die letzten Überlebenden sich kurz darauf in dem kleinen Wachraum drängten, stützte sich Castor an der Wand ab und richtete sich auf, um auf Augenhöhe zu seinen Männern sprechen zu können.
»Es ist vorbei, Männer. Entweder bleiben wir hier und verbrennen bei lebendigem Leib, oder wir gehen jetzt da raus und nehmen einige dieser Bastarde mit uns in den Hades. Mehr können wir nicht tun. Wenn ich euch den Befehl gebe, folgt ihr Centurio Septimus aus dem Turm. Bleibt dicht beieinander und rennt sie über den Haufen. Verstanden?«
Ein paar der Männer nickten, und einige brachten ein paar bestätigende Worte hervor. Septimus räusperte sich. »Was ist mit dir, Herr? Du kannst nicht mit uns kommen.«
»Ich weiß. Ich bleibe hier und kümmere mich um die Standarte. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie dem Feind in die Hände fällt.« Castor hielt dem Signifer der Kohorte die ausgestreckte Hand hin. »Hier, gib sie mir.«
Der Standartenträger zögerte einen Moment, trat dann vor und reichte seinem Kommandanten den Schaft. »Bewahre sie gut, Herr.«
Castor nickte, packte die Standarte fest und stützte sich darauf, um sein verletztes Bein zu entlasten. Rundum war die warme Luft vom Knistern und Prasseln der Flammen erfüllt. Ein unheimliches orangerotes Licht erleuchtete die Erde rings um den Wachturm. Castor humpelte zu der schmalen Holztreppe in der Ecke. »Wenn ich auf dem Dach angelangt bin, gebe ich den Befehl zum Angriff. Sorgt dafür, dass jeder Speerstoß und jeder Schwerthieb trifft, Männer.«
»So soll es geschehen«, antwortete Septimus leise.
Castor nickte, umfasste kurz den Arm des Centurio und stieg dann mit zusammengebissenen Zähnen die Holztreppe zum Dach hinauf, während die Luft immer heißer wurde und Rauchfäden sich im orangeroten Licht kräuselten, das durch die Fenster und Schießscharten nach draußen drang. Als er oben angekommen war, stand die dem Feind zugekehrte Seite des Wachturms bereits in Flammen. Castor sah Dutzende von Parthern, die im hellen Lichtschein des Feuers warteten, und holte tief Luft.
»Centurio Septimus! Jetzt! Zum Angriff!«
Unten im Turm ertönte ein dünner Chor von Kriegsschreien. Castor sah, wie die Parther ihre Bogen hoben und zielten. Dann war die Luft von schwirrenden dunklen Pfeilen erfüllt. Über die Brüstung verfolgte er, wie die kleine, dicht gedrängte Truppe seiner Männer zum Angriff überging. Die Schultern hinter den Schilden eingezogen, rannten sie hinter dem wild fluchenden Septimus direkt auf den Feind zu. Die feindlichen Bogenschützen hielten ihre Stellung und schossen ihre Pfeile so schnell sie konnten auf das näher rückende Ziel ab. Diejenigen, die noch Brandpfeile hatten, feuerten sie in hell lodernden Bahnen auf die Hilfssoldaten ab. Mehrere Pfeile blieben brennend in den Schilden stecken, doch ihre Träger rannten einfach weiter. Dann sah Castor, wie Septimus plötzlich wie angewurzelt stehen blieb, das Schwert fallen ließ und nach einer Pfeilspitze griff, die ihm in den Hals gedrungen war, während der letzte seiner Kriegsrufe noch über den Schauplatz gehallt war. Dann fiel er auf die Knie und stürzte vornüber. Zuckend verblutete er.
Die Hilfssoldaten drängten sich um den Sterbenden und hoben ihre Schilde. Castor beobachtete sie mit bitterer Enttäuschung. Die Kraft des Angriffs war mit Septimus’ Tod verlorengegangen. Jetzt fielen die Soldaten einer nach dem anderen, als die Pfeile der Parther ihren Weg zwischen ihren Schilden hindurch fanden und sich den Männern dahinter ins Fleisch bohrten. Castor wartete das Ende nicht ab. Schwer auf die Standarte gestützt, humpelte er zur anderen Seite der Aussichtsplattform und blickte die Klippe zum Fluss hinunter. Weit unten hatte der Nebel sich aufgelöst, so dass sich das Mondlicht unregelmäßig im reißenden Wasser brach, das dort über zahlreiche Felsen floss. Castor legte den Kopf zurück, blickte in die gleichgültigen Tiefen des Himmels und sog die Nachtluft in tiefen Zügen ein.
Auf der anderen Seite des Turms krachte plötzlich ein Balken herab. Castor blickte sich um und begriff, dass ihm nur noch wenig Zeit blieb, wenn er dafür sorgen wollte, dass die Standarte nicht in feindliche Hände fiel. Durch den wabernden Schleier von Flammen und Rauch sah er auf die schimmernden Reihen der Parther hinab. Dies war erst der Anfang. Bald würden Feuer und Zerstörung über die Wüste hinwegstürmen und die östlichen Provinzen des römischen Imperiums bedrohen. Castor umklammerte den Schaft der Standarte fest mit beiden Händen und humpelte an den äußersten Rand der Plattform. Nach einem letzten tiefen Atemzug biss er die Zähne zusammen und warf sich in die Tiefe.
KAPITEL 2
Besser kann das Leben nicht sein.« Macro lehnte sich lächelnd gegen die Wand der »Überfließenden Amphore«, seines Stammlokals, und streckte die Beine von sich. »Endlich bin ich nach Syrien versetzt worden. Weißt du was, Cato?«
»Was denn?« Sein Gefährte öffnete blinzelnd die Augen.
»Es ist genau so, wie ich es mir erträumt hatte.« Macro schloss die Augen und genoss die Wärme der Sonne auf seinem wettergegerbten Gesicht. »Guter Wein, halbwegs preiswerte Frauen, die den einen oder anderen Trick kennen, und schönes, trockenes Wetter. Es gibt hier sogar eine brauchbare Bibliothek.«
»Ich hätte nie damit gerechnet, dass du dich für Bücher interessieren würdest«, sagte Cato. In den letzten Monaten hatte Macro seine epikureischen Gelüste nahezu gestillt und sich dem Lesen zugewandt. Zugegebenermaßen bevorzugte er obszöne Komödien und Erotisches, aber wenigstens las er überhaupt. Cato hoffte, dass dieser Zeitvertreib vielleicht irgendwann zu einer anspruchsvolleren Lektüre führen würde.
Macro lächelte. »Vorläufig bin ich hier vollkommen zufrieden. Sonniges Wetter und schöne Frauen. Ich sage dir, nach diesem Feldzug in Britannien will ich mein ganzes Leben lang nie wieder einen Kelten sehen.«
»In der Tat«, stimmte Cato nachdrücklich zu und erinnerte sich an die kalten, feuchten, nebelverhangenen Sümpfe, in denen er, Macro und die Männer der Zweiten Legion sich durch die jüngste Eroberung des Imperiums gekämpft hatten. »Obwohl – im Sommer war es gar nicht so schlimm.«
»Sommer?«, fragte Macro stirnrunzelnd. »Ah, du meinst wohl die paar warmen Tage zwischen Winter und Herbst.«
»Warte nur ab. Ein paar Monate Feldzug in der Wüste, und du wirst dich an die Zeit in Britannien erinnern, als wäre dort das Elysium gewesen.«
»Das kann schon sein«, überlegte Macro, als er sich an ihren letzten Stützpunkt in der Einöde an der Grenze Judäas erinnerte. Er schüttelte diese Gedanken schnell ab. »Aber jetzt befehlige ich erst einmal eine Kohorte, genieße den Sold eines Präfekten und die Aussicht auf eine anständige Ruhepause, bevor wir wieder Leib und Leben für den Kaiser, den Senat und das römische Volk riskieren müssen« – ironisch intonierte er den offiziellen Leitspruch -, »womit ich natürlich diesen ach so schlauen, ränkeschmiedenden Drecksack Narcissus meine.«
»Narcissus …« Cato wiederholte den Namen von Kaiser Claudius’ Privatsekretär, setzte sich auf und wandte sich seinem Freund zu. Er senkte die Stimme. »Noch immer keine Antwort von ihm. Er muss unseren Bericht doch inzwischen gelesen haben.«
»Ja.« Macro zuckte mit den Schultern. »Und?«
»Was wird er wohl gegen den Statthalter unternehmen, was meinst du?«
»Gegen Cassius Longinus? Oh, der wird keine Schwierigkeiten bekommen. Longinus hat seine Spuren gut verwischt. Es gibt keine handfesten Beweise, die ihn mit dem Verrat in Verbindung bringen. Du kannst dir sicher sein: Jetzt, da er weiß, dass er unter Beobachtung steht, wird er sein Bestes tun, der treueste Diener des Kaisers zu sein.«
Cato ließ den Blick kurz über die Gäste am Nachbartisch wandern und beugte sich dann zu Macro hinüber. »Da wir die Männer sind, die Narcissus losgeschickt hat, um Longinus zu beobachten, bezweifle ich, dass der Statthalter über unseren Tod sehr betrübt wäre. Wir müssen sehr vorsichtig sein.«
»Er wird uns wohl kaum umbringen lassen«, meinte Macro von oben herab. »Das würde zu viel Verdacht erregen. Entspann dich, Cato, alles ist bestens.« Er reckte sich, ließ die Schultern knacken und faltete dann die Hände mit einem zufriedenen Gähnen hinter dem Kopf.
Cato betrachtete ihn einen Moment lang und wünschte sich, Macro würde die von Cassius Longinus ausgehende Gefahr nicht so beiläufig abtun. Einige Monate zuvor hatte der Statthalter von Syrien drei zusätzliche Legionen angefordert, um dem sich ausbreitenden Aufstand in Judäa entgegenzutreten. Mit einer solchen Streitmacht im Rücken hätte Longinus eine ernsthafte Bedrohung für den Kaiser dargestellt. Cato war überzeugt, dass Longinus sich darauf vorbereitet hatte, den Kaiserthron an sich zu reißen. Dank Macro und Cato war die Revolte niedergeschlagen worden, bevor sie die gesamte Provinz erfasste, und Longinus war der Notwendigkeit für seine Zusatzlegionen beraubt gewesen. Ein so mächtiger und gefährlicher Mann wie der Statthalter würde denjenigen, die sein ehrgeiziges Vorhaben vereitelt hatten, nicht so leicht vergeben, und Cato fürchtete nun schon seit mehreren Monaten seine Rache. Doch jetzt stellte die wachsende Bedrohung durch die Parther eine echte Gefahr für den Statthalter dar, und er hatte nur die Dritte, Sechste und Zehnte Legion und deren zugehörige Hilfseinheiten zur Verfügung, um dem Feind gegenüberzutreten. Sollte in den östlichen Provinzen Krieg ausbrechen, würde man jeden verfügbaren Mann brauchen, um sich den Parthern entgegenzustellen. Cato seufzte. Es war eine Ironie des Schicksals, dass ihm die Bedrohung durch die Parther gerade sehr willkommen war. Das sollte den Statthalter zumindest eine Zeit lang von seinem Rachedurst ablenken. Cato leerte seinen Becher, lehnte sich gegen die Wand und sah über die Stadt hinweg.
Die Sonne stand dicht über dem Horizont, und die Dachziegel und Kuppeln Antiochias schimmerten im Schein des schwächer werdenden Lichts. Wie in den meisten Städten, die unter römische Herrschaft gefallen und davor von den griechischen Erben Alexanders des Großen regiert worden waren, ragten im Stadtzentrum jene öffentlichen Gebäude auf, die man im ganzen Imperium fand. Hinter den hoch aufragenden Säulen der Tempel und Portiken schlossen sich schöne Stadthäuser und das Gassengewirr großer Armenviertel mit schmuddeligen Flachdachhütten an. In jenen Gassen herrschte der Gestank der dicht gedrängten Bewohner. Dort verbrachten die meisten Soldaten ihre Zeit, wenn sie dienstfrei hatten. Cato und Macro bevorzugten dagegen den relativen Komfort der »Überfließenden Amphore«, die mit ihrer leicht erhöhten Lage jeden erfrischenden Luftzug einfing, der über die Stadt wehte.
Sie hatten den größten Teil des Nachmittags getrunken. Cato versank allmählich in der warmen Umarmung müder Zufriedenheit und nickte hin und wieder kurz ein. Den ganzen letzten Monat über hatten sie ihre Hilfskohorte, die Zweite Illyrische, in dem riesigen Militärlager vor den Mauern Antiochias gnadenlos gedrillt. Die Kohorte war Macros erstes Kommando als Präfekt, und er war wild entschlossen, seine Männer zu einer schlagkräftigen Truppe auszubilden, die schneller marschierte und härter kämpfte als jede andere Kohorte in der Armee des östlichen Imperiums. Macros Aufgabe war durch den Umstand erschwert worden, dass nahezu ein Drittel der Männer unerfahrene Rekruten waren – Ersatz für die Leute, die er beim Kampf um Kastell Bushir verloren hatte. Da die Armee in Alarmbereitschaft versetzt worden war, hatte jeder Kohortenkommandant die Region nach waffenfähigen Männern durchkämmen lassen, um seine Einheit auf Sollstärke zu bringen.
Während Cato sich um die Ausbildung der Kohorte gekümmert und die nötigen Ausrüstungsgegenstände und Vorräte bestellt hatte, war Macro auf der Suche nach Rekruten die Küste von Pieria bis Caesarea entlanggereist. Er hatte zehn seiner kampferprobtesten Soldaten und die Standarte der Kohorte mitgenommen. In jeder Stadt hatte Macro einen Stand auf dem Forum aufgeschlagen und vor dem Publikum untätiger und rastloser Männer, die man wohl auf jedem Marktplatz des Imperiums fand, eine feurige Werberede gehalten. Mit dröhnender Exerzierplatzstimme versprach er ihnen eine Eintrittsprämie, anständigen Sold, regelmäßige Mahlzeiten, Abenteuer und, sollten sie so lange leben, zur Belohnung das römische Bürgerrecht, wenn sie nach der kleinen Formalität einer fünfundzwanzigjährigen Dienstzeit schließlich entlassen wurden. Mit ein wenig Übung würden sie genauso eindrucksvoll und männlich sein wie die Soldaten, die hinter Macro standen. Jedes Mal, wenn er seine Rede beendet hatte, näherte sich ein kunterbunter Haufen von Bewerbern dem Stand. Macro nahm die gesündesten von ihnen auf und wies all jene ab, die untauglich, zu einfältig oder zu alt waren. In den ersten Städten konnte er es sich noch leisten, wählerisch zu sein, doch als er die Rekrutierungsreise fortsetzte, stellte er fest, dass andere Offiziere vor ihm da gewesen waren und sich bereits die besten Männer gesichert hatten. Trotzdem hatte er bei seiner Rückkehr genug Rekruten angeworben, um die Kohorte auf Sollstärke zu bringen, und genug Zeit für die Ausbildung, bevor ein Feldzug beginnen konnte.
Macro verbrachte die langen Wintermonate damit, die neuen Rekruten zu drillen, während Cato mit dem Rest der Männer mörderische Gewaltmärsche und aufreibende Waffenübungen absolvierte. Während die Zweite Illyrische ausgebildet wurde, traf ein steter Strom weiterer Einheiten in Antiochia ein und vergrößerte das wachsende Lager vor der Festung der Zehnten Legion. Im Gefolge der Soldaten kamen Scharen von Zivilisten. Die Gassen und Märkte Antiochias hallten von den Rufen der Straßenverkäufer wider. Jede Taverne war mit Soldaten vollgepackt, und vor den grell bemalten Bordellen, die nach billigem Parfüm und Schweiß rochen, standen die Männer Schlange.
Während die Sonne über der Stadt unterging, betrachtete Cato all das völlig unvoreingenommen. Mit seinen gerade einmal zwanzig Jahren hatte er bereits viereinhalb Jahre in der Armee gedient und sich an das Gebaren von Soldaten gewöhnt und daran, wie sich ihre Anwesenheit auf die Städte auswirkte, durch die sie zogen. Trotz eines wenig verheißungsvollen Beginns war Cato schließlich zu einem guten Soldaten herangereift, wie sogar er selbst zugeben musste. Sein scharfer Verstand und sein großer Mut hatten dabei geholfen, ihn von einem verweichlichten Angehörigen des kaiserlichen Hofstaats in einen waschechten Kommandanten zu verwandeln. Aber er hatte auch das Glück gehabt, dass man ihn Macros Centurie zugewiesen hatte, als er der Zweiten Legion beigetreten war. Hätte Centurio Macro nicht in dem mageren, nervös wirkenden Rekruten aus Rom ein gewisses Potenzial erkannt und ihn unter seine Fittiche genommen, hätte Cato, daran zweifelte er kaum, an der Front in Germanien und auf dem folgenden Feldzug in Britannien nicht lange überlebt. Dann hatten Macro und er die Zweite Legion verlassen und kurzfristig in der Marine gedient, bevor sie in den Osten geschickt wurden, wo Macro sein derzeitiges Kommando übernommen hatte. Im bevorstehenden Feldzug würden sie wieder als Teil der regulären Fußtruppen kämpfen.
Cato fühlte sich bei dem Gedanken, dass man die Last eines unabhängigen Kommandos von ihren Schultern nehmen würde, etwas erleichtert; diese Erleichterung wurde allerdings von der instinktiven Sorge gedämpft, die stets mit dem Beginn eines neuen Feldzugs einherging.
Weit bessere Soldaten als Cato waren schon von einem Pfeil, einer Steinschleuder oder einem unerwarteten Schwertstoß niedergestreckt worden. Bisher war Cato verschont geblieben, und er hoffte, dass ihm sein Glück erhalten bleiben würde, falls es zu einem Feldzug gegen die Parther kam. Im vergangenen Jahr hatte er kurz gegen sie gekämpft und wusste nur zu gut, wie geschickt sie mit Pfeil und Bogen umgingen und mit welcher Geschwindigkeit sie einen Überraschungsangriff ritten und sich dann schnell wieder zurückzogen, bevor ihr Gegner reagieren konnte. Dies war ein Kampfstil, der die Legionäre einer schweren Prüfung unterziehen würde, von den Hilfssoldaten der Zweiten Illyrischen Kohorte ganz zu schweigen.
Aber vielleicht urteilte er diesbezüglich vorschnell. Die Männer seiner Kohorte hatten sogar eine bessere Chance gegen die Parther als die Legionäre. Sie trugen eine leichtere Rüstung, außerdem war ein Viertel von ihnen beritten, so dass die Parther sie weitaus vorsichtiger angreifen würden als die langsam marschierende schwere Infanterie der Legionen. Cassius Longinus musste mit Bedacht gegen die Parther vorgehen, falls er das Schicksal vermeiden wollte, das vor beinahe hundert Jahren Marcus Crassus und seine sechs Legionen ereilt hatte. Crassus war blindlings in die Wüste marschiert. Nach mehreren Tagen zermürbender Angriffe unter der gnadenlos sengenden Sonne war seine Armee zusammen mit ihrem Befehlshaber niedergemacht worden.
Als die Sonne schließlich hinter dem Horizont versank, kündigte das ferne Signal der Bucinen aus dem Armeelager die erste Nachtwache an. Macro erhob sich.
»Besser, wir kehren ins Lager zurück. Ich gehe morgen mit den Neuankömmlingen zum ersten Mal raus in die Wüste. Bin gespannt, wie sie sich machen.«
»Am besten nimmst du sie nicht zu hart ran«, schlug Cato vor. »Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen Mann zu verlieren, bevor der Feldzug beginnt.«
»Ich soll sie nicht zu hart rannehmen?« Macro runzelte die Stirn. »Und wie ich das werde, verdammt. Wenn sie’s jetzt nicht packen, sind sie im Kampf erst recht zu nichts nütze.«
Cato zuckte mit den Schultern. »Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir jeden Mann brauchen.«
»Jeden Mann, ja. Aber keine Schwächlinge.«
Cato schwieg einen Augenblick. »Das hier ist nicht die Zweite Legion, Macro. Wir dürfen von den Männern einer Hilfskohorte nicht zu viel erwarten.«
»Ach nein?« Macros Züge verhärteten sich. »Die Zweite Illyrische ist nicht einfach irgendeine Kohorte. Sie ist meine Kohorte. Und wenn ich will, dass die Männer so tapfer marschieren, kämpfen und sterben wie die Soldaten der Legionen, dann werden sie das auch tun. Verstanden?«
Cato nickte.
»Und du wirst deinen Teil dazu beitragen.«
Cato versteifte sich. »Natürlich, Herr. Habe ich dich je enttäuscht?«
Sie starrten einander einen Moment lang an, bevor Macro plötzlich lachte und seinem Freund auf die Schulter schlug. »Noch nie! Du hast Eier aus Stahl. Ich hoffe nur, dass der Rest der Männer mit dir mithalten kann.«
»Das hoffe ich auch«, gab Cato gleichmütig zurück.
Macro stand auf und rieb sich das Hinterteil, das sich nach den langen Stunden auf der harten Holzbank der Schenke taub anfühlte. Er griff nach seinem Befehlsstab aus Rebholz. »Gehen wir.«
Sie machten sich auf den Weg durchs Forum, das sich schon mit Bordellschleppern füllte, mit Händlern, die billigen Plunder verkauften, sowie mit den ersten Soldaten, die dienstfrei hatten. Junge, unbedarfte Rekruten zogen in lärmenden Gruppen in die nächstbeste Schenke, wo geübte Betrüger und Beutelschneider schon auf sie warteten. Sie hatten alle möglichen Gaunertricks auf Lager, um sie auszunehmen. Cato empfand einen Anflug von Mitleid mit den Rekruten, wusste aber, dass nur eigene Erfahrung sie alles lehren würde, was sie wissen mussten. Ein paar Beulen und der Verlust ihrer Geldbeutel würden dafür sorgen, dass sie in Zukunft wachsam blieben – falls sie lange genug lebten.
Wie immer herrschte eine strikte Trennung zwischen den Legionären und den Angehörigen der Hilfskohorten. Die Legionäre wurden weit besser bezahlt und betrachteten die Nicht-Bürger unter den Soldaten des Imperiums mit einem gewissen Maß an professioneller Verachtung – eine Haltung, die Cato nachvollziehen konnte und der Macro vollkommen zustimmte. Dieses Gefühl herrschte auch außerhalb des Lagers in den Straßen Antiochias vor, wo die Männer der Kohorten im Allgemeinen respektvollen Abstand zu den Legionären hielten. Allerdings nicht alle, wie es schien. Als Cato und Macro in eine der Straßen einbogen, die vom Forum wegführten, hörten sie vor sich einen lauten, wütenden Wortwechsel. Unter dem Schein einer großen Kupferlampe, die über dem Eingang zu einer Schenke hing, hatte sich eine kleine Menschenmenge um zwei Männer geschart, die auf die Straße gefallen waren und sich nun, wild aufeinander einschlagend, dort wälzten.
»Es gibt Ärger«, knurrte Macro.
»Sollen wir uns überhaupt darum kümmern?«
Macro beobachtete den Kampf im Nähergehen einen Moment lang und zuckte dann mit den Schultern. »Ich sehe nicht ein, warum wir uns einmischen sollten. Lass sie das unter sich ausmachen.«
Genau da blitzte etwas in der Hand eines der Kämpfenden auf. »Er hat ein Messer!«, rief jemand.
»Verflucht«, schimpfte Macro. »Jetzt müssen wir uns wohl doch einmischen. Komm!«
Er ging schneller und stieß einige der umstehenden Männer zur Seite, die aus der Schenke gekommen waren, um zu sehen, was auf der Straße vor sich ging.
»He!« Ein stämmiger Mann in roter Tunika wandte sich Macro zu. »Pass gefälligst auf!«
»Halt den Mund!« Macro hob seinen Rebstab, so dass der Mann und alle anderen ihn sehen konnten, und schob sich zu den im Rinnstein Kämpfenden durch. »Auseinander, ihr beiden! Das ist ein Befehl.«
Die Rauferei wurde noch einen Moment lang fortgesetzt, dann trennten sich die keuchenden Männer. Der eine, ein magerer, drahtiger Mann in einer Legionärstunika, sprang gewandt wie eine Katze auf und verharrte in geduckter Stellung, bereit, den Kampf jeden Moment fortzusetzen. Macro ging mit erhobenem Befehlsstab auf ihn zu.
»Es ist vorbei, habe ich gesagt.«
Da bemerkte Cato die schmale Klinge in der Hand des Mannes. Sie glitzerte nicht, sondern war mit einem dunklen Film überzogen. Von der Spitze fielen Tropfen. Auf dem Boden hatte sich der andere Mann auf den Ellbogen gestützt und die andere Hand gegen die Seite gepresst. Er schnappte nach Luft und zuckte vor Schmerz zusammen.
»Bei allen Göttern … Oh, verdammt, es tut weh … Der Bastard hat zugestochen.«
Er starrte den Legionär einen Moment lang wütend an, stöhnte dann vor Schmerz auf und sank im matten Schein der Lampe auf den Boden zurück.
»Ich kenne ihn«, sagte Cato leise. »Er gehört zu unseren Leuten. Gaius Menathus von einer Kavallerieschwadron.« Er kniete sich neben den Verletzten und befühlte seine Wunde. Die Tunika des Hilfssoldaten war durchtränkt von dem warmen Blutstrom, der aus der Stichwunde floss, und Cato sah zu den ihn umdrängenden Männern auf.
»Zurück!«, befahl er. »Macht mir Platz!«
Cato hatte seinen Rebstab im Lager zurückgelassen, und so zögerten aufgrund seiner Jugend einige Veteranen, seinem Befehl zu gehorchen. Doch die Männer der Zweiten Illyrischen, Menathus’ Kameraden, erkannten ihren Offizier und zogen sich sofort zurück. Kurz darauf folgten die anderen ihrem Beispiel, und Cato wandte sich erneut dem Verwundeten zu. Der Einschnitt im Stoff war nur klein, doch das Blut strömte heftig heraus. Cato zog rasch die Tunika hoch und legte den rot verschmierten Oberkörper des Mannes frei. Die Wunde, die mit ihren leicht aufgeworfenen Wundrändern wie ein kleiner Mund aussah, glitzerte im Schein der Lampe. Mit jedem Pulsschlag quoll ein Blutschwall daraus hervor. Cato legte die Hand auf die Wunde und drückte kräftig darauf, während er zum nächststehenden Mann aufblickte.
»Besorg mir ein Brett, irgendwas, womit wir ihn tragen können. Sofort! Und du, lauf zurück zum Lager, such den Chirurgen und schick ihn zum Hospital. Er soll bereit sein, wenn dieser Mann hier eintrifft. Sag ihm, dass Menathus eine Stichwunde hat.«
»Ja, Herr!« Der Hilfssoldat salutierte, drehte sich um und rannte die Straße hinunter und in Richtung Stadttor davon.
Während Cato sich wieder Menathus zuwandte, trat Macro vorsichtig auf den Legionär zu, der das Messer hielt. Der Mann hatte sich, noch immer geduckt, aus der Menge gelöst und zur gegenüberliegenden Straßenseite zurückgezogen. Er starrte Macro mit wildem Blick an.
Macro hielt ihm lächelnd die ausgestreckte Hand hin. »Das ist genug Ärger für heute Abend, mein Sohn. Gib mir das Messer, bevor du noch mehr Schaden anrichtest.«
Der Legionär schüttelte den Kopf. »Der Drecksack hat es verdient.«
»Ganz bestimmt. Das klären wir später. Jetzt gib mir erst mal das Messer.«
»Nein. Du wirst mich einsperren lassen.« Die Stimme des Mannes klang, als wäre er betrunken.
»Einsperren?«, schnaubte Macro. »Das ist die geringste deiner Sorgen. Lass das Messer fallen, bevor du alles noch schlimmer für dich machst.«
»Du verstehst nicht.« Der Legionär zeigte mit dem Messer auf den Mann auf dem Boden. »Er hat mich betrogen. Beim Würfelspiel.«
»Lüge«, schrie jemand dazwischen. »Er hat redlich gewonnen.«
Ein Chor wütender Stimmen gab ihm recht, bevor ihm gleich darauf aufgebrachter Widerspruch entgegenschallte.
»RUHE!«, donnerte Macro.
Die Männer verstummten sofort. Macro warf einen wütenden Blick in die Runde und wandte seine Aufmerksamkeit dann wieder dem Mann mit dem Messer zu. »Wie lautet dein Name, dein Rang und deine Einheit, Legionär?«
»Marcus Metellus Crispus, Optio, vierte Centurie, zweite Kohorte, Zehnte Legion, Herr!«, rasselte der Mann automatisch herunter. Er versuchte sogar, dabei Haltung anzunehmen, taumelte aber gleich wieder betrunken zur Seite.
»Optio, gib mir das Messer. Das ist ein Befehl.«
Crispus schüttelte den Kopf. »Ich gehe nicht wegen diesem betrügerischen Bastard in Arrest.«
Macro spitzte die Lippen. »Nun gut, aber morgen früh müssen wir uns sofort mit dieser Angelegenheit befassen. Ich werde mit deinem Centurio sprechen müssen.«
Er begann, sich abzuwenden. Crispus entspannte sich einen Moment lang und ließ in seiner Wachsamkeit nach. Macro drehte sich blitzschnell wieder zu Crispus herum und ließ den Rebstab in einem gewaltigen Bogen durch die Luft zischen. Mit einem krachenden Schlag traf er den Mann am Kopf, und Crispus brach zusammen. Das Messer fiel ein paar Schritte entfernt auf die Straße. Macro stellte sich mit schlagbereit erhobenem Arm über den Mann, doch der rührte sich nicht mehr – er war bewusstlos. Macro nickte zufrieden und senkte seinen Stab.
»Ihr vier.« Er zeigte auf ein paar Männer von der Zweiten Illyrischen. »Lest diesen Unruhestifter auf und lasst ihn in der Arrestzelle schmoren, während ich die Sache mit seinem Kommandanten kläre.«
»Moment mal.« Ein Mann, der Macro weit überragte, trat aus der Menge. Er war einen Kopf größer und entsprechend breit. Im orangeroten Schein der Lampe wirkte sein Gesicht hart und wettergegerbt. »Ich bringe diesen Mann zur Zehnten zurück. Wir werden uns der Angelegenheit annehmen.«
Macro rührte sich nicht und musterte den Mann mit einem abschätzigen Blick. »Ich habe meinen Befehl erteilt. Ich stelle diesen Mann unter Arrest.«
»Nein, er kommt mit mir.«
Macro lächelte geringschätzig. »Und mit wem habe ich es zu tun?«
»Mit einem Centurio der Zehnten Legion, der dir sagt, was du zu tun hast«, erwiderte der Mann verächtlich. »Ich bin nicht so ein lausiger, kleiner Centurio einer Hilfskohorte. Und jetzt, wenn deine Laufburschen so nett wären, sich zu bewegen …«
»Wie klein das Imperium doch ist«, gab Macro zurück. »Ich bin nämlich ebenso wenig Centurio einer Hilfskohorte wie du. Ich bin der Präfekt der Zweiten Illyrischen. Diesen Rebstab habe ich nur um der alten Zeiten willen behalten. Ich erhielt ihn als Centurio der Zweiten Legion.«
Der andere Offizier sah Macro einen Moment lang an, bevor er Haltung annahm und salutierte.
»Das ist schon besser«, nickte Macro. »Und wer bist du?«
»Centurio Porcius Cimber, Herr. Zweite Centurie, dritte Kohorte.«
»Nun gut, Cimber. Dieser Mann ist jetzt in meinem Gewahrsam. Geh du zu deinem Legaten und erstatte ihm Bericht. Sein Mann wird dafür bestraft werden, dass er mit dem Messer auf einen meiner Leute losgegangen ist.«
Macro wurde von einem tiefen Stöhnen am Boden unterbrochen, mit dem Menathus sich plötzlich aus Catos Griff wand. Ein mächtiger Blutstrom schoss mit einem Mal aus der Wunde hervor.
»Wo bleibt das Tragebrett?«, schrie Cato, presste dann die Hände wieder auf die Wunde und beugte sich zu Menathus hinunter: »Halt still!«
»Verdammt … Mir ist kalt«, murmelte Menathus. Seine Augen rollten ziellos unter den flackernden Lidern. »Oh … Verflucht, verflucht … es tut so weh.«
»Halt durch, Menathus«, sagte Cato mit fester Stimme. »Jemand wird sofort nach der Wunde sehen. Du kommst wieder in Ordnung.«
Die Menge der Soldaten und die Handvoll Städter, die sich zu ihnen gestellt hatten, beobachteten die Szene schweigend. Menathus stöhnte. Sein Atem war nur noch ein zischendes, unregelmäßiges Keuchen. Dann begann er heftig zu zittern. Seine Muskeln verkrampften sich so stark, dass jede Faser seines Körpers hart wie Stein wurde, dann sank er schlaff auf die Straße zurück, und der Atem wich ihm in einem letzten langgezogenen Seufzer von den Lippen. Cato presste dem Mann eine Weile das Ohr auf die blutige Brust und zog sich dann zurück, wobei er die Hand von der Stichwunde nahm.
»Er ist tot.«
Einen Moment lang herrschte absolute Stille. »Der Mistkerl hat ihn ermordet. Dafür wird er sterben«, knurrte einer der Hilfssoldaten.