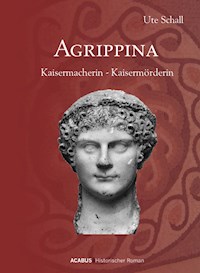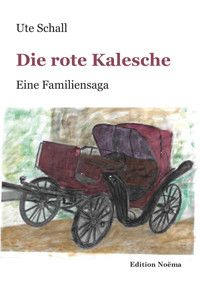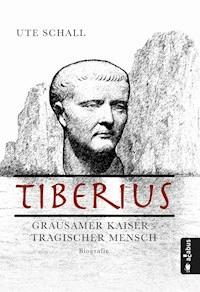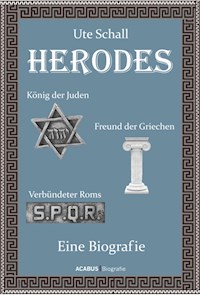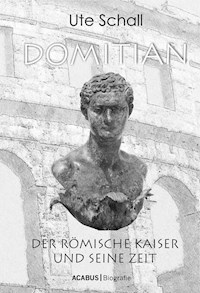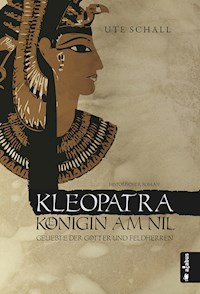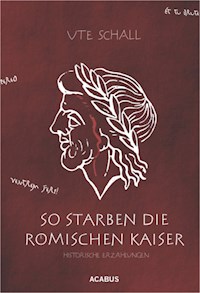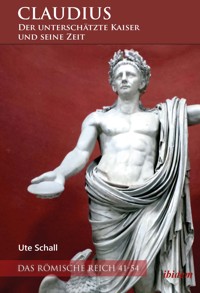
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Seine Mutter nannte ihn nur ein Ungeheuer von einem Menschen, von der Natur nur begonnen und nicht vollendet. Und wenn sie jemanden für besonders dumm hielt, meinte sie, der sei ja blöder als ihr Sohn Claudius. Tiberius Claudius Drusus (10 v. Chr. – 54 n. Chr.) wurde mit mehreren Behinderungen geboren, und niemand hätte diesem „Unvollendeten“ vorausgesagt, er werde an der Schwelle zum Greisenalter die höchste Würde erlangen, die Rom zu seiner Zeit zu vergeben hatte. Eher zufällig fiel dem Fünfzigjährigen der Thron zu wie eine überreife Frucht. Entgegen allen Erwartungen sorgte er als Kaiser jedoch für manche Überraschung. Er erwies sich als umsichtiger Verwalter und konnte sogar, ohne je auf diese Aufgabe vorbereitet worden zu sein, wichtige militärische Erfolge vorweisen. In einem Blitzfeldzug eroberte er Teile Britanniens (Südenglands), die für fast 400 Jahre dem römischen Imperium zugehörig blieben. Seine größte Leidenschaft gehörte jedoch den Wissenschaften und den Frauen, bei denen er trotz seiner Behinderung sehr begehrt war, wenn auch nur wegen seiner einzigartigen Stellung. Vier Ehen brachten ihm aber nicht das ersehnte Glück. Mit der gebotenen Behutsamkeit des neuzeitlichen Forschers nähert sich Ute Schall dem ungewöhnlichen Herrscher, indem sie vor allem alte Quellen vergleichend heranzieht und auswertet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Ein Wort zuvor
Sein Name war Drusus
Die politischen und familiären Verhältnisse
In jungen Jahren
Herrscherwechsel
Schicksal und Willkür
Am Hofe Caligulas
Die Thronerhebung
Erste Regierungsjahre
Verschwörungen und die Rechtspolitik des Kaisers
Brot und Spiele – Claudius und seine Quiriten
Eine komplexe Persönlichkeit
Die Bautätigkeit
Claudius und die Religion
Die Erweiterung des Reiches und die Provinzen
Claudius und die Frauen – Messalina
Iulia Agrippina
Die Kinder des Kaisers
Das geistige Leben in claudischer Zeit – Lucius Annaeus Seneca
Die letzten Regierungsjahre
Das Ende
Was bleibt
Die wichtigsten Personen
Zeittafel
Danksagung
Impressum
ibidem-Verlag
Dem Andenken meines geliebten Bruders Horst
und meinen Geschwistern Friederike und Klaus gewidmet.
Ein Wort zuvor
Wer die Bibliotheken der Neuzeit nach einer Biografie des vierten römischen Kaisers durchstöbert, Tiberius Claudius Drusus, wird bald frustriert aufgeben. Namhafte Historiker zählen ihn nicht zu den großen Kaisern Roms und haben sich schon deshalb kaum mit ihm beschäftigt. Und doch wird man nicht umhin können, ihn in gewisser Weise als Retter des Reiches oder doch des frühen Kaisertums zu betrachten. Denn nach den Auswüchsen eines Caligula musste er seinen Römern geradezu als eine Wohltat, als eine besondere Gunst des Schicksals erscheinen.
Im Gegensatz zu den neuzeitlichen Historikern haben ihm die Autoren der Antike, zeitgenössisch oder auch nicht, durchaus einen Platz in ihren Berichten eingeräumt, und er scheint nach deren Auffassung tatsächlich nicht der schlechteste Regent gewesen zu sein, der über das riesige Römerreich herrschte. Dies erschien ihnen umso erstaunlicher, als Claudius, wie er in den Geschichtsbüchern vereinfachend genannt wird, seit seiner Geburt an diversen Behinderungen litt und ihm niemand vorausgesagt hätte, auch nur die ersten Lebensjahre zu überstehen. Dass er dann über 60 Jahre alt würde und wahrscheinlich noch eine Weile länger gelebt hätte, wenn er nicht der Machtgier seiner vierten Ehefrau zum Opfer gefallen wäre, mag einem kleinen Wunder gleichgekommen sein.
Wer war er, dieser „Kaiser wider Willen“, als der er sich zumindest am Anfang gab? Dieser von der Natur betrogene Mensch, dem das Schicksal so übel mitgespielt hatte und den selbst seine Mutter als unfertiges Ungeheuer verachtete? Wer war er, der dennoch am Leben nicht verzweifelte, sondern versuchte, das Beste daraus zu machen? Schon früh, als er noch das Leben des unabhängigen Gelehrten führte, und erst recht, als ihn durch einen puren Zufall die Herrschaft überkam?
Es muss sich lohnen, sich mit seiner seltsamen Lebensgeschichte zu befassen. So will ich mich denn an die Arbeit machen.
Sein Name war Drusus
Rom schrieb das Jahr 744 ab urbe condita – seit Gründung der Stadt, nach der die Römer ihre Jahre zählten. Die Geschichtsschreiber späterer Jahrhunderte würden vom Jahr 10 vor Beginn der neuen Zeitrechnung sprechen. Aber daran dachte im Augenblick noch niemand, da die alten Götter noch herrschten.
Hoch im Norden des mächtigen Römerreichs, bei den aufrührerischen Stämmen der Germanen, träumte ein römischer Feldherr einen Traum, dem viele Römer anhingen: Er verfolgte Augustus’ Vision von einem Rom, das bis an die Elbe reichte, ja womöglich weit über deren jenseitiges Ufer hinaus. Sein Name war Drusus, Nero Claudius Drusus (oder Drusus Maior), der als Decimus Claudius Drusus geboren wurde und der angesehensten Familie des Imperiums angehörte: Seine Mutter Livia Drusilla war die Ehefrau des Octavianus, der später Augustus genannt wurde und der Drusus’ Stiefvater und als Princeps der mächtigste Mann Roms und damit der Welt war. In einer spektakulären Aktion hatte dieser die römische Schönheit, die dem höchsten Adel entstammte, der alteingesessenen Familie der Claudier, die hochschwangere Livia, dem Ehemann entführt und sie und sich damit dem Spott einer ganzen Stadt ausgeliefert.
An seinen leiblichen Vater Tiberius Claudius Nero hatte Drusus, der jüngere Stiefsohn des Octavianus Augustus, nur eine vage Erinnerung. Denn dieser starb, als der Junge gerade fünf Jahre alt war, vermutlich an gebrochenem Herzen. Er hatte die Schande, dass ihm der junge Aufsteiger Octavianus die hochschwangere Ehefrau weggenommen hatte, nicht verwunden. So musste Drusus, gemeinsam mit seinem vier Jahre älteren Bruder Tiberius, dem nachmaligen Kaiser, als kleines Kind ins Haus des Stiefvaters umziehen.
Da war der Spott der Römer schon weitestgehend verstummt. „Wer Glück hat, bekommt auch noch ein Dreimonatskind“, hatte ganz Rom, Drusus’ Geburt begleitend, gelacht. Denn Livia Drusilla, die sich jetzt als Augustus’ Gattin in unverdientem Ruhm sonnte, war damals, Schwangerschaft hin oder her, nur allzu bereitwillig dem hoffnungsvollen Aufsteiger (der zu jener Zeit, wie gesagt, noch Octavianus hieß) gefolgt, hatte ihren Ehemann verlassen und mit ihrem Liebhaber einen neuen Lebensbund geschlossen. Drei Monate nach der skandalösen Hochzeit war ihr zweiter Sohn, eben jener Drusus, zur Welt gekommen, und das Neugeborene dem Vater „zurückgegeben“ worden, wie das Gesetz es befahl …
Nicht nur viele Bürger Roms, auch Drusus’ jüngerer Sohn, der spätere Kaiser Claudius, waren davon überzeugt, dass sein Vater die Frucht eines Ehebruchs Livia Drusillas mit Octavianus war. Tatsächlich lassen erhaltene Bildnisse den aufmerksamen Betrachter gewisse Ähnlichkeiten zwischen Augustus und dem Vater unseres Protagonisten erkennen, der sich auch in seinem Wesen so auffällig von seinem älteren Bruder Tiberius unterschied.
Offiziell freilich galt Drusus als Stiefsohn des Augustus, der den jungen Mann später ebenso wie dessen Bruder mit Aufgaben nördlich der Alpen betraute, die die Erfahrung manches gestandenen Feldherrn herausgefordert hätten. Und dennoch gelang es dem ungleichen Brüderpaar scheinbar mühelos, das aufmüpfige Volk der Raeter dauerhaft zu befrieden und ihr Stammesgebiet dem römischen Imperium einzuverleiben.
Doch allen Eroberungsversuchen widersetzt hatten sich bisher die bis zum Nordmeer siedelnden Stämme der Germanen, zu denen der Generationen später wohl bekannteste römische Geschichtsschreiber Cornelius Tacitus bemerken sollte, sie seien wegen ihrer Freiheitsliebe dem römischen Imperialismus noch gefährlicher als die Parther, ja es handele sich bei ihnen um den Feind Roms schlechthin.
Jenen sturen Wilden also sollte Drusus den römischen Frieden bringen, was immer man im Zentrum der Macht darunter verstand: Zivilisation, mediterrane Stadtkultur und ein Rechts- und Verwaltungssystem, mit dem ein Volk, bei dem noch immer in weiten Bereichen Blutrache und Faustrecht galten, wenig anfangen konnte und wollte.
Beachtliche Erfolge nicht kriegerischer Art konnte Drusus in Germanien mittlerweile vorweisen, so die nach ihm benannten Fossae Drusianae, Kanäle, die den Rhein mit der Zuidersee verbanden. Doch auch auf dem Kriegsschauplatz war er erfolgreich. „In vielen Schlachten“, so sein antiker Biograf Suetonius Tranquillus, „schlug er den Feind und ließ nicht von der Verfolgung ab.“1 Er hätte sicherlich gut daran getan, sich mit dem Erreichten vorerst zu begnügen. Aber Drusus war ehrgeizig. Er kehrte kurz nach Rom zurück, wo ihm Augustus das Recht des kleinen Triumphes zugestand und ihm die Triumphabzeichen verlieh. Nach Prätur und Konsulat nahm der junge Mann den Feldzug gegen die Germanen wieder auf, siegreich zunächst wie gewohnt, aber die Götter Roms gönnten ihm weiteren Ruhm nicht. Und dennoch meinten sie es gut mit ihm. Sie schickten ungünstige Vorzeichen, die ihn hätten warnen sollen. Doch er schlug alle in den Wind. Stürme und schwere Gewitter, wie sie seit Generationen nicht mehr beobachtet worden waren, fegten über Italien hinweg, Tod und Verwüstung hinterlassend. In Rom „gingen viele Tempel zugrunde, ja selbst der des Jupiter Capitolinus“ und angrenzende Gebäude wurden beschädigt.2Aber Drusus achtete auf die düsteren Vorzeichen nicht.
Er drang bis zu den Sueben vor, fiel in das Stammesgebiet der Chatten ein, wandte sich dem Land der Cherusker zu und rückte, alles verheerend, bis an die Elbe vor. Seine Verluste waren schmerzlich, und er hätte sich spätestens jetzt mit dem Erreichten begnügen sollen. Doch er wollte auch diesen Fluss, „… welcher sich in großer Breite in die Nordsee ergießt“, überschreiten. Da erhob sich aus den dem Wasser entsteigenden Nebeln vor seinen Augen ein riesiges Germanenweib. „Wohin willst du, unersättlicher Drusus?“, wollte sie in seiner Muttersprache von ihm wissen. „Es ist dir nicht beschieden, das jenseitige Land zu schauen. Kehre um, denn das Ende deiner Taten und deines Lebens ist gekommen!“ Durch die geheimnisvolle Erscheinung zutiefst erschreckt, ließ der Feldherr nur eilig die römischen Siegeszeichen errichten und trat, völlig verwirrt, den Rückzug an. Es ist erstaunlich, wie empfindlich ein ansonsten vernunftbegabtes Volk immer wieder auf Wunderzeichen und allerlei düstere Vorhersagen reagierte. Verfolgt von Zauberspruch und Hexenbann ritt Drusus womöglich unvorsichtiger, als es das unwegsame Gelände gebot. Irgendwo zwischen Saale und Rhein stürzte er vom Pferd und zog sich einen komplizierten Schenkelbruch zu.
Der unerschrockene Feldherr, neben seinem Bruder Tiberius der tüchtigste, den Rom im Augenblick aufzubieten hatte – Marcus Vipsanius Agrippa, der Schwiegersohn des Kaisers, in dieser Hinsicht unübertroffen, war vor drei Jahren gestorben – konnte an eine Weiterreise auf sicheres römisches Gebiet nicht denken.
Die Römer schlugen ihre Zelte auf, befestigten den Ruheplatz und hofften auf eine baldige Genesung ihres Kommandanten, den sie beinahe wie einen Heiligen verehrten. Doch der einstige Liebling der Götter siechte langsam dahin, wurde von Tag zu Tag schwächer. Wölfe umkreisten heulend das Lager. Weibliche Klagelaute waren zu vernehmen, und in mondheller Nacht regnete es vom Himmel blutige Sterne. Für den erst 30jährigen gab es keine Rettung mehr. Viele seiner Männer boten den Göttern das eigene Leben für das ihres Feldherrn an. Aber die Himmlischen Roms wiesen das billige Opfer zurück …
Einen Monat nach dem schrecklichen Unfall starb Drusus, wohl an Wundbrand, wie die heutige Forschung vermutet. Vom Sommerlager der Römer nördlich der Alpen würde man künftig nur noch vom „verfluchten“ sprechen …
Aber es gibt auch zumindest eine andere Version der traurigen Geschichte. Drusus sei, so der antike Biograf Suetonius Tranquillus, der sich dabei allerdings auf „einige Schriftsteller“ beruft, also für seinen Bericht nicht die Verantwortung übernimmt, seinem Stiefvater verdächtig geworden, sodass er von diesem nach Rom zurückgerufen wurde. „Verdächtig“, das bedeutet, dass man vermutete, er wolle, notfalls mit Gewalt, die alte und über Jahrhunderte bewährte Staatsform der res publica wiederherstellen. Der Verdacht ist nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man bedenkt, dass Drusus zumindest offiziell einer Gens entstammte, die sich über Generationen als treueste Verfechterin der republikanischen Freiheit erwiesen hatte. Livia Drusilla, Drusus’ Mutter, habe sich, so wird ebenfalls vermutet, mit der Ausschaltung ihres Sohnes einverstanden erklärt, wenn auch schweren Herzens. Längst hatte sich die ehrgeizige und berechnende Frau an ihren neuen Status gewöhnt und war sicherlich nicht mehr bereit, diesen für eine unsichere Republik aufzugeben, in der sie eine allenfalls untergeordnete Rolle gespielt hätte, wo sie doch jetzt die erste Frau des Reiches und ihr Einfluss auf die Politik ihres Gatten bedeutend war. Drusus habe, so wird weiter berichtet, gezögert, dem Befehl seines Stiefvaters, nach Rom zurückzukehren, nachzukommen. So habe man von Seiten der Staatsführung keinen anderen Ausweg gesehen, als den Ungehorsamen durch Gift beiseite zu schaffen.3Und doch hat der Biograf erhebliche Zweifel. Denn, so meint er, Augustus habe Drusus so sehr geliebt, dass er ihn immer „zum Miterben seiner Söhne“ bestimmte und ihn den beiden jungen Cäsaren Gaius und Lucius Caesar, seinen Enkeln und Adoptivsöhnen, als Vorbild vor Augen stellte.
Würdenträger der Land- und Kolonialstädte begleiteten den Toten nach Rom. Augustus hatte, nachdem er von Drusus’ Unfall erfahren hatte, Tiberius eilig in den Norden geschickt, damit er seinem Bruder beistehe. Angeblich habe dieser den Schwerverletzten noch lebend vorgefunden. Jetzt begleitete er den Verstorbenen, wobei er den ganzen Weg dem Trauerzug vorangeschritten sein soll.
In Rom angekommen, wurde Drusus’ Leichnam auf dem Forum aufgebahrt, damit das Volk Abschied nehmen konnte, dann auf dem Marsfeld verbrannt und mit allen erdenklichen Ehren bestattet. Mit doppelter Leichenrede wurde seiner gedacht. Tiberius lobte den toten Bruder noch auf dem Forum. Und Augustus sprach die Laudatio im Flaminischen Zirkus. Der oberste Staatslenker durfte nämlich „die beim Eintritt in die Ringmauer (Roms) gewöhnlichen Obliegenheiten (des Staatsoberhauptes) wegen der Kriegstaten noch nicht erfüllen“. Der Flaminische Zirkus lag außerhalb des Pomeriums, der geheiligten Stadtgrenze Roms.4 Die Anmerkung weist darauf hin, dass Augustus gerade von einem Feldzug nach Italien zurückgekehrt war.
Augustus betrauerte den so tragisch verlorenen Sohn so sehr, dass er die Götter bat, ihm selbst einen ebenso ehrenvollen Tod wie Drusus zu gewähren, wenn seine Zeit gekommen wäre. Er ließ auf Drusus’ Gedenkstein einen selbst gedichteten Grabspruch einmeißeln und verfasste ein Werk über die Lebensgeschichte des Toten.
Das Heer errichtete Drusus einen Grabhügel, „um den jedes Jahr an einem bestimmten Tag die Soldaten defilierten und bei dem die gallischen Stämme von Staats wegen Opfer darbrachten“.5 Der Senat erbaute ihm an der Via Appia einen marmornen Triumphbogen und verlieh ihm zur Erinnerung an seine Siege nördlich der Alpen das Cognomen Germanicus.
Die besten Eigenschaften wurden dem Stiefsohn des Kaisers zugeschrieben, sowohl im Krieg als auch im Frieden. Es habe ihm beispielsweise nicht genügt, nur Sieger zu sein. Er habe selbst Rüstungen seiner Feinde erbeutet und oft unter Lebensgefahr an der Spitze seines Heeres germanische Stammesführer verfolgt. Und es heißt, er habe keinen Hehl daraus gemacht, wie sehr er der verlorenen Republik nachtrauere, die er wiederbeleben würde, wenn er es denn könnte. Dies vor allem könnte Augustus’ Missfallen erregt haben.
Drusus hinterließ seine Ehefrau, Antonia Minor, die jüngere Tochter aus der kurzen Ehe des Marcus Antonius und der Octavia, Augustus’ Schwester. Aus der Verbindung Drusus – Antonia waren mehrere Kinder hervorgegangen, von denen drei Kindheit und Jugend überlebten: Germanicus, Livilla und Claudius. Keiner dieser Nachkommen sollte eines natürlichen Todes sterben, wenn es auch für die Ermordung des Ältesten der Geschwister keinen eindeutigen Beweis gab und gibt.
Man darf mit Bestimmtheit sagen, dass Claudius, mit dem wir uns hier in erster Linie zu beschäftigen haben, an seinen berühmten Vater keine Erinnerung hatte.
Keine poetische Prophetie kündete 10 v. Chr. von einem weiteren Hoffnungsträger für das längst befriedete Rom. Vergils Iam nova progenies caelo dimittitur alto – schon steigt ein neuer Erbe vom Himmel herab – hatte vor vielen Jahren Augustus, dem lang ersehnten Friedensbringer, gegolten, der längst ein gesetzter Mann war und nahezu unangefochten auf dem Thron saß. Der berühmteste römische Dichter, Verfasser der Aeneis und Autor obiger Vorhersage, war schon lange tot. Claudius’ Geburt vollzog sich in aller Stille, von der Öffentlichkeit unbemerkt.
Er erblickte am 1. August des Jahres 10 vor Beginn der christlichen Zeitrechnung im gallischen Lugdunum (heute Lyon) unter dem Konsulat des Iullus Antonius (einem Sohn des Marcus Antonius) und Fabius Africanus das Licht der Welt – an dem Tag, an dem dort auch ein Augustus-Altar geweiht wurde. Lugdunum war die Hauptstadt des von Caesar eroberten Gallien. Sie diente Claudius’ Vater als Operationsbasis für die Germanenkriege. Nur ein Jahr nach Claudius’ Geburt sollte dieser im feindlichen Germanenland sein Leben verlieren. Claudius sollte übrigens der erste Kaiser des Römerreichs sein, der nicht in der Hauptstadt Rom geboren wurde. Dass am Geburtstag unseres Protagonisten Kaiser Augustus so besonders geehrt wurde, also in Lyon gewissermaßen Feiertag war, mag für Claudius ein besonderer Glücksfall und neben seiner hochadeligen Herkunft womöglich sogar lebensrettend gewesen sein. Denn Tiberius Claudius Drusus, so sein offizieller Geburtsname, kam behindert zur Welt. Und ein weit in Roms Vergangenheit zurückreichendes Gesetz verbot es, missgestaltete Neugeborene aufzuziehen. Sie mussten getötet oder irgendwo in den Bergen ausgesetzt werden – Menschenfängern als kurioser Nachschub für Bordell und Arena oder hungrigen wilden Tieren zum Fraß.
Aber Claudius – wie er fortan der Abkürzung halber genannt werden soll – hatte Glück. Trotz seiner offensichtlichen Behinderung – das eine Bein scheint kürzer als das andere gewesen zu sein, das Köpfchen hing schief und aus dem kleinen Mund sabberte ständig Speichel heraus – durfte er am Leben bleiben. Vielleicht hoffte man ja, dass sich der Schaden auswüchse, wenn der Junge Kindheit und Jugend erst einmal überstanden hätte. Oder dass er ohnehin nicht lange leben würde, da ja die Kindersterblichkeit damals bekanntlich sehr hoch war.
Möglicherweise war es ein Geburtstrauma, das für seinen bedauerlichen Zustand verantwortlich war. Oder Kinderlähmung, die damals allerdings meistens zum Tode führte. Die neuzeitliche Forschung geht eher von einer infantilen Zerebralparese aus, einer frühkindlichen Hirnschädigung, die mit Störungen des Nervensystems, der Muskulatur und der willkürlichen Motorik einhergeht. Sein antiker Biograf Suetonius Tranquillus sollte Claudius’ Zustand wie folgt beschreiben: „Seiner Gestalt fehlte es nicht an imponierender Würde, ob er stand oder saß, aber hauptsächlich, wenn er auf dem Ruhebett lag; denn er war schlank, ohne mager zu sein, hatte ein schönes Gesicht, schöne weiße Haare und einen vollen Hals. Beim Gehen aber ließen ihn seine ein wenig schwachen Kniegelenke im Stich, und beim Sprechen, sei es, dass er scherzend oder ernsthaft etwas behandelte, hatte er viel Unangenehmes an sich; sein Lachen war grell, und im Zorn erschien er besonders hässlich, mit schäumendem Mund und tropfender Nase. Außerdem stotterte er und zitterte beständig mit dem Kopf, was sich bei jeder wichtigen Tätigkeit noch steigerte …“6 In jungen Jahren ließ auch seine Gesundheit zu wünschen übrig. Leider verrät uns der antike Biograf nicht, woher er seine Kenntnisse hatte. Suetonius Tranquillus hat Claudius nie kennengelernt, da dieser schon lange tot war, als der Biograf seine Kaisergeschichte verfasste.
Ein ganz negatives, ja geradezu gehässiges Bild von Claudius zeichnete Lucius Annaeus Seneca, der berühmte Philosoph, der ein Zeitgenosse des Kaisers war und ihn sogar persönlich kannte. Nach dessen Ableben legte er eine Schmähschrift vor, die er Apocolocyntosis sive Ludus de Morte Claudii Neronis nannte – Die Verkürbissung des Kaisers Claudius oder Satire auf den Tod des Claudius Nero. „Dem Jupiter“, so schreibt er, „wird gemeldet, es sei da jemand gekommen, von großer Statur, schon recht grau, er stoße Gott weiß was für Drohungen aus und schüttle in einem fort den Kopf; auch ziehe er das rechte Bein nach. Man habe gefragt, welche Staatsangehörigkeit er besitze; aber jener habe irgendetwas in undeutlichem Tonfall und mit verworrener Stimme erwidert; man könne seine Sprache nicht verstehen, es handle sich weder um einen Griechen noch um einen Römer, noch gehöre er irgendeiner anderen bekannten Nationalität an …“ Ja, er sei überhaupt kein zu Lande lebendes Wesen. So etwas fände man nur bei Seeungeheuern … 7 Einem der Stoa verpflichteten Lehrer der Weisheit, unter dem in Rom gerade diese Lehre ihre höchste Vollendung erlangt haben soll, hätte es sicherlich besser angestanden, dem römischen Grundsatz de mortuis nil nisi bene zu folgen. Weshalb er den Toten so sehr verunglimpfte, wird an späterer Stelle zu untersuchen sein.
Man schenkte Claudius also das Leben, aber die Götter allein wussten, dass es ein über Jahrzehnte trostloses, von Spott und Hohn, von Scham und Schande vergiftetes werden sollte. Sogar die eigene Mutter würde von ihrem Sohn nur als von einem „Ungeheuer von einem Menschen“ sprechen, der „von der Natur nur begonnen und nicht vollendet“ worden sei. Und wenn sie jemanden für besonders dumm hielt, pflegte sie zu urteilen, der sei ja blöder als ihr Sohn Claudius. Und noch etwas sollte dieses Leben erschweren: Man würde ihn, Drusus’ jüngeren Sohn, wie seinen Bruder Germanicus stets am berühmten und bei den Römern äußerst beliebten Vater messen – ein Anspruch, dem Claudius nie würde gerecht werden können, den sogar sein Bruder Germanicus nur mit Mühe erfüllte.
Keine günstige Vorhersage begleitete Claudius’ Geburt, kein Spruch der weisen Sybille, kein Orakel sagte diesem Knaben eine hoffnungsvolle Zukunft voraus. Roms Götter hüllten sich in Schweigen.
Der altrömischem Brauch verpflichtete Drusus hob also schließlich auch diesen Sohn, den man ihm nach der Geburt zu Füßen legte, auf und bekannte sich so öffentlich zu seiner Vaterschaft, nicht ahnend, dass er dieses Kind nicht aufwachsen sehen würde, da der Tod bereits auf ihn wartete.
Als sein Bruder Germanicus in die Iulische Familie adoptiert wurde, im Jahr 756 ab urbecondita, rückte Claudius gewissermaßen an dessen Stelle, und es gesellte sich zu seinen drei Namen ein weiteres Cognomen hinzu, Germanicus.
Folgen wir dem antiken Biografen, so litt das Kind, wie erwähnt, während seines gesamten Knaben- und Jünglingsalters an verschiedenen hartnäckigen Krankheiten, die der Geschichtsschreiber für seine körperliche und vermeintlich auch geistige Zurückgebliebenheit verantwortlich macht. So hielt man ihn auch in fortgeschrittenen Jahren für unfähig, ein verantwortungsvolles politisches Amt auszuüben.8 Besonders seine Kindheit muss sehr traurig gewesen sein. Man gab das Kleinkind in die Obhut des Aufsehers der Lasttierknechte. In einer seiner Schriften sollte sich Claudius später beklagen, man habe ihn der Aufsicht eines Barbaren und ehemaligen Stallmeisters unterstellt, um ihn für die kleinsten Vergehen auf grausamste Weise bestrafen zu können und womöglich hoffend, durch strenge Zucht werde sich sein Zustand normalisieren.
Ansonsten wurde er zumindest während seiner Knabenzeit nur von Frauen erzogen: Von seiner Mutter Antonia Minor, die, wie wir gesehen haben, von dem anscheinend blödsinnigen Sohn nichts hielt. Und von Livia Drusilla, seiner Großmutter väterlicherseits, die sich für diesen Enkel schämte und ihn, genau wie die Mutter, ständig zurücksetzte. So soll sie kaum je das Wort an ihn gerichtet haben, und wenn es einmal unumgänglich war, ihm etwas zu sagen, so tat sie das schriftlich. „Augusta, seine Großmutter“, bemerkt der antike Biograf, „verachtete ihn aus tiefstem Herzen; sie sprach nur höchst selten mit ihm und pflegte ihm die Ratschläge nur in einem bitteren kurzen Schreiben oder durch Dritte zu geben“.9 Selbst Livilla, seine Schwester, zeigte keinen Funken Liebe für ihn. Sie hatte gehört, dass der Bruder einst Kaiser werden könnte. Da bedauerte sie den römischen Staat, der ein solch „unwürdiges Los“ nicht verdient habe.
Claudius’ Großmutter mütterlicherseits, Octavia, die, wie gesagt, Augustus’ Schwester war, durfte diesen Enkel nicht kennen lernen. Die unglückliche Frau war im Jahr vor seiner Geburt gestorben, nachdem sie den letzten Abschnitt ihres Lebens in tiefer Trauer verbracht hatte, Trauer um ihren Sohn Marcellus. Der war von ihrem Bruder mit dessen Tochter Julia verheiratet worden und nur zwei Jahre nach der Hochzeit unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Octavia war so unglücklich, dass sie die Kleider des Verstorbenen an die Armen verteilte, die Räume, die ihr Sohn bewohnt hatte, zumauern ließ und keinem mehr Zutritt zu ihnen gestattete. Auch soll sie die Trauerkleider nie mehr abgelegt und jedem verboten haben, den Namen ihres Sohnes auszusprechen. Und Claudius’ Großvater Marcus Antonius, der Freund des gemeuchelten Caesar? Er war schon 20 Jahre tot, als Drusus’ jüngerer Sohn geboren wurde, aus dem Weg geräumt von Octavianus (Augustus), dessen Machtanspruch er als Ehemann der ägyptischen Königin Kleopatra so offensichtlich bedroht hatte.
Mutter und Großmutter wurden in ihrer ablehnenden Haltung von Augustus unterstützt, der sich nicht weniger als die beiden Frauen für den behinderten Familienangehörigen schämte.
Es scheint in der kaiserlichen Familie Brauch gewesen zu sein, sich Briefe zu schreiben anstatt sich von Auge zu Auge zu begegnen. Jedenfalls pflegte auch der Kaiser selbst mit seiner Gattin in Dingen von einiger Wichtigkeit schriftlich zu verkehren, um, wie es heißt, nichts Unüberlegtes oder gar Falsches zu sagen. In dreien seiner Briefe, die er an seine Frau richtete, drückte er für den angeblich schwachsinnigen Claudius Verachtung, aber gleichzeitig auch ein wenig Bewunderung aus. Wenn dieser, so im ersten Brief, sowohl geistig als auch körperlich nicht ganz auf der Höhe sei, so dürfe man den Leuten, die es gewohnt seien, über derlei Gebrechen zu spotten und zu kichern, auf keinen Fall Anlass geben, Claudius und dessen Familie zu verlachen. Livia Drusilla hatte offensichtlich von der Staatsführung wissen wollen, ob man Claudius mit der Organisation des Festessens der Priester bei den anstehenden Marsspielen betrauen könne. Augustus meinte, dass ihm der Gedanke nicht missfalle, Claudius sich dabei aber von seinem Schwager, dem Sohn des Silvanus, beraten lassen müsse, „damit er nichts anstellt, womit er unangenehm auffallen oder verspottet werden könnte“.
Allerdings dürfe man ihn bei den Zirkusspielen nicht von der kaiserlichen Loge aus zusehen lassen, da er an so exponierter Stelle die Aufmerksamkeit ganz Roms auf sich ziehen könnte. Und erst recht dürfe er während des Latinerfestes nicht auf die Albaner Berge steigen. Denn wenn er dazu in der Lage sei, würden sich die Römer zu Recht fragen, weshalb er dann nicht auch in der Stadt ein öffentliches Amt, etwa das des Stadtpräfekten, übernehmen könne. Selbst bei Gladiatorenspielen, die Claudius zusammen mit seinem Bruder zum Andenken seines Vaters gab, musste er die Kapuze seines Umhangs weit ins Gesicht ziehen, damit niemand seine Behinderung sähe.
Augustus fügte noch hinzu, er hoffe, mit diesen „Richtlinien“ seinen Entschluss, Claudius betreffend, deutlich gemacht zu haben. Und Livia dürfe davon auch gern Claudius’ Mutter Antonia in Kenntnis setzen.
Dieser Brief zeigt, dass die Staatsführung wünschte, Claudius so gut wie möglich vor der Neugier der Stadtbewohner zu verbergen. Er kann von Augustus allerdings erst verfasst worden sein, als der Behinderte bereits das Mannesalter erreicht hatte. Doch darf zu Recht angenommen werden, dass man mit dem Jugendlichen in gleicher Weise verfuhr.
Der beste Beleg dafür war die Verleihung der toga virilis, die Mündigerklärung, ein Akt, der jeden römischen Jungen in die Liste der Erwachsenen und kriegsfähigen Bürger aufnahm, ihn also zu einem vollwertigen Mitglied der Gesellschaft machte. In jeder anderen Familie war der Tag der Einkleidung in die Männertoga für den Jugendlichen und seine Verwandten einer der Freude und ein lang ersehntes Fest, wenn die jungen Männer, begleitet von ihren Angehörigen, in strahlend weißen Gewändern durch die wärmende Frühlingssonne über das Forum zogen. Die Mündigerklärung, vergleichbar der Konfirmation im christlichen oder der Bar Mizwa im jüdischen Brauchtum, fand am Fest der Liberalia statt, das Rom alljährlich am 17. März beging. Es stellte einen der Höhepunkte im römischen Festkalender dar, zumal an diesem Tag auch die neue Feldzugsaison eröffnet wurde.
Claudius blieb die feierliche Zeremonie versagt. Um jedes Aufsehen zu vermeiden, trug man ihn um Mitternacht in einer Sänfte auf das Kapitol, dem heiligsten Ort der Stadt, wo sich seit alters her der Tempel der römischen Götterdreiheit Jupiter, Juno und Minerva befand. Dort wurde er ohne jede Feierlichkeit eingekleidet. Man kann sich leicht vorstellen, wie gekränkt der Junge über diese Behandlung seiner Verwandten sein musste.
Auf einem Ehrenbogen, den man Augustus und seiner Familie in Ticinum (heute Pavia) in den Jahren 7/8 der neuen Zeitrechnung errichtete, wurde Claudius an letzter Stelle genannt, und böse Zungen behaupten sogar, er selbst habe seinen Namen, nachdem er Kaiser geworden war, dem der anderen Familienmitglieder hinzugefügt.10 Auch dadurch muss sich der junge Mann zurückgesetzt gefühlt haben.
Da sich Claudius offensichtlich keine großen Hoffnungen auf eine verantwortliche Stellung im römischen Staat machen konnte, begann er, sich anderweitig zu beschäftigen. Mit großem Eifer widmete er sich wissenschaftlichen Themen, vor allem der Geschichte Roms und seiner eigenen Familie. Besondere Anerkennung erntete er zu seiner Zeit von seinen Verwandten dafür allerdings nie.
Er hatte als Heranwachsender zwei Freunde: Sulpicius (Flavus) und einen gewissen Ahenobarbus. Ob dieser der berühmten und mit der Kaiserfamilie weitläufig verwandten Sippe der Ahenobarbi entstammte, ist nicht bekannt. (Der Vater Neros, mit dessen Tod das julisch-claudische Kaiserhaus im Jahr 68 n. Chr. erlosch, hieß Gn. Domitius Ahenobarbus und war ein übel beleumdeter Angehöriger der Oberschicht.) Mit beiden scheint der junge Claudius sehr vertraut, sie scheinen aber auch sein bevorzugter Umgang gewesen zu sein. Augustus hat die beiden nicht sonderlich geschätzt. Denn in einem weiteren Brief an seine Ehefrau ließ er diese wissen, er werde während ihrer Abwesenheit den jungen Tiberius Claudius täglich zum Essen einladen, „damit er nicht allein mit seinem Sulpicius und Ahenobarbus essen muss. Ich wollte“, so hoffte der Kaiser, „er wählte sich mit mehr Sorgfalt und weniger Unüberlegtheit einen Kameraden, dessen Bewegung, Haltung und Gang er nachahmen würde. Der arme Kleine“, bedauerte er, „hat kein Glück in wichtigen Angelegenheiten“, denn „wenn sein Geist nicht verwirrt ist, wird sein Adel offenbar.“11
Augustus erkannte auch mit Erstaunen, dass Claudius keineswegs so blöde sein konnte, wie es wegen seiner Behinderung vielleicht schien und wie es seine Mutter so oft lieblos behauptete. Es ist ein dritter Brief des Kaisers überliefert, in dem es heißt, er, der Stiefgroßvater, habe mit Vergnügen Livias Enkel eine Rede halten hören. „… ich verstehe nicht“, wundert sich der erste Mann des Staates, „wie jemand, der so undeutlich spricht, beim Vortrag einer Rede alles, was er zu sagen hat, so deutlich hervorbringt“.12
Nichts in diesem Leben deutete, wie gesagt, auf eine hoffnungsvolle Zukunft hin. Die meiste Zeit von Kindheit und Jugend verbrachte Claudius in der Obhut von Frauen, Frauen, die ihn ablehnten. Es lohnte doch nicht, für einen so offensichtlich Unnützen größeren Aufwand zu betreiben. Niemand hätte vorauszusagen gewagt, Claudius würde dereinst in der römischen Politik auch nur eine bescheidene Rolle spielen und schon gar nicht, er würde einmal zum höchsten Staatsamt, das Rom zu vergeben hatte, gelangen.
Die Erziehung des Kleinkinds lag in Rom in den Händen der Mutter, die sich in höheren Kreisen der Hilfe ausgesuchter Sklaven bediente. Im Alter von sechs Jahren wurden Jungen wie Mädchen Privatlehrer beigestellt, die ihnen die ersten Schritte der Bildung, Lesen, Schreiben und die Grundrechenarten vermittelten. Man darf im Hinblick auf Claudius’ spätere Bildungsbeflissenheit annehmen, dass man auch für ihn einen entsprechenden Hauslehrer fand. Die körperliche Ertüchtigung, die im Jugendalter begann und mit Reiten, Scheinkampf und anderen Sportarten auf dem Marsfeld unter der Leitung der Väter erfolgte und die jungen Römer auf das Kriegshandwerk vorbereiten sollte, dürfte sich für Claudius schon wegen seiner Behinderung von selbst verboten haben. So entwickelte sich der Jüngling langsam, aber stetig zum Bücherwurm, der in Rom alles andere denn angesehen war.
Feindlich gestaltete sich das familiäre Umfeld für das Kind und den Heranwachsenden. Und wie sahen die politischen Verhältnisse in den ersten Jahren dieses scheinbar vergeudeten Lebens aus? Was hat Claudius, der nahezu hermetisch von der Außenwelt abgeschirmt wurde, von den Dingen, die sich außerhalb des Palastes abspielten, erfahren?
Die Lebensgeschichte unseres Protagonisten teilt sich in vier Abschnitte, wobei sich die ersten drei kaum voneinander unterscheiden. Es sind die Jahre der Kindheit, Jugend und ersten Mannesjahre unter Kaiser Augustus. Die Zeit, die er unter der Herrschaft des Tiberius verbrachte, der sein Onkel war. Und die Tyrannei unter seinem Neffen Caligula, während der er beständig um sein Leben fürchten musste. Allesamt waren Jahre der Bedeutungslosigkeit, und niemand, am wenigsten er selbst, hätte zu hoffen gewagt, dass sich an seiner Lage jemals etwas ändern würde.
Augustus, dem ersten Kaiser Roms, hatte die Vorsehung viel Zeit gelassen, in seine neue Rolle hineinzuwachsen. Tiberius war in langen Jahren neben Augustus an die spätere Verantwortung herangeführt worden, und sogar Caligula hatte Gelegenheit, seinem Onkel beim Regieren über die Schulter zu blicken. Eher zufällig fiel Claudius, den man Zeit seines Lebens sorgfältig von allen öffentlichen Aufgaben ferngehalten hatte, an der Schwelle zum Alter der Thron wie eine reife Frucht in den Schoß. Was durfte man von einem erwarten, der wegen seiner angeborenen Behinderung nicht nur als geistig zurückgeblieben galt, sondern auch ohne jegliche Regierungserfahrung war?
Das würde die Zeit erweisen.
1 Suetonius Tranquillus (Suet.) Leben der Caesaren. Claud. 1
2 Dio Cassius (Dio). Römische Geschichte. LV 1
3 Suet. Claud. 1
4 Dio LV 2
5 Suet. Claud. 1
6 Ebd.
7 Seneca, Lucius Annaeus. Apocolocyntasis Claudii. 5,2
8 Suet. Claud. 2
9 Ebd.
10 Corpus Incriptionum Latinarum (CIL) V 6416
11 Suet. Claud. 5
12 Ebd.
Die politischen und familiären Verhältnisse
Bevor wir uns mit den politischen Verhältnissen in Claudius’ ersten Lebensjahren befassen, sei ein Blick in die Vergangenheit der claudischen Gens gestattet, die weit in die Anfangszeit Roms zurückreicht. Alle angesehenen adeligen Familien versuchten damals, ihre Wurzeln möglichst weit zurück zu führen, um ihren augenblicklichen Herrschaftsanspruch zu legitimieren. Es gab sogar professionelle „Ahnenforscher“, die für gutes Geld bereit waren, Stammbäume zu konstruieren und einflussreiche Geschlechter bis in die Höhen des Olymp zurück zu verfolgen. Denn nur wer sich auf bedeutende Ahnen, die zu Roms Größe beigetragen hatten, berufen konnte, gehörte zum inneren Kreis der Nobilität, die sich sorgfältig gegen andere Gesellschaftsschichten abschirmte. Und nur ihm standen Sitz und Stimme im Senat zu, der auch in der Kaiserzeit noch eine gewisse Rolle spielte und als Instanz das Kaisertum sogar überleben sollte. Kaum einem homo novus war es bisher gelungen, in diese Schicht vorzudringen. Marcus Tullius Cicero mag hier eine rühmliche Ausnahme dargestellt haben. Und doch musste auch er sich als „selfmade man“ manchen Spott seiner Zeit- und Standesgenossen gefallen lassen.
Der Senat hatte sich seit Augustus’ Regierungsantritt zu einem fügsamen Werkzeug des Princeps entwickelt. Er war bestrebt, alle kaiserlichen Ideen und Anregungen in die Tat umzusetzen. Das Gremium der eingeschriebenen Väter setzte sich aus Patriziern und Plebejern zusammen. Neue Mitglieder wurden ursprünglich von den Censoren gewählt. Doch allmählich war der Senatssitz ein Erbamt geworden, das vom Vater auf den Sohn, oder, sofern eigene Söhne nicht vorhanden waren, einen anderen männlichen Verwandten überging. Es machte dabei schon zu Zeiten der späten Republik fast keinen Unterschied mehr, ob eine Familie adeligen oder plebejischen Ursprungs war. Sie musste nur reich und angesehen sein. Schon Augustus hatte verfügt, dass man nur dann dem Senatorenstand angehören konnte, wenn das Vermögen mindestens eine Million Sesterzen betrug. Doch gab es auch innerhalb des Senats verschiedene Gruppen, deren einflussreichste die altadeligen Familien waren, die im Idealfall noch einen Konsul zu ihren Ahnen zählten.
Wenn zur Zeit von Claudius’ Geburt die in Jahrhunderten bewährte res publica auch verloren war und die Leitung des Staates längst nicht mehr in den Händen der Ersten und Besten lag, so garantierte die Zugehörigkeit zur römischen Oberschicht doch noch einige Privilegien, auf die keiner ihrer Angehörigen verzichten wollte.
Auch Claudius sah mit Stolz auf eine Reihe erlauchter Vorfahren zurück. So betonte er als Kaiser in öffentlicher Rede – es ging um die gesellschaftliche Integration „Andersstämmiger“ – seine Herkunft von Clausus, der „von sabinischer Abstammung, zugleich in die römische Bürgerschaft und in die patrizischen Familien aufgenommen“ worden war.1 Nach der sagenhaften Überlieferung war Attus Clausus im Jahr 504 v. Chr. aus der Sabinerstadt Regillum nach Rom eingewandert und hatte dort in der städtischen Oberschicht Aufnahme gefunden.
Tiberius Claudius Nero, Claudius’ Großvater väterlicherseits, der, wie wir gehört haben, wenige Jahre nachdem ihm Livia Drusilla von Octavianus entführt worden war, starb, verkörperte den der republikanischen Tradition verpflichteten Vertreter dieser Staatsform schlechthin. Im Jahr 510 v. Chr. war sie in Rom eingeführt worden, nachdem man den letzten etruskischen König Tarquinius Superbus verjagt hatte. Damals hatte man sich nach schlimmen Erfahrungen mit der Alleinherrschaft geschworen, die Leitung des Staates nie mehr – außer für höchstens sechs Monate in Zeiten äußerster Not und Gefahr – einem Einzigen zu überlassen, sondern nur noch in die Hände mehrerer kompetenter Führer, Leuten der Hocharistokratie, zu legen. Es handelte sich bei der res publica, der „öffentlichen Sache“,nicht um eine Demokratie, wie sie die griechischen Stadtstaaten kannten, nicht um eine Volksherrschaft im heutigen Sinne. An die Stelle des Alleinherrschers, des Diktators (mit oft tyrannischen Zügen) traten Angehörige erlauchter, alteingesessener Familien, die sich in die Geschicke von Stadt und Reich teilten.
Die Republik hatte sich, was in Rom auch immer geschehen war, über Jahrhunderte bewährt. Doch mehr als hundert Jahre vor der Zeitenwende (von der damals freilich noch niemand etwas ahnte) waren heftige Bürgerkriege ausgebrochen, die erst mit dem Antritt der Alleinherrschaft Octavians, also etwa 30 Jahre vor Beginn der neuen Zeitrechnung, endeten. Sie hatten vor allem die staatstragende Schicht Roms nahezu ausgeblutet und das Imperium Romanum an den Rand des Verderbens geführt. Die heftigen Auseinandersetzungen gipfelten in der Ermordung Caesars an den Iden des März 44 v. Chr. und den darauf folgenden Rachefeldzügen seiner Anhänger gegen jene Vertreter der althergebrachten res publica, die für den Tod des Diktators verantwortlich waren. Erst mit Marcus Antonius’ Freitod 30 v. Chr. in seiner selbst gewählten neuen Heimat Ägypten an der Seite von dessen Königin Kleopatra waren die blutigen Bürgerkriege beendet.
Rom verdankte den so teuer erkämpften Frieden vorwiegend einem Mann, Gaius Octavianus, der kurze Zeit später den Beinamen Augustus erhielt, „der Erhabene und der in Ehrfurcht zu Verehrende“.
Nur wenigen Römern fiel auf, dass sich unter diesem Augustus ein schleichender Wandel in der Staatsform vollzog. Die res publica, die Sache, die einst viele betraf, mutierte langsam zur Herrschaft eines Einzelnen, mochte sich Octavianus auch hartnäckig nur als Princeps, als Erster unter Gleichen, bezeichnen. Die Römer gewöhnten sich an ihn, waren am Ende froh, dass es einen gab, der für sie und ihr Reich die Verantwortung übernahm. Mit der neuen Regierungsform war bald niemand mehr unzufrieden, und es gab kaum noch einen Römer, der sich an die republikanische Freiheit erinnerte. Denn die Menschen starben damals früh. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei knapp über 30 Jahren, wobei jedoch die hohe Kindersterblichkeit zu berücksichtigen ist. Augustus hatte das Glück, das nach unserer Kenntnis nur wenigen seiner Zeitgenossen vergönnt war: Er sollte das stattliche Alter von 76 Jahren erreichen, obwohl er, wie berichtet wird, Zeit seines Lebens an diversen Krankheiten litt.
Als Claudius geboren wurde, herrschte Augustus schon 20 lange Jahre über Rom, wenn man davon ausgeht, dass er die Stellung als erster Mann im Staate bereits mit dem Tod seines letzten Widersachers Marcus Antonius erlangt hatte. Claudius wurde also in eine Zeit hineingeboren, in der sich die Pax Augusta, der von Augustus heraufgeführte Reichsfrieden, bereits ahnen ließ. Die Stellung des Princeps war nahezu unerschütterlich. Größere Verschwörungen gegen seinen Anspruch waren nicht zu befürchten. Und dennoch war zumindest der Familienfrieden der julisch-claudischen Gens bedroht.
Augustus hatte seine Tochter Julia, eine stadtbekannte Schönheit, unmittelbar nach dem Tod ihres ersten Gatten Marcellus, von dem bereits die Rede war, seinem langjährigen Freund und Weggefährten Marcus Vipsanius Agrippa zur Frau gegeben. War ihre erste Ehe kinderlos geblieben, so erwies sich die zweite als erstaunlich fruchtbar. Julia schenkte ihrem Gatten drei Söhne und zwei Töchter, wobei der jüngste Sohn erst nach dem Tod seines Vaters zur Welt kam und deshalb Agrippa Postumus genannt wurde.
Marcus Vipsanius Agrippa stand bei seinem Freund und Schwiegervater in hoher Gunst. Augustus war sich auf seinem steilen Weg nach oben stets bewusst geblieben, was er dem Gleichaltrigen verdankte und dass er ohne ihn wohl nie die Stellung erlangt hätte, die er jetzt so verbissen hielt. Agrippa war d e r Feldherr seiner Zeit, beim Volk und seinen Soldaten gleichermaßen beliebt, und er war der, dem Rom augenblicklich seine bereits weltbeherrschende Stellung verdankte.
Aber nicht nur als Oberbefehlshaber der Streitkräfte, als tatkräftiger Verwalter und Unterstützer der kaiserlichen Politik, auch als Ehemann seiner Tochter war er für den Staatsführer von größtem Nutzen. Denn Augustus’ Ehe mit Livia Drusilla war trotz aller Bemühungen kinderlos geblieben – ein nach langer Dauer geborener Sohn starb bald nach der Geburt -, und so lieferte die äußerst fruchtbare Verbindung des Kaiserfreundes mit der schönen Julia den Nachwuchs, den der Princeps als Nachfolger und Vollender seiner Herrschaft so dringend benötigte. Wen interessierte es schon, dass nie vorgesehen war, dass der Anspruch auf den römischen Thron vererblich sein sollte!
Augustus setzte sich nicht nur insofern über alle Bedenken hinweg. In großväterlicher Freude adoptierte er die ersten beiden Söhne seiner Tochter, Gaius und Lucius Caesar, ließ ihnen eine standesgemäße und auf die Übernahme der Regentschaft gerichtete Ausbildung zukommen, um sie Stadt und Reich fortan als seine Söhne und Nachfolger vorzustellen. Er ahnte nicht, dass er beide Jünglinge um viele Jahre überleben sollte...
Zwei Jahre vor Claudius’ Geburt war Marcus Vipsanius Agrippa gestorben, 51 Jahre alt und im ganzen Reich hoch angesehen. Anders als bei seinem Vorgänger im Ehebett der Kaisertochter ging diesmal wohl kaum jemand von einer Vergiftung des kaiserlichen Vertrauten aus. Agrippa litt offensichtlich, wenn die von ihm angestrebte Therapie richtig gedeutet wird, an Rheuma, Arthritis und Gicht, nicht verwunderlich bei einem, der mehr als sein halbes Leben im rauen Feldlager verbracht und die Härte des Krieges mit seinen Soldaten geteilt hatte. Der unermüdliche Feldherr hatte sich noch bemüht, in den heißen Quellen Campaniens zumindest Linderung seiner Leiden zu finden, vergeblich. Die Einweihung des von seinem Freund 12 v. Chr. in Auftrag gegebenen Friedensaltars auf dem Marsfeld, der Ara Pacis Augustae, die auch sein Bildnis schmückt, sollte er nicht mehr erleben. Noch heute erinnert eines der schönsten erhaltenen Kunstwerke der römischen Antike an die kaiserliche Familie und ihr oft hartes Schicksal.
Agrippas Tod ließ nicht nur bei seinem Freund Augustus eine schwer zu füllende Lücke zurück. Er machte auch seine fünf Kinder zu Halbwaisen und Julia, die gerade 30 Jahre alt und schon zum zweiten Mal Witwe geworden war, zur reichsten und begehrtesten Frau Roms, wenn nicht des ganzen Imperiums. Wen wundert es da, dass die lebenshungrige Kaisertochter, von ihrem Vater im Sinne der Staatsräson in zwei arrangierte Ehen gezwungen, nach vielem griff, das sich ihr anbot. Doch sind insofern die alten Quellen, die ihr einen leichtfertigen Lebenswandel nachsagen, mit Vorsicht auszulegen. Denn es ist kaum möglich, dass die Tochter des Kaisers, auf die sich permanent die Augen der ganzen Stadt richteten, tatsächlich das anstößige Leben führte, das ihr die zeitgenössischen Historiker andichteten. Es war vor allem der Vater, der verbissen an entsprechenden Gerüchten festhielt und wohl doch nur verschleiern wollte, dass seine Tochter und ihre Freunde aus der römischen Oberschicht womöglich einen Umsturz planten, der das Ziel hatte, ihn vom Thron zu stürzen und vielleicht sogar ums Leben zu bringen, um die republikanische Staatsform wieder einzuführen oder zumindest einen Wechsel an der Spitze der Staatsführung vorzunehmen. Denn zu ihrem Freundeskreis gehörte kein Geringerer als Iullus Antonius, der Sohn des berühmten Marcus Antonius und als solcher möglicherweise der Auffassung, ein genuines Recht auf eine Führungsposition im römischen Staate zu haben – mehr jedenfalls als dieser blasse Aufsteiger, dessen Vorfahren noch in der leicht schmuddeligen Unterstadt zu Hause gewesen waren. Überhaupt verdankte Augustus seine jetzt so herausragende Stellung nur der Adoption durch einen alten Mann, Gaius Iulius Caesar, dem er, wie jedermann wusste, vor Zeiten in ganz bestimmter Weise gefällig gewesen war … Was konnte ein Octavianus Augustus, zu dem nicht auch Angehörige des alten Stadtadels fähig gewesen wären?
Die Lage muss sich für Augustus als besonders gefährlich dargestellt haben, zumal Antonius und Julia eine tiefe leidenschaftliche Beziehung verband. Auf jeden Fall wurde Julia, wie gesagt, zum zweiten Mal Witwe geworden, ein neuer Ehemann verordnet, der ihr wallendes Blut kühlen sollte. Von allen möglichen Heiratskandidaten schien der Stiefsohn des Kaisers, Tiberius Claudius Nero, der nachmalige Kaiser, am geeignetsten zu sein. Livia Drusilla, Tiberius’ Mutter, dürfte dabei auf ihren Gatten erheblichen Druck ausgeübt haben.
Der finstere, zu Melancholie und Schwermut neigende Mann war in glücklicher Ehe mit Vipsania Agrippina verheiratet, einer Tochter des Marcus Vipsanius Agrippa, und empfand die erzwungene Trennung von ihr, dem einzigen Menschen, den er je wirklich geliebt zu haben scheint, äußerst schmerzlich. Noch viele Jahre später sah er ihr mit Tränen in den Augen nach, als er ihr zufällig in der Stadt begegnete, sodass man künftig darauf achtete, dass sie nicht mehr zusammentrafen. So war die Verbindung zwischen dem unglücklichen Mann und der lebenslustigen und -hungrigen Kaisertochter von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Die Katastrophe ließ auch nicht lange auf sich warten. Nur eine kurze Zeit schienen die Himmlischen Roms ihre schützende Hand über das frisch vermählte Paar zu halten. Vielleicht hätte man sich ja arrangieren können, wäre der Sohn, den Julia bald nach der Eheschließung gebar, nicht wenige Monate später gestorben. Sie nahm, so heißt es, nach dieser Tragödie ihren leichtfertigen Lebenswandel wieder auf, trieb sich angeblich mit den Schönlingen der städtischen Oberschicht herum und reizte ihren Vater damit bis aufs Blut. Tiberius, der nach den kürzlich erlassenen Ehegesetzen des Princeps ihren Ausschweifungen hätte Einhalt gebieten müssen, schwieg.
Im Jahr 747 a.u.c. kehrte er von einem Feldzug, der ihn ins feindliche Germanien geführt hatte, nach Rom zurück. Er hatte Sugambrer und Sueben umgesiedelt und war im Jahr zuvor von Augustus mit einem großen Triumph geehrt worden. Die Gerüchte um den unsittlichen Lebenswandel seiner Frau hatten inzwischen einen Höhepunkt erreicht. Bereits um diese Zeit spielte der gehörnte Ehemann mit dem Gedanken, Rom den Rücken zu kehren. So lehnte er die Übernahme des Oberkommandos für einen Feldzug in den Osten des Reiches ab, begann mit den Vorbereitungen für seine Abreise und bat Mutter und Stiefvater um Urlaub. Es dauerte lange und bedurfte harter Drohungen von Seiten des entschlossenen Gekränkten, bis man seinem Ansinnen endlich nachgab. Man gestattete ihm, künftig als Privatmann auf der Insel Rhodos zu leben. Nur wenige Vertraute durften ihn dorthin begleiten.
Nicht nur der Sittenskandal um die schöne Julia hatte den Stiefsohn des Kaisers aus Rom vertrieben. Ihm war auch längst bewusst geworden, welch schändliche Rolle er im römischen Machtgefüge spielte. Augustus setzte alles daran, die Nachfolge seinen beiden Enkeln und Adoptivsöhnen, Gaius und Lucius Caesar, zu sichern und ihm, dem ungeliebten Stiefsohn, nur den undankbaren Status eines Platzhalters zuzuweisen. Schon erhielt Gaius Caesar die Männertoga und stieg damit gewissermaßen zum Kronprinzen der julischen Dynastie auf.
Auch auf der entfernten Insel Rhodos, wo sich Tiberius mit Gelehrten und Philosophen umgab, erreichten ihn die Neuigkeiten aus Rom. Vor drei Jahren war er in sein freiwilliges Exil gekommen, als er von der Einweihung des neuen Augustus-Forums erfuhr, das nördlich des Forum Romanum entstanden war, und von der Fertigstellung des Tempels des rächenden Mars. Sein Stiefvater hatte diesen gleich nach dem Sieg über die Caesar-Mörder in Auftrag gegeben und sich über den langsamen Baufortschritt immer wieder lustig gemacht. Tiberius mag auch mit einer gewissen Genugtuung erfahren haben, dass Julias Ausschweifungen endlich bestraft worden waren – nicht mit der Hinrichtung, an die ihr Vater wohl eine Zeitlang gedacht hatte, sondern mit der Verbannung auf die Insel Pandateria, ein ödes Felseneiland im Golf von Neapel, von dem es normalerweise keine Wiederkehr gab. Noch öfter sollte diese Insel unliebsamen Frauen des Kaiserhauses als Gefängnis dienen.
Mochte Julia auch im Sinne der gegen sie erhobenen Vorwürfe schuldig gewesen sein, Tiberius trat zumindest dem strengen Vater gegenüber für seine Frau ein und bat, sie nicht allzu schwer zu bestrafen. Doch kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich damit bei der Staatsführung nur in ein günstiges Licht setzen wollte und in Wirklichkeit froh war, die unbequeme Julia los zu sein. Nach Augustus’ Tod kümmerte er sich jedenfalls nicht mehr um sie und setzte sogar die ihr von ihrem Vater gewährten Unterhaltszahlungen aus. Er berief sich darauf, Augustus habe darüber in seinem Testament nichts verfügt. Nach Rom zurückkehren durfte die Verbannte nie. Und selbst der Toten wurden die Heimkehr und eine ehrenhafte Ruhestätte im Familienmausoleum am Tiber verwehrt.
Den geflohenen Tiberius, der in Rom längst als Verbannter galt, erreichte auch ein Brief von Augustus, der ihn unmissverständlich aufforderte, sein Stillhalten zu brechen und Julia endlich den Scheidebrief zu schicken. Und wieder vergingen drei Jahre, als seine Sehnsucht nach der Heimat so stark geworden war, dass er nach Hause zurückkehren wollte. Aber wenn er je auf ein einfaches Unterfangen gehofft hatte, sah er sich bitter getäuscht. Es war fast schwieriger, von der Staatsführung die Erlaubnis zur Rückkehr zu erhalten als es sechs Jahre zuvor gewesen war, Rom zu verlassen. Erst nachdem sich Tiberius verpflichtet hatte, auch in der Hauptstadt wie ein Privatmann zu leben und sich nicht in die Staatsgeschäfte einzumischen, durfte er, auch auf Fürsprache seiner Mutter, die Koffer packen. Man schrieb inzwischen das Jahr 754 a.u.c.
Auf Rhodos besaß der Verbannte eine Villa über den Klippen; von ihr führte ein Weg hinauf zur Sternwarte, auf der er sich nach dem Lauf der Gestirne öfter die Zukunft vorhersagen ließ. Unter anderen begleitete ihn auch Thrasyllos, sein Sterndeuter, dorthin. Dieser hatte Tiberius schon öfter günstige Prophezeiungen gemacht, doch hatte sich bislang keine davon erfüllt. Tiberius wurde misstrauisch. Schon hatte er einem Freigelassenen befohlen, Thrasyllos nach dem Besuch der Einrichtung die Klippen hinabzustoßen, wie das mit einigen seiner Begleiter schon geschehen war, da sie nicht weitergeben sollten, wovon sie dort oben Zeugen geworden waren. Da bemerkte er, dass der Wahrsager ungewohnt traurig war. „Was verraten dir heute die Sterne?“, wollte er von Thrasyllos wissen. Dieser meinte, Tiberius befände sich in einer äußerst günstigen Lage, er werde in Zukunft nur noch Glück haben. Und wie es mit seinem, Thrasyllos’ eigenem Schicksal stünde, wollte der Verbannte weiter wissen. Da wurde der Mann noch trauriger. Ach, meinte er, ihm stünde ein nahes schreckliches Unglück bevor. Sein Schicksal sei aber mit dem seines Herrn eng verbunden, fügte er eilends hinzu. Nur, wenn Tiberius bald eine glückliche Nachricht erhielte, sei auch er, Thrasyllos, gerettet. Tatsächlich war ein Schiff angekommen mit einem Brief des Augustus. In ihm wurde Tiberius gestattet, nach Hause zurück zu kehren. Da umarmte er seinen treuen Wahrsager und nahm ihn in die Reihe seiner besten Freunde auf.
Auch wenn Claudius am Hofe des Kaisers unter der Aufsicht von Mutter und Großmutter aufwuchs, dürfte er von all den Skandalen, Kränkungen und Enttäuschungen nicht viel mitbekommen haben. Im Jahr 10 vor Beginn der neuen Zeitrechnung geboren, war er bei Tiberius’ Rückkehr nach Rom elf Jahre alt. Wahrscheinlich hat er sich an seinen Onkel kaum erinnert. Es ist anzunehmen, dass man des in der Verbannung Lebenden bei Hofe kaum gedacht hatte und dass sein Name so selten wie nur möglich gefallen war. Denn Augustus war von dem Verhalten des Stiefsohns, der sich seiner Familienpolitik so offensichtlich widersetzt hatte, aufs Tiefste enttäuscht und ahnte noch nicht, wie bald er auf Tiberius’ unumschränkte Unterstützung angewiesen sein würde ….
Der Heimkehrer war kaum in Rom angekommen, als dort eine schreckliche Nachricht eintraf: Lucius Caesar, von seinem Adoptiv- und Großvater Augustus im Zuge seiner Ausbildung in die spanische Provinz geschickt, war auf dem Weg dorthin in Massalia (heute Marseille) unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Sogleich kam der Verdacht auf, Livia Drusilla, Stiefmutter par excellence, habe ihren eigenen Sohn Tiberius dem Thron ein Stückchen näher bringen wollen und bei Lucius’ Beseitigung die Hände im Spiel gehabt. Der Verdacht erhärtete sich, als nur zwei Jahre später auch sein älterer Bruder Gaius Caesar in Limyra an der kleinasiatischen Küste den Folgen einer Verletzung erlag. Konnte es so viel Zufall geben? Reichte Livias Einfluss, die sich ja selbst nicht von ihrem Zuhause wegbewegt hatte, so weit, dass sie den von Rom entfernten leiblichen Angehörigen ihres Mannes gefährlich werden konnte? Bewiesen ist nichts, und auch Augustus scheint gegen seine Frau keinerlei Misstrauen gehegt zu haben. Er schrieb die gehäuften Unglücks- und Todesfälle den Launen des Schicksals zu und adoptierte nolens volens seinen Stiefsohn Tiberius, der als einziger Erwachsener von seinen männlichen Familienmitgliedern für die Nachfolge übrig geblieben war. Sein jüngster Enkelsohn, Agrippa Postumus, der, wie bereits erwähnt, erst nach dem Tod des berühmten Feldherrn und kaiserlichen Schwiegersohnes geboren war, war noch zu jung, um sich für eine Führungsrolle im römischen Staat zu eignen, wurde aber gleichzeitig mit Tiberius von seinem Großvater adoptiert. Allerdings erhielt Tiberius die Auflage, seinerseits Germanicus, seinen Neffen, Sohn seines verstorbenen Bruders Drusus, an Sohnes Statt anzunehmen.
Wie bereits erwähnt, führte Claudius von Anfang an ein Schattendasein. Kaum jemand bekam diesen missgestalteten Jungen zu Gesicht. Er mag sich wie andere Kinder mit den üblichen Spielsachen beschäftigt haben, Würfeln, aus Knochen geschnitzten Figürchen, Murmeln und kleinen Wägelchen. Wirklich gekümmert hat sich wahrscheinlich niemand um ihn. Es ist auch nicht bekannt, wie sich das Verhältnis der Geschwister untereinander entwickelte. Mag sein, dass der fünf Jahre ältere Germanicus dem schwachen Kleinen beistand, wie das bei größeren Geschwistern ja oft der Fall ist. Seine Schwester Livilla aber wird sich wie alle Frauen des Kaiserhauses für den behinderten Bruder eher geschämt haben. Das lässt schon die bereits erwähnte spätere Äußerung auf die Vorhersage vermuten, Claudius werde dereinst Kaiser sein.
Nur zwei Jahre älter als unser Protagonist war Julias jüngster Sohn Agrippa Postumus. Die Angehörigen der kaiserlichen Familie wohnten auf dem Palatin, wenn auch wahrscheinlich nicht alle in dem verhältnismäßig bescheidenen Haus, das sich Livia und Augustus eingerichtet hatten, da dieses für mehrere Familien zu klein war. Der nachgeborene Agrippa und Claudius waren, wenn auch weitläufig, miteinander verwandt. Es ist also anzunehmen, dass sich die beiden Jungen zumindest gut kannten, wenn nicht sogar befreundet waren. Teilten sie doch gemeinsam das Los, von ihren Familien nicht als vollwertige Mitglieder anerkannt zu werden. Auch der vaterlose Nachgeborene hatte in seiner Familie einen schweren Stand, besonders, nachdem seine Mutter aus Rom verbannt worden war.
Wie auch in neuzeitlichen Herrscherhäusern üblich, etwa bei den Habsburgern des 19. Jahrhunderts, grenzte sich die römische Nobilität streng vom einfachen Volk ab. Man hat peinlich darauf geachtet, dass die Kinder der adeligen Familien stets nur unter ihresgleichen verkehrten. Da dürfte die Auswahl an geeigneten Spielkameraden nicht übermäßig groß gewesen sein.
Man hatte ja den behinderten Claudius, bei dem sich auch noch eine Art nervöses Stottern eingestellt hatte, von Anfang an vor der Öffentlichkeit versteckt gehalten, und so dürfte es schon aus diesem Grund nicht möglich gewesen sein, dass er andere Spielgefährten als die aus der eigenen Verwandtschaft oder zumindest dem höfischen Umfeld hatte. Eine Ausnahme bildete da vielleicht Herodes Agrippa (eigentlich Iulius Herodes Agrippa), ein Nachkomme des Judenkönigs Herodes des Großen. Er war wie Claudius 10 v. Chr. zur Welt gekommen und in Rom als eine Art vornehme Geisel am Hofe aufgewachsen. 37 n. Chr. sollte ihn Kaiser Caligula, Claudius’ Neffe und Vorgänger auf dem Thron, zum König über diverse Kleinreiche im Osten machen. Er hat bei der Thronbesteigung seines Freundes Claudius im Jahr 41 n. Chr. – er war zufällig in Rom, als Caligula ermordet wurde – eine entscheidende Rolle gespielt und durfte sich bis an sein Lebensende 44 n. Chr. der Freundschaft des neuen Kaisers erfreuen. Doch davon wird zu gegebener Zeit noch ausführlich zu berichten sein.