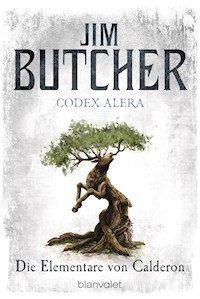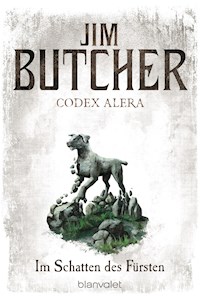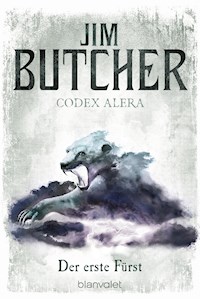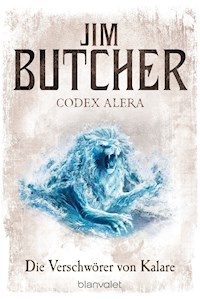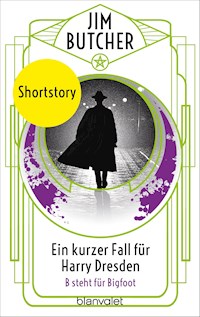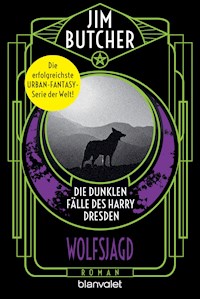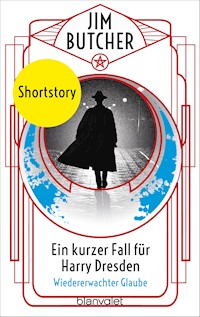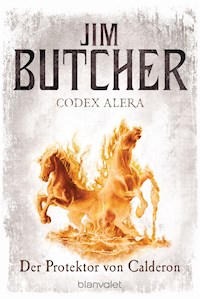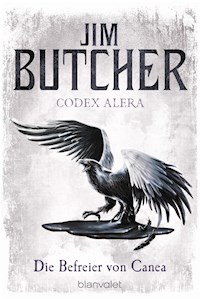
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Codex Alera
- Sprache: Deutsch
Die schrecklichen Vord haben die Canim aus ihrer Heimat Canea vertrieben und so die Invasion Aleras durch die Wolfsähnlichen erzwungen. Doch Tavi von Calderon, dem frisch ernannten Erben des Throns, gelingt es, die Canim zu einem unsicheren Frieden zu bewegen. Aber das Abkommen hat einen hohen Preis. Er muss ein Menschenheer übers Meer in die Heimat der Canim führen und ihnen gegen die Vord beistehen. Und während Tavi und seine Soldaten einen fernen Krieg kämpfen, erreichen die Vord bereits seine Heimat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 741
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Jim Butcher
Die Befreier von Canea
Codex Alera 5
Aus dem Englischenvon Andreas Helweg
blanvalet
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Codex Alera 05. Princeps’ Fury« bei Ace Books, the Berkley Publishing Group, Penguin Group (USA) Inc., New York.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2011bei Blanvalet, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Jim Butcher
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 by Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Published by Arrangement with Longshot LLC.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Covergestaltung und -illustration: © Melanie Miklitza, Inkcraft
Redaktion: Waltraud Horbas
UH · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-05792-3V003
www.blanvalet.de
Für Shannon und JJ,die das Leben trotz Hektik und Sorgen lebenswert machen.
Lebwohl, Mutter Roma.
Deine strahlenden Säulen,
Deine endlosen Straßen,
Deine mächtigen Legionen,
Deine friedlichen Felder.
Geboren im Feuer,
Ein Licht im Dunkel.
Lebwohl, Mutter Roma.
Niemals kehren deine Söhne heim.
Inschrift auf einem Stein in den Ruinen von Appia
Mach’s gut, gierige Hure! Viktoria Germania!
Zusatz zum Gedicht, eingeritzt in deutlich plumperen Buchstaben
Prolog
»Hier entlang, mein Fürst!«, schrie der junge Ritter Aeris und winkte, während er die Richtung seines Windstroms änderte und durch den dämmrigen Himmel nach unten stieß. Er blutete aus einer Wunde am Hals. An dieser Stelle hatte ihn unterhalb des Helms eines dieser messerscharfen Eisbruchstücke getroffen, die diese Wesen schleuderten wie Speere. Der junge Narr durfte sich glücklich schätzen, dass er überhaupt noch lebte; mit einer Halswunde war nicht zu spaßen. Wenn er nicht aufhörte, so wild herumzufuchteln, und wenn er sich nicht bald um seine Verletzung kümmerte, würde sie weiter aufreißen und die Legion einen unersetzlichen Mann kosten.
Der Hohe Fürst Antillus Raucus glich seinen Windstrom an den des jungen Ritters an und stieß neben ihm hinab zur Dritten Antillanischen Legion, die kampfbereit auf der Schildmauer stand. »Du!«, fauchte er und überholte den Ritter mühelos, da seine Elementare bei weitem überlegen waren. Wie hieß der Idiot noch? Marius? Karius? Carlus, das war es. »Ritter Carlus, du begibst dich zu den Heilern. Sofort.«
Carlus riss erschrocken die Augen auf, während Raucus davonschoss und den jüngeren Mann hinter sich zurückließ, als würde der auf der Stelle schweben und nicht in waghalsigem Sturzflug gen Boden jagen. Raucus hörte ihn noch sagen: »Ja, mein F …« Der Rest des Wortes ging im Brausen des Windes unter, den der Hohe Fürst hinter sich erzeugte.
Raucus bat seine Elementare, sein Sehvermögen zu verstärken, und die Szene unten wurde durch Luftkrümmung erheblich vergrößert. Auf dem Weg hinab nahm er eine Einschätzung der Lage vor und fluchte herzhaft. Sein Hauptmann hatte recht daran getan, ihn um Hilfe zu bitten.
Die Dritte Antillanische befand sich in einer verzweifelten Lage.
Raucus hatte mit vierzehn die Feuertaufe auf dem Schlachtfeld bestanden. In den vierzig Jahren seither war kaum ein Monat vergangen, ohne dass er in kleinere oder größere Kampfhandlungen verwickelt worden wäre, denn die Schildmauer wurde unablässig von den primitiven Eismenschen des Nordens bedroht.
In all den Jahren hatte er nie zuvor so viele von ihnen gesehen.
Ein Meer von Wilden erstreckte sich vor der Schildmauer, Zehntausende hatten sich versammelt, und während Raucus tiefer hinabstieß, wurde er plötzlich von einer Kälte umschlossen, die ihm eisiger erschien als der Frost des Winters. Binnen Sekunden war seine Rüstung mit Reif überzogen, und er musste seine Feuerkräfte einsetzen, um sich gegen die Kälte zu schützen.
Der Feind hatte Berge aus Schnee und Leichen vor der Schildmauer aufgehäuft und zu Rampen geformt. Diese Taktik war ihm nicht neu, er hatte sie schon bei ihren entschlossensten Überfällen erlebt. Die Legion hatte darauf mit den üblichen Mitteln geantwortet: brennendes Öl und Feuerstöße von den Rittern Ignus.
Die Mauer selbst war gewissermaßen ein Bestandteil des Landes, ein massives Bauwerk aus Granit, das mit Elementarkräften aus den Tiefen der Erde gezogen worden war. Es maß fünfzig Fuß in der Höhe und war hundert Fuß dick. Die Eismenschen musste es Tausende von Opfern gekostet haben, diese Rampen aufzuhäufen, die stets wieder abgeschmolzen wurden und neu errichtet werden mussten – wieder und wieder und wieder, bis sie es endlich geschafft hatten. Die Kälte dauerte lange genug an, um die Legionares ihrer Kräfte zu berauben, und die Schlacht wütete nun schon so lange, dass auch die Ritter der Dritten kaum noch in der Lage waren, dem Feind Einhalt zu gebieten.
Die Eismenschen hatten die eigentliche Mauer erreicht.
Raucus biss niedergeschlagen und wütend die Zähne zusammen, während die affenartigen Wesen durch eine Bresche in der Verteidigungsfront einfielen. Die größten dieser Scheusale konnten es an Höhe beinahe mit aleranischen Legionares aufnehmen, allerdings waren sie viel breiter in den Schultern. Sie hatten lange Arme mit riesigen Pranken, und ihre lederartige Haut bedeckte ein drahtiges gelbweißes Fell, durch das sie im eisigen Ödland des Nordens beinahe unsichtbar wurden. Gelbweiße Augen glänzten unter zotteligen Brauen, und dicke Hauer ragten aus ihren kräftigen Kiefern. Jeder Eismensch trug eine Keule aus Knochen oder Stein, und bei manchen waren scharfe Splitter aus unnatürlich hartem Eis eingearbeitet, die sich wie die Kälte des Winters selbst dem Willen dieser Wilden zu beugen schienen.
Die Legionares scharten sich hinter einem Zenturio mit Kammhelm zusammen und drängten mühsam in die Bresche vor, doch ihre Elementarkräfte, mit denen sie die Mauer oben von Eis freihalten sollten, ließen nach, und so standen sie auf tückischem Grund. Der Feind, der besser an solch glatte Oberflächen gewöhnt war, trieb die Legion auseinander, so dass sie nun in zwei verwundbare Teile gespalten waren, und mehr und mehr Eismenschen strömten auf die Mauer.
Diese gelbäugigen Söhne von Krähen massakrierten seine Männer.
Die Dritte Antillanische hatte nur noch wenige Minuten Zeit, dann würden die Eismenschen durchbrechen, und diese Horde könnte plündernd durchs Land ziehen. Im Umkreis weniger Marschstunden lagen ein Dutzend Wehrhöfe und drei kleine Städte, und obwohl die Militia in allen Orten entlang der Schildmauer gut ausgerüstet und ausgebildet war – darauf hatte Raucus bestanden –, hatten sie gegen eine solche Überzahl keine Chance. Ihnen blieb einzig die Möglichkeit, in einem aussichtslosen Kampf zu sterben, damit Frauen und Kinder Zeit zur Flucht hatten.
Das würde er nicht zulassen; sein Volk und sein Land würden kein derartiges Schicksal erleiden.
Antillus Raucus, Hoher Fürst von Antillus, ließ den Zorn in sich zu weißer Glut aufwallen, während er das Schwert aus der Scheide an seiner Seite riss. Er stieß ein wütendes Brüllen aus, rief seine Elementare und rief das Land, sein Land, das er ein Leben lang verteidigt hatte wie zuvor sein Vater und vor ihm dessen Vater.
Der aleranische Hohe Fürst schrie seine Wut ins Land und in den Himmel hinaus.
Und das Land und der Himmel antworteten.
Die klare Luft der Abenddämmerung brodelte, und Sturmwolken zogen auf. Dunkle Nebelbänke folgten dem Fürsten, als er in einer Spirale abwärts flog. Donner verstärkte den Schlachtruf des Hohen Fürsten um das Zehntausendfache. Raucus spürte, wie seine Raserei in das Schwert flutete; die Klinge flammte rot auf, brannte zischend in der Kälte und erhellte den Himmel um ihn herum, als wäre plötzlich die Sonne wieder am Horizont aufgegangen.
Licht fiel auf die verzweifelten Legionares, und die Gesichter wandten sich nach oben. Hoffnung und wilde Erregung machten sich in lautem Gebrüll Luft, und die Reihen, die gerade noch zu wanken gedroht hatten, schlossen sich wieder. Die Schilde schoben sich zusammen und hielten stand.
Es dauerte einige Sekunden, ehe die ersten Eismenschen aufblickten, und nun bereitete sich Raucus vor, in den Kampf einzugreifen. Er entfesselte die Elementare seines Himmels gegen den Feind.
Blitze zuckten herab, dünn und so zahlreich, dass sie aussahen wie brennender Regen. Blauweiß schossen sie auf die Eismenschen unterhalb der Mauer nieder und verbreiteten Tod und Schrecken. Unter den Angreifern brach ein heilloses Durcheinander aus, und plötzlich ließ der Druck ihres Vormarsches nach.
Raucus richtete die Schwertspitze nach unten, wobei er genau auf die Mitte der feindlichen Stellung auf der Mauer zielte, Feuer aus der brennenden Klinge beschwor und als weißen, heißen Flammensturm niedergehen ließ. In einem Umkreis von fünfzehn Fuß blieben nur Asche und verbrannter Knochen. Im letzten Augenblick rief er seine Windelementare, damit sie ihn verlangsamten, und landete hart auf dem unnachgiebigen Stein der Mauer, der nun vom tückischen Eis befreit war.
Raucus rief Kraft aus der Erde, zerschmetterte zwei auf ihn gezielte Keulen mit der brennenden Klinge und errichtete eine Feuerwand zwischen sich und der Südseite der Mauer, ehe er begann, sich grimmig nach Norden durchzuhacken. Die Eismenschen waren keine Dummköpfe. Natürlich wussten sie, dass man nur genug Speere und Pfeile und Keulen einsetzen musste, um auch den stärksten Elementarwirker zu fällen – und auch Raucus war das klar.
Aber ehe die überrumpelten Eismenschen ihren Angriff neu ordnen konnten, war der Hohe Fürst von Antillus mit seinem todbringenden Schwert zwischen sie gefahren. Er ließ ihnen keine Gelegenheit, ihn mit einem Geschosshagel zu überwältigen. Und kein Eismensch, auch kein Dutzend dieser Wilden, konnte Antillus Raucus Widerstand leisten, wenn er Stahl in der Hand hielt.
Die Eismenschen kämpften mit ungehemmter Wildheit, und sie waren stärker als die Aleraner. Jedoch nicht stärker als ein wutschäumender Hoher Fürst, der seine Kraft aus dem Stein und dem Land bezog. Zweimal gelang es Eismenschen, Raucus mit den ledernen Pranken zu packen. Doch er brach ihnen mit einer Hand das Genick und schleuderte die Leichen jeweils mit solcher Wucht in die gegnerischen Reihen, dass Dutzende anderer Angreifer zu Boden gingen.
»Dritte Aleranische!«, brüllte Raucus dann. »Zu mir! Antillus, zu mir! Antillus für Alera!«
»Antillus für Alera!«, donnerten seine Legionares zur Antwort, und nun drängten seine Soldaten in die andere Richtung und trieben den Feind von der Mauer. Die Veteranen unter den Legionares stießen ihren Schlachtruf aus und kämpften sich zu ihrem Fürsten vor, indem sie gnadenlos auf die Gegner einhieben, vor denen sie gerade noch zurückgewichen waren.
Sofort schwand der Widerstand wie Sand, den eine Welle fortspült, und Raucus spürte eine Veränderung im Druck. Die Ritter Ferrum der Dritten Aleranischen drängten sich durch die Legionares und gesellten sich an seine Seite, und danach war es nur noch eine Frage von Minuten, bis die letzten dieser Tiere von der Mauer vertrieben waren.
»Schilde!«, brüllte Raucus, ehe er auf eine Zinne stieg, von wo aus er die Schneerampe betrachten konnte. Zwei Legionares eilten zu ihm und schützten sich und ihn mit ihren breiten Schilden. Speere, Pfeile und geschleuderte Keulen prallten von dem aleranischen Stahl ab.
Raucus richtete seine Aufmerksamkeit auf die Schneerampe. Mit Feuer konnte man sie schmelzen, aber das würde einen riesigen Kraftakt erfordern. Leichter wäre es, sie von unten durch Erschütterungen zu zerstören. Er nickte knapp, legte eine Hand auf den Stein der Schildmauer und konzentrierte sich auf den Fels. Mit der Kraft seines Willens brachte er die ansässigen Elementare dazu, sich zu bewegen, und plötzlich hob und senkte sich der Boden vor der Schildmauer.
Das riesige Eisgebilde ächzte und bekam Risse, dann sackte es in sich zusammen und riss Tausende schreiender Wilder mit sich.
Raucus richtete sich auf und schob die Schilde auseinander, während eine gigantische Wolke aus Eiskristallen in die Luft aufstieg. Er hielt das brennende Schwert in der einen Hand, schaute aufmerksam hinaus und wartete, bis er den Feind wieder sehen könnte. Einen Augenblick lang regte sich niemand auf der Mauer, denn alle harrten aus, bis sie durch die Schneewolke etwas erkennen könnten.
Am anderen Ende ertönte ein triumphierender Schrei, und im nächsten Moment war auch bei Raucus die Luft wieder klar genug, so dass er die heillose Flucht der Wilden beobachten konnte.
Erst da löschte Raucus das Feuer seiner Klinge.
Die Männer versammelten sich an der vorderen Kante der Mauer und brüllten dem davonrennenden Feind höhnisch hinterher. Und sie priesen seinen Namen.
Raucus lächelte und salutierte mit der Faust auf dem Herzen. Das gehörte eben dazu. Wenn seine Männer ihm zujubeln wollten, konnte er einfach nicht so herzlos sein und ihnen den Spaß verderben. Sie wussten ja nicht, dass sein Lächeln nicht echt war.
Denn es lagen viel zu viele reglose Körper in aleranischer Rüstung auf dem Boden, als dass er sich wirklich hätte freuen können.
Er war vom Elementarwirken erschöpft und wünschte sich nur einen ruhigen, trockenen Flecken, wo er eine Weile schlafen konnte. Doch stattdessen hielt er eine Besprechung mit seinem Hauptmann und dem Stab der Dritten ab, ehe er zu den Zelten der Heiler ging und die Verwundeten besuchte.
Das gehörte eben auch dazu, genau wie den Jubel auszuhalten, der ihm nicht gebührte.
Denn diese Männer waren verletzt worden, während sie unter seinem Kommando gekämpft hatten. Ihnen waren Wunden zugefügt worden, seinetwegen. Er mochte eine Stunde Schlaf, oder zwei oder vielleicht zehn verlieren, und doch war das nichts, wenn ein paar freundliche Worte vielleicht das Leiden des einen oder anderen lindern würden.
Als Letztes besuchte Raucus den Ritter Carlus. Der junge Mann war noch immer sehr benommen. Er hatte viel größere Verletzungen erlitten, als er bemerkt hatte, und nach der Behandlung durch die Wasserwirker, die an seiner Heilung arbeiteten, war er erschöpft und verwirrt. Bei Halsverletzungen kam das durchaus vor. Es hatte mit dem Gehirn zu tun, so war es Raucus erklärt worden.
»Danke, mein Fürst«, sagte Carlus, als sich Raucus auf der Kante seines Feldbetts niederließ. »Ohne dich hätten wir die Stellung nicht halten können.«
»Wir ziehen doch alle an einem Strang, Junge«, erwiderte Raucus beschwichtigend. »Du brauchst dich nicht zu bedanken. Wir sind die Besten. So gehen wir an unsere Arbeit. So erfüllen wir unsere Pflicht. Nächstes Mal rettet vielleicht die Dritte mich.«
»Ja, mein Fürst«, antwortete Carlus. »Herr, ist es eigentlich wahr, was behauptet wird? Dass du den Ersten Fürsten zum Juris Macto herausgefordert hast?«
Raucus lachte leise. »Das ist schon eine Weile her, Junge. Und: Ja, es stimmt.«
Carlus’ matte Augen leuchteten kurz auf. »Ganz bestimmt hast du gewonnen, oder?«
»So dumm kannst du doch nicht sein, Junge«, meinte Raucus und legte dem jungen Ritter die Hand auf die Schulter. »Gaius Sextus ist der Erste Fürst. Er hätte mir meinen Kopf in den eigenen Schoß gelegt. Und dazu wäre er selbst heute noch in der Lage. Denk nur daran, was mit Kalarus Brencis passiert ist, ja?«
Carlus wirkte bei dieser Antwort nicht sonderlich erfreut, erwiderte jedoch: »Ja, mein Fürst.«
»Ruh dich aus, Soldat«, sagte Raucus. »Du hast gute Arbeit geleistet.«
Endlich kehrte Raucus zu seinem Zelt zurück. So. Pflicht erfüllt. Nun konnte er sich ein paar Stunden Ruhe gönnen. Der Druck auf die Schildmauer hatte in letzter Zeit zugenommen, und im Nachhinein wünschte er sich, er hätte darauf bestanden, dass Crassus seine erste Dienstzeit in der Legion zu Hause bei der Ersten abgeleistet hätte. Die Großen Elementare wussten es, der Junge konnte sich recht nützlich machen. Und Maximus ebenfalls. Offensichtlich hatten die beiden gelernt, miteinander auszukommen und sich nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegenseitig umbringen zu wollen.
Raucus schnaubte über diesen Gedankengang. In seinen eigenen Ohren klang er schon wie ein alter Mann, den Erschöpfung und Schmerzen plagten und der sich wünschte, jüngere Schultern würden ihm seine Bürden abnehmen. Allerdings würde er mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich eines Tages alt werden.
Und doch wäre es schön, Hilfe zu haben.
Es gab einfach so viele dieser Wilden – mochten sie die Krähen holen! Und er kämpfte schon viel zu lange gegen sie. Er stieg die Treppe hinunter, die in die Befestigungsanlagen innerhalb der Schildmauer führte. Dort erwarteten ihn ein geheiztes Zimmer und ein Bett. Doch nach kaum zehn Schritten hörte er aus der Ferne ein Windsausen, den Windstrom eines landenden Ritter Aeris.
Raucus blieb stehen, und einen Augenblick später rauschte ein Ritter Aeris in Begleitung eines Ritters von der Dritten Aleranischen heran, die die Streifenflüge übernommen hatte. Es war zwar schon dunkel, aber angesichts des Schnees stellte das vor allem in hellen Mondnächten kein größeres Hindernis dar. Doch erst, nachdem der Mann gelandet war, erkannte Raucus das Abzeichen der Ersten Antillanischen auf dem Brustpanzer.
Der Mann eilte schwer atmend zu Raucus und schlug hastig zum Salut mit der Faust aufs Herz. »Mein Fürst«, keuchte er.
Raucus salutierte ebenfalls. »Bericht.«
»Mitteilung von Hauptmann Tyreus, mein Fürst«, sagte der Ritter. »Seine Stellung wird aufs Heftigste angegriffen, und er bittet dringend um Verstärkung. Wir haben noch nie so viele Eismenschen auf einem Fleck gesehen, mein Fürst.«
Raucus blickte den Mann einen Moment lang an. Dann rief er ohne ein weiteres Wort seine Windelementare, hob in die Luft ab und machte sich nach Westen auf, wo die Stellungen der Ersten Antillanischen entlang der Mauer lagen, hundert Meilen entfernt. Er flog so schnell er konnte.
Seine Männer brauchten ihn. Der Schlaf musste warten.
Das gehörte eben auch dazu.
»Mir ist es gleichgültig, wie dick dein Kopf ist, Hagan!«, sagte Kapitän Demos im Plauderton, den man allerdings trotzdem auf dem ganzen Schiff und im halben Hafen hören konnte. »Du rollst diese Leinen ordentlich auf, oder ich lasse dich auf dem Weg durch die Hatz Entenmuscheln vom Kiel schaben!«
Gaius Octavian beobachtete, wie der bärbeißige Seemann mit den trüben Augen wieder an die Arbeit ging und seine Aufgabe diesmal zur Zufriedenheit des Kapitäns der Schleiche erfüllte. Die Schiffe waren kurz nach Morgengrauen mit der Flut aus dem Hafen von Werftstadt ausgelaufen. Jetzt am Vormittag sahen der Hafen und das Meer dahinter aus wie ein Wald aus Masten und aufgeblähten Segeln, die auf den Wellen am Horizont schwankten. Hunderte von Schiffen, die größte Flotte, die man in Alera je erlebt hatte, machten sich auf den Weg zum offenen Meer.
Nur ein einziges Schiff lag noch im Hafen, und zwar die Schleiche. Es sah alt und schäbig aus, doch das traf allenfalls äußerlich zu. Der Kapitän verzichtete einfach auf neue Farbe und neue Takelage. Die Segel waren schmutzig und geflickt, die Leinen dunkel mit Teer verschmiert. Die geschnitzte Bugfigur, die so oft nach gütigen weiblichen Elementaren oder verehrten Ahninnen gestaltet wurde, ähnelte hier eher einer jungen Hafendirne.
Wenn man nicht wusste, wonach man suchen sollte, konnte man leicht übersehen, welche Menge an Segeln die lange, schlanke Schleiche setzen konnte. Sie war zu klein, um sich mit einem richtigen Kriegsschiff messen zu können, aber auf dem offenen Meer bewegte sie sich flink und behände, und ihr Kapitän wusste gefährlich gut mit ihr umzugehen.
»Bist du dir vollkommen sicher?«, knurrte Antillar Maximus.
Der Tribun war genauso groß wie Tavi, aber kräftiger gebaut, und seine Rüstung war so zerkratzt und verbeult, dass es ihm kein Zenturio beim Antreten zu einer Parade hätte durchgehen lassen. Was jedoch in der Ersten Aleranischen Legion niemanden eine verfluchte Krähe scherte.
»Ob ich sicher bin oder nicht ist egal«, erwiderte Tavi ruhig. »Dieses Schiff ist das einzige im Hafen.«
Maximus verzog das Gesicht. »Stimmt auffallend«, grollte er. »Aber er ist ein verdammter Pirat, Tavi. Du musst jetzt auch an deinen Titel denken. Der Princeps von Alera sollte nicht so einen Kutter zum Flagschiff wählen. Es ist … von fragwürdiger Herkunft.«
»Mein Titel auch«, gab Tavi zurück. »Kennst du vielleicht einen besseren Kapitän? Oder ein schnelleres Schiff?«
Max schnaubte nur und sah die dritte Person auf dem Anleger an. »Immer nur auf die praktische Seite bedacht. Das ist deine Schuld.«
Die junge Frau antwortete selbstsicher und in aller Seelenruhe: »Ja, stimmt wohl.« Kitai trug ihr weißes Haar nach Art des Pferde-Clans vom Marat-Volk an den Seiten bis auf die Kopfhaut rasiert und in der Mitte lang wie die Mähne eines Pferdes, des Totem-Tiers ihres Clans. Ihre Kleidung bestand aus einer ledernen Reithose, einer lockeren weißen Tunika und einem Kämpfergurt mit zwei Schwertern. Wenn ihr die herbstliche Morgenkühle angesichts der leichten Kleidung unangenehm war, so ließ sie sich davon jedenfalls nichts anmerken. Ihre grünen Augen waren in den Winkeln nach oben gezogen, wie bei vielen ihres Volks, und ihr Blick wanderte abwesend und neugierig zugleich wie der einer Katze über das Schiff. »Aleraner haben viele dumme Vorstellungen im Kopf. Wenn man ihnen oft genug auf den Schädel haut, fallen manche davon am Ende heraus.«
»Kapitän?«, rief Tavi und grinste. »Ist dein Schiff bereit, heute noch auszulaufen?«
Demos kam zur Reling, lehnte sich mit den Unterarmen darauf und starrte sie von oben herab an. »Oh, aye, Hoheit«, antwortete er. »Ob du allerdings an Bord sein wirst oder nicht, wenn es ausläuft, ist eine ganz andere Frage.«
»Wie?«, meinte Max. »Demos, du hast das halbe Geld der Abmachung schon im Voraus erhalten. Ich habe es dir persönlich gegeben.«
»Ja«, erwiderte Demos. »Ich wäre froh, das Meer mit der Flotte zu überqueren. Mit Freuden nehme ich dich und das barbarische Mädchen mit.« Demos zeigte mit dem Finger auf Tavi. »Aber Seine Fürstliche Hoheit wird keinen Fuß auf mein Schiff setzen, ehe wir nicht abgerechnet haben.«
Max kniff die Augen zusammen. »Dein Schiff würde bestimmt lustig aussehen, wenn irgendwer ein riesiges Loch mitten hindurch brennt.«
»Kein Problem; ich stopfe es einfach mit deinem fetten Kopf«, gab Demos zurück und lächelte frostig.
»Max«, mahnte Tavi milde. »Kapitän, darf ich an Bord kommen, damit wir unsere Rechnungen begleichen?«
Max knurrte vor sich hin. »Der Princeps von Alera sollte nicht um Erlaubnis bitten müssen, das Schiff eines dahergelaufenen Piraten zu betreten.«
»Auf seinem Schiff«, murmelte Kitai, »hat der Kapitän einen höheren Rang als der Princeps.«
Tavi hatte das Ende der Laufplanke erreicht und breitete die Arme aus. »Und?«
Demos, ein dünner Mann, der ein wenig größer als der Durchschnitt war und Tunika und Hose in Schwarz trug, drehte sich auf einem Ellbogen halb zur Seite und musterte Tavi. Die freie Hand befand sich kaum einen Zoll vom Griff seines Schwertes entfernt. »Du hast etwas von meinem Eigentum zerstört.«
»Das stimmt«, sagte Tavi. »Die Ketten im Frachtraum, mit denen du Sklaven gefesselt hast.«
»Du wirst sie ersetzen.«
Tavi zuckte mit den Schultern. »Was sind sie dir denn wert?«
»Ich will kein Geld. Mir geht es überhaupt nicht ums Geld«, sagte Demos. »Sie haben mir gehört. Du hattest nicht das Recht, sie zu zerstören.«
Tavi wich dem Blick des Mannes nicht aus. »Ich glaube, mancher Sklave würde das Gleiche über sein Leben und seine Freiheit sagen, Demos.«
Demos blinzelte langsam. Dann sah er zur Seite. Er schwieg kurz, ehe er murmelte: »Ich habe das Meer nicht erschaffen, ich segele nur darüber.«
»Genau darin besteht das Problem«, sagte Tavi. »Wenn ich dir die Ketten ersetze, obwohl ich weiß, wozu du sie benutzen wirst, mache ich mich zu einem Teil dessen, was mit diesen Ketten getan wird. Ich würde selbst zum Sklavenhändler. Und ein Sklavenhändler bin ich nicht, Demos. Werde ich niemals werden.«
Demos runzelte die Stirn. »Mir scheint, aus dieser Sackgasse gibt es keinen Ausweg.«
»Und du wirst deine Meinung auch ganz bestimmt nicht ändern?«
Demos blickte Tavi wieder an, hart diesmal. »Nicht einmal, wenn die Sonne vom Himmel fiele. Ersetze die Ketten oder verlasse mein Schiff.«
»Das kann ich nicht. Du verstehst doch, warum?«
Demos nickte. »Ich verstehe dich sehr gut. Ich respektiere es sogar. Trotzdem ändert das nichts an der krähenverfluchten Sache.«
»Wir brauchen eine Lösung.«
»Es gibt keine.«
»Das habe ich schon das eine oder andere Mal gehört«, meinte Tavi grinsend. »Ich ersetze dir die Ketten, wenn du mir im Gegenzug ein Versprechen gibst.«
Demos legte den Kopf schief und kniff die Augen zusammen.
»Versprich mir, dass du niemals andere Ketten oder andere Fesseln außer denen benutzt, die ich dir jetzt gebe.«
»Und ich bekomme ein paar verrostete alte Stücke? Nein, danke, Hoheit.«
Tavi hob beschwichtigend die Hand. »Die Ketten kannst du dir vorher anschauen. Du musst mir das Versprechen nicht geben, wenn sie dir nicht gefallen.«
Demos schürzte die Lippen. Dann nickte er plötzlich. »Abgemacht.«
Tavi nahm sich die schwere Botentasche von der Schulter und schleuderte sie zu Demos hinüber. Der Kapitän fing sie auf und ächzte, weil sie so schwer war. Er warf Tavi einen misstrauischen Blick zu und öffnete die Tasche.
Eine Weile starrte er schweigend hinein. Dann zog er Glied um Glied einer Sklavenkette heraus.
Jedes einzelne Glied bestand aus Gold.
Demos strich erstaunt über das Metall. Es war so viel wert, wie ein Söldner in seinem ganzen Leben verdienen mochte, und noch viel mehr. Dann blickte er Tavi an und runzelte verwirrt die Stirn.
»Du brauchst sie nicht anzunehmen«, sagte Tavi. »Meine Ritter Aeris fliegen mich gern zu einem der anderen Schiffe. Du reihst dich hinten in die Flotte ein. Und wenn unser Vertrag erfüllt ist, kannst du dich wieder mit dem Sklavenhandel befassen.«
Er machte eine kurze Pause. »Oder«, fuhr er fort, »du nimmst die Kette an. Und beförderst nie wieder Sklaven.«
Demos schüttelte langsam den Kopf. »Was soll das?«
»Ich biete dir einen Anreiz, in Zukunft auf Sklavenhandel zu verzichten«, sagte Tavi.
Demos lächelte schwach. »Du schenkst mir Ketten in meiner eigenen Größe, Hoheit, und bittest mich, sie freiwillig anzulegen.«
»Ich brauche gute Kapitäne, Demos. Ich brauche Männer, deren Wort ich trauen kann.« Tavi grinste und legte Demos eine Hand auf die Schulter. »Und Männer, die auch bei der Stange bleiben, nachdem sie reich geworden sind. Wie lautet deine Antwort?«
Demos ließ die Kette zurück in die Tasche fallen, schlang sie über die Schulter und neigte den Kopf dann tiefer, als Tavi es je bei ihm gesehen hatte. »Willkommen an Bord der Schleiche, mein Fürst.«
Damit drehte sich der Kapitän um und begann, der Mannschaft Befehle zuzubrüllen, während Max und Kitai Tavi die Laufplanke hinauffolgten.
»Gut gemacht, Aleraner«, murmelte Kitai.
Max schüttelte den Kopf. »Irgendwas muss in deinem Kopf Schaden erlitten haben, Calderon. Du kannst überhaupt nicht mehr in klaren Linien denken.«
»Eigentlich hatte Ehren den Einfall«, verteidigte sich Tavi.
»Wäre schön gewesen, wenn er uns begleitet hätte«, knurrte Max.
»So verläuft eben das wunderbare Leben eines Kursors«, erwiderte Tavi. »Doch mit ein bisschen Glück sind wir gar nicht so lange unterwegs. Wir bringen Varg und sein Volk nach Hause, führen ein paar höfliche Gespräche, damit wir uns in Zukunft auf diplomatischem Wege verständigen können, und machen uns auf den Heimweg. In zwei Monaten sind wir wieder hier.«
Max schnaubte. »Das verschafft Gaius Zeit, im Senat Unterstützung zu suchen und dich zu seinem legitimen Erben zu erklären.«
»Und gleichzeitig befinde ich mich außerhalb der Reichweite möglicher Attentäter, während ich eine Aufgabe von unbestreitbarer Wichtigkeit für das Reich erfülle«, sagte Tavi. »Über Ersteres freue ich mich besonders.«
Die Seeleute machten die Leinen los, und Kitai ergriff Tavis Hand. »Komm«, sagte sie. »Ehe du dein Frühstück auf deine Rüstung spuckst.«
Als das Schiff ablegte und mit der Bewegung der Wellen zu schaukeln begann, spürte Tavi den Aufruhr in seinem Magen, und er eilte in seine Kabine, um die Rüstung auszuziehen, sich reichlich Wasser und einen leeren Eimer zu holen. Er war ein schlechter Seemann, und Schiffsreisen waren die reinste Folter für ihn.
Beim nächsten Rumoren im Bauch dachte Tavi sehnsüchtig an festen Boden unter den Füßen, mochten ihm dort auch noch so viele Attentäter auflauern.
Zwei Monate auf See.
Er konnte sich keinen schlimmeren Albtraum vorstellen.
»Das stinkt zum Himmel«, beschwerte sich Tonnar, der sich fünf Schritte hinter Kestus’ Pferd befand. »Mir erscheint es wie ein böser Traum.«
Kestus blickte auf das Beil, das an seiner Satteltasche hing. Es wäre schwierig, genug Kraft in einen Wurf zu legen, während er ritt. Andererseits war Tonnars Kopf so weich, dass es möglicherweise keine Rolle spielte. Aber dann müsste er sich um die Leiche des Schwachkopfs kümmern und sich auch noch mit einer Mordanklage herumschlagen.
Natürlich stand Kestus die ganze verlassene Wildnis südwestlich der Ödnis zur Verfügung, um die Leiche zu verstecken, doch die Angelegenheit wurde durch den neuen Mann noch verzwickter. Er blickte nach hinten zum dritten Mitglied ihrer Streife, dem schlanken, drahtigen Würstchen, der sich Ivarus nannte und genug Verstand hatte, die meiste Zeit den Mund zu halten.
Einer von Kestus’ wichtigsten Glaubenssätzen lautete, dass man die Dinge schön einfach halten sollte. Daran hielt er sich für gewöhnlich auch, wenn Tonnar zu quasseln begann. Er beachtete ihn nicht.
»Weißt du eigentlich, was so nah an der Ödnis los ist?«, fuhr Tonnar fort. »Überall gibt es wilde Elementare. Gesetzlose. Seuchen. Hungersnöte.« Er schüttelte traurig den Kopf. »Und als der alte Gaius diesen Kalare vom Antlitz der Erde getilgt hat, sind die Hälfte der gesunden Männer mit ihm gegangen. Frauen werfen sich Männern für zwei Kupferböcke oder einen Kanten Brot an den Hals. Oder nur, damit sie jemanden haben, von dem sie glauben, er würde ihre Bälger beschützen.«
Wehmütig belebte Kestus seine Mordgedanken von neuem.
»Ich habe da mit einem Kerl aus der Nordmark gesprochen«, fuhr Tonnar fort. »Er hat es vier Frauen an einem Tag besorgt.« Das Großmaul schlug mit dem überhängenden Stück der Zügel hart auf den Ast eines Baumes, verteilte Laub in der Luft und traf ungeschickterweise den Hals seines Tieres. Das Pferd bockte, und Tonnar konnte sich kaum im Sattel halten.
Der Mann schimpfte erbost mit seinem Pferd, trat ihm heftiger als notwendig mit den Hacken in die Flanken und riss an den Zügeln, um es wieder in seine Gewalt zu bringen.
Kestus fügte seinem Mordansinnen ein Folteransinnen hinzu, denn das könnte sogar Spaß machen, wenn man es richtig anstellte.
»Und wir sind hier«, fauchte Tonnar und umfasste mit wildem Gefuchtle die stillen Bäume der Umgebung. »Andere Männer verdienen ein Vermögen und leben wie die Fürsten, und Julius führt uns ans Ende der Welt. Hier gibt es nichts zu sehen und nichts zu erbeuten. Keine Frauen.«
Ivarus, dessen Gesicht fast vollständig unter der Kapuze seines Mantels verborgen war, brach einen daumendicken Ast von einem Baum neben dem Weg ab. Dann ließ er sein Pferd schneller gehen und schloss zu Tonnar auf.
»Die würden für ein Stück Brot Schlange stehen«, beschwerte sich Tonnar, »aber nein …«
Ivarus hob ruhig den Ast und zerschmetterte ihn auf Tonnars Kopf. Ohne ein Wort kehrte er an seinen alten Platz in der Reihe zurück.
»Verfluchte Krähen!«, brüllte Tonnar und griff sich mit einer Hand an den Kopf. »Krähen und verfluchte Elementare, was soll das denn, Mann?«
Kestus gab sich keine Mühe, sein Grinsen zu verbergen. »Er hält dich eben für einen ausgewachsenen Schwachkopf. Ich übrigens auch.«
»Wieso?«, protestierte Tonnar. »Nur, weil ich ein bisschen Spaß mit dem einen oder anderen Mädchen haben möchte?«
»Weil du Menschen ausnutzen willst, die verzweifelt sind und den Tod vor Augen haben«, sagte Kestus. »Und weil du überhaupt nicht nachdenkst. Die Menschen verhungern. Krankheiten breiten sich aus. Und Soldaten werden bezahlt. Was denkst du, wie viele Legionares wurden schon allein wegen der Kleidung, die sie auf dem Leib tragen, oder wegen ihrer paar Münzen im Schlaf umgebracht? Wie viele sind krank geworden und verreckt, genau wie die Wehrhöfer? Und falls es deiner Aufmerksamkeit bisher entgangen ist, Tonnar, es gibt da auch noch die Gesetzlosen, die genügend Gründe haben, dich ins Jenseits zu befördern. Vermutlich wärst du viel zu sehr damit beschäftigt, dein Leben zu retten, als dass dir Zeit bliebe, Frauen zu demütigen.«
Tonnar setzte eine finstere Miene auf.
»Pass auf«, sagte Kestus. »Julius hat uns heil durch Kalares Rebellion gebracht. Aus unserer Truppe ist keiner ums Leben gekommen. Und hier draußen haben wir das Schlimmste hinter uns. Vielleicht werden wir nicht so gut bezahlt, und uns bieten sich auch nicht so gute … Möglichkeiten wie in der Nähe der Ödnis. Aber wir sterben nicht an irgendeiner Seuche, und es kommt niemand und schlitzt uns im Schlaf die Kehle auf.«
Tonnar höhnte: »Du hast nur Angst vor dem bisschen Risiko.«
»Genau«, stimmte Kestus zu. »Und Julius auch. Und deshalb leben wir noch.« Bisher.
Das Großmaul schüttelte den Kopf, drehte sich um und funkelte Ivarus trotzig an. »Wenn du mich noch einmal anrührst, weide ich dich aus wie einen Fisch.«
»Gut«, meinte Ivarus. »Versuch es doch. Nachdem wir deine Leiche versteckt haben, können Kestus und ich schneller reiten, weil wir dein Pferd als Reserve benutzen.« Der Mann mit der Kapuze schaute zu Kestus. »Wie lange dauert es noch bis zum Lager?«
»Zwei Stunden«, antwortete Kestus und blickte Tonnar an. »Ungefähr.«
Tonnar murmelte ein paar Worte vor sich hin und gab Ruhe. Den Rest des Ritts über herrschte wohltuendes Schweigen, wie es sich für ihren Beruf gehörte.
Kestus konnte den neuen Mann gut leiden.
Die Dämmerung senkte sich über das Land, als sie schließlich die Lichtung erreichten, die Julius als Lagerplatz ausgesucht hatte. Es war eine gute Stelle. Ein steiler Hügel bot die Gelegenheit, mit Hilfe von Erdkräften eine Schutzhöhle zu wirken. Ein kleiner Bach plätscherte vorbei. Die Pferde wieherten und liefen schneller, denn sie erkannten den Ort, wo sie ausruhen durften und ein bisschen Hafer zu fressen bekamen.
Kurz bevor sie den Gürtel aus dichtem Grün verließen, der die Lichtung umgab, hielt Kestus sein Pferd an.
Irgendetwas stimmte nicht.
Sein Herz klopfte, weil ihn ohne sichtlichen Grund Unruhe erfasste. Er blieb still im Sattel sitzen und versuchte, die Quelle seines Unbehagens zu entdecken.
»Verfluchte Krähen«, seufzte Tonnar. »Was ist denn jetzt …«
»Ruhig«, flüsterte Ivarus angespannt.
Kestus blickte sich zu dem drahtigen kleinen Mann um. Ivarus war ebenfalls nervös.
Aus dem Lager war kein Geräusch zu hören.
Der Trupp Aufseher, die das Gebiet durchstreiften, das früher dem Hohen Fürsten Kalarus Brencis gehört hatte, bestand aus einem Dutzend Männer, doch waren die meist in Gruppen zu dritt oder zu viert unterwegs. Daher war es denkbar, dass sich nur zwei der Aufseher im Lager aufhielten. Und diese beiden waren möglicherweise gerade zu einem kurzen Ausflug in die Umgebung aufgebrochen, um ein wenig Wild zu schießen.
Sehr wahrscheinlich war das jedoch nicht.
Ivarus lenkte sein Pferd neben Kestus und murmelte: »Das Feuer brennt nicht.«
Und genau das war der springende Punkt. In einem Lager wurde das Feuer ständig am Leben erhalten. Es bedeutete mehr Arbeit, wenn es ausging und man es ganz neu entfachen musste. Selbst wenn es zu Glut heruntergebrannt wäre, würde man noch den Rauch in der Nase haben. Aber Kestus konnte das Lagerfeuer nicht mehr riechen.
Der Wind drehte leicht, und Kestus’ Pferd zuckte zusammen und schnaubte. In ungefähr dreißig Schritt Entfernung bewegte sich etwas. Kestus verharrte still, denn er wusste, jede Bewegung würde die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Er hörte Schritte im trockenen Herbstlaub rascheln.
Julius tauchte vor ihnen auf. Der grauhaarige Waldaufseher trug wie immer seine lederne Waldkleidung in dunkelbraunen, grauen und grünen Tönen. Er blieb an der Feuerstelle stehen, starrte sie an und regte sich ansonsten nicht. Sein Mund stand leicht offen. Er wirkte blass und müde, und seine Augen waren trüb und leer.
Er stand einfach nur da.
So benahm sich Julius nie. Ständig gab es Arbeit zu erledigen, und er konnte es nicht leiden, Zeit zu verschwenden. Wann immer der Mann sich doch mal eine Pause gönnte, nutzte er die Gelegenheit und fiederte Pfeile für die Truppe.
Kestus wechselte einen Blick mit Ivarus. Obwohl der jüngere Mann Julius nicht so gut kannte wie Kestus, verriet seine Miene, dass er zum gleichen Schluss gelangt war – am besten, sie zogen sich still und leise zurück.
»Na, da ist ja unser alter Julius«, murmelte Tonnar. »Seid ihr jetzt zufrieden?« Er knurrte und brachte sein Pferd mit den Hacken in Bewegung. »Hat er doch tatsächlich das Feuer ausgehen lassen. Jetzt müssen wir ein neues anmachen, ehe wir essen können.«
»Nicht, du Narr!«, zischte Kestus.
Tonnar sah sie über die Schulter hinweg wütend an. »Ich bin hungrig«, sagte er nachdrücklich. »Kommt schon.«
Ein solches Wesen, wie es sich jetzt aus der Erde unter den Hufen von Tonnars Pferd erhob, hatte Kestus noch nie gesehen.
Es war riesig, so groß wie ein Wagen, und mit einem grün schillernden, glatten Panzer überzogen. Es hatte Beine, und zwar viele, fast wie ein Krebs, und große Zangen wie die Scheren eines Hummers. Die glitzernden Augen saßen in tiefen Löchern in dieser eigenartigen Hülle.
Und stark war es auch.
Es riss Tonnars Pferd ein Bein aus, ehe Kestus auch nur eine Warnung rufen konnte.
Das Tier ging schreiend zu Boden, und Blut spritzte in alle Richtungen. Kestus hörte, wie Tonnars Knochen brachen, als das Pferd auf ihm landete. Tonnar brüllte in höchster Pein und schrie weiter, als ihm das Ungeheuer, was immer es sein mochte, mit der anderen Klaue den Bauch durch das Kettenhemd aufriss, so dass die Eingeweide offen an der kalten Luft lagen.
Kestus schoss ein halb hysterischer Gedanke durch den benommenen Verstand: Dieser Kerl konnte nicht einmal schweigend sterben.
Die Bestie begann, das Pferd methodisch zu zerlegen, mit schnellen Bewegungen wie ein hart schuftender Schlachter.
Kestus’ Blick wurde von Julius angezogen. Sein Kommandant wandte ihnen langsam das Gesicht zu und öffnete den Mund weit.
Julius schrie. Doch dieser ohrenbetäubende Laut, der aus seiner Kehle gellte, hatte nichts Menschliches an sich. Er klang irgendwie metallisch und seltsam trällernd. Kestus wurde unheimlich zumute, und die Pferde tänzelten, warfen den Kopf zurück und verdrehten die Augen vor Angst.
Plötzlich wurde es still.
Doch im nächsten Augenblick begann es im Wald zu rascheln.
Ivarus zog die Kapuze zurück, damit er das Geräusch besser hören konnte. Es kam von allen Seiten, ein Knistern wie von gefallenem Laub, ein Schaben, als würden Tannennadeln über etwas streichen, ein Knacken von Zweigen, Kiefernzapfen und abgebrochenen Ästen. Kein einzelnes Geräusch war lauter als ein Murmeln. Dafür aber waren es tausende.
Der Wald klang, als würde ein gewaltiges Feuer darin lodern.
»Oh, bei den großen Elementaren«, keuchte Ivarus. »Oh, verfluchte Krähen.« Er warf Kestus mit aufgerissenen Augen einen Blick zu, riss sein Pferd herum und wurde vor Schrecken ganz blass. »Keine Zeit für Fragen!«, fauchte er. »Flieh! Flieh!«
Ivarus ließ seinen Worten sofort Taten folgen und gab seinem Tier die Hacken.
Kestus löste den Blick von diesem Ding mit den leeren Augen, das bisher sein Kommandant gewesen war, und jagte mit seinem Pferd Ivarus hinterher.
Währenddessen spürte er …
Dinge.
Dinge im Wald. Dinge, die sich bewegten und Schritt mit ihnen hielten, Schatten, die in der zunehmenden Dunkelheit nur halb zu erkennen waren. Keines dieser Wesen ähnelte einem Menschen. Keines sah aus wie irgendein Geschöpf, das Kestus kannte. Das Herz schlug ihm vor Angst bis zum Hals, und er schrie sein Pferd an und verlangte, dass es schneller rannte.
Es war Wahnsinn, so durch den Wald und durch fast vollständige Dunkelheit zu preschen. Ein Baumstamm, ein niedriger Ast, eine hervorstehende Wurzel oder irgendein anderes gewöhnliches Hindernis könnten ihn oder sein Pferd töten, wenn sie in der Nacht damit zusammenstießen.
Aber diese Dinge schlossen auf, hinter ihnen und neben ihnen, und Kestus begriff, was das bedeutete: Sie wurden gejagt und flohen wie Wild, während sie von einem Rudel verfolgt wurden, das zusammenarbeitete, um sie zur Strecke zu bringen. Die Angst vor diesen Jägern ließ seinen Verstand aussetzen. Er wünschte nur noch, sein Pferd könnte schneller laufen.
Ivarus galoppierte spritzend durch einen Bach, änderte urplötzlich die Richtung und hetzte sein Pferd durch ein Dornendickicht, und Kestus blieb dicht hinter ihm. Während sie durch die Büsche galoppierten und während die Dornen ihnen und den Tieren die Haut aufrissen, griff Ivarus in einen Beutel am Gürtel und holte eine kleine Kugel hervor, die aussah, als wäre sie aus schwarzem Glas gemacht. Er sagte etwas zu ihr, drehte sich im Sattel um und schrie: »Runter!«, ehe er sie genau auf Kestus’ Gesicht warf.
Kestus duckte sich. Die Kugel zischte knapp über seinen Scheitel hinweg in die Dunkelheit hinter ihnen.
Plötzlich blitzte es, und Flammen loderten auf. Kestus wagte einen Blick über die Schulter und sah, wie sich im Dickicht ein Feuer ausbreitete, das aufgrund seiner immensen Heftigkeit nur elementargewirkt sein konnte. Es wallte wie eine Woge in alle Richtungen und verbrannte das trockene Gestrüpp des Dickichts wie eine Feuersbrunst – und bewegte sich schnell. Schneller als die Pferde.
Sie stürmten nur einen Herzschlag vor den brüllenden Flammen aus dem Dickicht, doch nicht, bevor zwei dieser Wesen in Katzengröße brennend aus dem Feuer flogen wie vorbeizischende Kometen. Kestus erhaschte einen Blick auf ein spinnenartiges Geschöpf, das aber zu groß wirkte. Es landete, immer noch brennend, auf dem Hinterteil von Ivarus’ Pferd.
Das Pferd wieherte und geriet mit dem Huf an einen Baumstumpf oder in eine kleine Senke. Es stürzte Hals über Kopf und riss Ivarus mit sich.
Kestus war sicher, der Mann müsste so gut wie tot sein, genau wie Tonnar. Doch Ivarus sprang von dem fallenden Pferd, vollführte eine Rolle in der Luft und landete einige Schritte entfernt auf den Füßen. Ohne auch nur im Mindesten zu zögern, zog er den kurzen Gladius aus dem Gurt und spießte das Untier auf, das weiterhin an den Hinterbeinen seines Pferdes hing, dann zerhackte er das zweite brennende Spinnenwesen in der Luft, bevor es ihn anrühren konnte.
Ehe der Kadaver auf dem Boden gelandet war, hatte Ivarus bereits zwei weitere schwarze Kugeln in die Nacht geworfen, eine nach rechts hinten und eine nach links. Binnen Sekunden hatte sich eine Wand aus Flammen erhoben und vereinte sich mit dem Inferno des brennenden Dickichts.
Kestus konnte sein panisches Pferd nur mit Mühe zum Halt bringen, er zwang es zu wenden und ritt zu Ivarus zurück, wo das verwundete andere Tier im Todeskampf wieherte. Er streckte ihm die Hand entgegen: »Komm!«
Ivarus drehte sich um und beendete das Leid des Pferdes mit einem sauberen Stich. »Zu zweit in einem Sattel kommen wir nicht weit«, sagte er.
»Woher willst du das wissen?«
»Bei den Krähen, wir haben keine Zeit! Die umgehen das Feuer und sind binnen Sekunden hier. Verschwinde, Kestus! Du musst das melden!«
»Was melden?« Kestus brüllte fast. »Verfluchte Krähen und …«
Die Nacht wurde weiß, und heiß-roter Schmerz erfüllte Kestus’ Welt. Benommen spürte er, wie er vom Pferd fiel. Er konnte nicht atmen. Konnte nicht schreien. Es gab nur noch den Schmerz.
Immerhin schaffte er es, an sich herabzusehen.
In seiner Brust prangte ein schwarzes Loch. Es ging durch das Kettenhemd genau über dem Solar Plexus in der Mitte seines Körpers. Das Metall am Rand war zusammengeschmolzen. Feuerwirken. Er war von einem Feuerwirker getroffen worden.
Er konnte nicht atmen.
Er spürte seine Beine nicht.
Ivarus beugte sich über ihn und untersuchte die Wunde.
Sein nüchternes Gesicht wurde grimmig. »Kestus«, sagte er leise, »es tut mir sehr leid. Aber ich kann nichts für dich tun.«
Kestus musste sich anstrengen, um den Blick auf Ivarus zu richten. »Nimm das Pferd«, stieß er hervor. »Los.«
Der andere legte ihm die Hand auf die Schulter. »Tut mir leid«, wiederholte er.
Kestus nickte. Das Bild des Wesens, das Tonnar und sein Pferd zerstückelt hatte, erschien vor seinem inneren Auge. Er schauderte, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und sagte: »Ich will nicht von diesen Ungeheuern getötet werden.«
Ivarus presste die Lippen zusammen und nickte.
»Danke«, sagte Kestus und schloss die Augen.
Ritter Ehren ex Kursori ritt auf Kestus’ Pferd weiter, bis das arme Tier halb tot war, und er setzte jeden Kniff ein, den er gesehen, von dem er gehört oder über den er gelesen hatte, um die Ungeheuer abzuschütteln und seine Fährte zu verwischen.
Bei Sonnenaufgang fühlte er sich so erschöpft und müde wie sein Pferd – aber es gab keine Hinweise mehr auf Verfolger. Er hielt an einem Bach an, lehnte sich an einen Baum und schloss für einen Moment die Augen.
Der Kursor war nicht sicher, ob er Alera Imperia von solch einem kleinen Seitenfluss aus erreichen könnte, allerdings hatte er kaum eine andere Wahl. Der Erste Fürst musste gewarnt werden. Er zog die Kette um seinen Hals hervor und damit die Silbermünze, die daran hing. Das Geldstück warf er ins Wasser: »Hör mich, kleiner Fluss, und bringe rasch Nachricht zu deinem Herrn.«
Einige Augenblicke lang ereignete sich nichts. Ehren wollte schon aufgeben und weiterziehen, als sich das Wasser rührte, in die Höhe stieg und das Abbild von Gaius Sextus, dem Ersten Fürsten von Alera bildete.
Gaius war ein großer, stattlicher Mann, dem Anschein nach in den späten Vierzigern, wenn man das Silberhaar außer Acht ließ. In Wahrheit war der Erste Fürst bereits über achtzig, doch wie bei allen mächtigen Wasserwirkern verriet sein Körper viel weniger Anzeichen seines wahren Alters als bei anderen Aleranern. Zwar lagen seine Augen tief in den Höhlen und wirkten müde, dennoch funkelten Klugheit und unbezähmbare Willenskraft darin. Die Wasserskulptur wandte sich Ehren zu, runzelte die Stirn und sprach.
»Ritter Ehren?«, fragte Gaius. »Bist du das?« Seine Stimme klang eigenartig, als spreche er durch einen langen Tunnel.
»Ja, Majestät«, erwiderte Ehren und neigte den Kopf. »Ich habe dringende Neuigkeiten.«
Der Erste Fürst gab ihm einen Wink. »Berichte.«
»Majestät. Die Vord sind hier in der Wildnis südwestlich der Ödnis von Kalare aufgetaucht.«
Gaius’ Miene erstarrte, die Anspannung erfasste auch seine Schultern. Er beugte sich leicht vor und blickte Ehren aufmerksam an. »Bist du sicher?«
»Vollkommen. Und das ist noch nicht alles.«
Ehren holte tief Luft.
»Majestät«, sagte er leise, »sie haben Elementarwirken gelernt.«
1
Auf Tavis früheren Reisen übers Meer hatte es stets mehrere Tage gedauert, bis er sich von der Seekrankheit erholt hatte – aber diese Fahrten hatten ihn bislang nicht auf die Weiten des Ozeans geführt. Es gab, so hatte er festgestellt, einen riesigen Unterschied, ob man innerhalb eines Tages die Küste entlang segelte oder sich tatsächlich hinaus aufs tiefe Meer wagte. Er hätte nicht geglaubt, wie hoch sich die Wellen hier draußen in der unendlichen Weite auftürmten. Häufig erschien es ihm, als fahre die Schleiche einen großen blauen Berg hinauf, um ihn auf der anderen Seite, sobald der Kamm erreicht war, wieder hinunterzurutschen. Mit Hilfe des Windes und der Erfahrung von Demos’ Halunken-Mannschaft blieben die Segel immer voll, und schon bald hatte die Schleiche die Führung in der Flotte übernommen.
Auf Tavis Befehl hin überholte Demos jedoch nicht die Treues Blut, das Flaggschiff des Canim-Führers Varg. Demos’ Männer ärgerten sich über diese Anordnung, wie Tavi nicht entging. Obwohl die Treues Blut für ihre Größe ein unglaublich elegantes Schiff war, bewegte sie sich im Vergleich zur Schleiche wie ein Flusskahn voran. Demos’ Mannschaft hätte den Canim liebend gern gezeigt, was in ihrem Schiff steckte, und den riesigen schwarzen Segler das Heck von hinten sehen lassen.
Tavi war beinahe versucht, es zu erlauben. Er war überhaupt für alles, das diese Reise beschleunigen würde.
Die höheren Wellen hatten ihn noch empfindlicher werden lassen auf alle Bewegungen, und trotzdem hatte die Krankheit gnädigerweise nach den ersten fünf Tagen des Leidens nachgelassen. Allerdings hatte sie nicht vollständig aufgehört, und Essen blieb weiterhin ein heikles Unterfangen. Er konnte ein wenig Brot bei sich behalten, auch dünne Brühe, mehr jedoch nicht. Außerdem litt er unablässig unter Kopfschmerzen, die ihn jeden Tag reizbarer werden ließen.
»Kleiner Bruder«, knurrte der graue alte Cane, »ihr Aleraner habt ein kurzes Leben. Bist du schon so alt und schwach, dass du mitten im Unterricht ein Nickerchen machen musst?«
Aus der Hängematte, die zwischen den Balken in der kleinen Kabine hing, ließ Kitai ein silbrig tönendes Lachen erklingen.
Tavi riss sich aus seinem Tagtraum los und sah Gradash an. Der Cane besaß eine Eigenschaft, die Tavi von den Angehörigen der Kriegerkaste eigentlich nicht kannte: Er war alt. Wie Tavi wusste, lebte Gradash bereits über neun Jahrhunderte nach Zählweise der Aleraner, und mit dem Alter war der Cane auf die jämmerliche Größe von sieben und einem halben Fuß geschrumpft. Seine Kraft war nur noch ein schwacher Abglanz dessen, was er in seinen besten Kriegerjahren zu bieten gehabt hatte. Nach Tavis Einschätzung war er heute kaum drei- oder viermal stärker als ein Mensch. Sein Fell hatte sich fast vollständig silbrig gefärbt, und nur an einigen wenigen nachtschwarzen Stellen, an einem bestimmten Muster von Schnitten in den Ohren sowie an den Verzierungen an seinem Schwertgriff konnte man erkennen, dass er zu Vargs ausgedehnter Blutlinie gehörte.
»Ich bitte um Verzeihung, älterer Bruder«, erwiderte Tavi und sprach ebenso wie Gradash auf Canisch. »Meine Gedanken sind abgeschweift. Ich habe keine Entschuldigung vorzubringen.«
»Er ist so krank, er schafft es kaum aus der Koje«, sagte Kitai, deren Canisch deutlich besser klang als Tavis, »wenn das keine Entschuldigung ist.«
»Wenn man überleben will, kann man auf Krankheiten keine Rücksicht nehmen«, knurrte Gradash ernst. Dann fügte er in einem Aleranisch mit starkem Akzent hinzu: »Allerdings will ich zugeben, dass er sich nicht mehr schämen muss, wenn er unsere Zunge spricht. Es war ein guter Gedanke, die Sprache zu tauschen.«
Aus Gradashs Mund war diese Bemerkung ein großes Lob. »Jedenfalls ist es sinnvoll«, antwortete Tavi. »Zumindest für mein Volk. Legionares, die zwei Monate nichts zu tun haben, werden von Langeweile gepeinigt. Falls es je wieder zu Zwist zwischen unseren Völkern kommt, sollte es dafür schwerwiegende Gründe geben und nicht nur den, dass wir unsere Sprachen gegenseitig nicht verstehen.«
Gradash fletschte kurz die Zähne. Einige waren abgebrochen, die meisten jedoch weiß und scharf. »Alles Wissen über einen Feind ist wertvoll.«
Tavi erwiderte die Geste. »Das kommt noch dazu. Läuft es auf den anderen Schiffen gut mit dem Unterricht?«
»Ja«, antwortete Gradash. »Ohne ernsthafte Zwischenfälle.«
Tavi runzelte leicht die Stirn. Aleranische Maßstäbe unterschieden sich in dieser Hinsicht deutlich von denen der Canim. Für einen Cane bedeutete ohne ernsthafte Zwischenfälle letztlich nur, dass niemand zu Tode gekommen war. Es lohnte sich allerdings nicht, der Sache weiter nachzugehen. »Sehr schön.«
Der Cane nickte und erhob sich. »Dann würde ich mit deiner Zustimmung auf das Schiff meines Rudelmeisters zurückkehren.«
Tavi zog eine Augenbraue hoch. Das war ungewöhnlich. »Willst du nicht vorher mit uns zu Abend essen?«
Gradash zuckte zur Verneinung mit den Ohren und erinnerte sich eine Sekunde später daran, die Antwort mit dem aleranischen Gegenstück dieser Geste zu beantworten: Er schüttelte den Kopf. »Ich möchte zurückkehren, ehe der Sturm beginnt, kleiner Bruder.«
Tavi sah Kitai an. »Welcher Sturm?«
Kitai zuckte mit den Schultern. »Demos hat nichts erwähnt.«
Gradash knurrte: Das Lachen der Canim. »Ich weiß, wann es Sturm gibt. Das spüre ich im Schwanz.«
»Dann bis zum nächsten Unterricht«, sagte Tavi. Er neigte den Kopf nach Art der Canim ein wenig zur Seite, und Gradash antwortete entsprechend. Dann tappte der alte Cane hinaus. Er musste sich ducken, um durch die kleine Tür zu passen.
Tavi blickte Kitai an, doch die Marat schwang sich bereits aus der Hängematte. Sie strich ihm mit den Fingerspitzen durch das Haar, als sie an seiner Koje vorbeiging, lächelte ihn kurz an und verließ die Kabine ebenfalls. Einen Augenblick später kehrte sie mit Magnus zurück, dem obersten Burschen der Legion.
Magnus war für einen Mann seines Alters in hervorragender Verfassung, allerdings fand Tavi, dass er mit dem Kurzhaarschnitt der Legion seltsam aussah. Als die beiden die antiken Ruinen des romanischen Appia erkundet hatten, hatte er sich an Magnus’ weißen Haarschopf gewöhnt. Der alte Mann hatte sehnige, kräftige Hände, einen ansehnlichen Bauch und triefende Augen. Nach all den Jahren, in denen er verblasste Schriften bei schlechtem Licht entziffert hatte, litt er unter Kurzsichtigkeit. Außerdem war Magnus nicht nur ein Gelehrter mit beachtlichem Wissen, sondern auch Kursor Callidus, einer der ranghöchsten Spione der Krone, und in dieser Eigenschaft war er gewissermaßen Tavis Lehrmeister geworden.
»Kitai hat Demos berichtet, was Gradash gesagt hat«, begann Magnus ohne Vorrede. »Und der gute Kapitän wird das Wetter im Auge behalten.«
Tavi schüttelte den Kopf. »Das genügt nicht«, sagte er. »Kitai, bitte Demos, er möge Nachsicht mit mir haben. Er soll sich auf einen ausgewachsenen Sturm vorbereiten und den anderen Schiffen Signal geben, es ebenso zu tun. Wenn ich es recht verstanden habe, hatten wir bis jetzt für die späte Jahreszeit sehr mildes Wetter. Gradash ist nicht so alt geworden, weil er dumm ist. Im günstigsten Fall ist es einfach nur eine Übung.«
»Er wird das schon hinkriegen«, sagte Kitai voller Zuversicht.
»Sei bitte so höflich, ja?«, bat Tavi.
Kitai verdrehte die Augen und seufzte. »Ja, Aleraner.«
Magnus wartete, bis Kitai gegangen war, ehe er Tavi zunickte. »Danke.«
»In ihrer Gegenwart kannst du stets offen sprechen, Magnus.«
Tavis alter Lehrer blickte ihn angespannt an. »Hoheit, bitte. Die Botschafterin ist und bleibt schließlich trotz allem die Vertreterin eines fremden Volkes. Ich habe mir in meinem Beruf schon genug Nachlässigkeiten erlaubt.«
Um richtig zu lachen, war Tavi zu schlapp, trotzdem bekam er bessere Laune. »Bei den Krähen, Magnus. Du kannst dir doch nicht vorwerfen, nicht erkannt zu haben, dass ich Gaius Octavian bin. Niemand hat das erkannt. Selbst ich habe nicht begriffen, dass ich Gaius Octavian bin.« Tavi zuckte mit den Schultern. »Was im Übrigen auch der Sinn der Sache war, nehme ich an.«
Magnus seufzte. »Ja, gewiss. Aber unter uns gesagt, meiner Meinung nach ist das wirklich eine Verschwendung. Du wärest als Historiker ein wahrer Schrecken geworden. Diese Sturköpfe an der Akademie hätten sich generationenlang nicht von all dem erholt, was du in Appia aufgespürt hättest.«
»Ich brauche ja nur zu versuchen, die Kleinigkeiten beizusteuern, die ich schon vorzuweisen habe«, sagte Tavi und lächelte schwach. Dann verblasste das Lächeln. In einem Punkt hatte Magnus recht. Tavi würde niemals in dieses einfache Leben zurückkehren können, um unter Magnus’ Leitung Ausgrabungen vorzunehmen und die antiken Ruinen zu erkunden. Ein wenig bereute er das. »In Appia war es schön.«
»Mmm«, stimmte Magnus zu. »Friedlich. Immer interessant. Ich habe noch eine Truhe voller Abschriften, die ich übersetzen muss.«
»Ich würde dich ja bitten, mir ein paar davon zu bringen, aber …«
»Die Pflicht«, sagte Magnus und nickte. »Wo wir gerade von der Pflicht reden.«
Tavi setzte sich auf und ächzte vor Anstrengung, als Magnus ihm mehrere Blatt Papier reichte. Stirnrunzelnd betrachtete er sie. Es handelte sich um mehrere ihm unbekannte Karten. »Und was ist das?«
»Canea«, antwortete Magnus. »Dort, ganz rechts …« Der alte Kursor zeigte auf die rechte Seite der Karte. »Die Sonnenuntergangsinseln und Westmiston.«
Tavi blinzelte kurz auf die Karte und sah zwischen den Inseln und dem Festland hin und her. »Aber … ich dachte, man segelt ungefähr drei Wochen von den Inseln aus.«
»Ja«, sagte Magnus.
»Aber dann wäre diese Küste …« Tavi zog die Linie mit dem Finger nach. »Bei den Krähen. Wenn die Karte maßstabsgetreu ist, wäre die Küste drei- oder viermal so lang wie die Westküste von Alera.« Er blickte Magnus scharf an. »Wie bist du in den Besitz dieser Karten gekommen?«
Magnus hüstelte. »Einige unserer Sprachlehrer konnten sie abzeichnen, während sie auf den Canim-Schiffen waren.«
»Bei den Krähen, Magnus!«, fauchte Tavi und erhob sich. »Bei den Krähen und den verfluchten Elementaren, ich habe dir gesagt, wir würden auf dieser Reise keine derartigen Spielchen treiben!«
Magnus blinzelte mehrmals. »Und … hast du tatsächlich erwartet, ich würde mich daran halten, Hoheit?«
»Natürlich!«
Magnus zog die Augenbrauen hoch. »Hoheit, vielleicht sollte ich es erklären. Ich unterstehe der Krone. Und meinen Befehlen zufolge, die ich von der Krone erhalten habe, soll ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dich zu beschützen und jeden nur erdenklichen Vorteil nutzen, um für deine Sicherheit und den Erfolg dieser Unternehmung zu sorgen.« Ohne jede Spur von Bedauern fügte er hinzu: »Darunter fällt auch, falls ich nach bestem Wissen und Gewissen deine Befehle missachte, wenn diese mehr von gutem Willen als von nützlichen Erwägungen gelenkt werden.«
Tavi starrte ihn einen Moment lang an. Dann sagte er leise: »Magnus, im Augenblick bin ich nicht ganz auf der Höhe. Aber sicherlich wird Kitai, wenn ich sie bei ihrer Rückkehr freundlich darum bitte, dich für mich über Bord werfen.«
Magnus neigte unbeeindruckt den Kopf. »Die Entscheidung darüber steht natürlich dir zu, Hoheit. Allerdings würde ich dich bitten, dir zuerst die Karte anzuschauen.«
Tavi knurrte noch einmal und wandte sich wieder der Karte zu. Geschehen war geschehen. Da hatte es wenig Sinn so zu tun, als wäre nichts passiert. »Wie genau ist die Pause?«
Magnus reichte ihm einige weitere Blatt Papier, die so gut wie identisch mit dem ersten waren.
»Hm«, machte Tavi. »Und die sind maßstabsgerecht?«
»Das wissen wir nicht«, antwortete Magnus. »Es könnte durchaus sein, dass die Canim ihre Karten unterschiedlich verstehen und lesen.«
»So groß kann der Unterschied nicht sein«, erwiderte Tavi. »Ich habe die Karten gesehen, die sie vom Tal angefertigt haben.« Tavi strich mit dem Finger über eine der Karten, auf der verschieden große Dreiecke die Lage einer Reihe von Städten markierten. Unter der Hälfte davon standen Namen geschrieben. »Diese Städte … ich bin sicher, dass …« Er blickte Magnus scharf an. »Die Bevölkerung dieser Städte wird groß sein. Sie wird so groß sein wie die in den Städten der Hohen Fürsten von Alera.«
»Ja, Hoheit«, sagte Magnus ruhig.
»Und es gibt Dutzende«, fuhr Tavi fort. »Allein in diesem Gebiet an der Küste.«
»Wohl wahr, Hoheit.«
»Was bedeutet …« Tavi schüttelte langsam den Kopf. »Magnus. Das bedeutet, die Bevölkerung der Canim könnte ein Dutzend mal so groß sein wie unsere – vielleicht hundertmal so groß.«
»Ja, Hoheit«, meinte Magnus.
Tavi starrte auf die Karte und schüttelte erneut den Kopf. »Und wir haben nichts davon gewusst?«
»Die Canim haben ihre Küste über Jahrhunderte hinweg äußerst argwöhnisch bewacht«, erklärte Magnus. »Kaum ein Dutzend aleranischer Schiffe haben ihr Land je besucht – und diese durften nur in einem einzigen Hafen anlegen, einem Ort namens Marshag. Kein Aleraner durfte den Hafen verlassen; jedenfalls ist keiner, der es gewagt hat, je zurückgekehrt.«
Tavi runzelte die Stirn. »Wie sieht es mit Elementarwirken aus? Haben wir keine Ritter Aeris ausgeschickt, die das Land überfliegen können?«
»Die Reichweite jedes Fliegers ist begrenzt. Ein Ritter Aeris könnte vielleicht dreihundert Meilen hin- und wieder zurückfliegen, aber er dürfte nicht hoffen, dabei unbemerkt zu bleiben. Das haben wir später in der Nacht der Roten Sterne erfahren: Die Canim verfügen über Möglichkeiten, unsere Flieger auszuschalten.« Magnus zuckte mit den Schultern und lächelte schwach. »Außerdem wurde vermutet, dass unsere Fähigkeit zum Elementarwirken stark geschwächt sein würde, so weit entfernt von Alera und der Heimat unserer Elementare. Vielleicht können die Ritter Aeris dort überhaupt nicht fliegen.«
»Hat denn niemand je daran gedacht, das zu überprüfen?«, fragte Tavi.
»Auf den Schiffen waren vor allem Kuriere und Kaufleute unterwegs.« Magnus grinste kurz. »Kannst du dir einen Civis vorstellen, der freiwillig ins Reich der Canim reist, und zwar inmitten eines Haufens rüder Seeleute, um dann am Ende herauszufinden, dass er genauso schwach dasteht wie sie?«
Tavi schüttelte langsam den Kopf. »Nein, eigentlich nicht.« Er tippte mit dem Finger auf die Karten. »Könnte es eine List sein? Könnten uns diese Karten absichtlich zugespielt worden sein?«
»Möglich«, sagte Magnus. »Allerdings halte ich das nicht für besonders wahrscheinlich.«
Tavi schnaubte. »Nun«, sagte er. »Diese Karten sind für uns von großem Wert.«
»Das habe ich auch so gesehen«, befand Magnus.
Tavi seufzte. »Ich schätze, vorerst werde ich dich doch nicht über Bord werfen lassen.«
»Wie überaus großzügig, Hoheit«, erwiderte Magnus ernst.
Tavi zog den Finger über einige dicke Striche, von denen manche so gerade waren wie mit der Richtschnur gezogen. »Diese Linien, sind das Kanäle?«
»Nein, Hoheit«, antwortete Magnus. »Es sind die Grenzen zwischen den Staatsgebieten.«
Fragend blickte er Magnus an. »Ich verstehe nicht.«
»Offensichtlich gibt es bei den Canim keine einheitliche zentrale Regierung. Stattdessen handelt es sich um einzelne Staatsgebilde.«
Tavi runzelte die Stirn. »Wie bei den Marat-Stämmen?«
»Anders. Jedes Staatsgebiet für sich ist vollkommen unabhängig. Es gibt keine übergeordnete Einheit, keinen Herrscher über alles. Alle Länder regieren sich selbst.«
»Das ist …« Tavi blinzelte. »Ich wollte gerade sagen ›verrückt‹.«
»Hm«, machte Magnus. »Carna ist eine wilde Welt, in der sich viel zu viele verschiedene Völker drängen, von denen die meisten mit den anderen in ständigem Streit liegen. Uns Aleranern hat das gemeinsame Vorgehen gegen unsere Feinde das Überleben und den Wohlstand gesichert.«
Tavi deutete auf die Karte. »Wohingegen die Canim so zahlreich sind, dass sie es sich leisten können, uneinig zu sein.«
Magnus nickte. »Wenn man es recht bedenkt, muss man doch froh sein, dass unser neuer Princeps für die Probleme im Tal eine so ehrenhafte und friedliche Lösung gefunden hat.«
»Es kann nicht schaden, gleich zu Beginn einen guten Eindruck zu hinterlassen«, stimmte Tavi zu. »Kannst du dir vorstellen, Magnus, was passiert wäre, wenn diese heißspornigen Schwachköpfe aus dem Senat ihren Willen bekommen und einen Vergeltungsfeldzug gegen die Heimat der Canim geführt hätten?«
Schweigend schüttelte Magnus den Kopf.
»Angesichts solcher Bevölkerungszahlen hätten sie uns ausgelöscht. Elementare hin und her, sie hätten uns nach Belieben vernichten können.«
»Das scheint mir auch so«, sagte Magnus mit grimmiger Miene.
Tavi blickte zu ihm hoch. »Warum haben sie es nicht getan?«
Der alte Kursor zuckte mit den Schultern. »Ich habe keine Ahnung.«
Erneut vertiefte sich Tavi in die Karte und betrachtete die verschiedenen Gebiete. »Wenn ich es recht verstehe, ist Varg dann auch nur Angehöriger eines dieser Gebiete?«
»Ja«, antwortete Magnus. »Narash. Das einzige Gebiet, das überhaupt bisher Kontakt mit Alera hatte.«