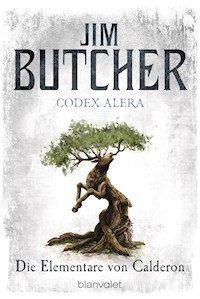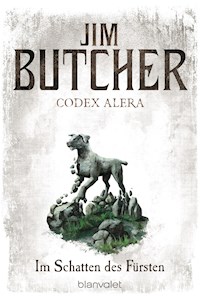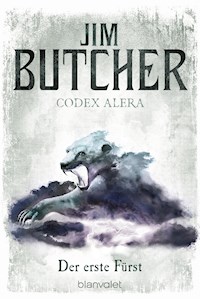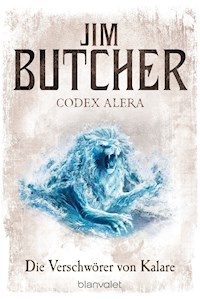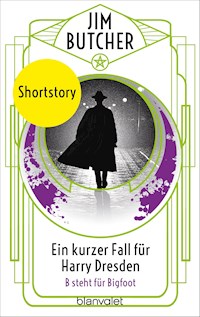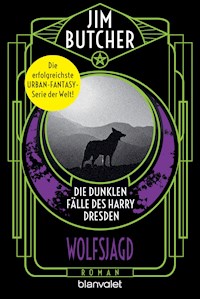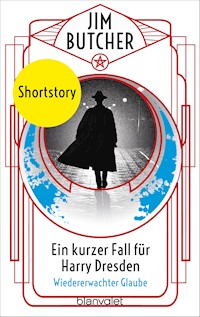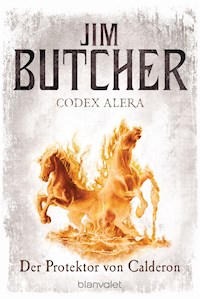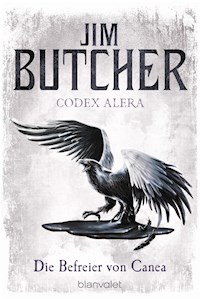9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Harry-Dresden-Serie
- Sprache: Deutsch
Einen verurteilten Verräter zu schützen ist seine einzige Chance, für Gerechtigkeit zu sorgen. Der elfte dunkle Fall des Harry Dresden.
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden, und heute bin ich ein Hüter des Weißen Rats der Magier. Doch früher hat mir dieser Rat immer misstraut, und einige seiner Mitglieder tun es noch heute. Besonders Hüter Donald Morgan hat mich schikaniert und stets einen Vorwand gesucht, um mich als Schwarzmagier hinzurichten. Es zeigt, wie verrückt dieser Fall war, dass Morgan des Hochverrats angeklagt wurde – und dass er ausgerechnet mich um Hilfe bat …
Die dunklen Fälle des Harry Dresden: spannend, überraschend, mitreißend. Lassen Sie sich kein Abenteuer des besten Magiers von Chicago entgehen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden, und heute bin ich ein Hüter des Weißen Rats der Magier. Doch früher hat mir dieser Rat immer misstraut, und einige seiner Mitglieder tun es noch heute. Besonders Hüter Donald Morgan hat mich schikaniert und stets einen Vorwand gesucht, um mich als Schwarzmagier hinzurichten. Es zeigt, wie verrückt dieser Fall war, dass Morgan des Hochverrats angeklagt wurde – und dass er ausgerechnet mich um Hilfe bat …
Autor
Jim Butcher ist der Autor der Dresden Files, des Codex Alera und der Cinder-Spires-Serie. Sein Lebenslauf enthält eine lange Liste von Fähigkeiten, die vor ein paar Jahrhunderten nützlich waren – wie zum Beispiel Kampfsport –, und er spielt ziemlich schlecht Gitarre. Als begeisterter Gamer beschäftigt er sich mit Tabletop-Spielen in verschiedenen Systemen, einer Vielzahl von Videospielen auf PC und Konsole und LARPs, wann immer er Zeit dafür findet. Zurzeit lebt Jim in den Bergen außerhalb von Denver, Colorado.
Jim Butcher
VERRAT
DIE DUNKLEN FÄLLE DES HARRY DRESDEN
Roman
Deutsch von Dorothee Danzmann
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Turn Coat (The Dresden Files 11)« bei Penguin RoC, New YorkDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2009 by Jim Butcher
Published by Arrangement with IMAGINARY EMPIRE LLC
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung- und motiv: www.buerosued.de
Illustrationen: © www.buerosued.de
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30443-0V001
www.blanvalet.de
Für Bob. Schlaf gut.
1. Kapitel
Draußen brannte die Sommersonne emsig den Asphalt von Chicagos Straßen. Mich ließen brutale Kopfschmerzen schon den halben Tag lang in der Horizontale dahinvegetieren, und dann hämmerte auch noch irgendein Idiot mit voller Wucht an meine Wohnungstür.
Ich ging aufmachen. Vor mir stand Morgan, die eine Gesichtshälfte blutüberströmt. »Die Hüter sind hinter mir her«, keuchte er. »Verstecken Sie mich. Bitte.«
Sprach’s, verdrehte die Augen, bis sie im Schädel zu verschwinden drohten, und brach zusammen.
Oha.
Na wunderbar!
Eigentlich hatte ich gedacht, Schlimmeres als die Schmerzen in meinem Kopf könnte mir an diesem Tag nicht widerfahren.
»Von allen verdammten …« Hilflos starrte ich Morgans reglose Gestalt an. »Das kann doch wohl nicht wahr sein!« Ich war echt, echt schwer versucht, die Tür zuzuschlagen und das Häufchen Elend davor liegen zu lassen. Verdient hätte der Typ das allemal.
Einfach nur dastehen und gar nichts tun ging natürlich auch nicht.
»Harry, du bist nicht ganz dicht im Kopf!«, knurrte ich vor mich hin, während ich meine Schutzzauber – das magische Sicherungssystem, mit dem ich meine Wohnung ausgestattet habe – deaktivierte, Morgan unter den Achseln packte und in meine Bude zerrte. Der Mann war groß, gut ein Meter neunzig, und reichlich mit Muskeln bepackt, die gerade sämtlich den Dienst quittiert hatten. Obwohl ich selbst kein zartes Püppchen bin, hatte ich Mühe, die schlaffe Gestalt über meine Schwelle zu bugsieren.
Sobald das geschafft war, knallte ich die Tür hinter ihm zu und richtete die Schutzzauber wieder ein. Ein Dutzend im Zimmer verteilter Kerzen erwachte flackernd zum Leben, nachdem ich mit der Hand vage auf meine Wohnung gedeutet, meinen Willen gebündelt und »Flickum bicus« gemurmelt hatte. Dann kniete ich mich neben den bewusstlosen Morgan, um mir seine Verletzungen anzusehen.
Die bestanden hauptsächlich in einem guten Dutzend übler Schnittwunden, aus denen Blut sickerte, und waren hässlich, wohl auch recht schmerzhaft, aber nicht lebensbedrohlich. Unter dem linken Arm zierte ein großes Brandloch das weiße Hemd, und darunter hatte die Haut über den Rippen Blasen geworfen und sah versengt aus. Und oben am Bein hatte jemand mit etwas, das wie ein Küchenhandtuch aussah, ungeschickt eine sehr tiefe Wunde bandagiert, an die ich mich nicht näher herantraute. Ich mochte noch nicht einmal den Verband abnehmen, musste ich doch befürchten, dass die Wunde gleich wieder zu bluten anfing. Meine Medizinkenntnisse sind nicht gerade so fundiert, dass ich ihnen das Leben eines Menschen anvertrauen möchte.
Selbst Morgans Leben nicht.
Hier war ein Arzt gefragt.
Aber wenn die Hüter des Weißen Rates tatsächlich hinter Morgan her waren, dann wussten sie höchstwahrscheinlich auch von seinen Verletzungen und hatten besonders Krankenhäuser unter Beobachtung. Von einem Besuch in einer der Notaufnahmen unserer Gegend bekam der Rat innerhalb weniger Stunden Wind.
Also rief ich einen Freund an.
Waldo Butters besah sich Morgans Wunden eine Zeit lang schweigend, während ich ihm nervös über die Schulter blickte. Waldo ist ein zierliches, drahtiges kleines Männchen, die schwarzen Haare standen ihm wie immer wirr vom Kopf ab wie das Fell eines verschreckten Kätzchens. Er trug grüne OP-Kleidung und Turnschuhe, und seine Hände arbeiteten flink und geschickt. Hinter der runden Brille mit schwarzem Stahlrand blitzten dunkle, sehr intelligente Augen. Insgesamt allerdings wirkte der Mann, als hätte er seit mindestens zwei Wochen nicht mehr geschlafen.
»Ich bin kein Arzt«, sagte Butters schließlich.
Diese Arie sangen wir nicht zum ersten Mal. »Du bist der mächtige Butters«, sagte ich, »für den nichts unmöglich ist.«
»Ich bin Gerichtsmediziner. Ich schneide Leichen auf.«
»Nenn es eine Präventivautopsie, wenn dir dann wohler ist.«
Butters warf mir einen schwer zu deutenden Blick zu. »Kannst ihn nicht ins Krankenhaus schaffen, was?«
»Du hast es kapiert, Mann.«
Er schüttelte nachdenklich den Kopf. »Ist das nicht der Typ, der mal an Halloween versucht hat, dich umzubringen?«
»Nicht nur damals an Halloween. Auch davor schon mehr als ein Mal.«
Butters klappte sein Arztköfferchen auf und fahndete nach irgendetwas. »Wobei ich nie ganz verstanden habe, warum.«
Ich zuckte die Achseln. »Als ich noch jung war, hab ich jemanden umgebracht. Mit Magie. Ich wurde von den Hütern geschnappt, und es kam zu einem Prozess vor dem Weißen Rat.«
»Bei dem du ja offenbar freigesprochen wurdest.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Aber sie waren der Meinung, ich hätte noch eine zweite Chance verdient. Der Mann, den ich umgebracht habe, wollte nämlich eigentlich mich mit Magie umbringen, und ich habe mich nur verteidigt, um mein Leben zu retten. Die Strafe wurde sozusagen zur Bewährung ausgesetzt. Morgan war mein Bewährungshelfer.«
»Bewährung?«, fragte Butters verwundert.
»Beim nächsten Regelverstoß sollte er mir den Kopf abschlagen. Das hätte er auch zu gern getan, weswegen er praktisch ständig hinter mir herschlich, um einen guten Grund dafür zu finden.«
Butters warf mir einen fragenden Blick zu.
»Der Typ hat mir in den ersten Jahren meines Lebens als Erwachsener ziemliche Kopfschmerzen bereitet. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste mich stets umschauen, nachsehen, ob er gerade da ist. Er hat mich verfolgt und belästigt. Eine Weile hatte ich schlimme Albträume, in denen er die Hauptrolle spielte.« Wenn man es genau nahm, plagten mich diese Albträume immer noch, in denen ich von einem erbarmungslosen Killer im grauen Umhang und mit einem fiesen Schwert in der Hand verfolgt wurde.
Butters schickte sich an, die Beinwunde von ihrem durchnässten Verband zu befreien. »Und jetzt hilfst du ihm?«
Ich zuckte erneut mit den Schultern. »Er hielt mich für ein gefährliches Tier, das eingeschläfert gehört. Das war seine ehrliche Meinung, und er hat sich einfach entsprechend verhalten.«
Butters bedachte mich mit einem raschen Seitenblick. »Und jetzt hilfst du ihm?«
»Er hatte unrecht, was mich betrifft«, erklärte ich. »Ein Bösewicht ist er deswegen nicht. Ein Arschloch schon, aber kein Bösewicht. Und nur weil jemand ein Arschloch ist, bringt man ihn nicht gleich um.«
»Ihr habt euch versöhnt, was?«
»So kann man das nun auch wieder nicht sehen.«
Butters lüpfte die Brauen. »Und was ist mit ihm? Warum wendet er sich ausgerechnet an dich, wenn er Hilfe braucht?«
»Da müsste ich jetzt raten. Ich würde drauf tippen, dass er hier ist, weil meine Wohnung der letzte Ort sein dürfte, wo man ihn vermutet.«
»Himmel, hilf!«, murmelte Butters, der inzwischen den improvisierten Verband gelöst hatte und nun eine Wunde von vielleicht sechs Zentimetern Länge vor sich sah, nicht groß also, dafür aber tief. Die Wundränder kräuselten sich wie die Lippen eines kleinen Mundes, und zwischen ihnen sickerte sofort wieder Blut hervor. »Wie eine Messerwunde, nur größer!«
»Stammt wahrscheinlich auch von so was wie einem Messer«, sagte ich, »nur größer.«
»Ein Schwert?«, fragte Butters. »Das kann nicht dein Ernst sein.«
»Die vom Rat sind noch von der alten Garde und altmodisch«, erklärte ich. »Und damit meine ich echt altmodisch.«
Butters schüttelte den Kopf. »Du hast ja gesehen, wie ich mir eben die Hände gewaschen habe. Wasch sie dir genauso gründlich. Zwei bis drei Minuten sollte das schon dauern. Dann zieh dir OP-Handschuhe an und komm wieder her. Ich brauche Hilfe.«
»Mensch, Butters …« Ich musste schlucken. »Ob ich da der Richtige …«
»Leck mich am Arsch, Zauberlehrling!« Butters klang angesäuert. »Komm mir hier nicht mit faulen Ausreden. Wenn es okay ist, dass ich kein Arzt bin, ist es auch okay, dass du keine OP-Schwester bist. Wasch deine verdammten Hände und hilf mir, ehe uns der Typ hier wegstirbt.«
Hilflos starrte ich meinen Freund eine Sekunde lang an, dann ging ich mir die verdammten Hände waschen.
Eins kann ich Ihnen verraten: Hübsch ist so eine OP nicht. Irgendwie schwebt da ständig ein ganz lächerliches Gefühl in der Luft, als würde einem Intimeres von einem anderen Menschen präsentiert, als eigentlich schicklich sein kann. Was sich ungefähr so anfühlt, als würde man unverhofft und unbeabsichtigt Vater oder Mutter im Adamskostüm antreffen. Nur ist bei einer OP mehr Blut im Spiel. Bestandteile des Körpers liegen frei, die deutlich nicht ins Freie gehören, und diese Körperteile sind voller Blut. Das Ganze ist vage peinlich, ekelerregend und gleichzeitig ganz schön aufwühlend.
»Das hätten wir«, verkündete Butters eine halbe Ewigkeit später. »Du kannst loslassen. Nimm deine Hände da weg! Die sind mir im Weg!«
»War die Arterie verletzt?«, wollte ich wissen.
»Grundgütiger, nein! Wer immer da zugestochen hat, die Arterie hat er kaum angekratzt. Sonst wäre der Mann nicht mehr am Leben.«
»Aber jetzt ist alles geregelt, oder?«
»Kommt drauf an, wie du ›geregelt‹ definierst. Das hier eben war eine Küchentisch-OP der denkbar primitivsten Sorte, aber die Wunde dürfte geschlossen bleiben, wenn unser Mann damit nicht groß rumläuft. Dennoch sollte er sich so schnell wie möglich von einem richtigen Arzt untersuchen lassen.« Butters runzelte konzentriert die Stirn. »Ich brauche noch eine Minute, ja? Dann ist alles dicht.«
»Lass dir Zeit, lass dir Zeit! Ich hab’s nicht eilig.«
Schweigend nähte Butters den Schnitt zu und deckte die Wunde mit Verbandsmull ab, ehe er sich den kleineren Verletzungen zuwandte. Bei den meisten reichte ein Verband, eine besonders hässliche musste er mit ein paar Stichen nähen. Die Brandwunde versorgte er mit einem örtlich wirkenden Antibiotikum und schützte sie vorsichtig mit einer Lage aus feiner Verbandsgaze.
»Okay!«, sagte er endlich. »Es ist alles, so gut es ging, steril, aber wenn trotzdem eine Infektion auftritt, würde mich das nicht groß wundern. Wenn er fiebert oder sich eine sehr starke Schwellung bildet, hast du die Wahl – entweder du schaffst ihn in ein Krankenhaus oder ins Leichenschauhaus.«
»Verstanden«, sagte ich leise.
»Jetzt gehört er aber erst einmal ins Bett. Er muss es warm haben.«
»Okay.«
Wir hoben Morgan gleich mit dem ganzen Teppich hoch, auf dem er lag, und schafften ihn in das einzige Bett in der Wohnung, das schmale Einzelbett in meinem Schlafzimmer. Dort hinein passt kein größeres Bett, das Zimmer selbst ist ja kaum geräumiger als ein Kleiderschrank. Wir deckten Morgan zu.
»Eigentlich gehört er an einen Tropf mit einer Kochsalzlösung«, meinte Butters. »Eine Einheit Blut könnte auch nicht schaden, wenn wir schon mal beim Thema sind. Und Antibiotika braucht er auf jeden Fall, aber ich kann keine Rezepte ausstellen.«
»Das regele ich schon«, sagte ich.
Butters verzog das Gesicht. Er schien ein paar Mal etwas sagen zu wollen, überlegte es sich aber immer anders.
»Harry?«, fragte er schließlich doch noch. »Du bist ja selbst im Weißen Rat, oder?«
»Bin ich.«
»Und Hüter bist du auch, habe ich das richtig verstanden?«
»In der Tat.«
Butters schüttelte den Kopf. »Dann sind also deine eigenen Leute hinter dem Typen her? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Freudensprünge machen, wenn sie ihn hier bei dir vorfinden.«
»Ach, über irgendwas regen die sich immer auf.«
»Ich meine das ernst, Harry. Du kannst dir hier eine Menge Ärger einhandeln. Warum willst du ihm helfen?«
Einen Moment lang starrte ich schweigend auf Morgans blasses, erschlafftes Gesicht.
»Weil Morgan nie gegen die Gesetze der Magie verstoßen würde«, sagte ich schließlich leise. »Einfach nie. Auch dann nicht, wenn es ihn das Leben kosten würde.«
»Da scheinst du dir ganz sicher zu sein.«
»Da bin ich mir absolut sicher. Und ich helfe ihm, weil ich weiß, wie es ist, wenn die Hüter hinter einem her sind wegen einer Sache, die man gar nicht gemacht hat.« Ich wandte mich von dem ohnmächtigen Mann in meinem Bett ab. »Das weiß ich wohl besser als jeder andere. Jeder andere Lebende.«
Butters schüttelte den Kopf. »Irgendwie bist du ganz schön verrückt.«
»Vielen Dank für die Blumen!«
Butters machte sich daran, sämtliche Gerätschaften zu säubern, die er während der improvisierten OP aus seinem Köfferchen geholt hatte. »Und wie steht es mit deinen Kopfschmerzen?«
Ich litt seit ein paar Monaten unter ständig heftiger werdenden Migräneanfällen. »Prima.«
»Was du nicht sagst«, meinte Butters trocken. »Mir wäre es wirklich lieb, wenn du es doch noch einmal mit einem MRT versuchen würdest.«
Magier und Technologie – das ist eine heikle Sache. Von friedlicher Koexistenz kann da kaum die Rede sein, und so ein MRT gehört nun mal leider in den Bereich Technologie. »Eine Taufe mit Feuerlöschschaum pro Jahr reicht mir völlig«, wehrte ich ab.
»Es könnte was Ernsthaftes sein«, warnte Butters. »Kopf und Nacken – damit spaßt man nicht.«
»Die Schmerzen sind ja auch schon weniger geworden«, log ich tapfer.
»Erzähl mir keinen Schwachsinn.« Butters warf mir einen Blick zu, der es mit einem Schlagbohrer hätte aufnehmen können. »Du hast doch gerade wieder welche, oder?«
Ich sah wieder zu Morgan hinüber, der friedlich in meinem Bett ruhte. »Momentan«, gestand ich seufzend ein, »habe ich höllische Kopfschmerzen.«
2. Kapitel
Morgan schlief.
Meinen ersten Eindruck von diesem Mann werde ich wohl nie vergessen: groß, muskelbepackt, das Gesicht schmal und eingefallen. Ein Gesicht, das einen unwillkürlich an einen religiösen Asketen oder leicht durchgeknallten Künstler denken ließ. Das braune Haar zeigte schon eisgraue Strähnen, der Bart, obschon stets sauber gestutzt, sah immer so aus, als brauche er noch ein paar Wochen, um ganz dicht zu werden. Zu Morgans hervorstechenden Eigenschaften gehörten der harte, unverrückbare Blick und ein Wesen, das große Ähnlichkeit mit dem tröstlichen, beruhigenden Charme eines Zahnarztbohrers aufwies.
So schlafend aber wirkte er … alt und müde. Tiefe Sorgenfalten hatten sich zwischen Brauen und an den Mundwinkeln eingegraben. Den Händen – es waren große Hände – sah man das Alter am ehesten an. Morgan hatte mehr als ein Jahrhundert auf dem Buckel, konnte also nach Magierbegriffen so langsam als richtig erwachsen gelten. Über seine beiden Hände zogen sich Narben, Graffiti der Gewalt. Ringfinger und kleiner Finger der rechten Hand lagen steif und etwas verkrümmt auf der Bettdecke, als hätte er sie sich irgendwann einmal heftig gebrochen und sie heilen lassen, ohne dass sie gerichtet worden wären. Die Augen lagen tief eingesunken in ihren Höhlen, die Haut darunter war so dunkel, dass es fast schon nach blauen Flecken aussah. Vielleicht litt ja auch Morgan unter Albträumen.
Wie er da so lag, fiel es mir schwerer, mich vor ihm zu fürchten.
In der Küchennische erhob sich mein großer grauer Hund Mouse von seinem angestammten Schlafplatz, um zu mir herüberzuschlendern. Neunzig Kilo schweigender, kameradschaftlicher Gesellschaft. Mit ernster Miene musterte er Morgan auf dem Bett, ehe er zu mir hochsah.
»Tu mir einen Gefallen, ja?«, bat ich. »Bleib bei ihm und sorg dafür, dass er mit dem kaputten Bein nicht rumläuft. Das könnte ihn nämlich umbringen.«
Mouse rammte mir den riesigen Schädel gegen die Hüfte, gab ein leises Schnaufen von sich und tappte zum Bett hinüber, wo er sich fallen ließ, lang ausstreckte und sofort wieder einschlief.
Leise zog ich die Schafzimmertür hinter mir zu, ohne sie ganz zu schließen, dann ließ ich mich in den Sessel neben dem Kamin fallen, massierte mir die Schläfen und versuchte, Ordnung in meine Gedanken zu bringen.
Beim Weißen Rat der Magier handelt es sich um das Gremium, das den Gebrauch von Magie in der Welt überwachte, und er setzt sich aus den mächtigsten Zauberkundigen aus aller Herren Länder zusammen. Die Mitgliedschaft im Weißen Rat lässt sich mit dem Erwerb des schwarzen Gürtels in einer der asiatischen Kampfkünste vergleichen – der Beweis dafür, dass man sich selbst gut im Griff hat und über Fertigkeiten verfügt, die von Gleichrangigen anerkannt werden. Auf der Grundlage der Sieben Gesetze der Magie wacht der Rat über den Umgang seiner Mitglieder mit ihren magischen Talenten.
Gnade Gott dem armen Zauberkundigen, der gegen eins dieser sieben Gesetze verstößt, denn dem schickt der Rat die Hüter auf den Hals, die für die Durchsetzung von Recht und Gesetz sorgen. In der Regel bedeutet das rücksichtslose Verfolgung, ein rasches Verfahren und umgehenden Strafvollzug – falls der Missetäter nicht schon vorher umgekommen ist, weil er sich seiner Verhaftung widersetzt hat.
Das hört sich jetzt hart an, und genauso ist es auch. Nur habe ich im Laufe der Jahre begreifen müssen, dass ein solches Vorgehen durchaus seine Berechtigung haben kann. Wer sich Schwarzer Magier bedient, vergiftet damit den eigenen Geist, die eigene Seele, das eigene Herz. Das geschieht nicht sofort und nie auf einen Schlag, sondern ganz langsam, wie ein Tumor, der sich Zeit lässt beim Wachsen, der einen nach und nach von innen her auffrisst, bis die Gier nach Macht letztendlich jegliches Einfühlungsvermögen, jegliches Mitleid, das man anfangs vielleicht noch besessen haben mag, verzehrt. Bis ein Magier ganz dieser Versuchung erliegt und zum Hexer wird, sind Menschen ums Leben gekommen, oder es ist ihnen noch Schlimmeres widerfahren. Mit Hexern müssen die Hüter einfach kurzen Prozess machen und bei ihrer Arbeit alle erforderlichen Mittel einsetzen, das ist ihre Pflicht.
Aber die Verfolgung von Straffälligen ist nicht die einzige Aufgabe der Hüter, sie fungieren zudem noch als Soldaten und Verteidiger des Weißen Rates. In den jüngsten kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Vampiren hatten die Hüter, diese Männer und Frauen mit einem Talent für schnelle, gewalttätige Magier, die Hauptlast getragen. Und in vielen, vielen Schlachten dieser Zeit hatte Morgan im Zentrum der Kämpfe agiert.
Auch ich hatte im Krieg mein Scherflein beigetragen, aber nur die Neuzugänge unter meinen Hüterkollegen mögen mit mir zusammenarbeiten. Die anderen haben allzu oft miterleben müssen, wie der Missbrauch von Magie Leben zerstört, und diese Erfahrungen haben bei ihnen tiefe Narben hinterlassen. Sie alle, mit nur einer Ausnahme, können mich nicht leiden, vertrauen mir nicht und wollen nichts mit mir zu tun haben.
Was mir normalerweise hervorragend in den Kram passt.
Nun hatte der Rat im Verlauf der letzten Jahre zu der Erkenntnis gelangen müssen, dass die Vampire von jemandem aus unseren eigenen Reihen mit Insiderinformationen versorgt wurden. Dieser Verräter hatte inzwischen eine Menge Leute auf dem Gewissen, aber bis jetzt war es noch nicht gelungen, ihn oder sie zu identifizieren. Die daraus resultierende allgemeine Paranoia und dass der Rat im Allgemeinen und die Hüter im Besonderen mich, wie eben beschrieben, herzlich wenig lieben, gestalteten mein Leben seit einiger Zeit höchst abwechslungsreich. Noch abwechslungsreicher war es geworden, seit man mich im Zuge der Kriegsanstrengungen selbst als Hüter dienstverpflichtet hatte.
Die Frage war nun also: Was tat Morgan hier bei mir? Warum bat er ausgerechnet mich um Hilfe?
Sie dürfen mich ruhig für verrückt halten, aber ich bin in vielem zutiefst misstrauisch, und von daher schoss mir als Erstes der Gedanke durch den Kopf, dass Morgan hier war, um mich zu irgendetwas Verrücktem zu verleiten, was mich beim Rat dann endgültig in Verruf bringen würde. So abwegig war dieser Gedanke nicht: Morgan hatte vor ein paar Jahren schon einmal versucht, mich auf so eine miese Tour zu diskreditieren. Aber letztendlich entbehrte er in diesem Fall dann doch jeglicher Logik, denn wenn Morgan eigentlich gar keine Probleme mit dem Rat und den Hütern hatte, durfte ich ihn auch getrost vor nichtexistenten Verfolgern schützen, ohne mich dadurch in die Scheiße zu reiten. Und dann waren da seine Verletzungen, die eine deutlichere Sprache sprachen. Sie waren nicht vorgetäuscht. Und das hieß, Morgan war wirklich auf der Flucht.
Ehe ich nicht mehr darüber herausgefunden hatte, was hier eigentlich gespielt wurde, durfte ich niemanden um Hilfe bitten. Bei meinen Hüterkollegen nachhaken und mich beiläufig nach Morgan erkundigen ging schlecht. Dann wäre sofort aufgefallen, dass ich ihn gesehen hatte, was umgehend heftiges und potenziell schmerzhaftes Interesse geweckt hätte. Und wenn der Rat wirklich hinter meinem alten Kontrahenten her war, wurde jeder, der ihm half, automatisch zum Komplizen und machte sich damit selbst des Verbrechens schuldig, dessen man Morgan bezichtigte. Also konnte ich erst einmal niemanden bitten, mir zu helfen.
Besser gesagt: Ich durfte nicht noch jemanden um Hilfe bitten. Das mit Butters hatte sich nicht verhindern lassen, in der Frage war mir keine Wahl geblieben, und da Butters so gar nichts mit irgendwelchen übernatürlichen Umtrieben zu tun hatte, würde man ihm aus einer Komplizenschaft mit mir nicht gleich einen Strick drehen können. Außerdem hatte der Mann beim Rat einen Stein im Brett, nachdem er mir eines Nachts geholfen hatte zu verhindern, dass ein familiengroßer Nekromanten-Mönchsorden einen der Ihren in eine niedere Gottheit verwandelt hatte. Er hatte in diesem Zusammenhang einem Hüter das Leben gerettet – zweien, wenn man mich mitzählte – und konnte somit als weitaus weniger gefährdet gelten als jeder andere, der Verbindung zu übernatürlichen Kreisen unterhielt.
Wie ich zum Beispiel.
Mann, mein Kopf! Irgendwann würde mich die Migräne noch umbringen.
Intelligentes Vorgehen war erst möglich, wenn ich mehr wusste. Fragen durfte ich keine stellen, das hätte unliebsame Aufmerksamkeit erregt. Wenn ich mich jetzt kopfüber in hektische Ermittlungen stürzte, wäre das ein kapitaler Fehler. Fazit: Ich musste warten, bis Morgan in der Lage war, mit mir zu reden.
Also streckte ich mich auf meiner Couch aus, um nachzudenken. Ich konzentrierte mich auf meine Atmung und versuchte, die Kopfschmerzen zurückzudrängen, indem ich mich entspannte und meine Gedanken ordnete. Das gelang mir so gut, dass ich glatte sechs Stunden liegen blieb, bis der Sommertag vergangen war und sich eine späte Dämmerung über die Stadt gesenkt hatte.
Nein, ich habe nicht geschlafen, ich habe meditiert. Das müssen Sie mir jetzt schon glauben.
Ich schreckte auf, als Mouse einen leisen kehligen Laut von sich gab, kein richtiges Bellen, aber doch deutlich kürzer und klarer als ein Knurren. Als ich aufstand und in mein Schlafzimmer ging, war Morgan wach geworden.
Mouse stand neben dem Bett und hatte meinem Besucher den schweren grauen Kopf auf die Brust gelegt. Der kraulte ihn lässig hinter den Ohren, machte bei meinem Anblick allerdings Anstalten, sich aufzusetzen.
Woraufhin sich Mouse ein wenig nach vorn lehnte und ihn sanft wieder aufs Bett drückte.
Morgan bereitete das Atmen sichtlich Mühe, und seine Stimme klang krächzend und trocken, als er sagte: »Offenbar hat man mir Bettruhe verordnet.«
»Das kann man so sagen«, antwortete ich gelassen. »Jemand hat Sie ziemlich schlimm zugerichtet. Der Arzt hält es für gar keine gute Idee, mit diesem Bein rumzulaufen.«
»Arzt?« Morgans Blick gewann einiges an Schärfe.
»Immer mit der Ruhe, der Besuch war inoffiziell. Ich kenne da jemanden.«
Morgan schnaubte verächtlich. Dann fuhr er sich mit der Zunge über die ausgetrockneten Lippen. »Hätten Sie vielleicht etwas zu trinken für mich?«
Ich holte ihm ein bisschen Wasser in einer Trinkflasche mit dickem Strohhalm. Er war klug genug, das kalte Zeug nicht gierig zu schlurfen, sondern trank in vorsichtigen kleinen Schlucken. Dann holte er tief Luft, verzog das Gesicht wie ein Mann, der gleich seine Hand in ein Feuer legen wird, und sagte: »Vielen D…«
»Ach, halten Sie die Klappe!«, unterbrach ich ihn schaudernd. »Die Konversation kann doch keiner von uns vertragen.«
Vielleicht bildete ich mir das ein, aber ich hatte das Gefühl, dass er sich deutlich entspannte. Auf jeden Fall nickte er dankbar und schloss dann die Augen.
»Aber jetzt nicht gleich wieder einschlafen!«, mahnte ich. »Ich muss noch Fieber messen, und das könnte peinlich werden, wenn Sie mir nicht helfen.«
»Beim Barte Gottes!« Morgan schlug hastig die Augen auf. »Das kann man wohl laut sagen!« Ich ging mein Fieberthermometer holen, eins von diesen altmodischen mit Quecksilber drin, und als ich zurückkam, meinte er: »Sie haben mich also nicht an den Rat ausgeliefert.«
»Noch nicht«, sagte ich. »Ich bin willens, mir anzuhören, was Sie zu sagen haben.«
Morgan nahm mir das Thermometer aus der Hand. »Aleron LaFortier ist tot.«
Woraufhin er sich das Fieberthermometer in den Mund schob – wahrscheinlich wollte er, dass ich vor Neugier umkam. Dieses Schicksal umging ich geschickt, indem ich darüber nachdachte, was das eben Gesagte bedeuten mochte.
LaFortier war Mitglied des Ältestenrates, der sich aus sieben der ältesten und fähigsten Magier des Planeten zusammensetzt. Dieser Ältestenrat lenkt den Weißen Rat und hat den Oberbefehl über die Hüter. LaFortier war mager – gewesen, musste ich jetzt wohl sagen. Mager und kahlköpfig und ein scheinheiliger Affe. Ganz sicher war ich mir nicht, da ich zum fraglichen Zeitpunkt eine Kapuze über dem Kopf getragen hatte, aber ich habe immer den Verdacht gehegt, dass er damals bei meinem Prozess als Erster aus dem Ältestenrat die Stimme zum Schuldspruch gegen mich erhoben und sich danach vehement dagegen gewehrt hatte, mir gegenüber Milde walten zu lassen. LaFortier war ein Hardliner gewesen. Er hatte zu den Unterstützern des Merlin gehört, des Oberhauptes des Ältestenrates, der damals voll und ganz gegen mich gewesen war.
Was soll ich sagen? Ein klasse Typ eben.
Gleichzeitig hatte er zu den am besten geschützten Magiern der Welt gehört, denn die Mitglieder des Ältestenrates sind nicht nur als Einzelpersonen echt gefährlich, sondern werden zudem noch von einer Gruppe von Hütern bewacht. Seit es im Krieg gegen die Vampire immer mal wieder zu Mordversuchen gekommen war, hatten die Hüter ihre Bemühungen verstärkt, für die Sicherheit des Ältestenrates zu sorgen.
Rasch zählte ich eins und eins zusammen.
»Das war niemand von außen, das war jemand aus dem inneren Kreis«, sagte ich leise. »Wie der, der Simon bei Archangelsk getötet hat.«
Morgan nickte.
»Und das hat man Ihnen in die Schuhe geschoben?«
Morgan nickte wieder, nahm das Thermometer aus dem Mund, warf einen Blick darauf und reichte es mir. Ich sah es mir an: siebenunddreißig und ein paar Zerquetschte.
»Und?« Ich sah Morgan an. »Haben Sie es getan?«
»Nein.«
Ich glaubte ihm.
»Warum hält man Sie dann für den Schuldigen?«
»Weil sie mich mit der Mordwaffe in der Hand über LaFortiers Leiche gebeugt antrafen. Noch dazu haben sie ein neu eröffnetes Konto aufgetan, das auf meinen Namen lief und auf das vor Kurzem ein paar Millionen Dollar eingezahlt worden sind. Dazu Telefonunterlagen, die auf regelmäßigen Kontakt mit einem bekannten Agenten des Roten Hofes hindeuten.«
»Himmel! Und da hält man Sie gleich für schuldig? Ist voll irrational!«
Morgans Mund verzog sich zu einem leicht verkrampften, recht säuerlichen Grinsen.
»Wie lautet denn Ihre Geschichte?«, wollte ich wissen.
»Ich bin vor zwei Tagen zu Bett gegangen. Aufgewacht bin ich in LaFortiers Arbeitszimmer in Edinburgh, eine dicke Beule am Hinterkopf und einen blutigen Dolch in der Hand, und ungefähr fünfzehn Sekunden später kamen Simmons und Thorsen ins Zimmer gestürmt.«
»Man will Ihnen den Mord also anhängen.«
»Nach allen Regeln der Kunst.«
Ich atmete langsam und hörbar aus. »Haben Sie Beweise für Ihre Unschuld? Ein Alibi? Irgendetwas?«
»Wenn dem so wäre, hätte ich ja wohl kaum aus der Haft fliehen müssen. Sobald mir klar war, dass jemand erhebliche Anstrengungen unternommen hat, mich als den Schuldigen dastehen zu lassen, wusste ich, dass meine einzige Chance …« Ein heftiger Hustenanfall hinderte ihn am Weitersprechen.
»… darin lag, den wahren Mörder ausfindig zu machen«, beendete ich an seiner Stelle den Satz. Ich reichte ihm die Wasserflasche, er würgte ein paar Schlucke hinunter, und der Husten ließ nach.
Als Morgan wieder sprechen konnte, sah er mich mit müdem Blick an. »Und? Werden Sie mich an die Hüter ausliefern?«
Ich betrachtete ihn wohl eine Minute lang schweigend. »Das würde mein Leben um etliches einfacher machen«, sagte ich schließlich.
»Auf jeden Fall«, meinte Morgan.
»Sind Sie ganz sicher, dass ein Prozess mit einem Todesurteil geendet hätte?«
Irgendwie wirkte sein Blick noch distanzierter als sonst. »Ganz sicher. Ich habe es oft genug miterlebt.«
»Ich könnte Sie also problemlos am ausgestreckten Arm verhungern lassen.«
»Das wäre natürlich eine Möglichkeit.«
»Aber wenn ich das täte, würden wir den Verräter nicht finden. Er bliebe frei wie ein Vögelchen, weil Sie ja an seiner Stelle verurteilt und hingerichtet wurden. Er könnte munter weitermachen, noch mehr Menschen würden umkommen, und der Nächste, dem er die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben versucht …«
»… könnten Sie sein.« Morgan hatte prima mitgedacht.
»Bei meinem Pech?« Ich lachte finster. »Da dürfen wir das ›könnte‹ gleich knicken.«
Wieder tauchte das säuerliche Nicht-ganz-Lächeln auf seinem Gesicht auf.
»Sie werden mit Suchmagie nach Ihnen fahnden«, sagte ich. »Ich gehe davon aus, dass Sie Gegenmaßnahmen ergriffen haben, denn sonst würden hier längst Hüter auf der Matte stehen.«
Er nickte.
»Und wie lange werden diese Gegenmaßnahmen funktionieren?«
»Achtundvierzig Stunden. Allerhöchstens sechzig.«
Ich nickte, langsam und nachdenklich. »Sie fiebern. Ich habe einen Medikamentenvorrat versteckt, den hole ich. Hoffentlich können wir verhindern, dass das Fieber schlimmer wird.«
Morgan nickte, dann fielen ihm die Augen zu. Dem Mann war die Puste ausgegangen. Ich beobachtete ihn noch eine kleine Weile, ehe ich mich daranmachte, meine Sachen zusammenzupacken.
»Pass auf ihn auf, Jungchen«, sagte ich zu Mouse.
Der machte es sich umgehend neben dem Bett bequem.
Achtundvierzig Stunden. Mir blieben ganze zwei Tage, um den Verräter innerhalb der Reihen des Weißen Rates zu finden – einen Magier, nach dem man schon ein paar Jahre lang erfolglos fahndete. Waren die achtundvierzig Stunden um, würden die Hüter Morgan aufspüren, ihn vor Gericht stellen und hinrichten. Und als Nächstes war dann sein Komplize dran, der freundliche Privatdetektiv von nebenan, Ihr ganz persönlicher Harry Dresden.
Nichts hilft einem so nachhaltig auf die Sprünge wie eine knapp kalkulierte Deadline.
Besonders dann, wenn man das mit der Deadline ganz wörtlich nehmen darf.
3. Kapitel
Ich stieg in meinen kampferprobten, zerbeulten alten VW und machte mich auf, um meine Medizinvorräte aus ihrem Versteck zu holen.
Im Grunde hätte sich das Problem mit dem Verräter im Weißen Rat recht einfach lösen lassen müssen, denn bei den aus dem inneren Kreis durchgesickerten Informationen hatte es sich um Interna gehandelt, von denen nur eine begrenzte Anzahl Personen Kenntnis gehabt hatte. Woraus man ja nun messerscharf schließen konnte, dass auch nur eine begrenzte Anzahl an Personen als Verräter infrage kam. Eigentlich war der Kreis der Verdächtigen sogar verdammt klein, schloss allerdings so gut wie den gesamten Ältestenrat ein. Das Problem war nur, dass jeder innerhalb dieses Kreises eigentlich als über jeden Zweifel erhaben gilt.
Was passieren würde, wenn jemand mit anklagendem Finger auf eine dieser illustren Persönlichkeiten deutete, konnte ich mir lebhaft vorstellen: Hektik überall. War der so unter Verdacht Geratene unschuldig, würde er unter Garantie wie Morgan reagieren, denn es blieb ihm ja nichts anderes übrig. Jeder weiß, dass der Rat Scheuklappen trägt, wenn es um Recht und Gerechtigkeit geht, daher kann man auf einen fairen Prozess nicht hoffen.
Wenn sich ein aufmüpfiger junger Magier wie ich gegen das System stellt, ist das eine Sache. Ganz anders sieht es aus, wenn das einer der Schwergewichte aus dem Ältestenrat tut. Die Ältesten verfügen allesamt über vielschichtige Kontakte und Bündnisse im Rat. Hinter ihnen stehen Jahrhunderte an Erfahrung, in denen sie ihre Fertigkeiten verfeinert haben, sodass sie über jede Menge roher Kraft verfügen. Entscheidet sich einer von denen zum Widerstand, geht es ganz anders zur Sache als bei einem simplen Magier, der sich seiner Verhaftung widersetzt.
Eine Anklage innerhalb des Ältestenrates und seiner engsten Umgebung würde Auseinandersetzungen in einem Ausmaß nach sich ziehen, wie sie der Weiße Rat noch nie erlebt hatte.
Letztendlich liefe das auf einen Bürgerkrieg hinaus.
Eine Entwicklung, die unter den gegebenen Umständen für den Weißen Rat verheerend wäre. Ohnehin existierte unter den übersinnlichen Nationen zurzeit ein recht prekäres Gleichgewicht der Kräfte, und wir hatten es während des Krieges gegen die Vampirhöfe gerade eben mal geschafft, den Kopf über Wasser zu behalten. Momentan erholten sich beide Seiten, nur ging das bei den Vampiren erheblich schneller als bei uns, da sie ihre Verluste nun einmal viel leichter ausgleichen und auch selbst schneller regenerieren konnten. Löste sich der Rat jetzt aufgrund interner Streitigkeiten praktisch auf, würde dies bei unseren Feinden einen regelrechten Blutrausch auslösen.
Morgan hatte sich richtig entschieden, als er getürmt war. Ich kenne den Merlin gut genug, um zu wissen, dass er, um den Rat zusammenzuhalten, ohne mit der Wimper zu zucken, einen Unschuldigen opfern würde. Wie viel leichter fiele ihm so eine Entscheidung bei jemandem, der unter Umständen sogar schuldig sein mochte, der Beweislage nach sogar als schuldig zu gelten hatte?
Und der Verräter? Der konnte sich in aller Ruhe zufrieden die Hände reiben. Einer aus dem Ältestenrat war bereits ausgefallen, und falls der Rat als solcher in den nächsten Tagen nicht ohnehin implodierte, würden nach einer Exekution des höchst fähigen und erfahrenen Kriegsbefehlshabers der Hüter Paranoia und Misstrauen fröhliche Urstände feiern. Da brauchte der Verräter nur noch hier und da ein wenig nachzuhelfen, und früher oder später würde irgendetwas nachhaltig in die Brüche gehen.
Für mich bedeutete das alles, dass ich in dieser Sache nicht mehr als einen Versuch hatte. Ich musste den Schuldigen finden, und zwar den richtigen, gleich beim ersten Mal.
Jetzt brauchte ich bloß noch irgendeinen brauchbaren Hinweis.
Immer mit der Ruhe, was, Harry? Bloß keinen Stress.
Mein Halbbruder lebt in einer teuren Wohnung am Rand des Stadtteils Gold Coast, einer Gegend, in der jede Menge Bürger unserer Stadt mit jeder Menge Geld in den Taschen wohnen. Thomas führt einen ziemlich angesagten Frisiersalon und hat sich auf eine Kundschaft spezialisiert, die nichts dabei findet, für einmal Waschen, Schneiden und Föhnen ein paar Hunderter auf den Tisch zu blättern. Dass er dabei nicht schlecht fährt, kann man unschwer an seiner Adresse erkennen.
Ich stellte meinen Käfer ein paar Straßenblocks westlich von seiner Wohnung ab, dort, wo man noch nicht ganz so goldküstige Parkgebühren verlangt, und ging die kurze Strecke zu seinem Apartmenthaus zu Fuß. Dort angekommen, stützte ich mich ein Weilchen auf seine Klingel. Schweigen im Walde. Ich warf einen Blick auf die Uhr in der Eingangshalle, lehnte mich an die Wand neben der Haustür und wartete darauf, dass mein Bruder von der Arbeit nach Hause käme.
Und tatsächlich, schon wenige Minuten später bog sein Wagen auf den Parkplatz des Apartmenthauses ein. Nachdem wir seinen riesigen halben Panzer erfolgreich zu Schrott gefahren hatten, hatte Thomas ihn durch ein brandneues und lächerlich teures Auto ersetzt, einen Jaguar mit allen Schikanen, zahlreichen Extras und – eigentlich unfassbar, ich weiß – Goldverzierungen im Innern. Natürlich in Schneeweiß, das versteht sich ja praktisch von selbst. Ich hielt mich bedeckt, lungerte im Dunkeln herum und wartete, bis Thomas bei der Tür ankam.
Knapp eine Minute später tauchte er auf. Thomas ist gut ein Meter neunzig groß. Er trug eine mitternachtsblaue Lederhose zu einem weißen Seidenhemd mit weiten Ärmeln, und das Haar, mitternachtsschwarz (wahrscheinlich zur Hose passend) fiel ihm in glänzenden Locken bis knapp unter die Schulterblätter. Er hat graue Augen, Zähne, die weißer sind als die Kutten des Ku-Klux-Klan, und ein Gesicht, wie man es sonst nur in Modemagazinen zu sehen bekommt. Dazu dann noch die passende Figur. Verglichen mit Thomas sind sämtliche Kino-Spartaner nichts als Weicheier, und das schafft er ganz ohne technische Hilfsmittel.
Bei meinem Anblick zuckten seine schwarzen Brauen in die Höhe. »’arry!«, sagte er mit diesem lächerlich wohlgesetzten französischen Akzent, den er sich für die Öffentlichkeit zugelegt hat. »Guten Abend, mon ami.«
Ich nickte ihm zu. »Wir müssen uns unterhalten.«
Toms Lächeln verblasste, als er sich meiner Körpersprache und meines Gesichtsausdrucks bewusst wurde. Er nickte. »Natürlich.«
Ich folgte ihm hoch in die Wohnung, die wie immer picobello aufgeräumt und sauber war, die Möbel modern, teuer und absolut im Trend. Ich lehnte meinen Kampfstab neben die Eingangstür und ließ mich auf eins der Sofas fallen, das ich mir daraufhin erst mal genauer anschauen musste.
»Was hast du dafür ausgegeben?«, erkundigte ich mich.
»Ungefähr so viel wie du für den Käfer.« Thomas hatte den Akzent fallen lassen.
Kopfschüttelnd suchte ich nach einer Möglichkeit, es mir auf dem Sitzmöbel bequem zu machen. »Bei der Kohle hätten sie dir ruhig ein paar Kissen mehr mitgeben können. Ich hab schon auf Zäunen gemütlicher gesessen.«
»Das liegt daran, dass dieses Sofa nicht zum Sitzen da ist«, erklärte Thomas gewichtig. »Man hat es, um zu beweisen, wie reich und modebewusst man ist.«
»Ich hab eines meiner Sofas vom Flohmarkt. Hat mich dreißig Mäuse gekostet. Orange und grün kariert, und wenn man erst mal drauf sitzt, möchte man am liebsten einschlafen.«
»Eine Couch, die zu dir passt.« Thomas lächelte. »Während meine Couch zu mir passt.« Er ging in die Küche. »Oder zumindest zu der Person, die ich darstelle. Ein Bierchen?«
»Wenn du ein kaltes dahast.«
Er kam mit zwei dunkelbraunen, eisverkrusteten Flaschen zurück. Wir ließen die Kronenkorken knallen, stießen mit den Flaschenhälsen an, und nach dem ersten Schluck ließ sich Thomas gegenüber der Couch auf einem Stuhl nieder.
»Okay«, sagte er, »was liegt an?«
»Ärger.« Ich erzählte ihm von Morgan.
Thomas starrte mich finster an. »Harry! Ist bei dir im Kopf wer zu Hause? Morgan? Morgan! Was ist bloß los mit dir, Mann?«
Ich zuckte die Achseln. »Ich glaube nicht, dass er es war.«
»Und wen schert das? Würdest du lichterloh in Flammen stehen und Morgan käme auf der anderen Straßenseite vorbeispaziert, der würde doch nicht mal zu dir rüberkommen und auf dich draufpissen! Da kriegt er endlich mal genau das, was er verdient, na und? Warum solltest du auch nur einen Finger für ihn krumm machen?«
»Weil ich nicht glaube, dass er es war!«, wiederholte ich stur. »Außerdem hast du die Sache nicht gründlich genug durchdacht.«
Thomas fläzte sich auf dem Stuhl herum und musterte mich aus zusammengekniffenen Augen, die Bierflasche an den Lippen. Ich tat es ihm nach und sah schweigend zu, wie er sich die ganze Sache gründlich durch den Kopf gehen ließ. Mit dem Kopf von Thomas war alles in bester Ordnung.
»Okay«, sagte er endlich, deutlich widerstrebend. »Ich könnte mir ein paar Gründe denken, weswegen du dem mordlüsternen Affen den Arsch retten willst.«
»Ich brauche das Medizinzeug, das ich bei dir untergestellt hab.«
Er stand auf und ging zum Flurschrank, der bis zum Stehkragen mit allem möglichen Haushaltszeug vollgestopft war, das sich nun mal ansammelt, wenn man irgendwo länger haust. Irgendwo zwischen dem Krempel fand er einen weißen Werkzeugkoffer mit aufgemaltem rotem Kreuz, den er herauszog, während er gleichzeitig seelenruhig einen Baseball auffing, der sich in einem der oberen Regale selbstständig gemacht und es auf seinen Kopf abgesehen hatte. Er schloss den Schrank, holte eine Kühltasche aus seinem Kühlschrank und stellte Kühltasche und Werkzeugkiste neben der Couch auf den Boden.
»Sag jetzt bitte nicht, mehr könnte ich nicht für dich tun«, sagte er.
»Mach ich nicht. Es gibt schon noch was.«
»Und das wäre?«
»Ich möchte, dass du herausfindest, was die Vampirhöfe über diese Großfahndung wissen. Aber halt dich bedeckt, wenn du nachfragst.«
Er starrte mich eine Weile schweigend an. Dann atmete er ganz langsam aus. »Wieso?«
»Ich weiß nicht, was genau Sache ist. Meine Leute kann ich nicht fragen, und wenn es sich zu sehr rumspricht, dass du Erkundigungen einziehst, zählt bestimmt bald mal wer eins und eins zusammen und nimmt Chicago genauer unter die Lupe.«
Mein Bruder, der Vampir, verharrte einen Moment lang vollkommen reglos, so ruhig, wie ein Mensch einfach nie dasitzen könnte. Er hörte auf zu existieren, selbst seine Gegenwart im Zimmer war nicht mehr zu spüren. Ich hatte das Gefühl, eine Wachsfigur anzustarren.
»Ich soll Justine einschalten. Darum bittest du mich doch«, sagte er schließlich.
Justine war die Frau, die um ein Haar ihr Leben für meinen Bruder hingegeben hätte. Um sie zu beschützen, hätte er sich wiederum um ein Haar selbst umgebracht. Das, was die beiden verbindet, »Liebe« zu nennen, trifft es auch nicht mal ansatzweise. Und für das, was ihnen diese »Liebe« angetan hat, gibt es schlicht keine Worte.
Für meinen Bruder, einen Vampir des Weißen Hofes, ist Liebe schmerzhaft. Thomas und Justine werden nie zusammen sein können.
»Sie arbeitet als persönliche Assistentin für die Führerin des Weißen Hofes«, sagte ich. »Wenn jemand etwas herausfinden kann, dann sie.«
Thomas stand auf – eine Bewegung, die einen Tick zu schnell ausfiel, um die eines Menschen sein zu können – und lief erregt im Zimmer auf und ab. »Justine geht auch so schon genügend Risiken ein. Immerhin leitet sie Infos über die Aktivitäten des Weißen Hofes an dich weiter, solange das halbwegs sicher zu bewerkstelligen geht. Ich möchte einfach nicht, dass sie noch mehr Risiken auf sich nimmt.«
»Was ich durchaus verstehe. Aber Justine hat sich doch überhaupt nur für die verdeckte Arbeit entschieden, damit sie in genau so einer Situation wie jetzt vor Ort ist. Deswegen arbeitet sie als verdeckte Ermittlerin.«
Thomas schüttelte nur stumm den Kopf.
Ich seufzte. »Hör mal, ich verlange ja gar nicht, dass sie den Traktorstrahl deaktiviert, die Prinzessin rettet und auf den vierten Mond von Yavin flieht. Ich will nur wissen, was sie so gehört hat und was sie herausfinden kann, ohne dass ihre Tarnung auffliegt.«
Thomas tigerte noch ein Weilchen erregt auf und ab, ehe er stehen blieb und mich unverwandt fixierte. »Aber erst versprichst du mir was.«
»Und das wäre?«
»Du versprichst mir, dass du sie nicht in noch größere Gefahr bringst. Und du versprichst mir, dass du nicht aufgrund von Infos tätig wirst, die man zu ihr zurückverfolgen könnte.«
»Thomas!«, sagte ich müde. »Verdammt noch mal, wie soll das denn gehen? Wie soll ich herausfiltern, welche Informationen ich gefahrlos benutzen kann, und wie soll ich echte Infos von Fehlinformationen unterscheiden? Was du willst, geht einfach nicht.«
»Du versprichst mir das!« Er betonte jedes einzelne Wort.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich verspreche dir, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um Justine nicht zu gefährden.«
Am Kinn meines Bruders zuckte ein Muskel. Klar, mein Versprechen reichte ihm nicht. Die ganze Sache gefiel ihm nicht. Er wusste, dass ich nicht voll und ganz für Justines Sicherheit garantieren konnte und dass ich ihm gerade so viel versprochen hatte, wie ich auch würde halten können. Mehr war einfach nicht drin.
Er holte ganz langsam und tief Luft.
Aber dann nickte er.
»Okay.«
4. Kapitel
Kaum fünf Minuten nachdem ich die Wohnung meines Bruders verlassen hatte, ertappte ich mich dabei, wie ich alle paar Sekunden unruhige Blicke in den Rückspiegel des Käfers warf. In mir hatte sich eine gewisse Anspannung breitgemacht, ein Gefühl, das mir sagte, dass ich nicht allein durch die Stadt fuhr. Irgendwo hatte ich mir einen Verfolger eingefangen.
Sicher, was ist schon ein Gefühl? Aber ich bin Magier, meine Instinkte haben sich im Laufe der Zeit reichlich Orden verdient, ich habe gelernt, auf sie zu achten. Wenn sie mir sagen, dass mir jemand auf den Fersen ist, ist es an der Zeit, aufzupassen.
So ein Verfolger brauchte allerdings nicht gleich etwas mit der momentanen Lage und Morgan zu tun zu haben. Nicht unbedingt. Allerdings habe ich nicht schon eine ganze Reihe hässlicher Scharmützel halbwegs heil überstanden, weil ich vom Kopf her etwas langsam bin. Okay, manchmal bin auch ich nicht der Hellste, aber hin und wieder eben schon. Klar hatte mein Begleiter etwas mit Morgan zu tun! Um den Zusammenhang zu übersehen, hätte ich schon ein Volltrottel sein müssen.
Rein zum Spaß schlug ich den einen oder anderen Haken, konnte aber nicht feststellen, ob irgendein Fahrzeug am Käfer klebte. Was nichts heißen musste. Ein erstklassiges, gut aufeinander eingespieltes Überwachungsteam kann einen verfolgen und dabei mehr oder weniger unsichtbar bleiben, besonders nachts, wenn man ein Scheinwerferpaar kaum vom anderen unterscheiden kann. Bloß weil ich sie nicht sehen konnte, hieß das noch lange nicht, dass sie nicht da waren.
Inzwischen hatten sich meine Nackenhaare aufgestellt, und ich spürte, wie sich meine Schulterpartie von Straßenlaterne zu Straßenlaterne mehr verspannte.
Und wenn mein Verfolger nun gar nicht in einem Auto saß?
Himmel! Umgehend lieferte mir meine Fantasie deftige Bilder von geflügelten Horrorwesen, die auf lautlosen Schwingen oberhalb des Lichtkegels der Stadt durch die Luft glitten, jederzeit bereit, auf den Käfer hinabzustoßen und ihn in Blechfetzen zu zerlegen. Wie immer war in diesem Teil der Stadt allerhand los auf den Straßen, eigentlich zu viel, um einen Anschlag zu wagen. Was aber nicht automatisch die Möglichkeit eines solchen Anschlags ausschloss, da hatte ich bereits unliebsame Erfahrungen gemacht.
Nervös und nachdenklich kaute ich auf meiner Unterlippe herum. Zurück zu meiner Wohnung? Das ging erst, wenn ich meinen Verfolger zuverlässig abgeschüttelt hatte. Nur musste ich ihn dazu erst einmal entdecken.
Gut, so ganz ohne Risiko würde es in den nächsten ein, zwei Tagen sowieso nicht abgehen. Warum also nicht gleich ein bisschen Wagemut zeigen?
Ich holte tief Luft, fokussierte meine Gedanken und blinzelte einmal ganz langsam. Als ich meine Augen wieder aufschlug, öffnete sich damit gleichzeitig mein Blick.
Der Blick eines Magiers, diese Fähigkeit, die Welt um sich herum in einem weit vergrößerten Spektrum aus interagierenden Kräften wahrzunehmen, ist eine gefährliche Gabe. Egal, wie man ihn nennt – spirituelle Sehkraft, innere Sehkraft oder Drittes Auge –, dieser Blick lässt einen Dinge wahrnehmen, mit denen eine Interaktion sonst nie möglich wäre. Er zeigt einem die Welt, wie sie wirklich ist, zeigt die Materie verwoben mit einem Universum aus Energie, aus Magie. Der Blick kann einem Bilder von solcher Schönheit offenbaren, dass Engel bei ihrem Anblick demütige Tränen vergießen würden, und Bilder von solcher Grausamkeit, dass der Ziegenbock mit den tausend Jungen es nicht wagen würde, sie als Gutenachtgeschichten für seine Zicklein auszuwählen.
Und was man mit diesem Blick sieht – das Gute, das Schlechte, das, was einen mühelos in den Wahnsinn treiben könnte –, bleibt auf ewig in einem bestehen. Man vergisst es nicht. Die Zeit verwischt oder verwässert die Erinnerung noch nicht einmal. Was man sieht, gehört danach zu einem.
Wer als Magier rumrennt und mit dem Blick arbeitet, wann immer es ihm in den Kram passt, knallt früher oder später durch.
Mein Drittes Auge zeigte mir das wahre Chicago, und eine Sekunde lang kam es mir vor, als sei ich unversehens in Las Vegas gelandet. Unendliche Energieströme flossen durch die Straßen, Häuser und Menschen wie dünne Lichtschichten, die hierhin und dorthin rannten, die mit festen Objekten zusammenstießen und ohne Unterbrechung der Bewegung auf der anderen Seite wieder herauskamen. Die Energien, die durch die großartigen alten Gebäude der Stadt rannen, zeigten mir die Straßen der Stadt selbst, eine gewisse Festigkeit, Stabilität. Aber der Rest, die ganze zufällige Energie, erzeugt durch die Gedanken und Gefühle von acht Millionen Menschen, floss völlig ungeplant und unstrukturiert, schimmerte in hektischen, zusammenhanglosen, teils grässlichen Farben.
Wolken aus Gefühlen, denen Ideen entsprangen wie Funken aus einem Lagerfeuer. Schwer fließende tiefgehende Gedanken, die träge dahinströmten, und darüber tanzte, flammenden Juwelen gleich, die Freude. Negative Gefühle setzten sich als Ablagerung an festen Oberflächen ab, färbten sie dunkler, während Träume, zerbrechlichen Seifenblasen gleich, vielfarbig schimmernd hin zu den Sternen aufstiegen.
Elender Mist! Durch all dies Farbengewusel hindurch konnte ich kaum noch sehen, wohin ich fuhr.
Bei jedem Blick über die Schulter oder in den Rückspiegel erkannte ich die Leute in den Autos hinter mir als hell erleuchtete weiße Gestalten, über denen ein ständig sich veränderndes Kaleidoskop aus Farben ihre Gefühle, Gedanken, Stimmungen und Persönlichkeiten zeigte. Mit weniger Abstand hätte ich mehr Details wahrnehmen können, wobei sich mein Unterbewusstsein in die Interpretation des Gesehenen eingemischt hätte. Aber selbst aus der Entfernung konnte ich feststellen, dass die Wagen hinter mir mit Sterblichen besetzt waren.
In gewisser Weise war das eine Erleichterung. Einen Magier, der mächtig genug ist, um zu den Hütern zu gehören, hätte ich auch aus der Entfernung erkannt. Wenn mich also ein normaler Sterblicher verfolgte, durfte ich fast sicher annehmen, dass der Rat Morgan noch nicht aufgespürt hatte.
Ich warf einen Blick nach oben und …
Die Zeit stand still.
Stellen Sie sich vor, wie verwesendes Fleisch stinkt. Stellen Sie sich das träge, unrhythmische Pulsieren einer von Maden besetzten Leiche vor. Stellen Sie sich abgestandenen Körpergeruch vor, durchmischt mit dem Geruch von Mehltau, dazu das Geräusch von langen Fingernägeln, die über eine Schiefertafel kratzen, den Geschmack verdorbener Milch, verfaulten Obstes.
Und nun versuchen Sie, sich auszumalen, Sie könnten all diese Dinge mit den Augen aufnehmen, alle auf einmal, jedes widerliche Detail.
Folgendes habe ich gesehen: eine Masse, bei deren Anblick sich einem der Magen umdrehte und Albträume wahr wurden. Flammend wie der Lichtkegel eines Leuchtturms auf einem der Gebäude über mir. Dahinter ganz vage eine Gestalt, aber so undeutlich, als würde ich sie durch ungefilterte Abwässer sehen. Dieses Etwas war durch und durch fehl am Platz, war ganz einfach falsch, war umgeben von einem Nebel aus Falschsein, durch den hindurch sich keinerlei Details ausmachen ließen. Das Ding sprang von Dachkante zu Dachkante und konnte mühelos mit meinem Wagen mithalten.
Jemand schrie. Wahrscheinlich ich, wie ich am Rande meines Bewusstseins gerade noch wahrnahm. Der Käfer stieß gegen irgendetwas, heulte protestierend laut auf. Ein harter Schlag, noch einer. Ich war gegen die Bordsteinkante gefahren. Durch das Lenkrad hindurch spürte ich, wie sich die Vorderräder verkeilten. Ich stieg, immer noch laut schreiend, voll auf die Bremse und mühte mich ab, mein Drittes Auge zu schließen.
Als Nächstes hörte ich das wütende, ungeduldige Protestgeschrei unzähliger Autohupen.
Ich hockte auf dem Fahrersitz, das Lenkrad so fest umklammernd, dass meine Knöchel schneeweiß hervortraten. Der Motor des Käfers war abgesoffen, auf meinen Wangen hatte sich Feuchtigkeit gesammelt – wahrscheinlich hatte ich geweint. Oder vor meinem Mund hatte sich Schaum gebildet – auch möglich, wenn man es genau bedachte.
Grundgütiger Himmel! Was, um alles in der Welt, war das gewesen?
Nur an das Ding zu denken, brachte die Erinnerung in all ihren grässlichen Details, brachte den ganzen Schrecken zurück. Ich kniff die Augen zu, klammerte mich am Lenkrad fest, zitterte am ganzen Leib wie Espenlaub. Ich weiß nicht, wie lange ich brauchte, um mich von der Erinnerung zu befreien, aber als es mir gelungen war, war alles um mich herum, wie es gewesen war – nur lauter.
Die Stoppuhr lief. Ich konnte es mir nicht leisten, wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen zu werden, was die Cops ganz sicher tun würden, wenn ich mich nicht bald mal wieder in Bewegung setzte.
Ich holte tief Luft, zwang meinen Willen, nicht an die Erscheinung zu denken …
… und sah sie erneut.
Als ich diesmal zu mir kam, hatte ich mir die Zunge zerbissen, und meine Kehle fühlte sich an wie mit Sandpapier aufgeraut. Ich zitterte womöglich noch heftiger als zuvor.
Autofahren kam in diesem Zustand überhaupt nicht mehr infrage. Ein halber Gedanke nur in die falsche Richtung, und ich baute womöglich noch einen Unfall, bei dem jemand zu Schaden kam. Aber hier stehen bleiben konnte ich auch nicht.
Mühsam lenkte ich den Käfer über die Bordsteinkante auf den Bürgersteig, so war er wenigstens schon mal von der Straße. Dann stieg ich aus und ging einfach los, wohl wissend, dass in ungefähr drei Komma fünf Millisekunden der städtische Abschleppdienst in Aktion treten würde. Aber dann war ich weg, und sie konnten mich nicht auch noch mitnehmen.
Verzweifelt stolperte ich den Bürgersteig entlang, voller Hoffnung, mein Verfolger, diese Erscheinung …
Als ich diesmal wieder zu Sinnen kam, lag ich, zu einem Ball zusammengerollt, am Boden. Sämtliche Muskeln taten mir weh, weil ich sie zu sehr angespannt hatte. Fußgänger gingen in einem weiten Bogen an mir vorbei, warfen mir fassungslose Blicke zu. Ich fühlte mich so schwach, dass ich mir nicht sicher war, ob und wie weit meine Beine mich tragen würden.
Hilfe. Ich brauchte ganz dringend Hilfe.
An der nächsten Ecke standen Straßenschilder, die ich so lange anstarrte, bis mein armes gemartertes Hirn kapiert hatte, wo ich mich befand.
Als ich mich aufgerappelt hatte, musste ich mich auf meinen Stab stützen, um nicht gleich wieder umzufallen. So humpelte ich davon, so schnell ich konnte. Dabei dachte ich an Primzahlen, an nichts anderes als Primzahlen, so intensiv, als würde ich mich auf einen Zauber konzentrieren.
»Eins«, murmelte ich zwischen fest zusammengebissenen Zähnen hindurch. »Zwei. Drei. Fünf. Sieben. Elf. Dreizehn.«
Und so stolperte ich durch die Nacht, derart in Angst und Schrecken, dass ich nicht mehr an das dachte, was mir vielleicht folgen mochte.
5. Kapitel
Als ich bei der Zahl zweitausendzweihundertneununddreißig angekommen war, stand ich vor dem Haus von Billy und Georgia.
Im Leben der jungen Werwölfe hatte sich einiges verändert, seit Billy nach Beendigung des Studiums als Ingenieur richtiges Geld verdient, aber ihre alte Studentenbude haben sie beibehalten. Georgia ging weiterhin zur Uni und studierte irgendetwas mit Psychologie, während die beiden auf ein Haus sparten. Gut für mich – bis in die Vororte hinaus hätte ich es zu Fuß nie geschafft.
Georgia kam an die Tür, eine große, gertenschlanke Frau, die in ihren langen, weit sitzenden Shorts und dem T-Shirt eher klug als hübsch wirkte.
»Mein Gott!«, entfuhr es ihr bei meinem Anblick. »Harry!«
»Hallo, Georgia«, sagte ich. »Zweitausendzweihundert … dreiundvierzig. Ich brauche ein ruhiges, dunkles Zimmer.«
Sie blinzelte mich verdutzt an. »Was?«
»Zweitausendzweihunderteinundfünfzig«, antwortete ich. »Und schick den Wolfsruf raus, die Gang muss her. Zweitausendzweihundert … siebenundsechzig.«
Sie hielt mir die Tür auf und trat zurück, damit ich an ihr vorbeikam. »Harry, was redest du da?«
Ich trat ein. »Zweitausendzweihundert … sechzig – nicht teilbar durch drei – … neunundsechzig. Ich brauche ein dunkles Zimmer. Ruhig. Schutz.«
»Ist etwas hinter dir her?«
Als Georgia mir diese Frage stellte und mein Hirn sie beantwortete, half mir auch der gute alte Eratosthenes nicht mehr: Das Ding war wieder da, überfiel in voller Größe meine Gedanken und zwang mich in die Knie. Wahrscheinlich wäre ich wieder als hilfloser Ball am Boden gelandet, wäre Billy nicht dazugekommen und hätte mich gerade noch rechtzeitig aufgefangen.
Billy ist eher klein, so um die ein Meter siebzig, hat dafür aber die Statur eines Profiringers und die Geschwindigkeit und Präzision eines Raubtiers.
»Dunkles Zimmer«, keuchte ich. »Gang zusammenrufen. Schnell.«
»Mach schon, tu, was er sagt«, drängte Georgia mit leiser Stimme. Sie schloss die Tür hinter mir, verriegelte sie und sicherte sie zusätzlich mit einem Holzbalken von der Länge und Breite einer Partybank, den Billy und sie selbst dort angebracht hatten. »Schaff ihn in unser Zimmer. Ich rufe die Gang an!«
»Alles klar.« Billy hob mich auf seine Schulter, was ihm kaum ein müdes Grunzen entlockte, trug mich wie ein Kleinkind den Flur entlang in ein dunkles Schlafzimmer und legte mich dort aufs Bett. Dann ging er zum Fenster, zog die schweren Stahljalousien zu – noch so eine von den Maßanfertigungen, mit denen Georgia und er die Wohnung ausgestattet hatten – und verriegelte sie.
»Brauchst du noch was, Harry?«, erkundigte er sich.
»Dunkel. Ruhe. Erklär später alles.«
»In Ordnung.« Er legte mir beruhigend die Hand auf die Schulter, ehe er aus dem Zimmer tappte und die Tür hinter sich schloss.
Daraufhin war ich allein im Zimmer, nur mit meinen Gedanken. Genau das brauchte ich jetzt.
»Okay, Harry«, flüsterte ich mir zu. »Jetzt gewöhn dich erst mal an die Vorstellung.«
Und ich dachte ganz bewusst an das Ding, das ich gesehen hatte.
Was höllisch wehtat. Aber als ich wieder bei mir war, dachte ich gleich noch einmal daran. Und noch einmal. Und noch einmal.
Ja, ich hatte mit meinem Blick etwas Schreckliches gesehen, etwas Grässliches, Grauenhaftes, etwas durch und durch Furchterregendes. Aber mein Blick hatte mir auch schon andere Dinge gezeigt.
Auch diese Erinnerungen rief ich in mir wach. Sie waren allesamt noch so frisch und gestochen scharf wie das Schreckensbild, das jetzt neu auf mir lastete. Ich hatte gute Menschen erlebt, die unter dem Einfluss von Schwarzer Magie wie wahnsinnig geschrien hatten, ich hatte das wahre Ich von Männern und Frauen gesehen, von guten und schlechten. Hatte gesehen, wie Menschen getötet worden waren. Ich hatte die Königinnen der Feen sich auf die Schlacht vorbereiten sehen, hatte gesehen, wie sie all ihre schreckliche Macht um sich sammelten.
Nein, vor einem Ding, mochte es auch noch so grauenhaft sein, das aber eigentlich nichts weiter tat, als von einem Dach zum anderen zu hüpfen, würde ich mich nicht bibbernd und heulend verkriechen. Eher wollte ich verdammt sein!
»Komm ruhig her, du armseliger Trottel«, zischte ich die Erinnerung an. »Verglichen mit den anderen bist du ein lahmes Schulfoto.«
Ich schwang die Erinnerungen wie Keulen, haute sie mir wieder und wieder um die Ohren, dachte, gezielt und bewusst, jede einzelne schöne oder grässliche Sache, die mir mein Blick je gezeigt hatte. Und während ich das tat, konzentrierte ich mich auf das, was ich damals, als die Erinnerung noch keine Erinnerung, sondern Realität gewesen war, jeweils getan hatte. Ich dachte, auch jetzt gezielt und bewusst, an die Dinge, gegen die ich angetreten war und die ich vernichtet hatte. Ich erinnerte mich an die Bastionen der Albträume und der Schrecken, in die ich eingedrungen war, die dunklen Tore, die ich niedergerissen hatte. Ich erinnerte mich ganz bewusst an die Gesichter von Gefangenen, die ich befreit hatte, an die Beerdigungen derer, die ich nicht hatte retten können, weil ich zu spät gekommen war. Ich erinnerte mich an Stimmen, an Lachen, an die tiefe Freude bei der Wiedervereinigung von Menschen, die sich aufrichtig liebten, an die Tränen der Verlorenen und der Trauernden.
Es gibt Schlechtes in der Welt. Das ist eine Tatsache, der man nicht entgehen, um die man nicht herumkommen kann. Das heißt jedoch nicht, dass man das Böse einfach hinnehmen muss, dass man nichts dagegen unternehmen kann. Man darf sich nicht einfach vom Leben verabschieden, nur weil es einem Angst macht und die Gefahr besteht, dass man manchmal auch verletzt wird.
Es tat weh, sich an das Ding zu erinnern, verdammt weh. Aber dieser Schmerz war weder etwas Besonderes, noch war er neu für mich. Ich hatte schon früher mit solchem Schmerz gelebt und würde auch in Zukunft immer mal wieder damit leben müssen. Das Ding war nicht die erste Scheußlichkeit, die mir mein Magierblick gezeigt hatte, und würde auch nicht die letzte sein.
Ich würde nicht einfach aufgeben und sterben.
Vorschlaghämmern gleich prasselten perfekte Erinnerungsbilder auf mich ein, bis alles um mich herum dunkel war.
Als ich mich wieder beieinanderhatte, hockte ich mit kerzengeradem Rücken im Schneidersitz auf dem Bett, die Handflächen auf den Knien. Mein Atem ging schwer, aber gleichmäßig, mein Kopf tat weh, aber nicht so, dass es mich behindert hätte.
Prüfend blickte ich mich im Zimmer um. Inzwischen hielt ich mich lange genug hier auf, meine Augen hatten sich an das Dunkel gewöhnt und kamen mit dem wenigen Licht aus, das unter der Tür hindurchsickerte. Über der Ankleidekommode, gegenüber vom Bett, hing ein Spiegel, in dem ich mich sehen konnte. Ich saß gerade und entspannt da. Den Mantel hatte ich ausgezogen, der Spiegel zeigte mir die weißen Buchstaben, mit denen das Wort PERFEKTIONIST auf mein schwarzes T-Shirt gedruckt war, spiegelverkehrt und rückwärts marschierend. Auf meiner Oberlippe trockneten zwei dünne Blutstreifen, einer unter jedem Nasenloch. Auch im Mund schmeckte ich Blut, immerhin hatte ich mir vorhin auch auf die Zunge gebissen.
Erneut dachte ich an meinen Verfolger. Bei der Erinnerung rieselte es mir eiskalt über den Rücken, mehr aber auch nicht. Ich atmete weiterhin langsam und gleichmäßig.
Sehen Sie, das ist einer der Vorteile am Menschsein: Unterm Strich sind wir ziemlich anpassungsfähig. Die Erinnerung an das grässliche Ding vorhin würde ich nie wieder loswerden, auch nicht meine Bilder von all den anderen grauenvollen Dingen, die ich mit meinem Blick gesehen hatte. Wenn sich meine Erinnerungen nicht ändern ließen, blieb mir nur eins: Ich selbst musste mich ändern. Ich musste mich daran gewöhnen, diese Schrecken zu sehen, richtig zu sehen, und trotzdem noch ein vernunftbegabtes Wesen zu bleiben. Diese Leistung hatten schon bessere Männer als ich vollbracht.
Morgan zum Beispiel.
Wieder musste ich zittern, aber nicht der Erinnerung wegen, sondern weil ich wusste, was es heißen kann, wenn man sich zwingt, mit solch grässlichen Dingen zu leben. Das verändert den Menschen. Es macht einen vielleicht nicht gleich zum Monster, aber es bleiben Narben. Auch ich hatte welche davongetragen, dessen war ich mir durchaus bewusst.