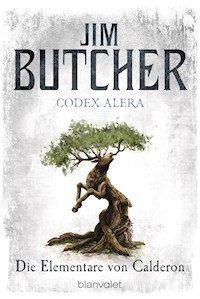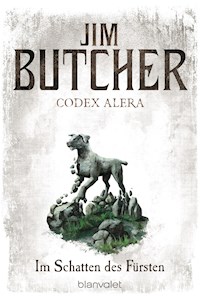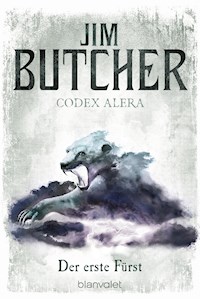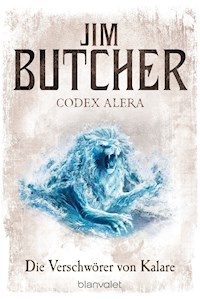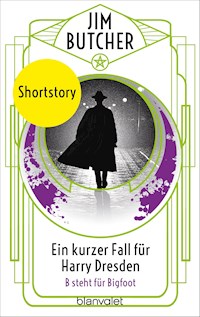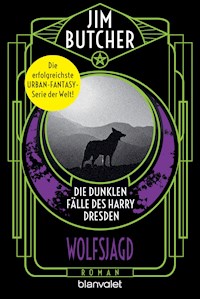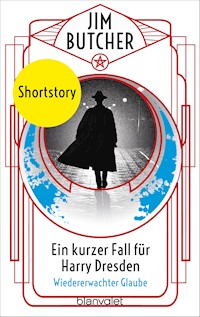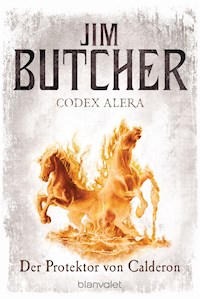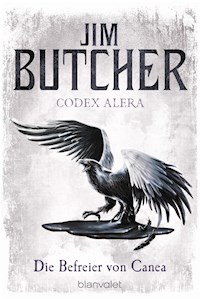9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Harry-Dresden-Serie
- Sprache: Deutsch
Erstmals auf Deutsch! Der 16. dunkle Fall des Harry Dresden soll den Krieg in der übernatürlichen Welt beenden.
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden, und ich bin der Repräsentant des Weißen Rats der Magier in Chicago. Als solcher war ich natürlich skeptisch, als die Friedensgespräche mit den Fomori ausgerechnet in meiner Stadt stattfinden sollten. Nennen Sie mich zynisch, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Meereswesen an echtem Frieden interessiert waren. Und ich ahnte, dass auch jede der anderen Parteien ihr eigenes Süppchen kochte. Meine Aufgabe bestand darin, dafür zu sorgen, dass wenigstens die Verhandlungen gesittet abliefen. Ich erwartete Intrigen, Verrat und brutale Gewalt. Dass aber ausgerechnet mein eigener Bruder dort eine Bombe zündete, überraschte mich schon …
Die dunklen Fälle des Harry Dresden: spannend, überraschend, mitreißend. Lassen Sie sich kein Abenteuer des besten Magiers von Chicago entgehen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden, und ich bin der Repräsentant des Weißen Rates der Magier in Chicago. Als solcher war ich natürlich skeptisch, als die Friedensgespräche mit den Fomori ausgerechnet in meiner Stadt stattfinden sollten. Nennen Sie mich zynisch, aber ich konnte mir nicht vowrstellen, dass diese Meereswesen an echtem Frieden interessiert waren. Und ich ahnte, dass auch jede der anderen Parteien ihr eigenes Süppchen kochte. Meine Aufgabe bestand darin, dafür zu sorgen, dass wenigstens die Verhandlungen gesittet abliefen. Ich erwartete Intrigen, Verrat und brutale Gewalt. Dass aber ausgerechnet mein eigener Bruder dort eine Bombe zündete, überraschte mich schon …
Autor
Jim Butcher ist der Autor der Dresden Files, des Codex Alera und der Cinder-Spires-Serie. Sein Lebenslauf enthält eine lange Liste von Fähigkeiten, die vor ein paar Jahrhunderten nützlich waren – wie zum Beispiel Kampfsport –, und er spielt ziemlich schlecht Gitarre. Als begeisterter Gamer beschäftigt er sich mit Tabletop-Spielen in verschiedenen Systemen, einer Vielzahl von Videospielen auf PC und Konsole und LARPs, wann immer er Zeit dafür findet. Zurzeit lebt Jim in den Bergen außerhalb von Denver, Colorado.
Jim Butcher
FRIEDENSGESPRÄCHE
DIE DUNKLEN FÄLLE DES HARRY DRESDEN
Roman
Deutsch von Oliver Hoffmann
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Peace Talks (The Dresden Files 16)« bei Penguin RoC, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2020 by Jim Butcher
Published by Arrangement with IMAGINARYEMPIRELLC
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Illustrationen: © www.buerosued.de
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31217-6V002
www.blanvalet.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
Für Frostbite Doomreaver McBane Butcher. Ich vermisse dich, kleiner Kumpel.
1. Kapitel
Mein Bruder ruinierte eine perfekte Joggingrunde, indem er bemerkte: »Justine ist schwanger.«
Das brachte mich völlig aus dem Konzept, und plötzlich war ich mir des Brennens in meinen Beinen und meines schweren Atems unangenehm bewusst. Ich schaltete einen Gang zurück und lief allmählich langsamer, bis ich nur noch trabte. Im blauen Licht der Julimorgenröte war der Montrose Beach menschenleer. Es war noch nicht heiß. Genau deshalb war ich mitten in der Nacht aufgestanden.
Thomas wurde auch langsamer, bis wir Seite an Seite gingen. Er hatte sein dunkles Haar zum Pferdeschwanz zurückgebunden. Wie ich trug er ein altes T-Shirt, Jogginghose und Laufschuhe. Er gehört zu den Männern, die so gut aussehen, dass sich die Leute nach ihm umdrehen, um sich davon zu überzeugen, dass ihnen ihre Augen keinen Streich gespielt haben.
Außerdem ist er ein Vampir.
»Damit ich das richtig verstehe …«, sagte ich. »Du holst mich heute Morgen ab, wir fahren den ganzen Weg hier raus, wir laufen zehn Kilometer durch den Sand, und keiner von uns sagt ein Wort. Die komplette Stadt ist still und ruhig. Wir haben kaum ein Auto vorbeifahren gesehen.«
»Ja und?«, fragte Thomas.
Ich schaute finster. »Warum musstest du das kaputt machen?«
Seine Mundwinkel zuckten. »Tut mir leid, dass ich dir deine Männeridylle verderbe, Hemingway.«
Ich ächzte. Wir hatten das Ende unserer letzten Runde erreicht und waren ohnehin fast wieder bei den Autos. Ich hielt an, wandte mich dem See zu und atmete tief durch. Die Gewichtsweste, die ich trug, drückte etwas auf meine Schultern, schränkte sie in ihren Bewegungen ein. Ich ließ die Schultern ärgerlich kreisen.
Weit draußen über dem See hellte sich das Blau auf. Bald würde die Sonne aufgehen.
»Bist du sicher?«, fragte ich.
»Sehr«, sagte er.
Ich sah ihn von der Seite an. Sein vollkommen symmetrisches Gesicht wirkte angespannt. Seine Augen, die manchmal blau, meist aber grau sind, schimmerten wie ein silberner Spiegel. Ich kannte diesen Blick. Er hatte Hunger.
»Wie ist das passiert?«, erkundigte ich mich.
Er sah mich aus dem Augenwinkel an, ohne den Kopf zu drehen, und hob die Brauen. »Hat dich nie jemand aufgeklärt?«
Ich schaute finster. »Habt ihr nicht aufgepasst?«
»Doch«, antwortete Thomas. »Meine Art ist obendrein so gut wie unfruchtbar. Es ist trotzdem passiert.«
»Was nun?«
»Im Grunde das Übliche. Außer dass der Hunger des Babys Justine Lebensenergie rauben wird. Sie muss in den nächsten siebeneinhalb Monaten ununterbrochen gefüttert werden.«
Ich musterte ihn. »Ist es gefährlich?«
Thomas schluckte. »Laut den Familienchroniken überstehen etwas mehr als fünfzig Prozent die Geburt nicht oder erliegen kurz danach ihren Folgen.«
»Herrjemine!«, fluchte ich. Ich starrte weiter aufs Wasser hinaus. Das Dunkelblau war einem helleren Ton und dann einem ersten Anflug von Gold gewichen. Um uns herum erwachte Chicago. Der Verkehrslärm schwoll langsam an. Die Vögel im Schutzgebiet am Ende des Strandes begannen zu singen.
»Ich weiß nicht, was ich tun soll«, gestand Thomas. »Wenn ich sie verliere …«
Er verstummte. Aber mehr musste er auch nicht sagen. In diesem Halbsatz steckte ein Universum voller Schmerz.
»Ihr schafft das schon«, sagte ich. »Ich werde euch helfen.«
»Du?«, fragte Thomas. Ein leises Lächeln erhellte für eine Sekunde sein Profil.
»Bitte nimm zur Kenntnis, dass ich seit über einem Monat alleinerziehender Vater bin und Maggie noch nicht tot ist. Ich habe eindeutig krasse Vaterfähigkeiten.«
Das Lächeln erlosch. »Ja. Aber … Harry …«
Ich legte ihm die Hand auf die Schulter. »Mach dir keine unnötigen Sorgen«, riet ich. »Was immer auch nötig ist, wir werden es tun.«
Er starrte mich einen Moment lang stumm an und nickte dann.
»In der Zwischenzeit«, fuhr ich fort, »solltest du dich wahrscheinlich darauf konzentrieren, auf dich aufzupassen, damit du für sie da sein kannst.«
»Mir geht es gut«, meinte er und winkte ab.
»Du siehst aber nicht gut aus.«
Daraufhin wandte er ruckartig den Kopf in meine Richtung und sah mich an. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Plötzlich sah er weniger wie ein Mensch aus, sondern eher wie etwas, das aus Marmor gemeißelt war. Aus zornigem, wutentbranntem Marmor. Ich spürte, wie sich meine Schultern in Anwesenheit einer Kreatur, von der ich wusste, dass sie wirklich gefährlich war, anspannten.
Er starrte mich an, aber dazu musste er zu mir aufschauen. Mein älterer Bruder ist etwa eins achtzig groß, ich hingegen eins neunzig. Normalerweise bin ich deutlich im Vorteil, wenn ich auf ihn hinabsehe. An diesem Tag war der Größenunterschied weniger ausgeprägt, denn ich stand in einer Vertiefung im Sand.
Seine Stimme war abweisend. »Lass es, Harry.«
»Wenn ich es nicht lasse«, fragte ich, »wirst du mich dann schlagen?«
Er sah mich finster an.
»Denn du weißt ja, ich bin jetzt voll Captain Winter. Es läuft vielleicht nicht so, wie du es dir vorstellst.«
Er feixte. »Ach, bitte. Ich würde dich mit deinen eigenen Eingeweiden fesseln.«
Ich schielte zu Thomas hinüber. Dann antwortete ich vorsichtig und langsam: »Wenn du nicht auf dich aufpasst und dich nicht wie ein vernünftiger Mensch verhältst, werden wir es vielleicht herausfinden.«
Er runzelte die Stirn und wollte etwas sagen, wobei sich seine Miene noch mehr verfinsterte.
»Nein«, sagte ich einfach. »Nein, das läuft nicht. Du darfst deswegen nicht in so eine Emo-Vampir-Angstspirale geraten. Denn das wäre egoistisch, und du kannst es dir nicht leisten, so zu denken. Jetzt nicht mehr.«
Er starrte mich eine Weile an, erst wütend, dann nachdenklich, dann beunruhigt.
Wellen brachen sich am Strand.
»Ich muss an sie denken«, pflichtete er mir schließlich bei.
»Ein guter Mann würde das tun«, meinte ich.
Er starrte mit seinen grauen Augen auf den See hinaus. »Alles wird sich ändern.«
»Ja.«
»Ich habe Angst«, gab er zu.
»Ja.«
Etwas in seiner Körpersprache entspannte sich, und plötzlich war Thomas wieder ganz mein älterer Bruder. »Tut mir leid«, sagte er. »Dass ich so reizbar bin. Ich … spreche nicht gern mit dir über Vampirangelegenheiten.«
»Ja, du würdest lieber so tun, als wären wir ganz normale Brüder mit ganz normalen Problemen.«
»Du nicht?«, fragte er.
Ich schielte eine Weile auf meine Füße. »Kann sein. Aber du kannst Tatsachen nicht ignorieren, nur weil sie unangenehm sind. Ich werde mich auf dich setzen und dich zwingen, auf dich aufzupassen, wenn es sein muss. Aber es ist wahrscheinlich besser für alle Beteiligten, wenn du es freiwillig tust.«
Thomas nickte. »Wahrscheinlich. Ich habe eine Lösung im Kopf«, entgegnete er. »Ich werde daran arbeiten. Reicht dir das?«
Ich hob die Hände, die Handflächen nach außen. »He, ich bin nicht dein Vater«, erwiderte ich. Dann war es an mir, die Stirn zu runzeln. »Wird die Familie deines Vaters ein Thema sein?«
»Wann ist sie das nicht?«
»Hm«, brummte ich. Stille senkte sich über uns. Am Himmel über dem See erschien das erste schwache Band von tiefem Orange. Es hatte bereits die Hochhäuser hinter uns erreicht. Das Licht bewegte sich gleichmäßig an den Seiten der Gebäude nach unten.
»Manchmal …«, brach Thomas das Schweigen, »manchmal hasse ich, was ich bin. Dann hasse ich es, ich zu sein.«
»Vielleicht ist es an der Zeit, daran zu arbeiten«, riet ich ihm. »Das ist nicht wirklich das, was man einem kleinen Kind vorleben sollte.«
Thomas starrte mich an. »Seit wann zum Teufel bist du so tiefsinnig?«
»Durch Erfahrung Weisheit erlangt ich habe«, antwortete ich mit Yoda-Stimme. Aber es kitzelte seltsam in meinem Hals, und ich musste husten.
Das tat ich länger, als nötig gewesen wäre, und wollte mich gerade wieder aufrichten, als Thomas mit plötzlich festerem Tonfall sagte: »Harry.«
Ich hob den Blick und sah einen jungen Mann auf uns zukommen.
Carlos Ramirez ist durchschnittlich groß und vielleicht ein wenig überdurchschnittlich muskulös. Er wird allmählich breiter, bekommt dieses erwachsene Aussehen, obwohl ich aus irgendeinem Grund immer noch einen schlaksigen Jungen Anfang zwanzig erwarte, wenn ich ihn sehe. Ramirez hatte sein dunkles Haar wachsen lassen. Seine Haut, die ohnehin einen leicht dunklen Teint hat, war sonnengebräunt. Er humpelte und stützte sich auf einen dicken Stock mit geschnitzten Symbolen – seinen Magierstab. Ramirez trug Jeans, ein Tanktop und eine leichte Jacke. Er ist hart im Nehmen, ein bewährter Kämpfer, ein guter Mann, auf den man sich verlassen kann, und einer der wenigen Mitglieder des Weißen Rates, die ich als Freunde betrachte.
»Harry«, begrüßte er mich. Thomas nickte er argwöhnisch zu. »Raith.«
Mein Bruder nickte ebenfalls. »Ist schon eine Weile her.«
»Carlos«, ergriff ich das Wort. »Was macht der Rücken?«
»Ich weiß jetzt, wann es regnen wird«, entgegnete er und schenkte mir ein kurzes Grinsen, »und ich werde eine Zeitlang nicht viel tanzen. Aber ich werde diesen gottverdammten Stuhl nicht vermissen.«
Er hob eine Faust. Ich boxte dagegen. »Was führt dich von der Küste hierher?«
»Ratsgeschäfte«, entgegnete er.
Thomas nickte und warf ein: »Ich gehe dann mal.«
»Nicht nötig«, hielt ihn Ramirez zurück. »Es wird heute Morgen sowieso öffentlich gemacht. McCoy fand, es wäre gut, wenn jemand, den du kennst, es dir sagt, Harry.«
Ich grunzte und zog die verfluchte Gewichtsweste aus. Die Machenschaften des Weißen Rates bereiten mir normalerweise Kopfschmerzen. »Worum geht es diesmal?«
»Friedensgespräche«, antwortete Ramirez.
Ich hob eine Braue. »Ernsthaft? Mit den Fomori?«
Die übernatürliche Welt war in letzter Zeit ziemlich durcheinander. Irgendein Irrer hatte es geschafft, den Roten Hof der Vampire vollständig auszulöschen, und das entstandene Vakuum hatte jahrhundertealte Machtverhältnisse ins Wanken gebracht. Das wichtigste Ergebnis dieses Chaos war, dass sich die Fomori, ein dämonisches Volk aus der Tiefsee, nach einer Ewigkeit wieder erhoben hatten, um verschiedenen Fraktionen der übersinnlichen Gemeinde Territorien zu entreißen und den normalen Menschen – vor allem den Armen, den Migranten, den Menschen ohne Fürsprechern – Schaden zuzufügen.
»Eine Konferenz der Unterzeichner des Abkommens«, bestätigte Ramirez. »Alle wichtigen Gruppierungen nehmen an dem Treffen teil. Offenbar haben die Fomori darum ersucht. Sie wollen ihre Differenzen mit uns beilegen. Jeder schickt einen Vertreter.«
Ich stieß einen Pfiff aus. Das war doch mal was. Eine Zusammenkunft einflussreicher Mitglieder der größten Mächte der übernatürlichen Welt in einer Zeit, in der die Spannung hoch und die Gemüter erhitzt waren. Ich bedauerte die arme Stadt, in der diese kleine Dinnerparty stattfinden würde. Tatsächlich …
Ich spürte, wie mir die Gesichtszüge entgleisten. »Augenblick. Hier? In Chicago? Wessen blöde Idee war das?«
»Der örtliche Baron hat sich als Gastgeber angeboten.«
»Marcone?«, fragte ich. »Gentleman« Johnny Marcone, ehemaliger Mafiaboss von Chicago, war jetzt Baron Marcone, der einzige normale Mensch, der das Abkommen der übersinnlichen Gemeinde unterzeichnet hatte. Seitdem baute er seine Machtbasis stetig weiter aus.
»Die Nummer, die er im Frühjahr mit Mab abgezogen hat«, sagte ich mit düsterer Miene.
Ramirez zuckte erneut mit den Schultern und spreizte die Finger. »Marcone hat Nikodemus Archleone in die Enge getrieben und ihm alles genommen, was er hatte, ohne auch nur eine einzige Bestimmung des Abkommens zu verletzen. Man kann über den Mann sagen, was man will, aber er hat’s drauf. Das hat eine Menge Leute beeindruckt.«
»Ja«, sagte ich düster, »das alles hat er getan. Sag mir, dass der Rat nicht will, dass ich unser Emissär bin.«
Ramirez blinzelte. »Bitte was? Oh … o Gott, nein, Harry. Ich meine … nein. Einfach nein.«
Mein Bruder hielt sich mit einer Hand den Mund zu, und ich beschloss, die Lachfältchen in seinen Augenwinkeln zu ignorieren.
Ramirez räusperte sich, bevor er fortfuhr: »Aber man wird von dir erwarten, dass du bei Bedarf als Verbindungsmann des Rates zum Winter dienst und für die Sicherheit der anwesenden Mitglieder des Ältestenrates sorgst. Alle werden sich an das Gastrecht halten, aber sie werden auch alle ihre eigenen Leute mitbringen.«
»Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser«, kommentierte ich. Missmutig warf ich die Gewichtsweste in den Sand. Beim Aufprall gab sie ein extrem lautes, dumpfes Geräusch von sich.
Ramirez hob eine Augenbraue. »Mein Gott, Harry! Wie viel wiegt das Ding?«
»Hundert«, antwortete ich.
Ramirez schüttelte den Kopf. Einen Moment lang war sein Blick nachdenklich und forschend. Ich kannte diesen Blick – den »Ich-frage-mich-ob-Harry-Dresden-immer-noch-Harry-Dresden-ist-oder-ob-die-Königin-der-Luft-und-Finsternis-ihn-in-ihr-persönliches-Monster-verwandelt-hat«-Blick.
Ich sah diesen Blick in letzter Zeit häufig. Manchmal sogar im Spiegel.
Wieder sah ich auf meine Füße hinunter und betrachtete den Boden. Ich sah ihn jetzt besser, da sich die Sonne dem Horizont näherte.
»Bist du sicher, dass der Ältestenrat will, dass ich im Sicherheitsteam mitmache?«, fragte ich.
Ramirez nickte. »Ich leite es und darf mir mein eigenes Team aussuchen. Hiermit wähle ich dich aus. Ich will dich dabeihaben.«
»Wo man ihn besser im Auge behalten kann«, murmelte Thomas.
Ramirez legte grinsend den Kopf schief. »Vielleicht. Oder vielleicht will ich auch nur noch mehr Gebäude abfackeln sehen.« Er nickte mir zu und sagte: »Harry, ich melde mich.«
Ich nickte ebenfalls. »War schön, dich zu sehen, ’los.«
»Raith«, verabschiedete sich Ramirez von Thomas.
»Hüter Ramirez«, antwortete mein Bruder.
Ramirez ging davon, auf seinen Stock gestützt und ohne viel Anmut, aber mit beträchtlicher Energie.
»Nun«, meinte Thomas. Er sah Ramirez nach, und seine Augen verengten sich nachdenklich. »Es sieht aus, als sollte ich mich besser auf den Weg machen. Die Dinge werden kompliziert.«
»Nicht unbedingt«, widersprach ich. »Vielleicht wird es ein nettes Abendessen, und alle singen ›Kumbaya‹.«
Er musterte mich.
Ich starrte wieder auf meine Füße hinunter und sagte: »Nun ja. Vielleicht auch nicht.«
Er schnaubte, schlug mir auf die Schulter und ging ohne ein weiteres Wort zurück zum Auto. Ich wusste, dass er dort auf mich warten würde.
Als er weg war, trat ich aus der Vertiefung im Sand und hob meine Gewichtsweste auf. Dann drehte ich mich um und studierte die Vertiefung, während die Sonne langsam aufging, sodass ich endlich etwas sah.
Ich hatte in einer humanoiden Fußspur gestanden.
Sie war deutlich über einen Meter lang.
Als ich mich umschaute, sah ich, dass es eine Reihe davon gab, die mehrere Meter voneinander entfernt waren. Die Spur führte zum Wasser, doch die aufkommende Brise am Seeufer verwischte sie bereits.
Vielleicht war ihr Auftauchen reiner Zufall.
Aber vielleicht eben auch nicht.
Ich hängte mir die Gewichtsweste über die Schulter und stapfte zurück zum Auto. Aus irgendeinem Grund hatte ich das ungute Gefühl, dass es bald wieder ziemlich hektisch zugehen würde.
2. Kapitel
Thomas kam zum Frühstück mit in meine Wohnung.
Na ja, technisch gesehen war es Mollys Wohnung. Aber sie war nicht oft da, und ich wohnte dort.
Die Botschaft des Schwarzelfenreiches in Chicago ist ein hübsches kleines Gebäude im Geschäftsviertel, mit einer Rasenfläche, die in Anbetracht der Immobilienpreise in der Stadt eine absolute Wucht ist. Sie sieht aus wie ein Gebäude, das eigentlich voller Menschen in streng nüchterner Geschäftskleidung sein sollte, die mit Geld und Zahlen hantieren, die für Normalsterbliche zu kompliziert, umständlich und gottverdammt komplex sind.
Das kommt der Wahrheit ziemlich nahe.
An der Einfahrt befand sich seit Kurzem ein kleines Wachhäuschen, und ein bieder aussehender Mann in einem langweiligen, teuren Maßanzug und mit dunkler Sonnenbrille sah von seinem Buch auf. Wir blieben am Fenster stehen, und ich sprach ihn an: »Der lila Mustang fliegt heute Abend.« Der Wächter starrte mich an.
»Äh … Moment«, sagte ich und zerbrach mir den Kopf. »Traurige Dienstage sind für die örtlichen Behörden kein Problem?«
Er glotzte mich weiterhin an. »Nennen Sie bitte Ihre Namen.«
»Ach, komm schon, Austri«, murrte ich. »Müssen wir diesen Tanz jeden Morgen wiederholen? Du weißt, wer ich bin. Verdammt, gestern Abend haben wir den Kindern eine Stunde lang zusammen beim Spielen zugesehen.«
»Da war ich nicht im Dienst«, sagte Austri. Sein Tonfall war völlig neutral, sein Blick leer. »Nennen Sie Ihre Namen, bitte.«
»Einmal«, schimpfte ich. »Würde es dich umbringen, das Sicherheitsprotokoll nur ein einziges verdammtes Mal nicht zu beachten?«
Er starrte mich wieder mit leerem Blick an, blinzelte langsam und antwortete: »Möglicherweise. Deshalb haben wir Sicherheitsprotokolle.«
Ich schenkte ihm erfolglos meinen zauberhaftesten Blick. Dann grummelte ich vor mich hin und begann, in meiner Sporttasche zu kramen. »Mein Name ist Harry Dresden, Ritter des Winters, Lehnsmann von Molly Carpenter, der Winterfürstin des Sidhe-Hofes, unter deren Schutz ich stehe. Das ist Thomas Raith, ebenfalls ihr Gast und ein Freund von Lady Evanna.«
»Er ist einer von Evannas Liebhabern«, korrigierte Austri akribisch. Dabei nickte er Thomas zu.
»Was geht, Austri?«, begrüßte ihn mein Bruder.
»Die Pflicht«, entgegnete Austri ernst, öffnete eine Mappe und blätterte eine Reihe von Profilausdrucken mit Fotos in der oberen Ecke durch. Bei meinem Profil hielt er inne, verglich sorgfältig das Bild mit mir und dann ein weiteres mit Thomas und nickte. »Parole bitte.«
»Ja, Sekunde.« In den Tiefen der Sporttasche fand ich schließlich den zusammengefalteten Zettel mit den wöchentlichen Passwörtern. Ich entfaltete ihn, schüttelte den Sand ab, warf einen Blick darauf und las: »›All my base are belong to me.‹ Was soll das überhaupt heißen?«
Austri starrte mich einen Moment lang frustriert an und seufzte. Dann wandte er sich an Thomas. »Wie lautet deine?«
»Die kleine Spinne ist in den Wasserspeier geklettert«, erwiderte Thomas prompt, ohne auf einen Spickzettel sehen zu müssen. Er hatte nämlich nichts Besseres mit seiner Zeit anzufangen, als vollkommen beliebig gewählte Parolen auswendig zu lernen.
Austri nickte, klappte die Mappe zu und legte sie weg. »Bitte warten Sie«, sagte er. Er drückte einen Knopf und murmelte fast lautlos ein Wort, von dem ich wusste, dass es etwa zweitausend tödliche magische Schutzzauber zwischen mir und der Eingangstür entschärfen würde. Dann nickte er mir zu und erklärte: »Sie können eintreten.«
»Danke«, antwortete ich.
Er lehnte sich in seinem Stuhl etwas zurück, entspannte sich, und die Illusion unauffälliger Menschlichkeit, die den Schwarzelfen umgab, wurde fluide und durchsichtig. Austri hatte graue Haut mit den Muskeln eines Turners darunter, einen Kopf, der etwas zu groß für den Rest seines Körpers war, und absolut riesige schwarze Augen wie der Außerirdische in dem Autopsievideo. Unter der oberflächlichen Illusion war sein Gesichtsausdruck entspannt und angenehm. »Meine Ingri würde gerne noch einmal mit Maggie und Sir Mouse spielen.«
»Das würde Maggie auch gern. Soll ich Mrs. Austri kontaktieren?«
Der Wächter nickte. »Das ist ihr Verantwortungsbereich. Heute Abend wieder Karten?«
»Ich würde gerne, aber ich kann noch nicht fest zusagen.«
Austri runzelte leicht die Stirn. »Ich ziehe es vor, meine Abendaktivitäten im Voraus zu planen.«
»Die Pflicht«, erklärte ich.
Sein Stirnrunzeln verschwand, und er nahm wieder sein Buch zur Hand. »Das ist natürlich etwas anderes. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Ihre Pflichten Ihnen erlauben, die Zeit zu erübrigen.«
Ich nickte und ging weiter.
Austri war ein klassischer Schwarzelf. Ein analfixierter, grimmiger Pedant, unmenschlich diszipliniert, halsstarrig, was seine Vorstellungen von Ehre und Pflicht anging – aber ein guter Mann, wenn man ihn erst einmal kennengelernt hatte. Der liebe Gott hat einen großen, bunten Zoo, wissen Sie?
Wir passierten zwei weitere Sicherheitskontrollen, eine in der Lobby des Gebäudes und eine weitere am Aufzug, der nach unten in den großen unterirdischen Komplex der Botschaft führte. Einer der anderen Schwarzelfen warf einen Blick auf meinen Führerschein, dann auf mich und bestand darauf, meine Größe zu messen und meine Fingerabdrücke zu nehmen, um zu überprüfen, ob es sich tatsächlich um mich handelte und nicht um einen Hochstapler in Harry-Verkleidung.
Ich hätte mich eigentlich nicht so sehr daran stören sollen. Mehr Kontrollen bedeuteten mehr Sicherheit, auch wenn Typen wie Gedwig hier sie gelegentlich etwas böswillig durchführen. Dennoch sorgte die besondere Mischung aus Paranoia und Pünktlichkeit der Schwarzelfen dafür, dass meine Tochter unter ihrem Dach besonders sicher war. Aber manchmal nervte es, und dies war so ein Tag.
Wir schlüpften in die Wohnung, in der es immer noch schummrig, dunkel und kühl war. Ich hielt einen Augenblick inne, um über das Wunder der Klimaanlage im Sommer zu staunen. Magie und Technik vertragen sich nicht, und die Aura der Energie, die einen wie mich umgibt, treibt mit so ziemlich allem, was nicht noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammt, lustige Spielchen. Ich hatte noch nie an einem Ort gelebt, dessen Klimaanlage dies mehr als ein paar Tage überlebt hat, aber die Schwarzelfen hatten diese Wohnung speziell für Molly entworfen. Sie hatte funktionierendes Licht, ein funktionierendes Radio, funktionierendes Warmwasser und eine funktionierende Klimaanlage, und ich hatte keine Ahnung, wie die cleveren Kerlchen das geschafft hatten. Die Schwarzelfen sind berühmt für ihre Handwerkskunst. Es heißt, wenn man etwas braucht, können sie es herstellen.
Vielleicht sollte ich Molly dazu bringen, nach einem Fernsehgerät zu fragen. Oder einem Internet…dings. Apparat. Eins von diesen Internet-Dingern. Alle sind so verrückt nach diesem Internet, da muss es doch irgendwie cool sein.
Wie auch immer, als wir ins Wohnzimmer kamen, tauchte Mister auf, mein großer grauer Kater, und warf sich mit einem Willkommen-daheim-Rammstoß gegen meine Schienbeine. Ich beugte mich zu ihm hinab und kraulte ihn hinter den Ohren, wie er es mag, was er mit großem Wohlwollen aufnahm, bevor er mir gestattete, mein Tagwerk fortzusetzen. Er ging an Thomas vorbei und rieb sich einmal am Bein meines Bruders ab, nur um ihn als sein Eigentum zu kennzeichnen. Dann entschwand er mit königlicher Gleichgültigkeit.
Mister ist kein junger Kater mehr, aber er weiß, wer in der Wohnung das Sagen hat.
Maggie schlief noch immer auf dem Diwan, zugedeckt mit einer schweren Decke. Neben ihr lag ein zotteliges graues Monstrum von der Größe eines Brauereigauls, mein Tempelhund Mouse. Er hob nicht mal den Kopf und öffnete auch nicht die Augen, als wir hereinkamen. Er gähnte nur und rekelte sich in eine etwas bequemere Position, ehe er einmal tief ausatmete und wieder einschlief. Maggies Atem stockte kurz, dann streckte sie die Hand aus und vergrub sie im Fell des Hundes. Beide seufzten im Schlaf und lagen dann wieder ruhig.
Ich stand einen Moment lang da und schaute auf sie hinab.
Normalerweise beschäftigte sich Thomas in solchen Augenblicken in der Küche mit Kaffeekochen. Aber diesmal trat er neben mich und sah das Mädchen und den Hund an.
»Verdammt«, sagte er.
Ich nickte. »Große Verantwortung.«
»Ja.«
»Du schaffst das.« Ich drehte mich um und sah Thomas an. Seine Miene war undefinierbar, eine Mischung aus Sehnsucht und sanftem, erlesenem Schmerz.
»Das glaube ich nicht«, gestand er.
»Sei kein Idiot«, widersprach ich. »Du liebst sie, und du wirst euer Kind lieben. Natürlich schaffst du das.«
Ein schwaches unglückliches Lächeln mischte sich in seinen Gesichtsausdruck.
Wir sahen wieder das schlafende Mädchen an.
Die Stille hatte eine Qualität, die ich nie gekannt hatte, bis ich mich um Maggie zu kümmern begonnen habe. Ein Gefühl von … ungeahnter Zufriedenheit. Da war sie, schlafend, glücklich, gesund und sicher.
Ich holte tief Luft, um mich wieder einzukriegen. Die Müdigkeit wich, nicht aus meinem Körper, sondern aus etwas Tieferem, das unendlich bedeutsamer war. Mein Bruder seufzte und schlug mir mit der Faust auf die Schulter. Dann ging er in die Küche und ich unter die Dusche.
Ich stand so lange unter dem heißen Wasser, wie es mir angemessen erschien, und als ich mich anziehen wollte, hörte ich Stimmen aus der Küche.
»Milch hat keine Gefühle«, verkündete Maggie gerade.
»Warum nicht?«, rief eine noch jüngere Stimme.
»Weil Milch nicht lebt«, antwortete Maggie heiter.
»Oh.« Es entstand eine Pause. »Aber sie bewegt sich.«
»Ich habe sie bewegt«, sagte Maggie. »Dann schwappt sie eine Weile herum.«
»Warum?«
»Wegen der Schwerkraft, denke ich«, entgegnete Maggie. »Oder vielleicht der Schwingkraft.«
»Meinst du Schwungkraft?«, fragte die jüngere Stimme.
»Höchstwahrscheinlich«, erwiderte Maggie ernst.
»Woher weißt du das?«
»Wenn du zehn bist, wirst du auch was wissen«, versprach Maggie.
»Warum?«
Ich betrat die kleine Küche und fand Maggie in ihrem Schlafanzug vor, die mit der aufmerksamen Hilfe von Mouse und eines aus Holz geschnitzten Schädels Chaos anrichtete. In den Augenhöhlen des Schädels glommen winzige grüne Lichtpunkte, wie die Glut eines bizarren Feuers. Die Hälfte des Inhalts der kleinen Speisekammer war auf dem Küchentisch versammelt.
Thomas saß mit einem Kaffee am Küchentisch. Er hatte bereits auch mir eine Tasse eingeschenkt. Ich ging zu ihm, nahm meine Tasse und murmelte: »Du hast nicht daran gedacht, einzugreifen?«
»Du hast so lange geduscht, dass ich nicht mehr genau weiß, was ich damals gedacht habe«, konterte er.
Ich senkte die Stimme ein wenig. »Wie hat sie sich geschlagen?«
Er entgegnete in der gleichen Lautstärke: »Ziemlich gut. Wir haben uns gegenseitig guten Morgen gesagt, Blickkontakt hergestellt, und sie schien es zu mögen. Sie hat gefragt, ob ich Pfannkuchen will.«
»Hast du etwa Ja gesagt?«
»Harry«, erwiderte Thomas, »sei ehrlich. Jeder will, dass ihm jemand Pfannkuchen macht. Wir sind nur alle zu erwachsen, um es zuzugeben.«
Ich trank einen Schluck Kaffee, denn gegen diese Logik kam ich nicht an.
Auch Thomas nippte an seiner Tasse. »Willst du es ihr verbieten?«
Ich genoss die Perfektion des ersten Schlucks Kaffees, ehe ich antwortete. »Ich denke, ich mache mich erst mal etwas kundig.«
Dann nahm ich meine Tasse mit in die Küche und hörte, wie Thomas aufstand, um mir zu folgen. Als ich in sein Blickfeld trat, drehte sich die Glut in den Augen des kleinen Holzschädels zu mir, und seine Stimme verkündete stolz: »Pfannkuchen sind leblos!«
»Richtig«, sagte ich zu dem Geist im Schädel.
In diesem hölzernen Schädel war er besser aufgehoben als in meinem, das kann ich Ihnen sagen. Seit sich der neu entstandene Geist des Intellekts in meinem Kopf gebildet hatte, war er gewachsen, bis er zu groß für meinen Schädel gewesen war, was zugegebenermaßen nicht lange gedauert hatte. Es war uns gelungen, ihn aus meinem Kopf zu extrahieren, und er hatte sich in dem geschnitzten Holzschädel eingerichtet, den ich für ihn vorbereitet hatte. Seitdem hatten wir den Geist – er war weiblich – unterrichtet und ihm einen endlosen Strom von Fragen beantworten müssen. »Morgen, Bonea.«
»Morgen ist, wenn die Sonne aufgeht!«, krähte der kleine Schädel. »Er endet am Mittag!«
Bonea ist voller zusammenhangloser Informationen. Sie kann einem Details aller möglichen Geheimnisse des Universums erzählen, aber sie hat keine Ahnung, welche Auswirkungen sie auf die tatsächliche Welt haben. Deshalb muss man vorsichtig mit ihr umgehen. »Wieder richtig«, bestätigte ich. »Guten Morgen, Maggie.«
»Hi, Dad«, begrüßte mich meine Tochter. »Ich mach Pfannkuchen zum Frühstück.«
»Großartig«, lobte Thomas und stupste mich in den Rücken.
Maggie warf meinem Bruder einen raschen Blick und ein schüchternes Lächeln zu.
Ohne mich umzudrehen, wusste ich, dass er ihr zuzwinkerte.
Ich hob die Brauen. »Ja. Pfannkuchen. Das ist neu.«
»Molly sagt, man muss tapfer sein und neue Dinge ausprobieren, um zu wachsen«, verkündete meine Tochter ernst, »und Thomas sagt, jeder mag Pfannkuchen.«
»Es mag ja auch jeder Pfannkuchen«, bekräftigte Thomas.
Ich warf ihm einen bösen Blick über die Schulter zu, um ihm klarzumachen, dass er seine Versuche einstellen sollte, mir zu helfen. Er erwiderte meinen Blick mit einem arglosen Lächeln.
»Beide haben nicht unrecht«, sagte ich ernst. »Brauchst du Hilfe?«
»Ich schaffe das schon«, wehrte sie ab. »Den Herd kann ich bedienen, und Bonnie kennt das Rezept.«
»Genau genommen kenne ich sogar zweihundertzwanzig verschiedene Pfannkuchenrezepte!«, prahlte Bonnie. »Sechzehn davon kann man mit dem derzeitigen Inventar der Küche umsetzen!«
»Wir nehmen Nummer sieben«, beschloss Maggie. »Alles selber machen ist am besten.«
Das hörte sich für mich nach einer riesigen Sauerei an. Ich schwöre, Mouse warf mir einen süffisanten Blick zu und leckte sich die Lefzen. Es würde zusätzliche Arbeit bedeuten, hinterher aufzuräumen – aber es wäre wahrscheinlich gut für Maggie, es zu versuchen. Also beugte ich mich zu ihr hinunter, küsste sie auf den Scheitel und mahnte: »Sei vorsichtig mit dem Herd und sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, Mäuschen.«
»Sehen Sie, Miss Maggie?«, ließ sich Thomas vernehmen. »Ich habe es Ihnen gesagt.«
Ich hielt inne und sah ihn an. »Hast du das alles arrangiert, nur damit du Pfannkuchen kriegst?«
Thomas setzte eine ernste Miene auf und sah Maggie an. »Ich leugne es nicht.«
Ich ließ die Augen rollen.
Maggie lachte. »Mister Thomas ist okay, Dad.«
Sie wandte sich wieder ihrer Aufgabe zu, und obwohl ihr Blick noch verschlafen war, konzentrierte sie sich auf die Arbeit mit der morgendlichen Energie, die nur jemand haben kann, der die unabänderliche Notwendigkeit von Kaffee noch nicht entdeckt hat.
Ich ließ mich auf einem Diwan in der Nähe nieder. Die Wohnung war im Grunde genommen ein einziger großer Raum, in dem sich ohne Trennwände die Küche, das Ess- und ein Wohnzimmer befanden. Es gab zwei Türen zu den beiden Schlafzimmern – Mollys und meinem. Nun, genau besehen war das andere Mollys Zimmer. Soweit ich wusste, war sie seit meinem Einzug nicht mehr darin gewesen, außer die paar Male, als sie hereingeschneit war, um Mouse zu streicheln, Maggie zu kitzeln, ein paar warme Worte mit mir zu wechseln und dann wieder zu verschwinden.
Es war schon eine Weile her, dass wir wirklich miteinander geredet hatten.
Die Wohnung erinnerte mich an meine im Souterrain von Mrs. Spunkelcriefs Pension. Nur dass es hier nicht so muffig und moderig roch wie in meiner alten Kellerwohnung und diese hier größer, heller beleuchtet, neuer und um einiges sauberer war – und sich einfach nicht richtig anfühlte.
So schäbig es auch gewesen sein mag, dieses versiffte kleine Apartment von früher ist mein Zuhause gewesen. Verdammt sollen die Vampire sein, weil sie es niedergefackelt haben. Verdammt soll Marcone sein, weil er das Grundstück gekauft und sein neues Hauptquartier dort errichtet hat, wo früher mein Zuhause gewesen ist.
Ich vermisse es.
Na schön. Es hat keinen Sinn, ihm nachzutrauern. Leben bedeutet Veränderung. Es kommt ständig irgendein Querschläger auf einen zu. Man kann nur versuchen auszuweichen.
Thomas suchte sich eine Stelle an der Wand, von der aus er die Küche einsehen konnte, und nippte an seinem Kaffee. Sein Blick war mit gedankenvoller Intensität auf Maggie gerichtet. »Sie lebt gefährlich, was?«
»Mouse wird mir Bescheid geben, wenn es ein Problem gibt«, beruhigte ich ihn.
»Braver Hund«, kommentierte Thomas.
»Wenn du willst«, erbot ich mich, »kann ich Bruder Wang schreiben. Ihm sagen, du willst einen Welpen.«
»Du hast ihm den schon gestohlen«, schnaubte Thomas.
»Aus Versehen«, rechtfertigte ich mich. »Außerdem glaube ich, dass sich das Fellknäuel damals absichtlich bei mir versteckt hat, auch wenn es Wang nicht gefallen mag.«
»Nun«, sinnierte Thomas, »Mouse ist ein ziemlich guter Hund.«
»Verdammt richtig«, bestätigte ich.
»Lass mich darüber nachdenken«, bat Thomas. »Es ist gerade viel los.« Er hatte den Blick noch immer nicht von Maggie abgewandt.
»He, Mann«, sagte ich. »Bist du okay?«
Er warf mir einen Seitenblick zu und schenkte mir ein leises Lächeln. »Ich denke sehr intensiv über die Zukunft nach.«
»Nun«, entgegnete ich, »das ist nachvollziehbar.« Ich schloss die Augen und spürte einen dumpfen, gleichmäßig pochenden Schmerz in den Gliedern, im Takt mit meinem Herzschlag.
Plötzlich musste ich heftig niesen.
»Gesundheit!«, rief Maggie prompt aus der Küche.
»Unnngh«, erwiderte ich. »Danke.« Der Nieser hatte einen Schmerzschub in meinen Gliedern ausgelöst, der erst nach einigen Augenblicken abebbte. Ich öffnete ein Auge. Das war nicht gut.
Die Macht des Winterritters in mir ermöglicht es mir, mit meinem Bruder, dem Vampir, Schritt zu halten, während ich im Sand laufe und hundert Pfund zusätzliches Gewicht trage. Sie dämpft unter anderem Schmerz bis zu dem Punkt, an dem ich ihn nur noch als eine Art angespanntes, silbriges Gefühl empfinde. Knochenbrüche sind irgendwie lästig. Eine blutende Wunde ist eine Art Ablenkung – aber ich hatte nie, nie einfach nur Schmerzen.
Außer jetzt.
Blödes Amt des Ritters des Winters. Es bringt einen ständigen Ansturm urtümlicher, wilder Emotionen und Begierden mit sich, die wie überladene Versionen meiner eigenen Instinkte sind. Ich trainiere nicht jeden Morgen so intensiv, weil es mir Spaß macht, sondern weil Disziplin und Routine mir helfen, die primitiveren Instinkte in Schach zu halten. Tägliches intensives Training zwingt den Ritter des Winters in mir, Energie darauf zu verwenden, meinen Körper in Gang zu halten – nach meinem Zeitplan, nach meinem Willen –, und verringert dadurch den Druck, den er auf meine bewussten Gedanken ausübt, und obwohl ich dadurch in der Lage bin, Schmerzen zu ignorieren und meinen Körper weit über die normalen Grenzen der menschlichen Ausdauer hinaus anzustrengen, ist der Einfluss des Amts ein fortwährendes Ärgernis, das ständige Anstrengung erfordert, um den Winterritter in mir im Zaum zu halten.
»Wow!«, sagte Thomas. »Alles klar bei dir, Nerd?«
»Das war komisch«, antwortete ich.
Mister kletterte auf den Diwan, ließ sich auf meinem Schoß nieder und schob den Kopf unter meine Hand. Ich streichelte ihn mechanisch, und er gab ein Schnurren von sich, das sich wie kochendes Wasser in einem Topf anhörte.
Ein oder zwei Sekunden nach diesem Gedanken nieste ich erneut, diesmal heftiger, und mich durchflutete eine Welle der Erschöpfung.
Außerdem ertönten ein Klirren und ein platschendes Geräusch. Mister sprang von meinem Schoß und rannte davon. Ich brauchte ein paar Anläufe, um meinen Blick zu fokussieren, aber dann sah ich, dass ein Metalltopf mit einem schwarzen Plastikgriff an der Seite auf dem Teppich vor mir lag. Kleine Dampfschwaden stiegen aus dem klatschnassen Teppich daneben auf.
Ich blinzelte zu Thomas empor und tauschte einen Blick mit ihm aus. Sein Gesicht verriet mir, dass er keine Ahnung hatte, was gerade geschehen war. Wir sahen beide wieder den Topf an.
Stirnrunzelnd beugte ich mich hinunter, um ihn zu berühren. Er war nicht so heiß, dass ich mich verbrannt hätte, aber fast. Ich packte den Griff und hob den Topf hoch. Der Griff fühlte sich ein paar Sekunden lang seltsam weich an – und dann zitterten plötzlich Plastik, Metall und Wasser gleichermaßen und zerschmolzen zu einer klaren gallertartigen Flüssigkeit, die mir aus den Fingern glitschte und auf den Teppich platschte. Ektoplasma, der Rohstoff der Geisterwelt.
Was zum Teufel …?
Ektoplasma ist eine fremdartige Substanz. Magie kann es formen und mit Energie versorgen, und solange die Energiezufuhr besteht, behält es seine Form. Geister aus dem Niemalsland können Körper daraus erschaffen, in denen sie in der materiellen Welt herumlaufen, als unternähmen sie einen Weltraumspaziergang. Doch sobald die Energie versiegt, verwandelt sich der erschaffene Körper wieder in das ursprüngliche schleimartige Ektoplasma, das seinerseits innerhalb weniger Augenblicke von der materiellen Welt zurück ins Niemalsland diffundiert.
Wo zum Teufel war der Topf hergekommen?
Meine Elitetruppe? Die kleinen Elfen, die mir immer wieder zu Diensten sind, haben mit Sicherheit auch eine boshafte Ader, die weit über das normale Maß hinausgeht. Konnte mir eine von ihnen einen Streich gespielt haben?
Möglich. Aber wenn ja, woher hatte der Scherzkeks gewusst, woran ich gerade gedacht hatte?
Das war verdammt seltsam.
»Harry?«, fragte Thomas.
»Verdammt seltsam«, sagte ich diesmal laut und strich mir über die Nase, die plötzlich völlig verstopft war. »Sogar für meine Verhältnisse.«
»Dad?«, rief Maggie aus der Küche.
»Hmmm?«
»Ich soll den Pfannkuchen erst wenden, wenn er goldbraun ist, sagt Bonnie. Aber ich sehe den gebackenen Teil nicht. Woher soll ich das also wissen?«
Ich erhob mich, schnappte mir eine Handvoll Taschentücher und ging in die Küche. »Das ist ein bisschen knifflig«, antwortete ich. »Du erkennst es daran, wie der Teig auf der oberen Seite aussieht. Ich zeig’s dir.«
»Gut.«
Ich unterrichtete also meine Tochter in der hohen Kunst des Pfannkuchenwendens. Wir hatten gerade den zweiten gebacken, als irgendwo in einem der Zimmer eine kleine Glocke sehr schnell zu läuten begann – die Alarmanlage der Wohnung.
Mouse drehte den Kopf zu der Geräuschquelle und stieß ein leises Knurren aus. Maggie blinzelte und sah mich unsicher an.
Thomas stieß sich mit einem kleinen Schub mühsam bezähmter Energie von der Wand ab. Er warf mir einen Blick zu und ging dann in die Küche, um eines der großen Messer aus dem Messerblock zu nehmen.
»Es kommt jemand«, sagte ich. »Lass uns erst mal abwarten. Also, wir machen jetzt alles so, wie wir es geübt haben. Nimm Bonnie, geh in mein Zimmer und sperr sie in ihre Box. Bleib bei ihr, kauere dich hin und sei still. Okay?«
Maggie wirkte unsicher, nickte aber. »Gut.«
»Dann mal los.«
Ich schloss die Schlafzimmertür hinter ihr und holte meinen Magierstab von seinem Platz neben dem Kamin. Plötzlich wünschte ich, ich hätte einen Weg gefunden, mehr Stunden mit meinem persönlichen magischen Arsenal zu verbringen. Ich hatte es nicht geschafft, denn ich war damit beschäftigt gewesen, Vater zu sein, was viel mehr Zeit in Anspruch nahm, als ich für möglich gehalten hatte. So war mir nur sehr wenig Zeit geblieben, um aktiv an meiner Ausrüstung zu arbeiten – ein sehr zauberstundenintensives Unterfangen. Ich hatte nur den Magierstab, den ich auf der mysteriösen Insel Demonreach mitten im Michigansee geschnitzt hatte, meinen Sprengstock und eine notdürftige Version meines alten Schildarmbands – aber das musste reichen.
Was auch immer den Alarm ausgelöst hatte, es schien unwahrscheinlich, dass es einfach so durch die Sicherheitskontrollen der Schwarzelfen marschieren konnte – aber wenn es das nicht getan hatte, warum hatte dann die Alarmanlage angeschlagen?
»Was denkst du?«, fragte mich Thomas.
»Ich denke, alles, was die Sicherheitskontrollen der Schwarzelfen überwindet, um hierher zu gelangen, macht mich ein wenig nervös.«
»Oh, es liegt also nicht nur an mir. Das ist schön.«
Sekunden später klopfte eine schwere Hand laut an die Wohnungstür.
3. Kapitel
Ich fokussierte meinen Willen und lenkte Kraft in meinen Magierstab. Die spiralförmig angeordneten Runen glommen in smaragdgrünem Feuer, und winzige Rauchschwaden stiegen von ihm auf. Der saubere rauchige Duft verbrannten Holzes lag in der Luft. Runen und Sigillen aus grünem Licht bedeckten die Wände.
Ein Magierstab ist ein vielseitiges Werkzeug. Man kann damit nach Bedarf alle möglichen Kräfte freisetzen und die verschiedensten Auswirkungen hervorrufen, und ich sorge dafür, dass mein Magierstab stets bereit ist, um bei Bedarf Verwüstung anzurichten oder magische Energie zu reflektieren, je nachdem, was ich gerade brauche.
Thomas huschte völlig lautlos zur Wand neben der Tür, sodass jeder, der hindurchkam, in seiner Reichweite war. Er hielt die flache Seite der Messerklinge gegen seinen Unterschenkel gedrückt, während er mir zunickte, um mir zu signalisieren, dass er bereit war.
Ich öffnete in aller Ruhe die Wohnungstür.
Da stand ein alter Mann. Er war ein paar Zentimeter kleiner als der Durchschnitt und kräftig. Wie ich hielt er einen Magierstab in der Hand, wenn auch der seine um einiges kürzer und dicker war als meiner, sodass die beiden Stäbe unsere körperlichen Unterschiede widerspiegelten. Einige silberweiße Haarsträhnen standen wirr um seinen ansonsten kahlen Kopf, und er schien mehr Altersflecken zu haben als bei unserer letzten Begegnung, doch seine dunklen Augen hinter seiner Brille blitzten hellwach. Er trug ein schlichtes weißes Baumwoll-T-Shirt zu einer blauen Latzhose und Arbeitsstiefel mit Stahlkappen. Er war mein Mentor, Ebenezar McCoy, ranghohes Mitglied des Weißen Rates der Magier.
Der alte Mann ist außerdem mein Großvater.
Er musterte mich, runzelte gedankenvoll die Stirn, studierte meine Pose und dann meinen grün leuchtenden Magierstab.
»Ein neuer«, stellte er fest. »Sehr stabil. Vielleicht ein bisschen primitiv.«
»Ich hatte nur ein Taschenmesser«, sagte ich. »Kein Schmirgelpapier, ich musste Steine benutzen.«
»Ah«, antwortete er. »Darf ich eintreten?«
Hinter Ebenezar sah ich Austri auf dem Flur stehen, eine Hand in seinem Anzug, ein paar Finger an ein Ohr gepresst. Seine Lippen bewegten sich, aber ich hörte nicht, was er sagte. »Austri? Was hat es mit dem Alarm auf sich?«
Austri lauschte offenbar auf etwas in seinem Ohr, das nur er hören konnte, und nickte. Er nahm die Hand nicht aus der Jacke, als er mir sagte: »Die Person ist den Schwarzelfen bekannt. Ein Vollstrecker des Weißen Rates, gilt als äußerst gefährlich. Die Person hat sich nicht an die Sicherheitsprotokolle gehalten.«
»Ich habe keine achtundvierzig Stunden Zeit, um auf die Analyse meiner DNA zu warten, selbst wenn ich sie Ihnen geben würde«, knurrte Ebenezar. »Das habe ich doch schon gesagt. Etri kennt mich persönlich. Er bürgt für mich.«
Es gab ein seltsames, fast plätscherndes Geräusch, und plötzlich glitt ein Dutzend weiterer Schwarzelfen wie Austri aus dem Boden, als wäre er aus Wasser. Sie hielten Waffen in der Hand, moderne wie antike, aber sie machten keine Anstalten, anzugreifen. Impulsive Reaktionen liegen nicht in ihrer Natur. Ihre Mienen waren schwer zu deuten, aber definitiv unfreundlich.
Austri beäugte Ebenezar und dann mich. »Dresden? Ist diese Person als Miss Carpenters Gast zu betrachten?«
»Das wäre für alle Beteiligten am einfachsten, denke ich«, erwiderte ich.
»Es ist unerheblich, wie einfach oder wie kompliziert es ist«, entgegnete Austri. »Ist er Miss Carpenters Gast oder nicht?«
»Ja«, sagte ich. »Lasst ihn eintreten. Ich übernehme die Verantwortung für ihn, solange er hier ist.«
Austri runzelte die Stirn, und sein Gesichtsausdruck nahm verschiedene Nuancen von Zweifel an, was eine ganze Weile dauerte. Aber schließlich nahm er die Hand aus der Jacke und nickte mir zu. Auf seine Geste hin verschwanden er und der Rest des Schwarzelfen-Sicherheitsteams den Gang hinunter aus unserem Blickfeld.
»Die sind ganz schön pingelig, was?«, fragte ich.
»Das ist gar nicht das Problem«, meinte Ebenezar.
»Du hast sie absichtlich provoziert«, mutmaßte ich.
»Zunächst nicht. Aber einer von ihnen war rotzfrech zu mir.«
»Und da hast du sie einfach ignoriert?«
Etwas Schalkhaftes blitzte in seinen Augen auf. »Es tut ihnen gut, wenn jemand sie von Zeit zu Zeit daran erinnert, dass sie nicht alles kontrollieren können und dass ein Mitglied des Ältestenrates gehen kann, wohin es will.« In seinen Augenwinkeln bildeten sich Lachfältchen. »Der letzte Typ hat echt genervt.«
»Gedwig«, sagte ich und musste grinsen. »Ja, ein echter Miesepeter. Er ist immer ganz besonders paranoid.« Ich ließ die Kraft aus meinem Magierstab weichen, und das Licht der Runen erlosch. Mit einer Hand machte ich eine Geste in Richtung Thomas, und mein Bruder wich von der Tür zurück. Dann trat ich zur Seite und öffnete die Tür weiter für meinen Großvater. »Komm rein.«
Dem alten Mann entgeht nicht viel. Er kam mit dem ruhigen, wachsamen Blick eines Mannes herein, dem nichts entgeht, der alles in sich aufnimmt –, und sofort wirbelte er seinen Magierstab herum, sodass er genau auf Thomas wies.
»Was tut dieses Ding hier?«, verlangte Ebenezar zu wissen.
Thomas hob die Brauen. »Dieses Ding? Ziemlich anmaßend für den Scharfrichter des Weißen Rates.«
Soweit ich wusste, war meinem Großvater nicht bekannt, dass Thomas und ich eine gemeinsame Mutter haben, seine Tochter. Ebenezar hatte also keine Ahnung, dass er noch einen Enkel hatte. Und er hatte … ein kleines Problem mit Vampiren des Weißen Hofes. (Das Paranet nennt sie »Whampire«, aber ich weigere mich, auf solche Albernheiten einzugehen, es sei denn, es kommt mir gerade zupass.)
»Vampir«, knurrte Ebenezar, »du warst dem jungen Dresden bisher ein nützlicher Verbündeter. Mach es nicht kaputt, indem du meine Aufmerksamkeit erregst.«
Thomas’ Augen funkelten eine Nuance heller, und er setzte das Lächeln auf, das er zur Schau stellt, wenn er besonders wütend ist. »Das sind große Sprüche für jemanden, der sich mir nicht zu nähern wagt, ohne bereits einen Schutzzauber parat zu haben.«
»Du kleiner mieser …«, begann mein Großvater.
Der Gestank verbrannten Teigs erfüllte die Luft, und ich ging zum Herd, wo ich den Pfannkuchen, der während des Streits angebrannt war, umdrehte. Dann schlug ich den Pfannenwender mit unnötiger Wucht zurück auf die Arbeitsplatte und sagte, schäumend vor Wut: »Meine Herren, ich muss wohl keinen von Ihnen daran erinnern, dass Sie Gäste in meinem Haus sind!«
Das traf die beiden wie ein Eimer kaltes Wasser.
In unserer Welt kommen die alten Traditionen des Gast- und des Hausrechts unantastbaren Gesetzen vielleicht am nächsten. Diese Traditionen besagen, dass man Gäste ehren und wie Mitglieder der Familie des Gastgebers behandeln muss und dafür von ihnen erwarten darf, dass sie sich wie Mitglieder der Familie des Gastgebers benehmen.
In diesem Fall waren wir alle tatsächlich eine Familie, nur wusste mein Großvater es nicht.
Aber Thomas wich ein wenig zurück, seine angespannte Haltung lockerte sich, und er gab seine raubtierhafte Pose auf. Mein Großvater senkte seinen Magierstab und wandte sich halb von Thomas ab.
»Sorry, Harry«, sagte Thomas. »Es kommt nicht wieder vor.«
Ich nickte ihm zu und warf dem alten Mann einen Blick zu.
»Ich muss mich bei dir entschuldigen«, ließ sich mein Großvater vernehmen. »So hätte ich mich in deinem Haus nicht benehmen dürfen. Tut mir leid.«
Nun, das war kein Vormittag fürs Familienalbum. Aber er führte auch nicht zu einem Begräbnis. Ich musste wohl lernen, die kleinen Siege zu schätzen.
»Danke«, antwortete ich den beiden. Ich streckte die Hand aus, und Thomas reichte mir das Fleischermesser, den Griff voraus.
Nachdem ich es zurück in den Messerblock gesteckt hatte, räusperte ich mich und wandte mich wieder meinem Großvater zu.
Er musterte Thomas drohend. Dann entspannte er sich plötzlich und fragte im Plauderton: »Rieche ich da Pfannkuchen?« Er stellte seinen Magierstab in die Ecke neben der Tür.
Ich stellte meinen dazu. »O ja. Ich mache uns gerade Frühstück.«
»Harry«, warf Thomas ein, »ich werde gehen.«
»Das musst du nicht«, widersprach ich.
Er sah Ebenezar an, die Lippen wie ein Strich zusammengepresst. »Doch, muss ich.«
»Thomas …«, begann ich.
Mit einem Gesicht wie eine Gewitterwolke hob mein Bruder die Hand, um meine Einwänden zuvorzukommen, und schlenderte hinaus.
Mein Großvater sah ihm nach, bis sich die Tür hinter ihm schloss, dann hob er unter dem Gestrüpp seiner buschigen Brauen den Blick zu mir.
»Na, vielen Dank auch«, sagte ich.
»Du solltest mir tatsächlich dankbar sein«, entgegnete er kühl. »Ich sage dir, du kennst sie nicht so gut, wie du glaubst.«
»Der Weiße Hof mag grundlegend böse sein«, räumte ich ein. »Aber Thomas ist in Ordnung.«
»Genau das wird dir jeder, den sie je verführt haben, über sie erzählen«, erwiderte mein Großvater finster. Aber dann hob er die Hand, und sein Ton wurde sanfter. »Hör zu, das ist ganz allein deine Sache. Ich habe nicht den weiten Weg hierher zurückgelegt, um zu versuchen, dein Leben zu bestimmen. Aber du bist jung, und ich habe Erfahrungen mit ihnen und eine Sichtweise auf sie, die du nicht hast. Ich will nur nicht, dass du ihre wahre Natur auf die harte Tour herausfindest.«
Ich sah den alten Mann stirnrunzelnd an. Wenn er so redete, war das stets ein Zeichen, dass er besorgt war.
»Da ist er ja!«, rief Ebenezar und lächelte, als Mouse zu ihm herübergewatschelt kam, um ihn zu begrüßen. Er kraulte den Hund voller Zuneigung hinter den Ohren. »Ich habe nicht viel Zeit, deshalb komme ich gleich zur Sache«, sagte er dann wieder zu mir. »Du steckst in großen Schwierigkeiten.«
»Aha«, entgegnete ich. Ich ging zurück in die Küche und goss Teig in die Pfanne. »Das erste Mal, dass wir uns seit Chichén Itzá von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Immer schön geschäftlich bleiben, was, Sir?«
Er dachte einen Moment lang darüber nach, kniff leicht die Augen zusammen. »Seit jener Nacht hatten wir alle Hände voll zu tun. Menschen sind gestorben. Du hast keine Ahnung, wie es da draußen zugeht.«
»Du hast mir auch gefehlt«, sagte ich. »Ich freue mich auch, dich gesund und munter zu sehen.«
»Dafür ist keine Zeit«, beharrte er.
»Pfannkuchen?«, fragte ich. »Ich bin nach meiner morgendlichen Joggingrunde immer ziemlich hungrig.«
Die Stimme des Alten wurde härter. »Ich bin nicht zum Scherzen aufgelegt«, knurrte er. »Es gibt einen Antrag an die Vollversammlung des Rates, dir deinen Status als Mitglied des Weißen Rates vollständig zu entziehen.«
Ich hob eine Augenbraue. »Erst zwingt mich der Rat, einen dieser gottverdammten grauen Umhänge zu tragen, ob ich will oder nicht, und jetzt will er mich schon wieder rausschmeißen? Ich krieg noch ein Schleudertrauma.«
»Du wirst mehr als das bekommen, wenn der Antrag angenommen wird«, antwortete er hitzig. Danach brauchte er einen Augenblick, um sich zu beruhigen. »Harry, jetzt ist nicht der Moment, um sich von Gefühlen leiten zu lassen.«
Ich schaute finster auf den Pfannkuchen hinunter. In letzter Zeit hatte ich viel Übung darin bekommen, meine Gefühle im Zaum zu halten. »Na schön«, entgegnete ich. »Waffenstillstand. Temporär. Auf welchen Vorwurf stützt sich der Rat?«
»Ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren«, erwiderte er. »Zum Beispiel deine nicht den Standards entsprechende Beförderung zum Vollmagier. Wie häufig du in Fälle verwickelt warst, die im Fokus der Öffentlichkeit standen. Dein Beharren darauf, seit über einem Jahrzehnt offen als Magier zu agieren, und nicht zuletzt der angebliche Interessenkonflikt, in dem du dich aufgrund deines Dienstes für Königin Mab befindest.«
»All das trifft zu«, sagte ich. »Ich habe es auch nie geleugnet. Es ist aktenkundig. Wo ist das Problem?«
»Das Problem ist, dass Vertrauen im Weißen Rat mehr und mehr zur Mangelware wird«, antwortete Ebenezar. »Deine Entscheidungen haben dich zu einem Außenseiter gemacht. In Zeiten der Anspannung begegnet man so jemandem natürlich mit Misstrauen.«
Ich wendete den Pfannkuchen. Es war genau der richtige Zeitpunkt. Er war goldbraun und knusprig.
»Wenn sie mich rausschmeißen«, dachte ich laut, »bedeutet das, dass ich nicht mehr unter dem Schutz des Rates stehe. Ich werde offiziell kein Magier mehr sein.«
»Du hast dir im Laufe der Jahre viele Feinde gemacht«, entgegnete Ebenezar. »Wenn man dich aus dem Rat ausschließt, sähen deine – und meine – Feinde dich in einer geschwächten Position und würden gegen dich vorgehen. Wie viel Schutz kann dir Königin Mab bieten?«
»Mab«, erwiderte ich, »bietet mir überhaupt keinen Schutz, eher das Gegenteil. Würde ich sie um Schutz bitten, schneidet sie mir höchstens die Kehle durch und schließt mich in Bernstein ein, das ist ihre Auffassung von Schutz und Sicherheit.«
Die Bemerkung entlockte dem Alten kein Lächeln. Stattdessen starrte er mich mit eisigem Ernst an.
Ich seufzte tief. »Es ist nicht Königin Mabs Aufgabe, ihren Ritter zu beschützen, sondern umgekehrt. Sollte mich irgendetwas töten, war ich ihrer Meinung nach von vornherein nicht stark genug, um ihr Ritter zu sein.«
»Du nimmst das nicht ernst«, warf er mir vor.
Ich legte den Pfannkuchen auf den Stapel derer, die Maggie schon gemacht hatte, und goss Teig für den nächsten in die Pfanne. »Wenn es hart auf hart kommt, kann ich mich immer noch auf Demonreach verkriechen.«
»Gott, wenn sie die ganze Wahrheit über diesen Ort wüssten«, brummte Ebenezar. »Aber was dann? Hockst du für den Rest deines Lebens auf deiner Insel?«
»Lass den Antrag nicht zur allgemeinen Abstimmung kommen«, sagte ich. »Du gehörst dem Ältestenrat an. Zieh ein paar Fäden. Kontrollier das Geschehen.«
»Das kann ich nicht«, antwortete Ebenezar. »Ohne Quorum muss es eine allgemeine Abstimmung sein, und vier Mitglieder des Ältestenrates werden bei den Friedensgesprächen sein, wenn die Abstimmung stattfindet.«
»Welche vier denn?«
»Cristos, Lauschet dem Wind, Martha Liberty und ich.«
»Oh«, sagte ich. Mein Großvater ist ein verschlagener alter Fuchs, mit einem dichten Netzwerk von Verbündeten im gesamten Weißen Rat – und fast ebenso vielen Feinden. Der Merlin kann Ebenezar nicht ausstehen, und von den drei Mitgliedern des Ältestenrates, die die nächste Ratssitzung leiten würden, hatte mir nur Rashid je eine gewisse Zuneigung entgegengebracht. Selbst wenn der Ältestenrat abstimmen konnte, würde ich mit zwei zu eins verlieren.
Wie das Fußvolk des Weißen Rates zu mir stand, wusste ich nicht. Magier leben sehr lange, und dies auch, weil sie unnötige Risiken meiden. Und wenn man im Wörterbuch des Weißen Rates »Unnötiges Risiko« nachschlägt, findet man mein Bild, meine Adresse, all meine persönlichen Kontaktinformationen und mein Abschlusszeugnis der Mittelstufe.
»Du musst mit einigen Magiern persönlich sprechen«, riet mir Ebenezar. »Schüttle ein paar Hände. Sorg dafür, dass sie wissen, wer du bist. Beruhige sie. Du hast nur ein paar Tage Zeit, aber wenn du dich beeilst, kannst du genug Unterstützung sammeln, damit der Antrag erst gar nicht zur Abstimmung kommt.«
»Nein«, widersprach ich, »kann ich nicht. Nicht, ohne meine Pflichten als Hüter und Ritter des Winters zu vernachlässigen.«
»Was?«, fragte er.
Ich erzählte ihm von meinem morgendlichen Treffen mit Ramirez. »Ich habe den Auftrag, auf der Konferenz der Unterzeichner des Abkommens auf euch aufzupassen und als Verbindungsmann zum Winter zu fungieren.«
Der alte Mann fluchte.
»Genau«, pflichtete ich ihm bei.
Der größte Teil meiner Unterstützer würde also auf dem Friedensgipfel sein, und ich würde dort für ihre Sicherheit sorgen, während man im Ältestenrat über mein Schicksal abstimmte.
»Das ist eine Falle.«
»Hmpf«, stimmte Ebenezar zu.
»Steckt der Merlin dahinter?«, fragte ich. »Fühlt sich irgendwie nach ihm an.«
»Vielleicht«, antwortete mein Großvater. »Andererseits macht Cristos in letzter Zeit auch jede Menge Ansagen. Schwer zu sagen, wer da die Fäden gezogen hat.«
Ich wendete den nächsten Pfannkuchen. Hätte ich nicht Jahre mit dem alten Mann verbracht, wäre mir nichts an seinem Tonfall aufgefallen, aber seine Formulierung hatte eine merkwürdige Betonung. Er hatte »Cristos« gesagt, aber gemeint hatte er …
»Der Schwarze Rat«, sagte ich.
Ebenezar verzog das Gesicht und sah zuerst mich und dann die Wände an.
Der Schwarze Rat ist ein Mysterium. Unbekannte aus der Gemeinschaft der Magier haben in den letzten Jahren viel Unheil in meinem Leben angerichtet. Ihre Ziele sind ebenso unklar wie ihre Identität, aber es ist offensichtlich, dass sie verdammt gefährlich sind. Cristos war unter merkwürdigen Umständen in den Ältestenrat aufgestiegen – Umstände, die darauf hinzudeuten schienen, dass der Schwarze Rat innerhalb des Rates selbst Macht ausübt. Ein Weißer Rat, der stümperhaft und pingelig ist und sich nur für seine eigene Politik interessiert, ist schon an sich eine ziemlich üble, aber leider normale Sache – aber ein Weißer Rat, den Leute von der Art führen, denen ich im Laufe der Jahre begegnet bin, wäre ein wahrer Albtraum.
Ein paar von uns hatten sich zusammengetan, um genau das abzuwenden. Da die Gründung eines Geheimbunds innerhalb des Weißen Rates als Beweis für ein Komplott zum Umsturz des Rates gilt, müssen wir mit unserem kleinen Klüngel sehr, sehr vorsichtig sein. Vor allem, da wir tatsächlich eine Art Komplott gegen den Weißen Rat schmiedeten, auch wenn wir es zu seinem Wohl taten.
»Ich checke die Bude hier dreimal am Tag und lasse das Kleine Volk nach möglichen Lauschangriffen Ausschau halten«, beruhigte ich Ebenezar. »Niemand belauscht uns.«
»Gut«, antwortete er. »Nun ja, ob Cristos nun ein offener Diener des Schwarzen Rates ist oder nur seine Marionette, ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass er dich loswerden will.«
»Was gibt es sonst noch Neues?«
»Sei nicht albern«, erwiderte Ebenezar. »Bisher hat der Schwarze Rat Geheimaktionen durchgeführt, und manchmal hast du dich eingemischt – aber sie haben dich nie direkt angegriffen.«
»Ich habe ihm wohl einmal zu viel Kopfschmerzen bereitet.«
»Was ich damit sagen will, ist«, fuhr Ebenezar fort, »was auch immer hier läuft, dich zu vernichten hat für diese Leute jetzt Priorität.«
Ich wendete einen weiteren Pfannkuchen. Ein Teil des Teigs spritzte und blieb auf dem Herd kleben. Ich hatte nicht wirklich Angst, aber der Schwarze Rat hatte einige furchterregende Dinge auf dem Kerbholz.
»Was denkst du, was passieren wird?«, fragte ich Ebenezar.
»Dass diese Leute ohne Vorankündigung zuschlagen werden. Diese Abstimmung … sie soll dich ablenken von dem Sturm, der sich bereits zusammenbraut.«
»Was also tun wir?«
»Konzentrier dich nicht zu sehr auf diese Falle. Genau das wollen sie, damit du die eigentliche Gefahr nicht siehst. Ich werde sehen, was ich wegen dieser Abstimmung unternehmen kann. In der Zwischenzeit tust du, was du tun musst.«
»Um was zu erreichen?«, fragte ich.
»Na, um zu überleben«, antwortete er. Sein Blick wanderte ins Leere. »Du hattest es bisher in mancher Hinsicht leicht.«
»Leicht?«, wiederholte ich ungläubig.
»Du hattest Probleme«, räumte er ein. »Aber du konntest immer den Lancelot spielen, bist mit offenem Visier in den Kampf geritten und hast ihn jedes Mal für dich entschieden.«
»Nicht jedes Mal.«
»Mehr, als die meisten geschafft hätten«, beharrte er. »Doch die Einsätze werden immer höher, und du verstrickst dich immer tiefer, Junge.«
»Was soll das denn bitte heißen?«
»Ich glaube, dass dir jemand, von dem du es nicht erwartest, in den Rücken fallen wird.«
4. Kapitel
Aus dem hinteren Teil der Wohnung ertönte ein leises Geräusch, und der alte Mann fuhr herum, zischte ein Wort, und sein Magierstab flog quer durch den Raum in seine Hand.
»Halt, halt, halt!«, sagte ich hastig.
»Wer ist das?«, verlangte Ebenezar zu wissen. Er warf mir einen strengen Blick zu. »Wer?«
»Würdest du dich bitte mal entspannen? Nur für fünf Sekunden?«
Ebenezar funkelte mich an. »Warum?«
»Weil ich nicht möchte, dass meine Tochter bei ihrer ersten Begegnung von ihrem Urgroßvater zu Tode erschrickt«, antwortete ich.
Daraufhin blinzelte der Alte. Zweimal. Dann ließ er seinen Magierstab sinken. »Was? Sie ist hier? Sie war die ganze Zeit über hier?«
»Maggie hat Probleme mit neuen Leuten«, sagte ich leise. »Das ist immer schwer für sie.« Ich schaute zu Mouse hinunter und wies mit dem Kinn auf die Tür zum Schlafzimmer. Der große Hund stand gehorsam auf und trabte zur Tür hinüber, um für das Mädchen eine beruhigende Präsenz zu sein.
»Du hast den Vampir in ihre Nähe gelassen?«, flüsterte mein Großvater mit schockierter Miene.
»Maggie?«, rief ich leise. »Bitte komm mal raus. Hier ist jemand, den du kennenlernen solltest.«
Die Tür öffnete sich einen Spalt breit. Ich sah einen Teil ihres Gesichts und ein braunes Auge, das vorsichtig herausschaute.
»Ich möchte dir deinen Urgroßvater vorstellen«, fuhr ich ebenso leise fort. »So hatte ich mir das eigentlich nicht gedacht«, setzte ich mit einem Blick zu dem alten Mann hinzu. »Komm, Mäuschen.«
Die Tür öffnete sich etwas weiter. Maggie streckte eine Hand heraus und tastete herum, bis sie Mouse’ Fell fand. Sie krallte die Finger in seine Mähne und öffnete dann ganz behutsam die Tür. Maggie sah Ebenezar an, ohne sich zu bewegen oder zu sprechen.
»Maggie«, begann er ruhig. Seine Stimme klang rau. »Hallo, junge Dame.«
Sie nickte ihm vorsichtig zu.
Ebenezar erwiderte ihr Nicken. Dann wandte er sich zu mir um, und in seinen Augen glühte ein Zorn, wie ich ihn noch nie bei ihm gesehen hatte. Er öffnete den Mund.
Bevor er ein Wort sagen konnte, warf ich ihm einen warnenden Blick zu und schlug vor: »Wie wäre es, wenn wir in den Garten gehen, damit Mouse sich die Beine vertreten kann?«
»Okay«, antwortete Maggie.
Der alte Mann bedachte mich mit einem weiteren finsteren Blick. Dann entspannte er seine Körperhaltung ganz bewusst und wandte sich mit einem sanften Lächeln wieder meiner Tochter zu. »Das hört sich gut an«, sagte er.
Ich stand neben Ebenezar und sah zu, wie Maggie und Mouse mit den Kindern der Schwarzelfen spielten.
Der Garten im Innenhof der Schwarzelfenbotschaft war wunderschön. In seiner Mitte standen ein paar Bäume. Gras und Blumen wuchsen in geschmackvollem Gleichgewicht und ließen den Kindern genug Platz zum Herumrennen und Spielen.
Schwarzelfenkinder sind seltsam aussehende kleine Kreaturen, mit der grauen Haut ihrer Eltern und absolut riesigen Augen – wirklich niedlich. In der Botschaft wohnte ein halbes Dutzend Kinder in Maggies Alter, und alle liebten Mouse, der sie in ein Fangenspiel verwickelte, bei dem er mit Leichtigkeit vor ihnen weglief und sich trotz seiner Muskelmasse gewandt drehte und auswich.