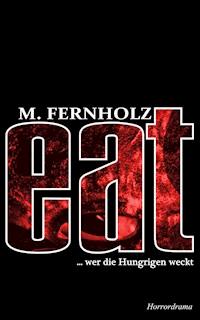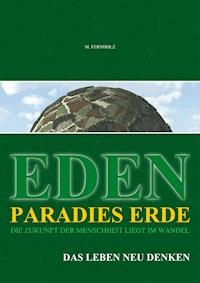Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jeder Mensch hat seine ganz individuellen Geschichten zu erzählen. Diese Anthologie zeigt in den acht Stories Einblicke in die Erlebniswelt der jeweiligen Protagonisten. Alles scheint so ziemlich normal zu verlaufen, manchmal auch etwas kurios, aber dann zeigt sich allmählich eine bitterböse Erkenntnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
M. Fernholz
COLDCUT
... denn das Ende überrascht am meisten
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
DER UNFALL
PANIK
ALLES FÜR DIE KATZ
DER FREMDE
DER TANZ
DAS BUCH
VERZWEIFELTE FRAGEN
UFO
Impressum neobooks
DER UNFALL
Ich ringe nach Luft. Hitze staut sich in meinem Schädel.
Panik. Ich bilde mir ein, jemand würde meine Luftröhre zusammendrücken.
Ich weiß nicht, was gerade passiert. Es riecht nach nasser Erde, nach Holz. Nur verschwommen nehme ich meine Umgebung wahr; aber ich erkenne natürliches Grün.
Ich versuche, mich zu orientieren. Den Kopf bewege ich panisch in alle Richtungen. Alles ist wie in einem Traum. Nichts erscheint mir real; nur die Qual der mangelnden Atemluft zeigt mir, dass ich lebe.
Hastig ertaste ich meinen Hals. Etwas drückt auf die Halsschlagader. Die Hitze in meinem Kopf steigt stetig, der Pulsschlag dröhnt bedrohlich.
Meine Hände gleiten tastend höher. Nasser glatter Kunststoff. Ich lasse die Hände nach vorn rutschen, sodass ich sie vor meinen Augen sehen kann. Sie liegen auf dem Visier.
Nun begreife ich. Erneut taste ich panisch am Hals. Lange werde ich nicht mehr durchhalten, mir wird schon jetzt wieder schwindlig. Das Gefühl, mich übergeben zu müssen, setzt ein. Die Bäume und Sträucher um mich herum verblassen. Doch dann kann ich den Kinngurt öffnen, und mit einem tiefen Luftzug reiße ich den Helm von meinem Kopf. Ich japse. Muss mich übergeben, was mich wiederum ermattet, da ich in diesem Moment nicht ausreichende Sauerstoffzufuhr bekomme. Das Herz rattert. Meine Sehorgane scheinen aus den Höhlen gequetscht zu werden, während ich würge und erneut Magensäure und Undefinierbares ausspeie. Ich spüre, wie stark mein Brustkorb sich hebt und senkt, als ich kurz darauf angestrengt atme.
Allmählich aber werde ich mir selbst bewusster - die Luft in meinen Lungen transportiert wieder ausreichend Sauerstoff in mein Gehirn. Auch wenn mein Kopf noch immer dröhnt, wage ich zu beurteilen, dass ich einen Unfall mit meinem Motorrad hatte. Nur weiß ich nicht, wie lange es her ist, noch, wo mein Krad ist und wohin ich eigentlich unterwegs war.
Ich sehe mich um. Außer den Bäumen, die ihre schon teilweise braunen Blätter verlieren, und dem feuchten Unterholz ist nichts zu erkennen. Plötzlich überkommt mich das Gefühl von Kälte. Obwohl ich unter den Achselhöhlen nass bin, friere ich zitternd. Und während ich dieses Vibrieren meines Körpers beobachte, gleitet mein Blick abwärts zu den Beinen. Schluckend reiße ich die Augen auf, als ich mein rechtes Bein begutachte. Erneut ein Anfall von Angst und Panik – ein erschreckend großer Ast steckt schräg in meinem Oberschenkel. Das Hosenbein der Jeans ist mit Blut getränkt.
Schmerz, unvorstellbaren Schmerz verspüre ich, als ich realisiere, dass dieses Stück Holz in meinem Körper steckt. Das Blut in meinem Leib schießt durch die Venen und Arterien, so dass mein Herz erneut zu rattern beginnt. Tausende, vielleicht auch millionen oder abermillionen Gedanken strömen durch die Nervenbahnen meines Hirns. Es arbeitet – errechnet, was in diesem Augenblick sinnvoll ist.
Fakt ist, dass ich mich irgendwo in einem Wald befinde. Es kann sein, dass ich wer weiß wie weit von der Zivilisation entfernt bin. Außerdem wird es bald dunkel sein. Was soll ich tun? Was ist sinnvoll, und was ist nicht sinnvoll? Beim Ersthelfer-Lehrgang habe ich erfahren, dass Fremdkörper in der Wunde verbleiben sollen, bis ärztliche Hilfe da ist.
Hilfe! Das war ein ermunterndes Wort, und hastig taste ich meine Lederjacke ab. Wieder spüre ich Schmerzen. Meine komplette rechte Körperseite und der Rücken brennen enorm - gerade jetzt, wo meine Hand die Schürfwunden berühren.
Die Jacke hat dem Asphalt nicht standgehalten. Aber wo ist das Handy? Ich kann es nicht finden, es muss beim Sturz verloren gegangen sein. Erneut ergreift mich Panik.
»Hilfe!«, schreie ich laut. Kurz lausche ich und rufe ein weiteres Mal. Doch die Sekunden ohne Antwort scheinen eine Ewigkeit anzudauern. Niemand wird meine Hilfeschreie wahrgenommen haben.
Der Fremdkörper in meinem Fleisch löst ein drückendes Tuckern aus – so, als würde das Bein gleich explodieren. Dazu kommt der stechende Schmerz, so dass ich meine Augen vor Qual zusammenkneifen muss. ›Das Ding muss raus!‹, rede ich mir ein. ›Das Ding muss raus!‹, wiederhole ich den Gedanken. Dann schreie ich, und sofort umfasse ich das hervorstehende Stück des Astes und ziehe.
Der Schmerz während dieser Aktion ist zehnmal stärker als der, der vorherrschte, als das rinden- und knospenumwucherte Holz, welches jetzt wie ein Widerhaken wirkt, noch in Ruheposition im Fleische verblieb.
Mein Schrei ertönt noch immer. Auch dann noch, als der blutverschmierte Ast mit einem Ruck die Wunde verlässt. Aufgrund der zuvor genutzten Kraftanstrengung knalle ich aus sitzender Position mit dem Rücken auf den Boden, so dass ich erschöpft liegen bleibe. Ich kann fühlen, wie das warme Blut aus der Wunde rinnt. ‚Ich muss hier weg‘, denke ich, als mir klar wird, dass ich verbluten würde, sollte ich nicht jetzt nach Hilfe suchen. Bei diesem Gedanken schlucke ich, atme tief durch und rapple mich auf. Verkrampft verziehe ich mein Gesicht, denn der Schmerz im Bein ist nach wie vor mein Begleiter.
Anfangs hüpfe ich noch, bis ich wegen des unebenen Bodens stolpere. Dann krieche ich, richte mich wieder etwas auf, um schneller voranzukommen. Trotz der Schmerzen muss ich weiter. Aber wohin? Ich schleppe ich mich in eine wahllose Richtung, versuche aber, nicht im Kreis zu laufen, was sich in der beinahen Dunkelheit als schwierig erweist.
Nach ungefähr fünf Minuten – zumindest schätze ich die Zeit so ein – komme ich auf einen sandigen Weg, der von Regen durchnässt ist. Euphorie lässt meine Schmerzen für einen Augenblick vergessen. Ich habe die Chance auf Hilfe zu stoßen. Doch welche Richtung soll ich einschlagen? Von welcher Seite bin ich ursprünglich gekommen? Befand ich mich überhaupt auf diesem Landweg? Wie weit hatte ich mich von meinem Motorrad entfernt, während ich panisch damit beschäftigt war, den Helm von meinem Haupt zu entfernen? Und wie weit bin ich überhaupt von meinem Gefährt weggeschleudert worden?
Verzweiflung. Das Herz in meiner Brust rattert vor Angst; Angst vor der Unwissenheit des vorangegangenen Geschehens; Angst, um eine Entscheidung zu treffen. Ich schlucke, während ich abwechselnd in beide Richtungen des Weges sehe. Links oder rechts? Wohin? Den linken Pfad solle man meiden, erzählte mir meine Großmutter einst. Zwar beruht diese Aussage auf biblische Weltanschauungen, die ich mit meinem Realitätssinn nicht vereinbaren kann, doch in meiner derzeitigen Verfassung bin ich kurz davor, zumindest in diesem Augenblick, dieser christlichen Weisheit Vertrauen zu schenken. Aber hier bin ich nicht, um ins Jenseits zu gehen. Oder doch? Wenn ich nicht jetzt bald eine Lösung finde, werde ich verbluten und stehe wirklich unmittelbar vor der Schwelle des Todes.
Ich schlage den rechten Weg ein, und ich bin erleichtert, mich endlich entschieden zu haben; erleichtert, mich auf ein Ziel zuzubewegen.
Ich springe auf einem Bein, setze das verletzte hin und wieder auf, damit ich nicht falle. Auch wenn ich einen stechend reißenden Schmerz verspüre, ich brauche schnellstmöglich ärztliche Hilfe.
Nach wenigen Metern halte ich den Schmerz jedoch nicht mehr aus; ich stürze zu Boden und bleibe einen Moment entkräftet liegen. Der nasse Sand in meinem Mund knirscht, als ich meine Zähne zusammenbeiße, um Mut zum Aufstehen zu fassen. Ich schaffe es, mich aufzurichten; dennoch merke ich, wie meine Kräfte mehr und mehr nachlassen. Aber ich sehe einen verschwommenen hellen Punkt vor mir, weit vor mir. Dieser teilt sich so, dass die nun zwei kleineren Leuchtpunkte sich waagerecht voneinander entfernen und an Schärfe gewinnen. Doch mein Gleichgewichtssinn lässt nach, kurz wird mir schwarz vor Augen. Ich falle.
Wieder dröhnt mein Kopf, als ich auf meine linke Seite knalle, eine kleine Böschung hinabrutsche und an einem dünnen Baumstamm hängenbleibe. Trotz des Pochens in meinem Kopf, schüttle ich diesen, wobei ich mit den Augen zwinkere und sie anschließend öffne. Orientierend schaue ich mich um, erkenne die Anhöhe der Böschung. ›Ich muss da wieder hoch!‹ Somit drehe ich mich unter Schmerzen auf die Bauchseite und krieche ein Stück hoch. Teilweise rutsche ich wieder etwas hinunter, kann mich aber an Grasbüscheln festklammern und mich erneut hochziehen.
Plötzlich halte ich inne und lausche. Ist es das Geräusch eines Motors? Ich höre genauer hin. Ja, es muss ein Auto sein. »Hilfe!«, rufe ich mit geschwächter Stimme, und noch einmal beiße ich die Zähne zusammen und ziehe mich die nasse Böschung hinauf. Das Geräusch ist jetzt genau über mir. Der Motor des Fahrzeugs tuckert in gleichem Rhythmus. Ich schaue auf, sehe Helligkeit am Rande des kleinen Abhangs. Doch die Umgebung um mich herum verschwimmt. Ich kann nur noch eine schattige Gestalt sehen, die oben im Lichtkegel erscheint. Dann verblasst alles, gefolgt von Schwärze.
Es schimmert hell, als ich blinzle. Nur langsam sehe ich die Umwelt schärfer. Jemand beugt sich über mich, und ich spüre feuchtes Reiben an meiner rechten Körperseite. Es riecht wie bei einem Arzt. Erleichterung. Mein Bein tuckert zwar noch immer, aber der Schmerz ist nur latent. Ich sehe jetzt klar. Eine ältere Dame hockt am Rand des Bettes, auf dem ich liege. Sie lächelt dezent, als sie erkennt, dass ich erwacht bin. Ihr dunkles schulterlanges Haar muss gefärbt sein, denn in ihrem Alter, welches ich auf fünfzig schätze, müsste ergraut sein. Dieses schließe ich daraus, weil sie Hautfältchen im Gesicht aufweist, die sie aber mit Hilfe von Make-up gut zu kaschieren weiß. Trotz alledem wirkt die Dame sehr attraktiv. Um ihren Hals hängt eine goldfarbene Kette, an der eine Art Amulett aus gleichem Material hängt. Dieses ist oval, und in der Mitte funkelt ein roter Rubin.
Sie hört auf, meine Schürfwunden zu behandeln; nimmt das mit Sterilisationsmittel durchtränkte Tuch von meinem Körper und beugt sich näher an mein Gesicht. Sie starrt mir in die Augen. »Sie haben Glück. Sie haben keine Gehirnerschütterung davongetragen«, weiß die Dame zu berichten. Mich umsehend stelle ich fest, dass ich hier nicht in einem Krankenhaus oder einer ähnlichen Einrichtung bin. Links neben dem Bett steht ein altmodischer Nachtschrank, auf welchem Mullbinden, Pflaster und Druckverbände liegen. Das Desinfektionsmittel in der halbleeren Flasche schaukelt leicht kreisend. Die für meinen Geschmack hässlich umschirmte Nachttischlampe ist zwischen den medizinischen Utensilien kaum wahrzunehmen. An der Wand befindet sich ein Kleiderschrank, der den gleichen Stil besitzt, wie das kleine Schränkchen direkt neben mir. Wahrscheinlich gehören die Möbelstücke, wie auch das Bett, auf dem ich liege, zusammen, um eine Kombination zu ergeben.
Zwei Schritte vor dem Bett ist die offenstehende Tür, die, wie auch deren Rahmen, ebenfalls so robust erscheint, wie das Mobiliar. Die Tapete ist auch nicht nach meinem Geschmack. Sie ist beige, weist handtellergroße verschnörkelte Pik-Muster auf, die so ineinandergewunden sind, dass die zum Beispiel obere rechte Hälfte eines Piks schon die untere linke Hälfte des anderen Piks darstellt, und so bis in die Unendlichkeit hätten fortgeführt werden können. Diese Symbole sind mit einer groben Strichstärke eines sehr dezenten Rot dargestellt, wobei das schmal darüber gedruckte Schwarz nur als zeichnende Farbe dient.
Auf der rechten Seite steht ein Schaukelstuhl in der Ecke; eine zusammengelegte Decke ist auf der Sitzfläche abgelegt. Eine Gardine verdeckt das Fenster, an dessen Glas der Regen peitscht. An der Wand über mir hängt ein dunkles, etwa 40 Zentimeter großes Kruzifix.
»Wo bin ich?« frage ich.
»Oh, entschuldigen Sie, ich habe Sie an der Böschung, etwa hundert Meter von hier, verletzt vorgefunden.«
Einen kurzen Augenblick überlege ich; dann erinnere ich mich an die Silhouette, die von Licht umgeben war.
»Ach, und Sie dürfen Angelika zu mir sagen«, fügt die Dame hinzu, wobei sie noch mehr lächelt als zuvor. Dann scheint Nachdenklichkeit in ihren Augen zu sein, ihre Mundwinkel fallen wieder; dennoch bleibt das Lächeln erhalten. »Wissen Sie, dass Sie mich an meinen Sohn erinnern?!«, sagt Angelika. Einen Moment noch schaut sie mich weiterhin nachdenklich an, wendet ihren Blick kurz von mir und setzt eine erneute Fröhlichkeit auf. »Wie heißen Sie eigentlich?«
Etwas verwirrt durch die Erwähnung ihres Sohnes, antworte ich: »Ich bin Daniel.«
Als Angelika das durchweichte Tuch in eine Nierenschale legt, schlage ich das Bettdecke zurück und erkenne ein verbundenes Bein. »Was haben Sie gemacht?« will ich wissen. »Die Wunde muss von einem Arzt behandelt werden.«
»Kein Grund zur Sorge«, beruhigt mich die auf der Bettkante Sitzende, »Ihre Verletzungen sind gut versorgt. Die Wunde am Bein wurde gesäubert und mit zehn Stichen vernäht.«
Ein wenig bin ich erleichtert, dennoch kann ich der Sache nicht ganz trauen. Ihrem Outfit nach zu urteilen, macht Angelika eher den Eindruck, als würde sie sich nicht unnötig die Hände schmutzig machen wollen. »Sie sind Ärztin?« frage ich - beinahe sicher, dass es so ist.
»Nein, aber Krankenschwester. Und ich habe damals viel von meinem Mann gelernt. Er war Chirurg.« Angelika lächelt mich aufmunternd an. »Sie brauchen sich wirklich keine Sorgen machen, Daniel. Bei mir sind Sie gut aufgehoben.«
Meine Verwirrung lässt mich die Umgebung erneut absuchen. Im Flur, durch die Tür hindurch, sehe ich auf einem metallenen Rollwagen blutdurchtränkte Tupfer, Operationsbesteck und einen Infusionsbehälter an einem Gestänge. In einem Metalleimer steckt ein blutbefleckter grüner Stoff. Hat sie mich hier in diesem Zimmer operiert? Wie darf sie das ohne eine erforderliche Genehmigung? Und gerade hier, wo alles nicht steril ist? Mir ist klar, dass sie es einfach tat. Doch Angelika hätte doch den Notarzt alarmieren können. Es wäre gar ihre Pflicht gewesen. Innere Panik breitet sich in mir aus. Was ist, wenn meine Beinverletzung nicht ausreichend behandelt wurde? Ich male mir aus, wie sich das Bein entzünden wird und absterben würde. Entsetzt blicke ich Angelika an. »Weshalb haben Sie keinen Notruf abgesetzt, als Sie mich fanden?«, will ich von ihr wissen.
Gelassen antwortet die Gefragte: »Es hätte zu spät für Sie sein können, da ich weder ein Mobiltelefon noch einen Festnetzanschluss habe. Bis zur nächsten Farm oder auch bis in die nächste Stadt wäre ich über eine halbe Stunde unterwegs. Dies alles hätte zulange gedauert, Sie hatten bereits zu viel Blut verloren, Daniel.«
Mit dieser Antwort muss ich mich vorerst zufrieden geben; außerdem bin ich zu erschöpft und müde, um mich aufzuregen. Morgen würde alles schon anders aussehen. Ich fange an zu gähnen, als Angelika meint, dass ich jetzt schlafen und mich schonen solle. Kaum spricht sie zu Ende, fallen mir auch schon die Augen zu, und ich sinke in wohltuenden Schlaf. Beim Aufwachen erinnere ich mich sofort an das gestrige Gespräch mit Angelika, in dem sie erwähnte, dass sie kein Telefon besitze. Unruhe wächst in mir heran; denn meine Überlegung bedeutet, dass ich niemanden informieren kann, wo ich stecke. Selbst ich weiß dies gar nicht. Wo bin ich überhaupt? Mein Handy kommt mir in den Sinn; doch mir fällt ein, schon gestern danach gesucht zu haben, es aber nicht vorhanden war.