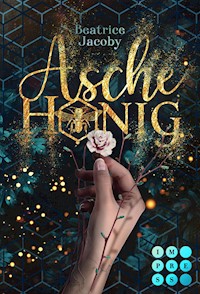4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Feelings
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Eine Welt der Isolation ohne Farben – ein dystopisch-romantischer Urban-Fantasy-Roman über den Kampf gegen Konventionen und die Kraft der Liebe In der isolierten Kleinstadt Mary's Yard sind die Menschen durch einen Gendefekt farbenblind. So auch Kalla und Sander. Die beiden stammen aus zwei völlig verschiedenen Welten: Er ist der tadellose Mustersohn des Bürgermeisters und sie eine sogenannte »Meerjungfrau«, ein Mädchen aus dem Problemviertel am Hafen, das mit dem Kopf lieber in den Gewitterwolken über ihrer Heimat steckt als in der streng genormten Realität. Durch ein Missverständnis kreuzen sich die Wege der beiden und allen Konventionen ihrer Herkunft zum Trotz entwickelt sich ein starkes Band zwischen ihnen. Doch ihre Gefühle werden auf eine harte Probe gestellt, als Kalla und Sander unverhofft das Geheimnis der Farbe entdecken, das alle Wahrheiten in ihrer schwarz-weißen Welt in Frage stellt – selbst die als Volksmärchen verschriene Liebe. Bald müssen sie sich entscheiden: Wie weit sind sie bereit für die Farbe und für die Liebe zueinander zu gehen? Für Fans von Ally Condie und Lauren Oliver. »ColourLess – Lilien im Meer« von Beatrice Jacoby ist ein eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr von uns ausgewählte erotische, romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du auf unserer Facebook-Seite. Genieße jede Woche eine neue Geschichte - wir freuen uns auf Dich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 706
Ähnliche
Beatrice Jacoby
ColourLess Lilien im Meer
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Eine Welt der Isolation ohne Farben – ein dystopisch-romantischer Urban-Fantasy-Roman über den Kampf gegen Konventionen und die Kraft der Liebe
In der isolierten Kleinstadt Mary’s Yard sind die Menschen durch einen Gendefekt farbenblind. So auch Kalla und Sander. Die beiden stammen aus zwei völlig verschiedenen Welten: Er ist der tadellose Mustersohn des Bürgermeisters und sie eine sogenannte »Meerjungfrau«, ein Mädchen aus dem Problemviertel am Hafen, das mit dem Kopf lieber in den Gewitterwolken über ihrer Heimat steckt als in der streng genormten Realität.
Durch ein Missverständnis kreuzen sich die Wege der beiden und allen Konventionen ihrer Herkunft zum Trotz entwickelt sich ein starkes Band zwischen ihnen.
Doch ihre Gefühle werden auf eine harte Probe gestellt, als Kalla und Sander unverhofft das Geheimnis der Farbe entdecken, das alle Wahrheiten in ihrer schwarz-weißen Welt in Frage stellt – selbst die als Volksmärchen verschriene Liebe.
Bald müssen sie sich entscheiden: Wie weit sind sie bereit, für die Farbe und für die Liebe zueinander zu gehen?
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Mein Absturz begann klammheimlich mit einem Traum. Ich wusste sofort, dass es nur eine Illusion sein konnte, als ich den Blick übers Wasser schweifen ließ – die Sonnenstrahlen fielen aus einem wolkenlosen Himmel aufs Meer und brachten die sich in friedlichem Rhythmus wiegenden Wellen zum Funkeln. Der Himmel über Mary’s Yard war dank des rauen Klimas und des Smogs eigentlich nie wolkenlos und die See schon gar nicht friedlich. Sie tobte ständig. Es war also eindeutig ein Traum. Deshalb wunderte es mich nicht, dass ich mich nicht daran erinnerte, wie ich hergekommen war oder was ich überhaupt im Hafenviertel verloren hatte. Die Natur der Träume ist so. Sie ergeben zumeist wenig Sinn, dennoch kommen einem die irrwitzigsten Dinge nicht merkwürdig vor.
Ich stand am Kiesstrand, in sicherer Entfernung zu den heranrollenden Wellen. Sie kicherten leise, als sie in weißem Schaum an die über Jahrzehnte abgerundeten Steine schwappten. Weiter draußen auf offener See, wo die größeren Wellen träge auf und ab wogten, sah ich kein einziges Boot. Ich kniff die Augen angestrengt zusammen, während ich den Horizont noch einmal absuchte, doch außer der blendenden Sonne war weit und breit nichts zu sehen. Bestes Wetter, wie man es in meiner Heimat vielleicht alle paar Jubeljahre mal erlebt, und kein einziger Fischer versuchte sein Glück.
Da – ein Zucken im Wasser. Im Augenwinkel war es nur ein Schatten gewesen. Ein Aufflackern. Ich drehte den Kopf nach links. Noch mehr Meer, noch mehr nasser, glitzernder Teppich, der sich in Richtung Horizont ausstreckte. Ich beobachtete die Wasseroberfläche in der Erwartung, einen Blick auf einen besonders großen Fisch zu erhaschen, doch stattdessen fanden meine Augen eine junge Frau, die mit einem breiten Lächeln im Gesicht aus den Wellen hervorstieß. Malerisch tauchte ihr bloßer Oberkörper aus dem sicherlich eisigen Wasser auf und sie wirbelte ihre ellenlangen Haare nach hinten.
Natürlich hätte ich aus Respekt und sicher auch aus einer ganzen Menge Scham weggesehen, hätte die Szene in der Realität stattgefunden – niemals würde ich so tief sinken, verstohlen aus den Augenwinkeln eine junge Frau dabei zu begaffen, wie sie nackt im Meer badete. Meine Mutter hatte mich anständig erzogen, nicht zu einem Voyeur! Aber das hier war bewiesenermaßen ein Traum, also erlaubte ich mir, einen Blick zu riskieren. Einer Ausgeburt meiner eigenen Fantasie beim Schwimmen zuzusehen erschien mir moralisch vertretbar. Bevor ich mir weitere Gedanken darüber machen konnte, was sich in der Logik der Traumwelt mit mir als einzigem Zeugen schickte oder nicht, tat das Mädchen im Wasser uns beiden einen Gefallen und versank wieder bis zum Schlüsselbein in den Wellen. Das Meer diente ihr als schillerndes, schulterfreies Kleid mit unendlicher Schleppe.
Mit kräftigen Schwimmzügen schob die Schönheit das Wasser zur Seite und kam näher ans Ufer – an mich – heran. Ihr Mund war ungewöhnlich breit, ihre Lippen schmal und blass. Ihr dunkles Haar lag in dicken, nassen Strähnen an ihrem Kopf, umrahmte ihr herzförmiges Gesicht und schlängelte sich wie ein Vorhang bis zu ihren Schultern herunter. Wo sie die Meeresoberfläche berührten, fächerten sie sich auf, schwebten förmlich auf ihr dahin. Und mit keinen mir bekannten Worten könnte ich beschreiben, was an ihren Augen so fesselnd war, dass ich wie in Trance einige Schritte hin zum Meer machte.
Als ich schließlich stehen blieb, konnten die letzten Ausläufer der Wellen an meine Schuhspitzen tippen. Das Mädchen mit den Zauberaugen tauchte hell lachend ab, nur um unerwartet nah am Strand wieder aufzutauchen und mir aufgeregt zuzuwinken, als würden wir uns schon Jahre kennen. Doch dem war nicht so.
Um ehrlich zu sein, war ich froh, dass diese Traumfigur keinem mir tatsächlich bekannten Gesicht nachempfunden war. Das hätte es sehr viel unangenehmer gemacht, dieser hypothetischen Person später ohne Scham in die Augen zu sehen, dachte ich, als schließlich im flachen Wasser keine Wellen mehr ihren Oberkörper verdeckten.
Erneut regte sich etwas im Meer, nur eine Armlänge hinter meiner neuen Bekanntschaft. Ich erwartete, dass sie erschrocken aufjapsen und an den Strand hechten würde, doch sie blieb ruhig. Bei näherem Hinsehen erkannte ich, dass es überhaupt keinen dicken Fisch gab, vor dem sie sich erschrecken konnte – die Bewegung im Wasser verursachte sie selbst. Dramatisch langsam erhob sich eine gigantische Flosse aus den Wellen. Ihre Spitzen waren so hauchdünn und transparent wie das Papier, aus dem Kinder Teelichter und Laternen basteln. An ihren Rändern rannen wie in einem kleinen Wasserfall Tropfen herab, sprangen eilig zurück ins Meer, wo sie hingehörten, während sich die schuppige Schwanzflosse höher in die Luft streckte.
»Schön, dich zu sehen, Sander«, sang die Meerjungfrau meinen Vornamen – ziemlich dreist für eine Fremde. Vielleicht stammte sie aus anderen Gewässern und besuchte diese Küste bloß. Das würde erklären, warum sie nicht mit unseren Höflichkeitsfloskeln vertraut war.
Der bloße Klang ihrer Stimme zauberte trotzdem ein dösiges Lächeln auf mein Gesicht. Pure Harmonie – als hätte sie Harfensaiten, wo anderen Stimmbänder gewachsen waren.
Grazil zog sich die junge Frau ein Stück näher an den Strand, ließ ihren Kopf dabei auf die Seite kippen, wobei sie einen gespielten Blick an sich herunterwarf, als wäre sie selbst überrascht, dort eine enorme Fischflosse vorzufinden statt zweier Beine. Kurz über ihrem Beckenknochen ragten die ersten Schuppen aus ihrer Haut, auf der sich trotz der hier herrschenden Wassertemperaturen nicht das kleinste Anzeichen von Gänsehaut abzeichnete.
Ich musterte jeden Zentimeter des nass glänzenden Schwanzes von der Hüfte bis zur Spitze der beiden Flossenenden. Vergessen waren mit einem Mal der nackte Oberkörper, das bezaubernde Lächeln, die wellige Flut von Haaren, die funkelnden Augen. Niemals hätte ich gedacht, von einem Fischkörperteil derartig angezogen sein zu können – zu meiner großen Erleichterung in einer Entdecker- beziehungsweise Forscherfaszination, nicht in irgendeiner, die mich gleich am nächsten Morgen auf die Couch eines Psychiaters geschickt hätte.
Prüfende, fragende, wahrscheinlich auch unbewusst merkwürdige Grimassen ziehend, versuchte ich auszumachen, wie ich die Flosse der Meerjungfrau beschreiben sollte. Sie war hell, aber sicher auch nicht weiß, kein Ton, an den ich mich erinnern konnte, mit dem ich diesen Anblick vergleichen konnte. So sehr ich mich auch sträubte, es anzunehmen, schließlich musste ich mir das Offensichtliche eingestehen – das waren keine Graustufen, es waren schillernde Nuancen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Jede einzelne war so ergreifend schön, dass sie mir noch einmal bewiesen, dass ich träumen musste. Der dünne Wasserfilm darüber verlieh den Schuppen ein Eigenleben. Und jede Facette löste in mir eine neue Emotion aus, als würde ein Feuerwerk direkt in meinem Inneren explodieren.
Zu fasziniert, um mich zu bewegen, starrte ich mein Gegenüber an. Scheinbar um meine von ihrer Schönheit hervorgerufenen Qualen noch zu vergrößern, spielte die Meerjungfrau neckisch mit ihrer Flosse, senkte sie ab und ließ sie unregelmäßig die Wasseroberfläche tätscheln.
Auf wundersame Weise kam mir der Anblick der unbekannten Facetten auf der Schwanzflosse völlig natürlich vor. Als wäre es nie anders gewesen. Als hätte alles schon immer so ausgesehen. Als wären die Grenzen von Schwarz und Weiß vor Jahrzehnten schon gesprengt worden, um mir die Augen für dieses Weltwunder zu öffnen.
Wer hätte gedacht, dass es etwas so Wundervolles geben kann, schmunzelte ich in mich hinein. Dass ich, Sander Berry, einer der wohl fantasielosesten Menschen, die ich kannte, sich etwas Derartiges erträumen konnte.
In diesem Moment wünschte ich mir, niemals wieder aufzuwachen. Ewig an den schillernden Bildern festzuhalten. Kaum war dieser Gedanke aufgetaucht, schlüpfte die Meerjungfrau zurück unter die Wellen und nahm all die realitätsfremden Nuancen ihrer Flosse mit in die Dunkelheit des Meeres.
Als ich die Augen aufschlug, war meine Farbenblindheit wieder intakt. So wie bei allen Bewohnern meiner Heimat seit Generationen.
Mit einem enttäuschten Seufzen prüfte ich den Stehkalender auf meinem Schreibtisch. Es war Sonntag. Sonntags gab es traditionell Fisch beim obligatorischen Essen mit meinen Eltern. Unweigerlich fragte ich mich, ob ich nach diesem Traum jemals wieder guten Gewissens auch nur einen Bissen davon herunterbekommen würde. Ich lasse mir besser schnell eine Ausrede einfallen, dachte ich. Nicht ahnend, dass dieses Mittagessen nicht das Einzige bleiben würde, was eine Meerjungfrau in meinem Leben durcheinanderwirbelte.
Kapitel 2
Wie in Zeitlupe drehte ich den Globus entgegen seiner eigentlichen Drehrichtung. Mit Zeige- und Mittelfinger tat ich so, als würden sie darüber stolzieren. Während meine Nägel behutsam über die frisch restaurierte Oberfläche tippten, fantasierte ich über die Entstehungszeit dieser Antiquität. Über die Helden der Seefahrt lange vor dem dunklen digitalen Zeitalter, die weiße Blätter überhaupt erst in Weltkarten verwandelt hatten. Wie musste sich wohl der Kartograph gefühlt haben, der sein Leben lang mit nichts anderem verbracht hatte, als er das letzte leere Fleckchen auf seiner Karte gefüllt, das letzte Puzzleteil an seinen Platz gebracht hatte? Ob er ekstatische Euphorie oder sogar Stolz empfunden hatte? Oder überkam ihn kurz nach dem letzten Pinselstrich Klaustrophobie beim Anblick der vollständig erfassten Welt? Schließlich war es das. Kein blütenweißer, reiner Spielraum mehr. Weder für Tagträume noch für nächtliche Fantastereien. Kein Ausweg, kein Entkommen von der Karte. Eingesperrt in der begrenzten Realität, die er feinsäuberlich über Jahre hinweg dokumentiert hatte. Wie hätte dieser Kartenzeichner wohl reagiert, hätte man ihm erzählt, dass ihm ein Fehler unterlaufen war? Dass ihm eine Insel durch die Lappen gegangen war, so klein, dass sie den Namen der einzigen Stadt hier trug – Mary’s Yard. Hätte er angesichts unserer Existenz vor Freunde oder vor Frustration geweint?
Den Zeigefinger zum Takt in meinem Kopf auf die Stelle klopfend, wo besagte Insel wahrscheinlich in Wahrheit wegen ihrer überschaubaren Größe nicht abgebildet wurde, starrte ich durch den Globus hindurch ins Leere.
Ob es anderswo wohl genauso ist?
Das mechanische Klingeln der Pendeluhr auf der anderen Seite der Galerie rief mich aus meiner Mittagspause zurück in meine Schicht in der Bibliothek, wo ich seit meinem Schulabschluss arbeiten durfte. Da nun schon drei Jahre zwischen mir und meiner Vergangenheit im verrufenen Hafenviertel lagen, fiel ich nicht einmal mehr auf, wenn ich durch die Gänge trippelte und Bücher von A nach B trug. Ich war so unsichtbar, dass ich mir manchmal fast wie der Geist der altehrwürdigen Bibliothek vorkam. In der Stadt allgemein. Bis zu einem gewissen Punkt gefiel es mir, so angepasst zu sein, dass ich nicht mehr auf den ersten Blick herausstach. Ab einem anderen brachte es mich manchmal um den Schlaf. Denn es war nicht mehr als eine gut einstudierte Scharade, deren Erfolg darauf basierte, dass niemand sich die Mühe machte, genauer hinzusehen.
»Gehen Sie heute zur Parade?«, fragte meine Kollegin, die neben mir einen Stapel Bücher von einem der Pulte nahm.
Ariana Bender. Sie war auf den Tag genau ein halbes Jahr älter als ich. Eigentlich studierte sie an der Universität von Mary’s Yard zwei Hauptfächer – Literatur und Botanik –, aber da sie nicht aus einer übermäßig gut betuchten Familie stammte, jobbte sie nebenbei, um ihre Haushaltskasse aufzubessern. Diese Doppelbelastung war es allemal wert, um nicht wie ihr Vater auf der Ölbohrinsel vor unserer Küste zu enden, betonte sie oft in den stressigen Klausurenphasen. Die überdimensionierte Hornbrille mit Tigermuster hing dann etwas tiefer als gewohnt, leicht nach unten geschoben auf ihrer Stupsnase, die ihre schmalen Lippen unterstrich.
Alle ihre Züge waren zierlich, nur ihre Haare bildeten in einen voluminösen Zopf geflochten einen üppigen Kontrast dazu. Nur sehr selten trug sie Kleidung ohne Fischgrätenmuster oder etwas anderes als Blusen mit niedlichen Miniaturen. Meistens waren darauf Tiere, an diesem Tag – ausnahmsweise – eine kleine Ananas und ihre Klone.
Während wir gemeinsam die eingesammelten Bücher an ihren rechtmäßigen Platz brachten, führten wir unsere übliche Unterhaltung um diese Zeit im Jahr. Bender, wie der Rest der Stadt, kannte nur noch ein Thema: die Parade zum Unabhängigkeitstag unseres Inselstaates, für die auch diesmal keine Kosten und Mühen gescheut wurden.
»Ich wollte eigentlich mit einem Freund hingehen. Aber bis jetzt haben wir noch nichts Genaueres ausgemacht. Der Vorschlag stand nur mal so im Raum. Was ist mit Ihnen?«
»Alle meine Kommilitonen gehen hin«, sagte Bender wie selbstverständlich. »Viele aus meinem Botanikkurs haben den Festwagen für die Universität mitgestaltet. Also gehen wir alle zusammen hin. Ich mag das Gedrängel rund um die Parade nicht so gerne, aber auf den Jahrmarkt freue ich mich.«
Die meisten Leute hier in der Stadt waren viel zu sehr mit sich selbst und ihren unfassbar umfangreichen Studien beschäftigt und natürlich damit, sehr viel wichtiger und gebildeter zu sein als der Rest von uns, sodass sie wenig Zeit für zwischenmenschliche Beziehungen zu vergeben hatten. Angesichts dessen war ich froh, eine Kollegin wie Ariana Bender gefunden zu haben, die ich nach einem langen Prozess des Auftauens ihrerseits inzwischen so etwas wie eine gute Bekannte nennen konnte, ohne das Gefühl zu haben, zu übertreiben.
Wir nahmen im Gänsemarsch die Treppe zum Erdgeschoss, die eigentlich mehr als breit genug gewesen wäre, um nebeneinander zu gehen.
»Sehen Sie die Jungs da drüben?«, fragte Bender und deutete wenig unauffällig mit ihrer freien Hand in eine der hinteren Ecken. »Da, die Gruppe rund um den mit dem Bowler-Hut. Was meinen Sie?«
Ich nickte in freudiger Begeisterung für unser alltägliches Spiel.
»Ganz sicher eine lustige Szene. Sehen Sie, wie seine Lippen sich kräuseln? Die anderen haben so versteinerte Mienen, entweder haben die ihren Humor zu Hause gelassen, oder sie lesen was Dramatisches. Sieht so aus, als würde er das Lachen unterdrücken. Ich tippe auf … ähm … eine Teeny-Komödie mit extra viel Strass und Slapstick.«
»Oder er liest was Schweinisches«, gab Bender trocken zurück, »und verzieht das Gesicht so, weil er sich geniert, wenn die anderen was mitbekommen.«
Anhand der Gesichter der Bibliotheksbesucher zu erraten, was sie gerade lasen, war unser liebster gemeinsamer Zeitvertreib. Heute war nicht unbedingt einer unserer fantasiereichsten Tage, aber es lockerte die Eintönigkeit des Alltags trotzdem auf.
An dem Tisch, an dem wir gerade vorbeigingen, kaute ein muskulöser Student umringt von zahlreichen Leidensgenossen mit offenem Mund Kaugummi – hergestellt auf Basis einer genauso zähen wie geschmacklosen Algenart. Ohne mich umzudrehen, wusste ich, dass Bender augenblicklich das Gesicht verzog, als hätte sie in eine rohe Zwiebel beißen müssen. Sie war ein ziemlich gelassener und duldsamer Mensch, aber das Geräusch vom Kaugummikauen oder gar Blasen-platzen-Lassen traf bei ihr einen Nerv.
Kein Wunder, dass sie sich mit unserem Spiel abzulenken versuchte.
»Und was ist mit ihm dort?«, wisperte sie verschwörerisch, als sie sich unauffällig an mir vorbeidrängte, um schneller von dem Kaugummikauer wegzukommen.
»Ist das Ihr Ernst, Bender?«, kicherte ich halbherzig.
Der junge Mann, in dessen Richtung sie nickte, verbarg sich hinter einer Mauer aus Bücherstapeln. Allesamt Sachbücher mit dicker Aufschrift. Wie jeden Tag im selben Trott, den er zu genießen schien. Aber selbst wenn er kein Wiederholungstäter gewesen wäre, hätte ich ihn erkannt. Diese hochkonzentrierten, grübelnden Augen gehörten Sander Berry. Dem Sohn des Bürgermeisters. Dem fleischgewordenen Traum von Mary’s Yards Routine und dem Grund für schlaflose Nächte bei adretten Schwiegermüttern in spe.
Was er dachte, musste man nicht ergründen. Es stand in jeder Tageszeitung und wurde auf offiziellen Pressekonferenzen kundgetan. Aus dem Mund seines Vaters, der keine Gelegenheit versäumte, seinen Sohn als Neuauflage von sich selbst zu präsentieren. Wahrscheinlich wusste der Rest von uns vor Sander Berry, was er zu denken hatte.
Wie ein dressierter, frisch frisierter Pudel saß er brav auf seinem angestammten Platz. Ein bewundernswert fleißiger, relativ ansehnlicher Pudel, das musste ich ihm lassen – obwohl ich ja Katzen lieber mochte. Und wenn er nur einmal von seinem Buch hochgesehen hätte, hätte ich sicher nach einem Funken Rebellion, einer stummen Inspiration für Benders und mein Spiel gesucht. Einfach, um dieses Phantom aus meinem Kopf zu verjagen, das sich auch noch über ein so vorgekautes, streng vorausgeplantes Leben freute.
Aber ich kam nicht mehr dazu, mir einen überspitzten Kommentar zu Sander Berrys vermeintlicher Lektüre zusammenzuspinnen.
Bender stieß mich auf einmal mit dem Ellbogen an. Ich drehte mich um und sah verdutzt in Richtung der Rezeption. Unsere Empfangsdame sprach aufgeregt mit zwei Polizisten und deutete in meine und Benders Richtung. Wir sahen uns gegenseitig an, gingen zeitgleich die Kataloge mit Fehltritten durch, wegen denen man uns aufsuchen könnte, dabei war ihrer ohnehin nicht vorhanden und meiner dank guter Tarnung und in der Zeit nach meinem Umzug geübter Selbstbeherrschung erstaunlich kurz.
Ein vertrautes Geräusch ließ mich zusammenzucken. Mein Name. Er hatte etwas Eigenartiges aus dem Mund der Polizisten, die uns musterten, aber nicht auf eine gute Art und Weise.
Ich trat einen Schritt vor. Die Polizisten mit den phlegmatischen Mienen baten mich, mit ihnen zu kommen, also drückte ich Bender meinen Bücherstapel in die Hand und hielt mit ihr über die Schulter hinweg Blickkontakt, bis man die Milchglastür zum Büro neben dem Empfangspult schloss. Kaum war sie klackend im Rahmen eingerastet, nahmen die Polizisten ihre Mützen ab und legten sie an ihre Herzseite. Einer der beiden – sichtbar älter als sein Kollege – zog ein Portemonnaie aus seiner Gesäßtasche, aus dem er wiederum ein Foto zu Tage förderte.
»Sind Sie das?« Seine Stimme klang blechern. Meilenweit entfernt. Als wäre ich unter Wasser und er auf einem Ruderboot darüber. Augenblicklich kam mir mein Frühstück wieder hoch.
Kapitel 3
Sander? Sander! Hörst du mir überhaupt zu? Erde an Sander Berry …«
Bas tippte mich ungeduldig an der Schulter an. Sein knochiger Zeigefinger stach unsanft die Blase auf, in die ich mich eingeigelt hatte. Ich schüttelte den Kopf und musste mich erst einmal sortieren. Auf meiner Zunge lag noch immer der Geschmack eines Gedankens, den ich schon nicht mehr fassen konnte.
Erst nach ein, zwei Sekunden dämmerte mir wieder, wo ich war und was ich hier machte. Ich saß in der Bibliothek an einem der langen Holztische inmitten eigens errichteter Hochhäuser aus Büchern über Pharmazie und Maschinenbau, zwischen die sich hier und da ein Klassiker geschmuggelt hatte, den ich sicher nachher ausleihen, aber nicht ein einziges Mal aufschlagen würde.
»Psst!«, zischte das Mädchen hinter Bas, der mir gegenübersaß, bevor sie sich genervt mit den Augen rollend wieder ihrer Lektüre widmete.
Bas duckte sich tief in seine spitzen Schultern, um dann im Flüsterton weiterzusprechen. »Was ist heute los mir dir, Sander?«
Bas Marrygolds Vater war Inhaber der traditionsreichsten Apotheke der Stadt, einer der einflussreichsten Bürger und Nachbar meines Vaters. Darum kannte ich ihn schon mein ganzes Leben und hatte das Glück, einer der Auserwählten zu sein, die Bas trotz seines scheuen Naturells um sich duldete. Seit gut zwei Jahren waren wir sogar dazu übergegangen, uns nicht nur zu duzen, sondern auch beim Vornamen zu rufen.
Auf den ersten Blick wirkte Bas ziemlich distanziert und verschroben, aber wenn er erst einmal aufgetaut war, merkte man, was für ein gutes Herz hinter der griesgrämigen Fassade steckte. Er war diskret, jemand, dem man seine tiefsten Geheimnisse anvertrauen konnte, ohne dass man sie am nächsten Tag auf der Titelseite der Tageszeitung wiederfand. Mit anderen Worten, Bas Marrygold war eine Rarität in unserem knapp Vierzigtausend-Seelen-Staat. Nicht dass ich irgendwelche nennenswerten Geheimnisse hatte. Ich genoss es einfach, einen sicheren Aufbewahrungsort für sie zu wissen, falls es einmal so weit kam. Nicht dass ich jemals damit gerechnet hätte – ich wusste schon früh genau, wo mein Weg mich hinführen sollte. Und man wurde nie müde, mich bei jeder Gelegenheit daran zu erinnern.
»Keine Ahnung, ich versuch ja, mich zu konzentrieren, aber …«, antwortete ich und massierte meine Schläfen.
»Aber? Sag bloß nicht, dieser Traum beschäftigt dich immer noch?«
Ein Achselzucken musste als Antwort genügen.
»Sander, ist das dein Ernst? Es war nur ein Traum, warum beißt du dich so darin fest?«
»Ich mach das ja nicht mit Absicht, sie lässt mich nur einfach nicht los.«
»Die Meerjungfrau in deinem Traum?«, verhöhnte mich Bas heiser.
Ich verzog die Lippen zu einer schmalen Linie, ohne ihn zu korrigieren. Es war nicht die Sirene, die mir keine Ruhe ließ, sondern ihre Flosse. Diese Idee, die sich in mir eingenistet hatte. Diese Vision von dem Ausbruch aus der Farbenblindheit, des Sehens, das in klassischer Literatur vorausgesetzt wurde. Auch wenn mir völlig klar war, dass ich nur einer Spinnerei nachhing. Immer wenn mein Verstand ein Nickerchen machte und ich gedanklich abdriftete, sah ich wieder das Feuerwerk auf den Fischschuppen, und gerade an diesem Tag fühlte es sich an, als hätte mein Verstand Schlaftabletten gefrühstückt.
Jeder wusste, dass der Elektrosmog, der vor unserer Unabhängigkeit unsere Umgebung verpestet hatte, eine Genmutation ausgelöst hatte. Die daraus resultierende Farbenblindheit war eine Spätfolge des Leichtsinns, dem unsere Gesellschaft damals verfallen war – und ein Mahnmal. Immerhin konnten wir froh sein, uns abgeschottet zu haben, bevor weit Schlimmeres eintrat. Nicht auszudenken, wie es den Menschen auf der anderen Seite des Ozeans inzwischen erging.
»Ich weiß, ich weiß. Es ist Unsinn, weiter daran zu denken«, spielte ich meinen Flirt mit einem Hirngespinst herunter.
»Trotzdem geht das jetzt schon seit zwei Wochen so. Ich muss mich geradezu abstrampeln, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen, und ich bezweifle, dass deine Dozenten mehr Erfolg haben als ich …«
»Was soll ich denn dagegen machen? Die Gedanken kommen von allein«, versuchte ich, mich zu erklären, und begann unbewusst, auf dem Ende meines Bleistifts herumzukauen.
»Und ich dachte schon, ich wäre der Merkwürdige von uns beiden«, gab Bas trocken zurück.
Wir brüteten schon seit Stunden über unseren Notizen und Fachbüchern, sodass ich jeden Moment damit rechnete, weißen Rauch aus Bas’ Ohren aufsteigen zu sehen, aber ich konnte mich beim besten Willen nicht an einen einzigen Satz erinnern, den ich gelesen hatte. Was studierte ich noch mal?
Ich würde mich eigentlich als recht geselligen Menschen bezeichnen – auf jeden Fall im Vergleich zu meinem Freund auf der anderen Tischseite, dessen Nase schon wieder zwischen den Seiten eines Wälzers mit abgestoßenem Ledereinband nach Informationen schnüffelte. Doch nun wünschte ich mir, ich hätte die Bibliothek für mich allein gehabt, damit ich die gesamte Höhe des weitläufigen Gebäudes mit meinen Gedanken füllen konnte.
Eine Idee mag ein zuckersüßes Geschenk sein für all diejenigen, die etwas Kreatives hervorzubringen versuchen. Für mich als jemanden, der einfach nur seine Mitschriften auswendig lernen und seine Klausuren bestehen wollte, war sie eher lästig. Wie ein Parasit, der sich in mein Gehirn gefressen hatte und sich dort von klaren Gedanken ernährte, bis nichts mehr übrig war außer ihm. In meinem treibsandartigen Selbstmitleid bereits knöcheltief versunken, war ich beinahe froh, die fröhlich grunzende Gruppe zu sehen, die sich meinem Tisch näherte. Vielleicht schaffte sie es, mich von mir selbst abzulenken.
Der kernige Typ an der Spitze des Pulks mit dem hageren Erstsemester im Schwitzkasten war das Alpha-Männchen der Clique, Kolja Almond. Leicht zu erkennen am stolzen Gang und am Kilometer weit schallenden Lachen. Menschen, die so betont gut drauf waren, waren mir meistens unangenehm, aber wenn ich ausnahmsweise mal alleine mit Almond redete, fand ich ihn eigentlich ganz in Ordnung.
Um meine Aufmerksamkeit, die er eigentlich schon hatte, auf sich zu ziehen, knallte Almond seine prankenartige Hand direkt neben meinem aufgeschlagenen Buch auf die glänzende Tischplatte. Er verlagerte sein Gewicht, bis er sich komplett auf seinem muskulösen Arm stützte, wodurch sich eine lässige Haltung in den gebirgsartigen Körper bog. Was ihm ganz natürlich zuflog, wirkte auf mich wie eine Leistungssportart. Almond bedeutete seinem Fußvolk mit einem beiläufigen Nicken weiterzugehen. Ihrem ununterbrochenen Lachen und Durcheinandergejohle zufolge schienen sie sich auch ohne ihn köstlich zu amüsieren.
»Hey, Champ.«
Unser Blickkontakt verriet, dass er diesmal mich mit diesem Titel ansprach. Von Almonds Standardanrede konnte man das nie genau ableiten, für ihn bestand die gesamte restliche Weltbevölkerung aus Champs.
»Hallo, Almond«, antwortete ich knapp.
Ich genoss durch den Zufall, Sohn des Bürgermeisters zu sein, kein schlechtes Ansehen unter Gleichaltrigen, allerdings würde ich auch nicht behaupten, zu denen zu gehören, die sich im Rampenlicht bewegten. Da Almond es sich dort sehr bequem gemacht hatte, war sowieso nicht mehr viel Platz übrig – seine Schultern waren nicht nur mühevoll trainiert, sondern auch überdurchschnittlich breit.
Bas, obwohl er sich für sein Elternhaus sicher nicht verstecken musste, bedachte Almond nur mit einem Kopfnicken, das dieser auffällig deutlich ignorierte.
»Alles klar? Es roch auf einmal so nach verbranntem Hirn, da dachte ich, ich seh mal nach Ihnen«, scherzte Almond mit charmantem Schmelz in der Stimme. »Haben Sie beide nicht langsam genug vom Lernen?«
»Man kann nie genug Wissen ansammeln, das wissen Sie ja«, rezitierte ich den Lieblingsspruch unseres Universitätsdirektors.
»Als würden Sie Überflieger das alles hier noch brauchen.« Almond blätterte eines der einzeln liegenden Pharmaziebücher durch. »Geben Sie’s zu, Sie betreiben diesen Aufwand doch nur, damit wir Normalsterblichen uns nicht so schlecht fühlen, weil wir wirklich hart arbeiten müssen, um gute Zensuren zu bekommen«, behauptete er und schob dabei den Kaugummi in seinem Mund von einer Backentasche in die andere.
»Ertappt«, raunte Bas genervt.
Als würde Kolja Almond – Sportass und Unischwarm – sich zu den Normalsterblichen zählen. Bei dieser Ironie musste ich fast etwas schmunzeln. Er war einer dieser Typen, die vor Stolz und Selbstbewusstsein fast überliefen, die zu allem einen mehr oder weniger unqualifizierten Kommentar auf Lager hatten und die man trotzdem nicht hassen konnte. Na ja, außer Bas – der schaffte das vorzüglich.
»Hey, Champ, was ist mit heute Abend? Als Sohn des Bürgermeisters müssen Sie sich doch auf der Parade zeigen, oder?«
»Eigentlich hatte ich diesmal nicht vor …«
»Blendend! Wie wär’s, wenn wir das Ganze für Sie dieses Jahr spannender gestalten würden und Sie mich und die Jungs dorthin begleiten? Ist sicher mehr Spaß, als alleine aufzukreuzen.«
»Ich bin nicht allein, Bas kommt mit«, widersprach ich, ohne Gehör zu finden.
»Dann ist es also abgemacht«, fuhr Almond unbeeindruckt fort. Immerhin war er sowieso der bessere Redner von uns beiden, da konnte er die Unterhaltung auch gleich alleine führen. »Sie und Marrygold, Sie beide sind also auch dabei. Blendend. Wir treffen uns um acht am Marientor. Wir sehnen uns, Champ.«
Und bevor ich irgendeine Stellungnahme dazu abgeben konnte, war Almond auch schon wieder über alle Berge.
»Ich wusste nicht mal, dass er deinen Namen kennt«, war alles, was ich überrumpelt, wie ich war, zu unserer neuen Abendplanung sagen konnte.
»Ernsthaft, Sander, du musst lernen, nein zu sagen. Dieser Almond will doch ohnehin nur mit dir gesehen werden, um sein Ansehen weiter aufzupolieren«, unkte Bas.
Wie so oft hatte ich das Gefühl, dass er nicht wirklich mit mir sprach. Die Worte mussten einfach nur raus, bevor sie Bas den Magen verdarben. Dass ich da war, um als Alibi zu fungieren, damit Bas sich nicht eingestehen musste, Selbstgespräche zu führen, war ein Gefallen, den ich ihm gerne tat. Er würde dank mir seinen Abend mit Almond und dessen Gefolge verbringen, da war das wohl das Mindeste.
»Du stehst tief in meiner Schuld, Mr. Berry, wenn ich dich zur Parade begleite«, murmelte Bas seinem Buch entgegen und blätterte viel zu schnell die Seiten um, als dass er eine Zeile darin hätte erfassen können. »Allein schon, wie der Kaugummi kaut – bah – wie eine Kuh auf der Weide.«
Das Marientor war eins der ältesten Wahrzeichen in Mary’s Yard. Die Gründerfamilie Armitage, deren Linie bis zu diesem Tag weitergeführt worden war, an dem der 86. Unabhängigkeitstag der Stadt gefeiert wurde, soll das Monument selbst errichtet haben. In einer alten Schriftart war darin ein kurzer Text eingraviert, den ich nur schwer hätte entziffern können, hätte man mich diese Worte nicht, seit ich sprechen konnte, auswendig lernen lassen. Alle für alle – Gemeinschaft statt Egoismus. Über runden Säulen, die ich und Bas nicht einmal gemeinsam hätten umfassen können, war eine Brücke aus zwei steinernen Meerjungfrauen beziehungsweise deren Flossen gespannt. Sowohl ihre Gesichter als auch die Wellen ihrer üppigen Haarpracht waren mit viel Liebe zum Detail gearbeitet worden. Eine frühere Tugend, die wir nun als Charakterschwäche betrachteten. Aber aus Traditionsbewusstsein schätzten wir alte Kunst dennoch weiter und passten lediglich die ausgedienten Interpretationsweisen an. Sie erinnerte uns daran, aus unseren Fehlern von früher zu lernen, oder war schlichtweg von zeitloser Schönheit, wie die im Sprung gute drei Meter über meinem Kopf erstarrten Meerjungfrauen. Als hätte der Blick der Medusa sie getroffen, lachten die Nixen mir zu. Eine schien fast zu winken. Meine ganze Aufmerksamkeit galt ihrem schuppigen Beinersatz, dessen auffallend helle Oberfläche extra für den heutigen Tag noch einmal aufpoliert worden war.
Bas stieß mich mit dem Ellbogen an und räusperte sich. Als ich mich daraufhin umdrehte, sah ich auch schon Almond mit einer zu diesem besonderen Anlass sorgsam ausgewählten Gefolgschaft auf uns zusteuern. Sie wateten durch die sich verdichtende Masse auf dem Platz um das Marientor, wobei sich der Pulk mehrmals teilen musste.
Immerhin für Almond wichen die meisten in unserem Alter aus. Er war schwer beschäftigt, auf kurze und längere Distanz Leute zu begrüßen und ihnen lässig zuzuwinken. Immerhin konnte er sich ausgiebig in all der Aufmerksamkeit sonnen, wenn schon der Himmel gewohnt grau und bedeckt war.
Mit einem breiten Grinsen und dunkel angelaufener Nase prostete Almond mir und Bas zu, der mit verschränkten Armen nur ein halbherziges Nicken für unseren Kommilitonen übrig hatte. Die Parade hatte noch nicht begonnen, da schwankten die meisten von Almonds Fangemeinde bereits hinter ihm her, weshalb sie die Hälfte ihrer Getränke auf dem Weg bis zu uns verschütteten. Nicht so Kolja Almond.
Er stammte aus einer gutbürgerlichen Familie. Somit war er ein geübter Trinker, wusste, wie er mit Schnaps und Konsorten umzugehen hatte, sprich, wie man sich betrunken unter die Massen mischte, ohne sein Gesicht völlig zu verlieren. Eine hohe Kunst, wie ich mir hatte sagen lassen, aber wie immer galt – Übung macht den Meister. Und Leute wie Almond hatten unheimlich viel davon. Es war immerhin allseits bekannt, dass viele Schriftsteller alter, besonders literarisch wertvoller Werke lange vor der Technikverherrlichung exzessiv getrunken hatten. Um die Tiefgründigkeit ihrer Texte also zu verstehen, so die Theorie der Experten, musste man sie betrunken oder zumindest angetrunken genießen. Auch untertags Alkohol zu sich zu nehmen, war schick geworden. Alkoholismus war der Volkssport der Intellektuellen.
Die Band spielte auf. Die Masse klatschte energisch zu dem vornehm-beschwingten Rhythmus, als der Bürgermeister, mein Vater, die Bühne neben dem Marientor erklomm, was angesichts seines Wohlstandsbäuchleins Schwerstarbeit bedeutete. Ich zwinkerte ihm stolz zu und hob den beißend nach billigem Cidre riechenden Becher, den mir einer von Koljas Schoßhündchen in die Hand gedrückt hatte, damit er sich den Schnürsenkel binden konnte. Er war schon eine ganze Weile damit beschäftigt, als ich mich fragte, ob er da unten vielleicht Hilfe brauchte.
»Kommen Sie, Champ. Wir besorgen Ihnen beiden auch was zu trinken. Es kann ja nicht angehen, dass Sie auf dem Trockenen sitzen«, rief Almond über die fleißig eingeübte Rede meines Vaters über die Einzigartigkeit unserer Heimat und ihre glorreiche Zukunft, die auf den Schultern meiner Generation und die wiederum auf den Werten und reichen Traditionen unserer Vorfahren errichtet werden würde, hinweg.
»Danke, wir sind versorgt«, erwiderte ich höflich verhalten lächelnd, während Almond mir einen seiner muskulösen Arme um die Schultern wickelte. Ich konnte mich nicht dagegen wehren, dass seine überschwängliche Laune auch auf mich abfärbte, obwohl er sich für eine flüchtige Bekanntschaft unheimlich aufdringlich benahm. Offenheit würde man es als Optimist nennen. Also nicht aufdringlich, sondern sehr, sehr offen war er.
Almond hatte Glück, aus einer relativ angesehenen Familie zu kommen und dadurch immer in gutem Licht dazustehen. Jemandem von geringerer Herkunft hätte man so ein Verhalten nicht ungestraft durchgehen lassen.
Bas fischte aus der Stofftasche, die an ausgeleierten Trägern über seiner linken Schulter hing, eine Glasflasche ohne Etikett. Mit triumphierender Miene präsentierte er die klare, mit glänzenden Goldblättchen versetzte Flüssigkeit darin.
»Verstehe. Der Adel hat seinen eigenen Stoff mitgebracht.«
»So wie es sich gehört«, bluffte ich.
Die peinliche Wahrheit war, dass weder Bas noch ich besonders trinkfest waren. Karten auf den Tisch, jedes fünfzehnjährige Mädchen hatte uns aus dem Stegreif unter den Tisch trinken können. Wir hatten es mal zu trainieren versucht, aber alles, was uns das einbrachte, war die Erkenntnis, wie lächerlich wir uns alkoholisiert aufführten. Es gibt diese glücklichen Leute, die auch stockbesoffen noch eine gute Figur machen, beinahe cool sind. Nicht wir. Wir gehörten zu der Sorte, für die man sich fremdschämte. Um also nicht ans Ende der sozialen Nahrungskette abzurutschen – entweder indem wir gar nicht tranken oder durch Eskapaden –, hatten Bas und ich eine Lösung ausgeheckt. Verziertes Wasser statt Wodka. So simpel wie genial.
»Schmeckt das Zeug auch so exklusiv, wie ihr tut?!«, hakte Almond nach, bevor er nach der von Bas präsentierten Flasche griff.
»Lieber nicht«, wimmelte dieser ihn mit einstudierter Geste ab. »Ziemlich hartes Zeug. Ist nichts für jeden, wissen Sie.«
»So exklusiv also, Champ?«
Wir nickten selbstsicher, obwohl uns beiden der Schweiß bis zum Hemdkragen stand. Einige Sekunden des Grübelns lang ließ uns Almond in unserem eigenen Saft schmoren, bevor seine Aufmerksamkeit sich an eine neue Attraktion heftete – die ersten aufwändig dekorierten, prunkvoll glitzernden Paradewägen bogen um die Ecke. Bas und ich seufzten erleichtert im Duett. Ein Wunder, dass dieser billige Trick nicht nur funktionierte, sondern auch noch unser Image aufwertete. Ich glaube bis heute, dass es nicht so sehr an unserem souveränen Auftreten lag wie daran, dass die Leute genau das in uns sehen wollten, was wir ihnen vorspielten.
Die Parade mit Almond und seinem persönlichen Hofstaat anzusehen war tatsächlich eine Klasse für sich. Man konnte über ihn sagen, was man wollte, aber er schaffte es durchgehend, dass man sich in seiner Nähe wohl und ausgelassen fühlte, sodass man unentwegt über Dinge lachte, die nicht lustig waren. Wissenschaftler bissen sich seit Jahrzehnten die Zähne daran aus, was Persönlichkeiten wie Almond so einnehmend machte – ohne Erfolg. Kolja Almond schien eine der wenigen Sorten echter Magie für sich entdeckt zu haben. Sogar Bas wurde nach einiger Zeit zumindest teilweise in diesen Bann gezogen, was eine Seltenheit war, denn mein Freund schien seit frühester Kindheit immun für einen Großteil der klassischen Varianten von Spaß zu sein.
Zur Musik und an ihr vorbei singend liefen wir der Parade hinterher, folgten dem Strom in Richtung Stadtmitte und bewunderten das Spektakel zur Ehren von Mary’s Yards Unabhängigkeit. Das Komitee – traditionsgemäß geleitet von meiner Mutter – hatte sich dieses Jahr selbst übertroffen. Die durchgearbeiteten Nächte, die sie inmitten von auf dem Arbeitszimmerboden ausgebreiteten Plänen, Stoffproben, Angeboten und weiterem Schnickschnack verbracht hatte, zahlten sich endlich aus. Was machte es da schon, dass sie stundenlang im Bad damit zugebracht hatte, eine drei Zentimeter dicke Schicht Make-up auf ihr Gesicht zu spachteln, um ihre dunklen Augenringe zu übertünchen?
Als Kind war ich schrecklich naiv gewesen, deshalb fragte ich meine Mutter einmal, warum sie so leidenschaftlich für die Gemeindeprojekte arbeitete. Rückblickend konnte ich verstehen, warum ihr alles aus dem Gesicht gefallen war. Nach einem kurzen Griff nach ihrem Riechsalz erklärte sie mir, dass ihre Arbeit nichts mit Leidenschaft zu tun hätte, wobei sie drei Kreuze schlug, ohne wirklich gläubig zu sein, sondern aus reinem Pflichtbewusstsein. Meine Mutter kannte ihren Platz und die Leistungen ganz genau, die von ihr erwartet wurden. Dafür hatte ich sie immer am meisten bewundert – was für ein gutes Vorbild sie war, wie sie sich perfekt in ihre Rolle in unserer Gesellschaft fügte und so zum reibungslosen Ticken dieses Uhrwerkes beitrug.
Durch Präzision statt Liebe zum Detail. Durch Komposition statt Emotion. Das hatte uns die Geschichte unserer wunderbaren Stadt gelehrt. Daran erinnerte uns diese Feierlichkeit zur Unabhängigkeitserklärung – gegenüber dem Festland genauso wie gegenüber ihrer Akzeptanz der wuchernden Passion.
Meine Mutter strahlte vom führenden Wagen auf die ihr zujubelnde Menschenmenge hinab, präsentierte das so lange vorm Spiegel trainierte vornehme Winken, während jüngere Mädchen in kürzeren Kleidern dem begeisterten Publikum Bonbons und in schimmerndes Papier verpackte Kamellen zuwarfen wie wir als Kinder den Möwen an der Steilküste altes Brot.
Der Festwagen an der Spitze des Umzuges war selbstverständlich der opulenteste, nicht zuletzt, weil er die Gattin des Bürgermeisters als Gallionsfigur tragen durfte. Jedes Teil des Gefährts war auf Hochglanz poliert, aber keines funkelte so über alle Maßen wie das Kleid meiner Mutter – sie sah aus, als stecke sie in einer überdimensionalen, mit Diamanten besetzten Kugel. Ihr Wagen repräsentierte das Regierungsviertel, so wie jeder andere für einen weiteren Stadtteil stand und mit spezifischen Nachbildungen von Sehenswürdigkeiten oder Ähnlichem geschmückt war.
Die Instrumente der Band, deren Bühne auf Rädern als Schlusslicht selbst einen Teil der Parade darstellte, diktierten meinem Puls den Takt. Ihr Rhythmus putschte mich auf, ohne dass ich es wollte. Das zu einem unterschwelligen Rauschen verschmolzene Klicken und Surren der unzähligen Zahnräder und Maschinerien unter den Röcken der Festwägen und in den tanzenden Konstruktionen auf ihren Rücken wurde beinahe vollständig von der Musik verschluckt.
So dauerte es nicht lange, bis ich mich dabei ertappte, den Abend so sehr zu genießen wie lange keinen mehr. Ich hatte nicht gemerkt, wie sehr ich es mal wieder gebraucht hatte, mich unter eine Menschenmasse zu mischen, bis ich schon bis zum Hals drinsteckte und die Parade mit ohrenbetäubend kreischendem Feuerwerk über unseren Köpfen ihr Ende fand.
Die Nacht war noch jung, und die Musiker waren noch lange nicht fertig mit uns. Mehr schwungvolle Melodien trieben uns weiter durch den Abend, während wir uns zwischen den Buden des auf dem weitläufigen Rathausplatz errichteten Volksfestes mit Süßigkeiten und Alkohol vollstopften, bis kein Krümel, kein Tropfen mehr hineinpasste. Durch unsere Lossagung von der Außenwelt hatten wir Handelsbeziehungen und Luxusgüter verloren, wir mussten mit den Ressourcen zurechtkommen, die das von Farmern und Förstern besiedelte Inselinnere und das Meer boten. Aber einmal im Jahr frönten wir zügellos der Völlerei.
Die Luft war übersättigt vom Geruch gebrannter Kastanien, frischer Zuckerwatte und Pommes Frites. Dazu mischte sich die Note von aufgewirbeltem Straßenstaub, verbrannter Kohle und den Maschinenölen der Fahrgeschäfte, deren Hebel und Zahnräder ihr eigenes Konzert gaben. Abenteuerliche Konstruktionen aus Altmetall, dem eine neue Bestimmung geschenkt wurde, bildeten eine Achterbahn, eine kleine Wildwasserbahn, aufziehbare Autoscooter mit überdimensionalen Schlüsseln im Heck und sogar ein Riesenrad. Ihre Innereien bildeten möglichst platzsparende mechanische Apparaturen, mit denen die Attraktionen zum Leben erweckt wurden. Sie waren die Ausnahme von unserem Kodex der Sachlichkeit und Effizienz. Maschinen, die zu keinem anderen Zweck als Spaß und Spielerei gebaut wurden. Sogar Kinderspielzeug hatte auch immer die Prämisse, einen pädagogischen Wert zu erfüllen. Nur nicht die heutigen Amüsements.
Ich verstehe eventuelle Einwände vollkommen – natürlich wäre es sehr viel einfacher gewesen, ausgefeilte Elektronik heranzuziehen, Programme zu entwickeln, mit denen alles praktisch von alleine lief. Aber in Mary’s Yard handhabten wir die Dinge anders, auch wenn das nicht immer der Fall gewesen war.
Wie der Rest der Welt verfiel auch meine Heimat vor Jahrzehnten den Reizen, den als unendlich suggerierten Möglichkeiten der elektronischen Technik. Hals über Kopf stürzte sich unser Jahrhundert in eine leidenschaftliche, aufopferungsvolle Romanze mit allerlei computergesteuertem Klimbim. Die Menschen führten komfortable Leben, sagen die Geschichtsbücher. Und dann kam der Blackout. Legte unsere Stadt für über eine Woche lahm, weil wir in unserer Gier mehr Strom fraßen, als unsere Leitungen aushalten, Wind- und Gezeitenkraftwerke liefern konnten. Danach war nichts mehr wie vorher.
Fakt ist, dass die Bevölkerung unserer Stadt durch den Blackout zum Umdenken gebracht wurde. Oder vielmehr durch das Chaos, das der einwöchige Abschnitt vom Stromnetz ausgelöst hatte. Unsere Autos – damals natürlich noch nicht ausgeschlachtet und abgerüstet – fuhren meist autonom und die Leute wussten nicht mehr, wie sie sie eigenständig bedienen sollten. Dazu fielen wichtige Satelliten aus, und ohne Navigationssysteme schafften es die Güterschiffe vom Festland nicht mehr zu unserer abgelegenen Insel. Dinge, die bis dahin selbstverständlich gewesen waren, stellten plötzlich unüberwindbare Hindernisse dar. Die Menschen waren abhängig von etwas, das von einem auf den anderen Moment fehlte.
Die blinde, heißblütige Liebe zur Technologie nur um ihretwillen wurde als Wurzel allen Übels gesehen, das der Blackout mit sich gebracht hatte. Immerhin entsprangen ihr all die unnötigen elektronischen Spielereien, ohne die die Menschen glaubten, nicht mehr atmen zu können. Die gierig Strom verschlingenden Computer und Prozessoren wurden nahezu vollständig von unserer Insel verbannt und in Windeseile durch rein mechanische Apparate ersetzt, für die wir viele nun redundante Geräte und hochseetaugliche Schiffe ausschlachteten.
Nun, über achtzig Jahre nach dem Blackout, erinnerte fast nichts mehr an die unheilvolle Liebesaffäre unserer Stadt. In der Zwischenzeit klärte man uns über zwei vorrangige Dinge auf, die unsere Geschichte uns lehrte: dass sowohl Technik als auch maßlose Leidenschaft gefährlich seien.
Als letzte Konsequenz brachen unsere Vorfahren alle Brücken zur Außenwelt ab. Verweigerten sich modernen Kommunikationswegen, kündigten Handelsabkommen auf und verstärkten die Küstenwache, damit sie uns nie wieder verführen konnten. Und sie ließen uns. Bauten ihre Zukunft aus Masten, Signalen und Kabeln auf, die nicht bis zu uns reichten. Und was hatten wir ihnen – aus ihrer Sicht – auch schon zu bieten? Manchmal glaubte ich, den meisten auf dem Festland war es herzlich egal, dass wir uns abkapselten, es war ja nicht so, dass unsere kleine Insel wirtschaftlich elementar für sie gewesen wäre. Dass sie inzwischen mit den Schultern zuckten, wenn man sie nach uns fragen würde, und antworteten: »Mary’s was?«
Das mag vielleicht für Fremde etwas dramatisch klingen, aber um ehrlich zu sein, mir gefällt unser neues Stadtbild, wie das Surren der Maschinerien das Wellenrauschen des Meeres übertönt, ihr einzigartiger Charme. Sie haben einfach mehr Persönlichkeit als Computer. Zugegeben, die Abgase durch die Verbrennung von Kohle aus der Mine im Inselinneren und getrockneten Algen sind ein Problem. Wenn Mary’s Yard eines nicht ist, dann sauber. Aber immerhin sind wir unverwechselbar. Für mich als angehenden Mechaniker, als Bewunderer dieser Zunft, hätte unsere Stadt keine bessere Entscheidung treffen können. Was die Meister dieses Fachgebietes tagtäglich vollbrachten, wie sie Mary’s Yard mit ausrangierten Teilen und dem Nötigsten an neuen Ressourcen stets wieder zusammenflickten und ihre Rädchen am Rotieren hielten, grenzte an Zauberei.
Bas musste sich an mir festhalten, als unsere Truppe aus der Achterbahn – einem ihrer Glanzstücke – torkelte. Wir beschwipst von Adrenalin, der Rest bis über den Rand abgefüllt mit penetrant klebrig-süß riechendem Obstschnaps. Der Rausch der Geschwindigkeit hatte es uns allen angetan, also schwankten wir ohne nötige Absprache sofort zurück in Richtung Kassenhäuschen, um uns noch einmal die Innereien durcheinanderwirbeln zu lassen, während wir uns anerkennend auf die Schultern klopften für unsere Tapferkeit, eben die Hände selbst beim Looping laut johlend in die Luft geworfen zu haben. Alle guten Vorsätze und Heldenmutsbekundungen hin oder her – wir kamen nie am Kassenhäuschen an.
Mit Speck fängt man Mäuse, und mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig, aber mit nichts fing man unsereins besser als mit Trauben. Menschentrauben. Diese hier wurde ausgelöst durch den grellen Aufschrei einer Frau. Was für ein Klischee. Für einen Moment hielt scheinbar der gesamte Jahrmarkt die Luft an – nur die Maschinen rotierten weiter. Zumindest kam es mir so vor, auch wenn der Trubel den Aufschrei wenige Meter weiter sicher schon wieder verschluckte. Um die Geräuschquelle herum bildete sich augenblicklich besagte Traube. Wir eilten natürlich dazu. Schaulustige und Sensationsliebhaber scharten sich um die betagte Dame mit bleichem Gesicht und weit aufgerissenen Augen, die mit fuchtelndem Zeigefinger auf den Zierbrunnen – ein weiteres Denkmal zu Ehren der Gründerfamilie – deutete. Ihre Lippen bebten, doch kein Wort kam heraus. Bevor ich einen Blick auf den Brunnen erhaschen konnte, schob sich ein korpulenter älterer Herr vor mich und versperrte mir die Sicht. Immer mehr Menschen strömten hinzu, folgten anscheinend dem aufgeregt sprudelnden Monolog der Dame, von dem nur einzelne Silben und Wortfetzen bis zu mir durchdrangen. Etwas Strecken und Drängeln später begriff mein Rudel, dass es zwecklos war, sich in den Passantennebel zu mischen. Er war bereits viel zu dicht.
»Eine Schande«, bemerkte Almond enttäuscht angesichts seines angeheizten Hungers auf Skandale.
Aber es war ja nicht so, dass hier nicht sowieso alles früher oder später die Runde machte und dass Sensationen ebenso kurzlebig waren wie Eintagsfliegen. Die Leute hier waren aufmerksam auf jede Kleinigkeit, die außerhalb der Regel passierte. Jeden einzelnen Fuß, der aus der Reihe tanzte, entdeckten sie. Allerdings waren sie mit einem schrecklich schlechten Kurzzeitgedächtnis gesegnet, das ihnen schnell half, über das Geschehene Gras wachsen zu lassen. Ich war fast neidisch. Wenn ich meine Traumfrau – ähm, Meerjungfrau – nur so schnell aus meinen Gedanken hätte bekommen können …
Wenig später zog kein heller Aufschrei unsere Aufmerksamkeit auf sich, sondern das dunkle, nasse Husten eines alten Mannes mit Bronchitis – Donnergrollen in schwindender Entfernung. Wie jedes Jahr war es das Wetter, das schließlich die Feierlichkeiten sprengte und alle Leute nach und nach zurück nach Hause scheuchte. Zugegeben, diesmal hatte das Gewitter lange auf sich warten lassen und der Wind war verhältnismäßig nachsichtig mit uns gewesen.
»Hey, Champ, was halten Sie von einem kleinen Umweg?«
Wie eine Boa Konstriktor schlang Almonds Arm sich wieder um meine Schultern. Er zog mich ruppig an sich heran. Inzwischen waren von unserer Truppe nur noch er, ich und Bas übrig, der rückwärts vor uns herlief, den wachsamen Adlerblick nicht von uns nehmend, als würde er prüfen, ob wir etwas ausfraßen. Und mit wir meine ich Almond.
Durch seine Umarmung zum Schunkeln gezwungen schlug ich Haken über den Platz, bis er unvermittelt stehen blieb.
»Ein Gewitter über dem Meer soll ein Spektakel sein, das man erlebt haben muss. Das raubt einem buchstäblich den Atem, hab ich gehört. Wir sollten hingehen!«
»Machen Sie mal einen Punkt, Almond. Bis zur Steilküste wären wir über zwei Stunden zu Fuß unterwegs, und die nächste Straßenbahn dorthin fährt erst wieder morgen früh«, unkte Bas.
Almond riss seinen freien Arm hoch und deutete nach Westen. »Da! Der Hafen. Bis dahin ist es gar nicht so weit. Das könnten wir schaffen, bis die Show losgeht.«
Bas schnaubte ungehalten.
»Was denn? Sind Sie etwa nicht Manns genug, um sich ins Hafenviertel zu trauen, Marrygold?«
Als überschaubarer Inselstaat war unser Mary’s Yard beengt genug, um einem das Gefühl zu vermitteln, hier mit jeder Möwe per Du zu sein, aber immerhin noch groß genug, dass wir uns ein eigenes Armenviertel leisten konnten. Der Fischerhafen im Westen, wo die Küste kein steiler, meterhoher Abgrund war, sondern lediglich eine leicht felsige Ebene.
»So ein Schwachsinn. Ihnen muss ich nichts beweisen. Schon gar nicht, wie hoch mein Testosteronspiegel ist«, knurrte Bas und warf die Hände in die Luft. »Ich bin raus. Sander? Was ist mit dir?«
Tja, was war mit mir? Das Hafenviertel war, nun, sagen wir eine Klasse für sich und Almonds Idee völliger Quatsch. Mutproben hatten mich noch nie dazu animiert, irgendwelche Dummheiten zu begehen. Dafür hatte mir Bas immer viel zu gute Rückendeckung gegeben. Aber nun, nach meinem Traum, übte der Hafen eine ganz merkwürdige Anziehungskraft auf mich aus. Es war, als würde er zu mir flüstern. Mich rufen. Dabei wusste mein Verstand, dass es nur der auffrischende Wind war, der um die Häuser pfiff.
Ich hob den Blick, als könnte ich durch die dicke Schicht Gebäude hindurchsehen. Stellte mir vor, der See in ihre tiefen Augen zu blicken. Sie versprach mir stumm, mich noch einmal meinen Traum erleben zu lassen, nur diesmal in Echt statt durch immer stärker verblassende Bilder in meiner Erinnerung. Ich könnte noch einmal schmecken, was ich im Schlaf gekostet hatte, oder? Noch einmal dieses Feuerwerk sehen, das ich nicht recht in Worte fassen konnte. Meine Güte, ich befand mich bereits abseits aller Logik – war tatsächlich nur Wasser in unserer Flasche sehr exquisiten selbstgebrannten Likörs gewesen?
Ich schob meine Irrationalität auf den Rausch des Abends und auf den Vollmond, den ich hinter der dichten schwarzen Wolkendecke vermutete.
»Ein kleiner Umweg kann ja nicht schaden«, sagte ich in Gedanken schon am Strand.
»Ihr seid ja beide irre«, raunte Bas resigniert. »Bitte schön, wie ihr wollt. Lasst euch ruhig vom Blitz erschlagen, aber ohne mich.«
Bevor sich unsere Wege an der nächsten Kreuzung trennten, bedachte er mich mit einem enttäuschten Blick. Dann schlurfte Bas zum Studentenwohnheim, während Almond und ich Richtung Westen schwankten.
Kapitel 4
Untermalt von einem vertrauten Klacken drehte ich meinen Haustürschlüssel im Schloss um. Es klemmte, weil sich die Tür um diese Jahreszeit immer ein wenig verzog. Also stieß ich ein genervtes Seufzen aus und rüttelte. Doch diesmal hing sie besonders fest. Ausgerechnet an diesem Tag. Ungeduldig riss ich am Knauf. Ich schloss meine Faust so fest ich konnte um das ausgekühlte Metall. Würgte es förmlich. Doch die Tür blieb zu.
Schadenfroh verhöhnte mich das Schloss mit seinem klickenden Kichern, während ich weiter daran rüttelte. Heiße Tränen stiegen mir bereits in die Augen. Der Nagel meines rechten kleinen Fingers brach bei einem weiteren Versuch, mir gewaltsam Zutritt zu meiner Wohnung zu verschaffen, so tief ein, dass mir prompt ein stechender Schmerz durch die Hand schoss.
Warum gerade heute? Warum ausgerechnet jetzt?
Inzwischen zerrte ich mit beiden Händen am Türknauf, der nicht daran dachte, sich gnädig zu zeigen.
Warum überhaupt?!
Das ergibt keinen Sinn. Absolut keinen Sinn.
Ich schlug mit der Faust neben das Schloss. Mit aller Wucht der angestauten Emotionen in meiner Brust warf ich mein gesamtes Körpergewicht gegen die Tür.
Klack.
Blindlings stolperte ich in meine stockdunkle Einzimmerwohnung.
Warum er?
Warum in drei Teufels Namen ausgerechnet er?!
Das kann alles nicht wahr sein!
Doch egal, wie oft ich mich kniff, bis meine Nägel tiefe Abdrücke auf meiner Haut hinterließen, ich wachte einfach nicht aus diesem Albtraum auf. Das war wohl das Schlimmste an ihm – der hier war real.
Ich presste die Handballen gegen meine brennenden Augen. Die Mühe, die Tür hinter mir zu schließen, machte ich mir gar nicht. Es war doch eh egal. Sollte doch jemand hier reinstürmen und mich ausrauben. Oder was auch immer. Es war mir egal, ob meine Nachbarn mich sahen. Was bedeutete das alles schon?! Dieser Tag kam mir ohnehin vor wie ein geschmackloser Streich meiner Fantasie. Krampfhaft suchte ich nach einer Erklärung, die mir Halt geben würde, aber da war nichts. Nichts.
Voller Emotionen und absolut leer zugleich stand ich wie gelähmt da.
Wohin mit mir? Was tun?
Jede noch so kleine Entscheidung war zu viel verlangt.
»So eine Scheiße«, winselte ich hinter meinen Handflächen. »So eine verdammte Scheiße!«
Zu fluchen änderte nichts an den Tatsachen, aber immerhin durchbrach ich so die drückende Stille, die mich eingehüllt hatte. Und sei es nur für wenige Sekunden.
Da erklang auf einmal ein sehr viel zarteres Geräusch als meine hilflose, wütende Stimme. Das Knistern von Papier unter meinem Schuh. Langsam, weil ich mich benommen fühlte, bückte ich mich zu dem Blatt herunter. Meine tauben Finger falteten es auf.
Das war nicht meine Handschrift. Das aufgedruckte Wasserzeichen war nicht das meiner Familie – die hatte gar keines.
Ein Beben durchfuhr meine Hände, breitete sich in meinem ganzen Körper aus. Mein Puls pochte so wild in meinem Kopf, dass ich das Gefühl hatte, jemand würde ihn heftig schütteln, als ich die vier Zeilen wieder und wieder überflog. Zum Lesen war mein Verstand nicht in der Lage, doch immerhin eine Information sickerte langsam durch.
Es war eine Nachricht von ihm. Unter dem Türschlitz durchgeschoben.
Obwohl mir fast schwarz vor Augen wurde, raffte ich mich auf. Mit dem mir heiligen Papier in der Hand rannte ich aus meiner Wohnung und knallte die Tür hinter mir ins störrische Schloss.
Kapitel 5
Es gab nur einen Weg in das verrufene Hafenviertel, immerhin konnten wir uns also schon mal nicht verlaufen. Der Fischmarkt stellte die einzige Verbindung zum Hafen dar. Alle Häuser, die das Viertel umgaben, wandten sich empört ab, richteten den Blick und ihre Türen Richtung Zentrum, sodass ihre Wände eine fensterlose Backsteinmauer bildeten. Einen Keil, der sich im Westen durch unsere Stadt zog, unterbrochen allein von dem Markt. Ein Indiz, dass wir alle einen klaren Platz zugewiesen bekamen – den Almond und ich in dieser Nacht wissentlich missachteten.
»Wie lange kennen Sie sich eigentlich schon, Sie und Marrygold?«
Almonds Frage war rhetorisch. Jeder wusste, wie lange Bas und ich schon Nachbarn waren. Meine Familie stand durch die Arbeit meines Vaters unter ständiger Beobachtung der Klatschfraktion und Bas’ Vater war der Besitzer der ältesten, sprich traditionsreichsten Apotheke der Stadt und somit allerseits unheimlich angesehen. Dementsprechend privat war also sein Privatleben.
»Sie stehen sich ziemlich nahe, nicht?«, fragte Almond weiter, ohne mir in die Augen zu sehen.
Ich zuckte beiläufig mit den Schultern, weil ich nicht wusste, was ich antworten sollte. Immerhin hatte ich keinen Schimmer, worauf er hinauswollte.
»Denke schon. Verhältnismäßig«, murmelte ich schließlich.
Almond hatte den Blick auf die Straße gerichtet und die Hände lässig in den Hosentaschen vergraben. Ich hingegen sah auf zum sternlosen Himmel, in dessen Wolken hier und da das Licht von Blitzen glomm. Noch regnete es nicht, aber es konnte nicht mehr lange dauern. Die Luft war bereits schwer und roch nass. Vielleicht lag das auch an der Nähe zum Meer.
Seit wir den Fischmarkt passiert hatten, folgten wir einer uneben geteerten Straße, die seit einer Weile parallel zum steinigen Strand verlief. Einen kleinen Hang hinauf ragten windige Holzhütten und Wellblechverschläge mit vorgezogenen Vorhängen in die Nacht. Etwas entfernt drang ein geplärrtes Streitgespräch durch dünne Wände und rollte an den Stand wie die trägen Wellen. Zusammen mit dem gelegentlichen Kläffen eines Hundes.
Mit jedem Schritt wurde der Salzgeruch in meiner Nase penetranter. Zusammen mit dem Drang, mich nach zwielichtigen Gestalten umzusehen. Ob sich die Leute hier wohl irgendwann dran gewöhnten? Wie hielten sie dieses Brennen auf den Schleimhäuten nur dauerhaft aus? Das Jucken unter der Haut, wenn man sich zwang, weiter geradeaus zu schauen, um sich nicht paranoid vorzukommen.
Wahrscheinlich ist die Hälfte der Gerüchte nur heiße Luft, erinnerte ich mich und kam mir schrecklich arrogant vor in meiner Furcht vor einem Überfall, für den weit und breit kein Täter in Sicht war. Meine anfängliche Überraschung darüber wich der nüchternen Erkenntnis, dass es hier nachts auch nichts gab, wofür man auf die Straße gehen sollte. Keine Bars, Ausstellungen, Lesungen oder das Theater wie in der Stadt. Bloß das Meer und sein Salzgeruch.
Entweder pflegte Almond die Vorbehalte gegenüber dem Problemviertel nicht so aufmerksam wie ich, oder er war ein besserer Schauspieler.
»Manche sagen, Sie und Marrygold verbindet eine gewisse Geschichte«, lachte er trocken.
Ich stolperte kurz über meine eigenen Füße. Das verschlagene Schmunzeln in Almond Mundwinkel ließ keinen Zweifel daran, worauf er anspielte.
Das werden sie mich wohl nie vergessen lassen … huh.
»Es war nur ein Kuss, warum bauscht das denn alle Welt so auf?«, lamentierte ich und warf die Hände in die Luft. »Außerdem – ohne Wahrheit oder Pflicht wäre es nie dazu gekommen, so ein Kuss zählt nicht mal richtig. Und überhaupt, das ist schon wie lange her? Über acht Jahre? Verjährt so was nicht auch irgendwann mal?«
Almonds tiefes Lachen war warm und herzlich, aber vor allem eins – ohrenbetäubend laut. Übertrieben hielt er sich den Bauch, obwohl ich selbst in meiner Unbeholfenheit doch nicht so lustig hatte sein können.
»Schon gut, schon gut, Champ. Es ist ja nur Gerede.«
»Haben die Leute denn nichts Besseres zu tun? Alles vergessen sie, nur das natürlich wieder nicht.«
Ich badete offenkundig in Selbstmitleid, ohne mir jedoch verkneifen zu können, etwas zu schmunzeln. Solche Gerüchte über mich und Bas waren einfach zu lächerlich.
»Wieso regen Sie sich denn so auf? Bas Marrygold wäre eine ausgesprochen vorteilhafte Partie, nicht wahr? Kaum jemand sonst entspricht Ihrem Stand.«
Interessiert hob Almond die Augenbrauen und sah mich prüfend an. Die anderen, die von meiner Stellung – korrigiere, der Stellung meines Vaters – profitieren wollten, indem sie mit mir Zeit verbrachten, gingen nicht so ans Eingemachte. Smalltalk war ihr Erfolgsrezept. Almonds direkte Art gefiel mir trotzdem.
»Unsinn«, sagte ich. »Wenn ich Männer vorziehen würde, dann wäre das was anderes. Und Bas wäre dann sicher nicht die schlechteste Wahl, er ist ein prima Kerl. Ist ja auch nicht so, dass ich mir explizit ausgesucht habe, mich für Frauen zu interessieren. Ich stehe nur einfach nicht gerne im Mittelpunkt der Gerüchteküche. Mal ehrlich, wer will das schon?«Mit dieser Antwort waren wir also beide zufrieden, vermutete ich anhand von Almonds sich entspannender Körperhaltung und seinem tiefen Ausatmen, als wäre ihm ein Stein vom Herzen gefallen – warum auch immer. Dennoch schien mein Kommilitone das Thema nicht fallen lassen zu wollen.
»Das mag schon stimmen, aber sind Sie sicher, dass das der einzige Grund ist?«
»Worauf spielen Sie an?«
»Ich hab gehört, Marrygold soll sich von dem Kuss mehr versprochen haben?«
»Almond, Hand aufs Herz, wollen Sie sich als Chefkoch der Gerüchteküche bewerben, oder was soll dieses Verhör?«
Er prustete. Ertappt. »Ich betreibe nur Konversation.«
So nennt man ein Kreuzverhör also heutzutage.
Was Bas anging, wollte ich keine Angaben machen. Er band seine Vorliebe für Männer niemandem auf die Nase, indem er es in seine Standardbegrüßung einfließen ließ oder sich in dicken Lettern auf die Stirn schrieb, aber sie war auch kein Geheimnis. Befreit vom Firlefanz der Romantik erkannten wir Sexualität als menschliches Grundbedürfnis an, mit dem niemand ein Problem hatte, solange man sie hinter verschlossenen Türen auslebte. Außerdem brachten gleichgeschlechtliche Beziehungen keine Kinder hervor, was unserer Insel, die sich eine Überbevölkerung nicht leisten konnte, nur entgegenkam. Nicht ohne Grund genossen kinderlose Ehepaare beziehungsweise Familien mit wenigen Kindern beispielsweise steuerliche Vergünstigungen.
Almond sollte diese Unterhaltung wenn überhaupt mit Bas selbst führen, wenn er es so genau wissen wollte. Ich würde nicht hinter dem Rücken meines besten Freundes über seine Privatangelegenheiten sprechen. Dass Almond selbst das Thema wechselte, kam mir daher gelegen.
»Hey, Berry! Sehen Sie das?!«
Viel zu fest stieß Almond mir den Ellbogen zwischen die Rippen. Sei ein Mann, ermahnte ich mich und verkniff mir, vor Schmerz zu husten. Stattdessen legte ich eine Hand an die lädierte Stelle und rieb möglichst unauffällig darüber.
Das gibt bestimmt einen blauen Fleck …
»Da drüben!«, rief Almond.
Ich folgte seinem deutenden Finger, der meinen Blick an einer kaputten Straßenlaterne vorbei auf einen der weniger felsigen Bereiche des Strandes lenkte. Ein Kiesbett wie in meinem Traum wartete dort. Ich suchte noch die sich angesichts des heranrollenden Gewitters sträubenden Wellen ab, während Almond schon zum Stand joggte und immer wieder »Hey!« gegen das Rauschen des Meeres brüllte.
Verwirrt folgte ich ihm. Erst als die unebenen Kieselsteine in die zu dünnen Sohlen meiner Lederschuhe stachen, sah ich sie – die junge Frau in den Wellen.
Ihre offenen Haare griffen wütend nach dem um sie herum peitschenden Wind. Die aufbrausende See schlug um ihre Oberschenkel, Wellen brachen an ihrem Körper und schleuderten ihr eisige Tropfen Salzwasser ins Gesicht, doch sie regte sich keinen Zentimeter. Sie stand einfach nur da in ihrem aufgeweichten Kleid. Ihre Arme hingen schlaff an ihren Seiten herunter, wo ihre Hände im zornigen Meer verschwanden. Ihr Gesicht war in die Ferne gerichtet, wo man in der Schwärze der Nacht Wasser nicht mehr von Himmel unterscheiden konnte. Alles, was sich vor ihr aufbäumte, war ein unendliches, dunkles Nichts.
Almond winkte mit beiden Armen und rief lauthals nach der im Wasser erstarrten Person. Ich hatte mich einen ganzen Meter weniger an die Wellen herangetraut. Zu meinen Füßen lagen fein säuberlich drapierte, abgetragene Schuhe mit schief abgelaufenem, flachem Absatz. Daneben eine ordentlich zusammengefaltete Tweetjacke. Ein pelziger Geschmack vertrieb die welkende Erinnerung an heiße Maroni von meiner Zunge.