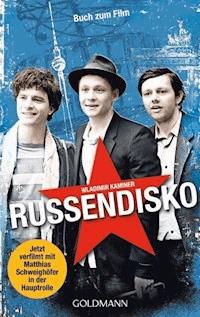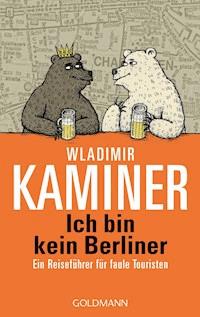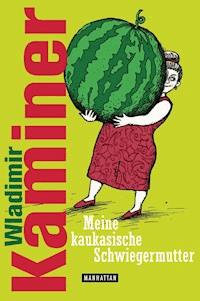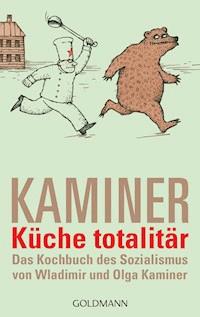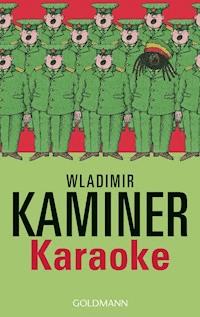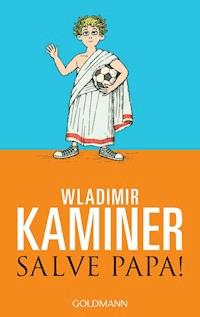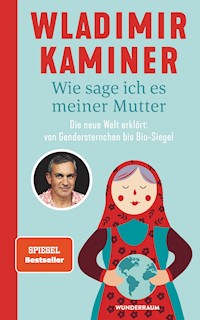9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Das neue Buch vom Autor der Bestseller »Russendisko« und »Liebesgrüße aus Deutschland«
Wenn die Kinder erwachsen werden, beginnt für viele Eltern ein Albtraum namens Pubertät. Das muss nicht sein! Wladimir Kaminer und seine Familie stürzen sich kopfüber in dieses Abenteuer aus Facebook-Partys, unsichtbaren Schnurrbärten, Liebeskummer und der Frage, ob man das Haus in einer kreativ zerlöcherten Jeans verlassen darf, die kaum noch als Rock durch gehen würde. Die Rebellion im Kinderzimmer ist ohnehin nicht aufzuhalten, besser also, sich mit Gelassenheit zu wappnen, die Flatrate jenes Anbieters zu erwerben, bei dem auch die Freundin des Sohnes Kundin ist, und die Kinder auch einfach mal in Ruhe vor sich hin reifen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Ähnliche
Buch
Wenn die Kinder erwachsen werden, beginnt für viele Eltern ein Albtraum namens Pubertät. Das muss nicht sein! Wladimir Kaminer und seine Familie stürzen sich munter in dieses Abenteuer aus Facebook-Partys, unsichtbaren Schnurrbärten, Liebeskummer und der Frage, ob man das Haus in einer kreativ zerlöcherten Jeans verlassen darf, die kaum noch als Rock durchgehen würde. Die Rebellion im Kinderzimmer ist ohnehin nicht aufzuhalten, besser also, sich mit Gelassenheit zu wappnen, die Flatrate jenes Anbieters zu erwerben, bei dem auch die Freundin des Sohnes Kundin ist, und die Kinder zwischendurch auch einfach mal in Ruhe vor sich hin reifen zu lassen.
Autor
Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Toningenieur für Theater und Rundfunk und studierte anschließend Dramaturgie am Moskauer Theaterinstitut. Seit 1990 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Berlin. Er veröffentlicht regelmäßig Texte in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften und organisiert Veranstaltungen wie seine mittlerweile international berühmte »Russendisko«. Mit der gleichnamigen Erzählsammlung sowie zahlreichen weiteren Büchern avancierte er zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands. Alle seine Bücher gibt es als Hörbuch, von ihm selbst gelesen.
Näheres zum Autor und seinen Büchern finden Sie unter www.russendisko.de
WLADIMIR
KAMINER
Coole Eltern leben länger
Geschichten vom Erwachsenwerden
MANHATTAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Manhattan Bücher erscheinen imWilhelm Goldmann Verlag, München,einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
4. Auflage
Erstveröffentlichung August 2014
Copyright © der Originalausgabe
2014 by Wladimir Kaminer
Copyright © dieser Ausgabe 2013
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher Genehmigung
des Hans-im-Glück-Verlags, München
Umschlaggestaltung und Konzeption:
Buxdesign · München,
unter Verwendung von Autorenfotos von
Urban Zintel © 2014
Satz: Uhl+Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-12437-3V003www.manhattan-verlag.de
für Nicole Helena Lilith und Sebastian Charles Gregor
Alle Namen sind geändert, alle Geschichten hätten so oder ähnlich passieren können, alle Ähnlichkeiten mit real existierenden Kindern, Müttern und Vätern sind weder beabsichtigt noch gewollt.
Inhalt
Wer lange schläft, wird niemals heiß
Der unsichtbare Schnurrbart
Widerspenstige Schüler
Facebook-Party
Mittelreif
Die Anmachsprüche
Deutsche Schule
Komplizierte Menschen
Abenteuer Familie
Berlin – Malawi
Im Rahmen der Hose
Der Tag des Wissens
Romeo & Julia 2.0
Die Asche unserer Zigaretten auf dem Fest der Eidechsen oder: Enttäuscht für immer
Wozu brauchen wir reiche Menschen?
Jack Daniel’s ist sein zweiter Vorname
Das Jugendschutzgesetz
Bunt statt blau
Der nächste Champion betritt die Bühne
Solange Merkel lacht
Ahnenforschung
Die ungarische Rhapsodie
Französisch lernen
Klassenfahrten
Kommen und gehen
Die Geschmäcker der neuen Generation
Erderwärmung
Die Reise nach Ägypten
Matriarchat
Alles glitzert
Das Leben – ein Wissenssupermarkt
Stunde Null
Die Rolle des Fernsehens im Leben der Kinder
I Can’t Get No Satisfaction
Alter Mormone hat immer recht
Ode an die Dummheit
Leben heißt Leben
Zur Kernfrage einer Geschichte
Die Entführer
Loreley
Wir haben nichts bemerkt
Mitläufer der Zeit
Der Aufsatz zum Thema Freiheit
Das Wunderkind
Russen, Indianer, Afrikaner und wir
Finger knacken kurz vor Weihnachten
Mein Leben mit Es
Wer lange schläft, wird niemals heiß
Die Kinder rebellieren, weil sie ihre eigene, nicht mit dem Kram der Väter vorbelastete Welt haben wollen, anstatt die Geschichte des elterlichen Scheiterns weiterzuschreiben. Ein Konflikt ist in dieser Situation unvermeidlich. Die Erwachsenen haben dafür ein unschönes Wort gefunden: Pubertät. Das ist keineswegs eine Kinderkrankheit, es sind immer zwei, manchmal sogar drei Generationen daran beteiligt. Die Eltern pubertieren mit ihren Kindern, sie versuchen, sie zu erziehen oder in ihrem Erwachsenwerden auszubremsen. Beides wirkt so lächerlich, als würde man sich bemühen, mit bloßen Händen die Erdumdrehung zu beschleunigen oder zu verhindern. Der Traum der einen wird in der Pubertät in den Albtraum der anderen verwandelt.
Der Wunsch der Jugend auszubrechen, keine Zeit mit den Eltern zu verbringen, ist natürlich verständlich. Die Kinder glauben, die Erde sei rund, wenn man nur lange genug ausbrach, könnte man andere, vielleicht interessantere Menschen als die Eltern kennenlernen. Die Eltern dagegen wissen, weiterlaufen ist sinnlos, die Erde ist rund und überall gleich. Deswegen verbarrikadieren sich die Erwachsenen die meiste Zeit ihres Lebens in quadratischen, praktischen Räumen, sie sitzen am liebsten in einer Ecke, damit niemand von hinten an sie heranschleichen kann. Aus den quadratischen Räumen der Eltern, gebaut auf der runden Erde der Kinder, entsteht das Paradox der Pubertät. Die Kinder laufen weg, die Eltern laufen ihnen oft hinterher. Aber spätestens nach zwei Stunden kommen sie alle zu uns, klingeln an der Haustür oder rufen an.
»Darf meine Freundin Antonia bei uns übernachten? Sie hat mit ihrer Familie ein Problem, ihre Eltern drehen durch«, fragte mich meine Tochter Hilfe suchend.
Wir standen in diesem Generationenkonflikt, schätzte ich, auf der falschen Seite. Wir selbst erziehen wenig, nur in Notsituationen. Wir mischen uns aus Prinzip nicht in die Angelegenheiten der Jugend ein – eine aus der Erfahrung der Menschheit resultierende Weisheit. Selbst in der Bibel steht, dass jedes neue Wissen nur das Leid mehrt. Ein altes deutsches Sprichwort sagt zu diesem Thema »Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß«, die Engländer meinen »Curiosity killed the Cat«. Auch die Russen haben ihre Lehre auf diesem Gebiet in einem Sprichwort formuliert: »Wer wenig weiß, kann länger schlafen.« Ich weiß also am liebsten gar nichts, aber ein wenig weiß ich schon. Ich weiß zum Beispiel, dass Antonia noch drei jüngere Geschwister hat, von denen jedes einen eigenen Papa hat. Ihre Mama ist sehr sensibel, sie läuft ihrer Tochter bestimmt hinterher, und wenn sie alle bei uns übernachten wollen, müssen wir viele neue Matratzen kaufen.
»Das ist ein bedauerliches Problem, liebes Töchterchen, wenn die Eltern durchdrehen«, sagte ich nachdenklich, um etwas Zeit zu gewinnen. »Wie sieht das bei Antonia genau aus?«
Die Mutter von Antonia habe eine Liste im Korridor aufgehängt, in der sich alle Besucher von Antonia eintragen sollen, mit Namen, Vornamen, Geburtsdaten, Adressen und Telefonnummern. Wenn sie gehen, sollen sie die genaue Zeit ihres Aufbruchs angeben, damit die Mutter den Überblick über das Privatleben ihrer Tochter behält. Antonia fühle sich zu Hause wie im Knast. Sie sei von dort abgehauen und müsse bei uns übernachten dürfen. Außerdem sei sie ja schon da. Zehn Minuten später rief, wie ich gleich vermutet hatte, die durchgedrehte Mutter von Antonia an. Sie klang eigentlich ganz normal, fragte mich, ob Antonia bei uns angekommen und ob noch jemand mit ihr mitgekommen sei. Ich hatte keine Ahnung, ob sie jemanden mitgebracht hatte. Antonias Mutter wollte das nicht glauben.
»Sie wissen nicht, wer im Zimmer Ihrer Tochter ist?«, wunderte sie sich.
»Ja, weiß ich nicht«, erwiderte ich. »In der Bibel steht, jedes Wissen mehrt nur das Leid. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß; curiosity killed the cat.«
»Vielleicht haben Sie ja recht und ich bilde mir zu viel ein«, sagte die Mutter von Antonia und legte auf.
So einfach kann Erziehung sein, dachte ich auf dem Balkon in einer Hängematte liegend und widmete mich weiter der Himmelsbeobachtung. Nicht einmal fünf Minuten waren vergangen, da erschien meine Tochter zwischen den Sternen.
»Darf Frederike bei uns übernachten?«
Wie der Zufall das so an sich hat, waren auch die Eltern von Frederike synchron mit den Eltern von Antonia durchgedreht – ohne sich vorher abgesprochen zu haben. Die Mutter von Frederike, eine Künstlerin, hatte sich in einen Musiker verliebt, der in einer deutschen Doppelgängerband von »The Cure« Gitarre spielte. Zusammen haben sie nun ein Baby, das Frederike nicht anfassen darf, weil ihre Mutter den schlimmen, jedoch unbegründeten Verdacht hegt, Frederike würde heimlich rauchen – so schilderte mir meine Tochter den Fall. Die Mutter von Frederike stehe voll auf einen gesunden Lebensstil, sie wolle mit Frederike zusammen joggen gehen und Joghurt essen. Alles Unreine und Ungesunde wolle sie aus der Welt schaffen und befürchte, wenn Frederike das neue The-Cure-Baby mit ihren Nikotinfingern anfasse, werde die Musik dieses neuen Lebens möglicherweise falsch gespielt. Sie hatte von Frederike bereits das Ehrenwort erpresst, dass sie, falls sie tatsächlich rauchte, dies unterlassen würde, bis das The-Cure-Baby volljährig war. Sie hatte das Zimmer von Frederike durchsucht, alle Möbel auf den Kopf gestellt und die Klamotten kontrolliert, um ihre Tabakvorräte zu finden.
Nun wollte Frederike aber nicht mit ihrer Mutter joggen gehen, weil sie sich verfolgt fühlte, wenn sie mit ihrer Mutter zusammen durch die Stadt laufen musste. Sie hatten sich gestritten, die Tochter war weggelaufen, die Mutter hinter ihr her. Das The-Cure-Baby hatte die Abwesenheit der beiden Frauen genutzt, war aus dem Bettchen und in Frederikes Zimmer gekrabbelt, hatte blitzschnell den Tabak Cheetah gefunden und begonnen, sich das erste Zigarettchen seines Lebens zu drehen, so schilderte es Frederike. Als die Mutter zurückkam, suchte das Baby bereits nach Feuer. Frederike gab zu bedenken, laut Jugendschutzgesetz dürfe sie mit sechzehn Jahren schon rauchen, nur nicht in Anwesenheit älterer Personen. Die Mutter flippte daraufhin aus – und deswegen müsse Frederike jetzt bei uns übernachten, behauptete meine Tochter.
Ich kaufte ihr die verrückte Babygeschichte nicht ab, aber andererseits hatten sich Wahrheit und Wahnsinn in der letzten Zeit bereits sehr stark angeglichen, sie waren kaum noch auseinanderzuhalten. Wenig später rief mich die Mutter von Frederike an. Sie fragte mich, ob ich Informationen darüber besäße, ob meine bzw. ihre Tochter rauchten.
»Ich habe keine Ahnung!«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »In meiner Anwesenheit tun sie es nicht, wie es im Jugendschutzgesetz vorgeschrieben ist. Was sie unter sich treiben, will ich nicht wissen. Jede neue Katze mehrt nur das Leid«, sagte ich, »wer lange schläft, wird niemals heiß.«
»Vielleicht haben Sie ja recht, ich übertreibe«, meinte die Mutter von Frederike.
Kurz vor Mitternacht, ich war gerade mit Sternezählen fertig, klingelte es wieder an der Haustür. Ob Johanna bei uns übernachten dürfe?, fragte meine Tochter und fing gar nicht erst an zu erzählen, was passiert war. Es war auch egal. Bestimmt hatten die Eltern von Johanna erfahren, dass die Eltern von Antonia und Frederike durchgedreht waren, und beschlossen, sich aus Solidarität ebenfalls dem Wahnsinn hinzugeben. Sie hatten eine Computerfirma engagiert, um den Facebook-Account ihrer Tochter zu knacken, hatten Mikrokameras in ihrem Zimmer eingebaut und ihr Telefon angezapft. Und deswegen musste auch Johanna jetzt bei uns übernachten.
In der Nacht hörte man komische Geräusche aus dem Mädchenzimmer, Schreie, Lachen und Musik. Frederike, Johanna und Antonia »chillten«. Es klang nicht im Geringsten danach, als machten sie sich Sorgen über ihre armen durchgedrehten Eltern. Sie tauschten sich ziemlich laut über andere Themen aus. Ich habe natürlich gar nicht zugehört, denn: Wer zu viel weiß, dem wird die Katze heiß.
Der unsichtbare Schnurrbart
Unruhige Zeiten. Mein Kind ging in die siebte Klasse. Schon mehrere Male hatte ich von verschiedenen Eltern gehört, die siebte Klasse sei die Spitze der Pubertät, da erreiche sie ihre höchste Stufe. Meine Tochter, die damals in die neunte Klasse ging, bestätigte mir dies aus eigener Erfahrung.
»Die sechste geht noch, sogar die achte wäre unter Umständen zu akzeptieren, aber die siebte – kannst du vergessen. Zum Heulen und Wegschmeißen«, meinte sie.
Zur Beruhigung las ich alte Bücher, sie spendeten mir Trost. Alles sei vergänglich, stand in diesen Büchern, alles komme und gehe, nichts währte ewig, auch die siebte Klasse nicht. Doch es gelang mir nicht, mich gänzlich mit alten Büchern vor dem Alltag zu verbarrikadieren. Immer wieder wurde ich von den anderen Familienmitgliedern, von meiner Mutter zum Beispiel, aufgefordert, aktiv am Erziehungsprozess teilzunehmen. »Du musst auch was sagen«, drängte sie mich. Sie hängte mir den Erziehungsauftrag buchstäblich um den Hals. Das Hauptdilemma jedes Erziehungsbeauftragten ist, sich den Respekt des Erziehungsbedürftigen zu verschaffen. Der Erziehungsbeauftragte muss beweisen, dass er nicht nur älter, sondern auch weiser als der Erziehungsbedürftige ist, mehr erlebt hat und dementsprechend eine größere Lebenserfahrung besitzt, die er jederzeit bereit ist, dem Erziehungsbedürftigen auf dessen Weg mitzugeben. Der Erziehungsbedürftige wehrt sich dagegen.
»Was hast du denn in deinem Leben gehabt, was ich in meinem nicht auch schon hatte?«, fragte mich mein zwölfjähriger Sohn, als ich ihm mit meinem Erziehungsauftrag zu nahe kam.
»Sehr vieles, mein Sohn«, sagte ich mit ausschweifender Geste und überlegte fieberhaft, was genau das sein könnte. Etwas, das seriös genug wäre und auch in den Augen des Kindes eine wichtige Lebenserfahrung darstellen würde.
»Zum Beispiel eine unglückliche Liebe«, sagte ich pathetisch.
»Hatte ich!«, rief Sebastian und schüttelte verständnisvoll den Kopf.
Ich wusste sogar, wen mein Sohn damit meinte. Vor ein paar Wochen hatte er von einem Mädchen aus seiner siebten Klasse eine Wollmütze geschenkt bekommen, die er nie mehr abnehmen wollte. Er lief den ganzen Tag in dieser Mütze herum, ging sogar mit der Mütze schlafen, wollte aber nicht mit mir darüber reden. Nach einigen Tagen verschwand die Mütze jedoch von seinem Kopf und aus der Wohnung. Das war wahrscheinlich die unglückliche Liebe, die er meinte.
Gut, dachte ich, kommen wir ihm mit dem Erziehungsauftrag eben von hinten. Wenn das Kind sich für zu erwachsen hält, spielen wir das Spiel mit und reden miteinander Klartext, wie es unter Erwachsenen angebracht wäre.
Kinder, die sich für erwachsen halten, suchen in der Regel auch nach sichtbaren Beweisen für ihr Erwachsensein. Und wenn sie keine sichtbaren finden, schalten sie auf unsichtbare um. Jeden Tag verbringt mein Sohn viel Zeit vor dem Spiegel mit dem nachdenklichen Betrachten seines unsichtbaren Schnurrbartes. Dieser Schnurrbart macht ihm Sorgen. Er könnte womöglich krumm wachsen. Er fragt sich außerdem, ob er nicht zu dick, zu schräg, zu schnell oder zu langsam herauskam und ob die linke Seite nicht doch etwas schiefer hing als die rechte? Weil dieser Schnurrbart ein unsichtbarer ist, kann er sein Problem nur mir mitteilen, denn ich bin der Einzige, der vorgibt, diesen Schnurrbart zu sehen.
»Ja«, sage ich, »tatsächlich ist die linke Seite etwas schief. Das kommt daher, dass …« – und an der Stelle fädle ich meinen Erziehungsauftrag in die Schnurrbartproblematik ein. Der Erziehungsauftrag wächst hoffentlich wie der Schnurrbart von allein weiter. In diesem Alter soll alles schnell wachsen: innen der Erziehungsauftrag, außen der Schnurrbart. Selbst wenn er unsichtbar bleibt.
Unsichtbare Schnurrbärte werden sowieso demnächst groß in Mode kommen. Denn eigentlich sollte diese Generation durchsichtig sein wie keine andere vor ihnen. Sie wird per Internet kontrolliert, in zahlreichen Foren organisiert und von mächtigen Suchmaschinen erfasst, die jeden Einzelnen in Sekundenschnelle überall finden können. Dadurch wird sich ihre Moral ändern müssen. In einer Welt, in der die Menschen die intimsten Gedanken anderer auf Facebook lesen können, werden sie nachsichtiger miteinander sein, mit mehr Verständnis die Macken der anderen ertragen und Barmherzigkeit und Geduld ihrem Nächsten gegenüber zeigen. Außerdem werden sie ehrlicher miteinander umgehen müssen, denn Beschiss lohnt sich nicht mehr in einer Welt, die von Webkameras rund um die Uhr unter Kontrolle gehalten wird.
Dafür wird die Selbstkontrolle stärker werden, weil man sich stets als in der Öffentlichkeit stehend begreifen wird. Gleichzeitig erlangt das Unwahrscheinliche, das Mystische, das Geheimnisvolle einen besonderen Stellenwert. Die verborgenen Sehnsüchte und Träume, die von keiner Suchmaschine erfasst, von keinem fremden Auge entdeckt werden können, werden den wahren Reichtum eines Menschen ausmachen. Der unsichtbare Schnurrbart wird ein Vermögen wert sein.
Widerspenstige Schüler
Wenn ich die Schule meiner Kinder und meine eigene sowjetische Schule vergleiche, stelle ich fest, dass die Schüler von hier und heute unglaublich brav sind. Selbst in der tiefsten Pubertät, in einem Alter, in dem man keinen Konflikt scheut, um die eigene Reife zu beweisen, zeigen sich diese Schüler leistungsorientiert und gesetzestreu, so wie die bürgerliche Gesellschaft sie gerne hätte. Selbst wenn sie untereinander streiten, beleidigen sie lieber die Handys, die Musik oder die Computerspiele des Feindes als diesen selbst. Selten wird es persönlich. Ein vietnamesischer Junge beschimpfte einmal meinen Sohn, seinen bis dahin besten Freund, im Streit als »Scheißausländer«. Später, als die Jungs sich wieder vertrugen, fragte ihn Sebastian, wie er das gemeint hätte und wo er sich selbst ausländertechnisch verorten würde. Der Junge schüttelte nur den Kopf und sagte, er hätte das im übertragenen Sinne gemeint.
Das Verhalten von Zwölfjährigen ist schwer zu prognostizieren. Mein Sohn nennt seine Schulkameraden nicht umsonst »tickende Zeitbomben«. Manchmal ticken diese Bomben im Uhrzeigersinn und manchmal nicht. Streiten, wenn überhaupt, tun sie auf dem Hof. Im Klassenzimmer sind es nette Kinder, sie helfen einander und widersprechen nie ihren Lehrern. Es gibt in der ganzen Klasse nur einen einzigen widerspenstigen Schüler, der den Lehrern ständig ins Wort fällt. Das macht er natürlich nicht bei den exakten Wissenschaften. Die Erkenntnisse in Mathematik, Chemie oder Physik geben wenig Anlass, sie anzuzweifeln. Bei den Geisteswissenschaften öffnet sich allerdings ein breites Feld des Widerstands. Auch im Kunstunterricht kann man statt einer langweiligen Vase den grünen Teufel an die Wand malen und behaupten, die Wahrheit läge im Auge des Malers. Bei Musik kann man behaupten, falsch und laut sei auf jeden Fall besser als richtig und leise. Am meisten wird aber im Ethikunterricht gestritten. Ethik ist eigentlich zum Streiten da. Ich konnte meinen Kindern in vielen Fächern bei der Erledigung der Hausaufgaben helfen, nur bei Ethik musste ich passen. Ich glaube, mit meinen Ratschlägen hätten die Kinder in dem Fach nur schlechte Noten bekommen.
»Stellen Sie sich vor«, lautete eine Hausaufgabe, »Sie gehen mit einer Freundin bzw. einem Freund in einen Laden einkaufen und merken, dass Ihre Freundin bzw. Ihr Freund etwas gestohlen hat. Was würden Sie tun? a) Ihren Freund decken, b) es ihm aus Solidarität nachtun oder c) die Polizei verständigen?«
»Ich würde niemals meinen Freund verraten, dafür sind es ja Freunde, damit man sie eben nicht verpfeift, ganz egal was sie tun, auch wenn sie Mist bauen«, so hätte ich geantwortet und hätte dafür eine Fünf bekommen. Für eine Eins in Ethik hätte man den Freund sofort verpfeifen müssen! Dein Freund oder deine Freundin, sie werden dir später dankbar sein, dass du sie zur rechten Zeit vom falschen Weg abgebracht und ihre kriminelle Karriere gleich zu Anfang abgewürgt hast – so behauptet es zumindest der Ethikunterricht. Ich sehe es direkt vor mir, wie dieser Freund bzw. diese Freundin im Knast sitzt und mir Dankesbriefe schreibt:
»Vielen Dank, mein lieber Freund, dass du mich damals verpfiffen hast. Ohne dich wäre mein Leben möglicherweise völlig falsch gelaufen. Jetzt habe ich viel Zeit, in Ruhe darüber nachzudenken. Noch mal danke und auf baldiges Wiedersehen.«
Der widerspenstige Schüler fragte: »Was ist, wenn ich eine Bank ausraube, nur um meiner Freundin ein Hochzeitsgeschenk zu machen? Soll sie mich dann auch verpfeifen? Außerdem kann man doch auch aus ethischen Gründen klauen, zum Beispiel, um Armen zu helfen, wie Robin Hood es getan hat.«
Die Lehrerin kommt ins Schwitzen und mag den widerspenstigen Schüler nicht. Ein anderes Thema in Ethik ist die Gleichberechtigung von Andersgläubigen, Andersfarbigen, Lesben und Schwulen. Der widerspenstige Schüler streitet auch hier. Er sieht die Mehrheit benachteiligt. Minderheiten haben doch ausnahmslos schon alle Rechte der Mehrheit, wollen aber dazu auch noch ihre Extrarechte als Minderheit. Alle Männer in Deutschland haben zum Beispiel das Recht Frauen zu heiraten. Sie müssen nicht, aber sie dürfen. Schwule wollen zusätzlich aber auch noch Männer heiraten können. Darin sieht der widerspenstige Schüler eine Ungerechtigkeit der Mehrheit gegenüber. »Wenn schon gleiche Rechte, dann sollen die Mehrheit sie genau wie jede Minderheit bekommen«, behauptet er und macht sich bei der Ethiklehrerin noch unbeliebter.
Aus dem gleichen Grund will der widerspenstige Schüler kein Englisch lernen. Die Engländer leiden ohnehin schon lange darunter, dass alle Welt ihre Sprache versteht und mindestens ansatzweise spricht. Alle anderen Völker haben jedoch außer Englisch auch noch ihre eigene Sprache, mit der sie sich untereinander schnell und direkt verständigen können, und zwar so, dass kein Engländer sie versteht. Engländer und Amerikaner haben diese Möglichkeit nicht. Sie müssen nicht nur im Ausland und mit Ausländern, sondern auch untereinander stets dasselbe Englisch sprechen. Das ist ungerecht. Deswegen will der widerspenstige Schüler nicht Englisch lernen, selbst wenn er der letzte Mensch auf dem Planeten sein sollte, der nicht versteht, worüber die Engländer reden.
Manche Lehrer lassen sich auf den Streit ein, andere nicht. Auf jeden Fall bekommt der widerspenstige Schüler schlechte Noten und ist schon einmal sitzen geblieben. Trotzdem genießt er bei seinen Mitschülern und auch bei den Lehrern Respekt. Sie wissen, die Widerspenstigen von heute sind die Revolutionäre von morgen.
Facebook-Party
Meine Tochter Nicole bereitete sich auf eine große Feier vor: Ihr sechzehnter Geburtstag stand an. Sie wollte ihn unkonventionell feiern, das heißt ohne Eltern und ohne Geschenke. Als erwachsener Mensch, der Sartre und Marx gelesen hat und das kapitalistische System bei jeder Gelegenheit anprangerte, war sie zu dem Schluss gekommen, dass auch die sogenannte Geburtstagsfeier bloß eine kapitalistische Erfindung war, um die Bürger zum Kauf von Sachen zu bewegen, die sie nicht brauchten. Diese werden als »Geschenke« vermarktet. Meine Tochter wollte nicht nach dieser kapitalistischen Pfeife tanzen und verzichtete auf Geschenke. Stattdessen sollten wir ihr gleich Geld geben, damit sie selbst bestimmen konnte, was sie brauchte und was nicht. Und wir müssten nicht bis zum Geburtstag damit warten, denn dieses Datum hatte sowieso nur einen symbolischen Wert. Die Feier würde irgendwann stattfinden, pleite aber sei sie schon jetzt.
Statt eines Geburtstags wollte sie eine Facebook-Party feiern und nur die besten Freunde aus ihrem Facebook-Kreis einladen. Dazu würde sie, mit unserer Erlaubnis selbstverständlich, eine Kiste Bier kaufen, denn Facebook-Freunde mögen Bier. Wir fanden das eine ziemliche Schweinerei, dass unsere Tochter ohne uns feiern wollte, zeigten aber Demut und Verständnis und fuhren am Geburtstagstag aufs Land. Man wird schließlich nur einmal im Leben sechzehn Jahre alt. Wir saßen draußen am Lagerfeuer und erinnerten uns wehmütig an unsere eigenen Partys, als wir sechzehn wurden. Damals waren Freunde noch richtige Menschen aus dem Leben, nicht aus dem Netz. Mit einer Kiste Bier waren sie nicht zufriedenzustellen.
Ab Mitternacht wurden wir immer öfter mit Anrufen terrorisiert, die immer häufiger und schließlich im Zehnminutentakt kamen. Der jüngere Bruder von Nicole rief an, obwohl er, wie sich später herausstellte, extra mit Geld geschmiert worden war, um nicht zu petzen. Meine Mutter, die zwei Stockwerke über uns wohnt, rief an. Die Nachbarn von gegenüber riefen an. Alle wollten wissen, ob wir noch alle Tassen im Schrank hätten. Nach Einschätzung der Anrufer stand die Tür zur Wohnung offen, zwischen fünfzig und hundert Menschen gingen ein und aus, und es sah nicht nach einer Party, sondern eher nach einem Überfall aus. Meine Mutter wäre vor lauter Aufregung beim Beobachten der Geschehnisse beinahe aus dem Fenster gefallen. Sie berichtete, in unserem Schlafzimmer lägen Menschen auf unserem Bett, und in der Garderobenecke ginge ständig das Licht ein und aus, unbekannte Jungs und Mädchen säßen auf den Fensterbrettern und rauchten. Die Musik spielte so laut, dass die Nachbarn die Polizei rufen wollten – alles Kleinbürger natürlich, die selbst nie sechzehn geworden waren.
»Kommt sofort zurück«, beschworen uns die Anrufer, »sonst fliegt das ganze Haus in die Luft!«
Wir waren, zugegeben, etwas aufgeregt, blieben aber am Lagerfeuer sitzen. Man wird schließlich nur einmal im Leben – und so weiter. Am nächsten Tag fuhren wir zurück und fanden eine supersaubere und gelüftete Wohnung vor. Nicht alle Facebook-Freunde hätten sich als richtige Freunde erwiesen, berichtete uns Nicole. Das Problem war, dass Facebook-Partys wie eine arabische Revolution funktionieren: Du lädst deine Facebook-Freunde ein, die laden ihre eigenen Freunde dazu, die wiederum auch eigene Freunde haben, und so kannte Nicole die Hälfte der Facebook-Gäste nicht. Irgendein Freund war in meinen Turnschuhen weggegangen, ein anderer hatte Sebastians Kopfhörer mitgenommen und eines der Flugzeugmodelle, die Boeing 747. Wieder andere hatten die Türklingel demoliert und Briefkästen mit Graffiti beschmiert.
Wir haben nichts gesagt, schließlich wird man nur einmal im Leben blablabla. Aber ich denke an dich, du fremder Facebook-Freund, der in meinen Turnschuhen jetzt irgendwo da draußen rumläuft. Du wirst kein leichtes Leben haben. Denn die Welt ist groß, Freunde lauern überall, und jeder wird einmal im Leben sechzehn Jahre alt.
Mittelreif
Den ganzen Winter verbrachten wir unter dem Zeichen des MSA, der mittleren Schulreife meiner Tochter. Anfangs staunten wir nicht schlecht, mit welcher Ernsthaftigkeit die Zehntklässler ihre eigene Reife wahrnahmen. Das ging nicht ohne Schmerz und Leid. Der deutsche Schüler muss wie Käse reifen, bevor er dem Staat auf den Tisch kommt. Er muss reifen in einem speziellen Gefäß aus Aufgaben, in einem engen Korsett von Prüfungen, Herausforderungen und Pflichten, bis er richtig stinkig ist. Erst dann darf er raus in die große weite Welt.
Die erste wichtige Aufgabe des mittleren Schulabschlusses hörte sich leicht an. Meine Tochter sollte zusammen mit einer anderen Schülerin aus ihrer Klasse einen Vortrag ausarbeiten und vor einer Lehrerkommission halten. Das Thema ihres Vortrags durften sich die Schüler selbst ausdenken, es musste allerdings vom Lehrerrat genehmigt werden. Nicole und ihrer Freundin Marie wurde vom Lehrerrat empfohlen, nach einem Stoff zu suchen, mit dem sie sich auch im täglichen Leben auseinandersetzten, der also etwas mit ihrer Lebenssituation zu tun hatte und sie stark beschäftigte.
Die Mädchen überlegten und knüpften sich das Thema »Pest« vor. Die Schulleitung hielt das zwar für brutal, aber eigentlich in Ordnung. Marie sollte die medizinischen Aspekte der Entstehung und Bekämpfung der Krankheit vorbereiten, Nicole etwas über die Ausbreitung und den Einfluss der Pest auf Kultur, Literatur und Kunst im Mittelalter erzählen. Das Thema Pest breitete sich in unserer Wohnung aus. Jeden Tag erfuhren wir neue Einzelheiten über diese tödliche Krankheit. Nicoles Aufgabe war durch die vorgegebene Kürze ihres Vortrages zusätzlich erschwert, immerhin wütete die Pest allein in Europa mehrere Jahrhunderte lang, und Nicole hatte für den ganzen Vortrag nur sieben Minuten.
»Die hygienischen Bedingungen im Mittelalter waren erschreckend«, erzählte Nicole uns während des Frühstücks und beim Mittagessen. »Die Menschen hatten keine Kanalisation, sie kackten direkt vor ihre Häuser, Krankheitserreger breiteten sich über die Straßen aus, über Ratten, Mäuse und Flöhe. Die Klöster, die man als Krankenhäuser benutzte, taugten dazu nicht. Die Pilger und Mönche, die von Kloster zu Kloster und von Stadt zu Stadt gingen, um ihren Glauben zu verbreiten, verbreiteten vor allem die Pest. Gleichzeitig behauptete die Kirche, die Seuche sei keine Krankheit, sondern eine Strafe Gottes für die von Menschen begangenen Sünden und von daher gar nicht heilbar.«
Im Zuge der Vorbereitung auf die Präsentation des Vortrags brauchte Nicole einen Zuhörer mit Stoppuhr. Ich hörte mir den Vortrag jeden Abend vor dem Schlafengehen fünf Mal an und verdammte innerlich die mittlere Reife. Ich träumte bereits von riesigen verpesteten Flöhen, die über die Straßen sprangen und mich fragten: »Wie geht’s?«
Lina, die zweitbeste Freundin von Nicole, wollte ebenfalls etwas Brutales als Thema wählen, den spanischen Bürgerkrieg zum Beispiel oder den Einfluss der amerikanischen Horrorfilme auf das Verhalten der deutschen Jugend. Ihr Freund aber, der sich als Linker positioniert und schon an mehreren Aufmärschen und Demonstrationen teilgenommen hat, wollte unbedingt einen Vortrag über Marxismus halten. Er hatte auch bereits einen tollen Titel für diese Arbeit gefunden, »Das Gespenst des Kommunismus – Illusion oder Wirklichkeit?«, fand aber niemanden in der Klasse, der mit ihm zusammen über dieses Gespenst recherchieren wollte. In seiner Verzweiflung wandte er sich an Lina. Sie konnte ihren Freund nicht im Stich lassen, verzichtete auf die Horrorfilme und konzentrierte sich auf marxistische Theorie.
Die beiden interviewten meine Frau und mich dazu, immerhin hatten wir ein Vierteljahrhundert mit dem Gespenst des Kommunismus auf engstem Raum zusammengelebt.
»Was war das für ein Gefühl, in einer sozialistischen Gesellschaft zu leben und zu arbeiten?«, fragten uns die Schüler. Durch diese Fragen erschien uns unsere eigene Lebenserfahrung plötzlich besonders wichtig und wertvoll, so als hätten wir die ganze Zeit damals in einem Käfig mit wilden Tigern verbracht und nicht in unserer Heimat, die einmal von einem lustigen amerikanischen Präsidenten als »Imperium des Bösen« bezeichnet worden war. Meine Frau wollte Linas Freund auch erklären, dass die Gier die Idee des Kommunismus letztlich zunichtegemacht hätte. Die ersten Kommunisten wären im Alltag sehr zurückhaltend, bescheiden gewesen, sie hätten zu viel über das Glück der Menschheit nachgedacht – ohne das eigene Glück zu bedenken. Allerdings verwechselt meine Frau manchmal deutsche Worte, die in der Tat, jedes für sich genommen, einander sehr ähneln, im falschen Zusammenhang aber einen völlig anderen Sinn ergeben. Statt »zurückhaltend« verwendete Olga das Adjektiv »zurückgeblieben«, was im Groben dasselbe ist, wenn man über Verkehrsmittel spricht. Angewandt auf den Kommunisten aber irritierte diese Aussage die Marxismusforscher ziemlich und steuerte ihre Ergebnisse in eine völlig falsche Richtung.
Der dritte Freund aus der Clique meiner Tochter, der sorglose Jan, lachte über die übertriebene Mühe seiner Kumpel. Er hielt diese ganze mittlere Reife für eine Verschwendung kreativer Energie und sich selbst längst für reif genug, um mit solchen Lächerlichkeiten klarzukommen. Seine ältere Cousine hatte vor vier Jahren auf einer anderen Schule eine Eins für ihren sehr langweiligen Vortrag »Die Auswirkung der Landschaft Schwedens auf Kunst und Kultur« bekommen. Diesen Vortrag lernte Jan auswendig. Er bekam das Thema auch genehmigt und rechnete fest damit, die Prüfung mit Bestnote zu bestehen. Mit seiner Sorglosigkeit störte er die anderen nur. Jeden Tag versammelten sich die Mittelreifenden bei uns in der Wohnung, aßen das ganze Toastbrot weg und tranken in Mengen modische koffeinhaltige Limonade. Mit Stoppuhren in den Händen präsentierten sie einander und uns ihre Vorträge. Diese sollten nicht zu lang und nicht zu kurz sein. Bald fühlte ich mich selbst mittelreif – für die Klapse. Alles vermischte sich im Haus, die verpesteten Flöhe und Pilger, das bärtige Gespenst des Kommunismus und der sorglos durch die öden Landschaften Schwedens torkelnde Jan. Wann ist dieser Albtraum endlich vorbei, dachten wir.
Am Tag der Prüfung fuhr ich die Vortragenden persönlich mit dem Auto zur Schule, die Aufregung war groß. Die Pest bekam eine Eins minus, das Gespenst des Kommunismus eine Vier, weil das Thema angeblich nicht richtig aufgemacht war. Es sei unklar geblieben, was es denn nun gewesen wäre, Illusion oder Wirklichkeit, und wo es von heute aus gesehen zurückgeblieben wäre.
Aber am schlimmsten hatten es die Landschaften Schwedens verkackt zur großen Verwunderung aller Eingeweihten. Der leichtsinnige Jan stand kurz davor durchzufallen: Obwohl er alles genauso wie seine Cousine vor drei Jahren erzählt hatte, konnte er die Prüfungskommission nicht überzeugen. Jan selbst sah darin einen Ausdruck von antimännlichem Sexismus. Anscheinend wirkten die Landschaften Schwedens auf die Prüfungskommission nur, wenn über sie mit einer weiblichen Stimme und in einem kurzen Rock referiert wurden, schimpfte der Junge wütend. Nach der Prüfung wurden alle Kärtchen vernichtet, und es wurde in einer Pizzeria bis zum späten Abend gefeiert. Die Flöhe, das Gespenst und die Landschaften Schwedens verschwanden aus der Wohnung und aktuell aus unserem Leben. Die Reife blieb.
Die Anmachsprüche
Wenn Jungs und Mädchen zum ersten Mal versuchen, Kontakt zueinander aufzunehmen, ist es nicht leicht für sie, gleich die richtigen Worte zu finden. Ich denke, selbst die größten Dichter und Romanciers der Vergangenheit, die als Erwachsene jeden Tag frische Frauenherzchen zum Frühstück verspeisten, hätten als Vierzehnjährige in unserer emanzipierten aufgeklärten Welt Probleme bekommen, eine richtige romantische Anmache hinzukriegen. Nach wie vor will die Natur, dass die Jungs beginnen, obwohl sie in der Allgemeinentwicklung nicht ganz vorne sind. Trotzdem sollen sie die richtigen Fragen stellen und die Mädchen die dafür passenden Antworten finden.
Täglich bringt mein Sohn, der Achtklässler, neue Anmachsprüche nach Hause, die lächerlich sind und die beiden Geschlechter einander bisher nicht einen Millimeter nähergebracht haben. Ich wundere mich jedes Mal, wenn Sebastian mir die Sprüche vorführt. Wer mag sich bloß so etwas Bescheuertes ausdenken? Man kann sich kaum vorstellen, dass dieser Quatsch in einem runden menschlichen Kopf entstanden ist. Die weniger harmlosen hören sich wie folgt an:
»Sind deine Eltern Terroristen? Du siehst aus wie eine Bombe!«
Die Mädchen schweigen dazu in der Regel und zucken mit der Schulter.
»War es Liebe auf den ersten Blick, oder soll ich später noch mal vorbeikommen?«
Sie schweigen.
»Deine Augenfarbe passt zur Farbe meiner Unterhose – soll ich sie dir zeigen?«
Da haben die Mädchen die passende Antwort allerdings bereits gefunden. Sie sagen: »Deine Farbe kenne ich, bestimmt kackbraun.«
Die Jungs sind ratlos. Diese Sprüche taugen nichts, und andere sind nicht vorhanden.
Die alten Bücher überliefern, dass Gott den ersten Menschen als Hermaphroditen kreiert hat, damit es ihm in seiner Vollkommenheit an nichts fehlte. So konnte sich der erste Mensch durch bloße Anstrengung seines Geistes selbst begatten und Nachkommen zeugen. Doch auf Dauer fanden die ersten Menschen es langweilig, sich auf diese unspektakuläre Art zu vermehren, und baten Gott, ihnen jemand anderen dazu zu erschaffen. Gott hielt dies für Verschwendung, kam aber seiner Schöpfung entgegen und teilte sie auf in Mann und Frau. Ein Gefühl der Unvollkommenheit ergriff die Schöpfung. Beide Teile hatten noch gut in Erinnerung, dass sie einst eins gewesen waren. Diese Erinnerung zog sie ungeheuer stark zueinander hin. Sie versuchten immer und immer wieder, eins zu werden, aber teilten sich bei dieser Anstrengung bloß in noch mehr Teile, indem sie sich paarten und Kinder bekamen. Mit jedem neuen Kind wurde die Erinnerung an die frühere Zusammengehörigkeit schwächer, aber sie erlosch nie.