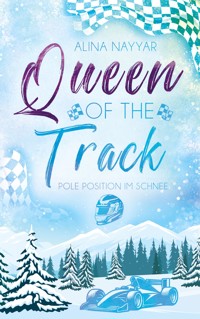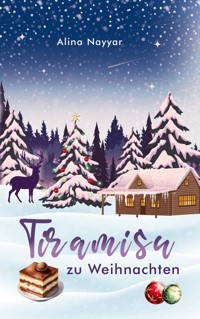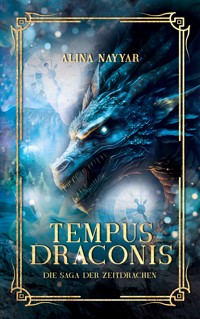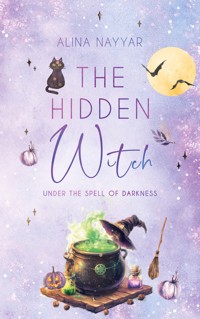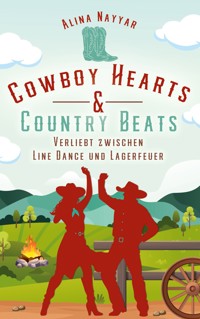
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amber hat ihr Leben stets nach den Erwartungen anderer ausgerichtet und ist auf dem Weg, Medizin in Los Angeles zu studieren. Doch als sie sich nach einem Ausgleich zu ihrer stressigen Welt sehnt, entdeckt sie die Leidenschaft für Line Dance. In Los Angeles wird sie schnell Teil einer Gruppe, die sich auf den Wettbewerb in Tennessee vorbereitet. Dort trifft sie auf Wade, einen talentieren Tänzer, den sie überhaupt nicht einschätzen kann. Und je mehr sie miteinander tanzen und die Herausforderungen des Wettbewerbs meistern, desto stärker wird die Anziehung zwischen den beiden. In Tennessee, umgeben von Country-Melodie und Lagerfeuer-Flair erkennt Amber, dass sie mehr als nur in die Tanzwelt verliebt ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweis: Dieser Roman enthält fiktive Personen, Handlungen und Orte. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen, lebendig oder verstorben, sind rein zufällig. Die Ereignisse und Situationen, die im Buch beschrieben werden, sind reine Produkte der Fantasie des Autors/der Autorin. Die Verwendung von realen Ortsnamen oder historischen Referenzen dient lediglich dem Zweck der atmosphärischen Gestaltung und sollte nicht als Verbindung zu tatsächlichen Ereignissen oder Orten betrachtet werden.
If you can’t beat the fear, do it scared.
Für meinen Mann
Playlist
Footloose - Fake ID
Footloose – Dance the Night away
Footloose – Holding out for a hero
Footloose- Footloose
David Mayonga- Gib mir ein Chee Hoo aus Vaiana 2
Shakira- Try Everything
Dasha- Austin
Benson Boone- Beautiful Things
Rascal Flatts- Life is a Highway
Rascal Flatt- Bless the broken road
One Republic- i lived
Line Dance ist eine Tanzform, bei der mehrere Personen in Reihen (Lines) nebeneinander und hintereinander stehen und gemeinsam choreografierte Schritte tanzen. Alle tanzen synchron dieselbe Schrittfolge, meist ohne Partnerwechsel.
Line Dance stammt ursprünglich aus den USA und ist besonders beliebt bei Country-Musik, wird aber auch zu anderen Musikstilen getanzt. Es ist eine soziale Aktivität, die oft in Gruppen in Tanzschulen, Clubs oder bei Events stattfindet.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Epilog
Kapitel 1
,,Amber McAllister‘‘, schreit meine Mom von unten. Ich liebe sie, aber sie kreischt wie ein Marktschreier. Frische Äpfel, frische Äpfel. Ich bin kein Apfel.
Schwermütig pelle ich mich aus meiner kuschelig weichen Bettdecke und sitze minutenlang auf der Kante meiner Matratze.
In meinem Kopf hallt der Satz „Ich will nicht.“ immer wieder nach, als wäre er in Endlosschleife auf repeat. Jedes Mal, wenn er durch meinen Frontallappen zieht, spüre ich, wie sich die Anspannung verstärkt. Der Satz ist nicht nur ein Gedanke, er wird zu einem körperlichen Gefühl. Meine Amygdala, die Region in meinem Gehirn, die für die Verarbeitung von Angst zuständig ist, reagiert jedes Mal mit einem intensiven Panikgefühl. Es ist, als ob die Worte nicht nur in meinem Kopf, sondern auch in meinem Körper Widerhall finden – ein Zittern, das tief in mir aufsteigt. Die Angst breitet sich aus, als hätte sie die Kontrolle übernommen.
Es ist seltsam, dass diese ständigen, überwältigenden Gedanken so plötzlich auftauchen, als hätte ich nie mit solchen Gefühlen gerechnet. Aber dann erinnere ich mich: Ich habe erst vor kurzem den Studienplatz für Medizin bekommen. Es ist noch nicht real, dieser neue Lebensabschnitt, und doch fühlt es sich an, als würde er schon jetzt mein gesamtes Denken und Fühlen dominieren. Ich habe mein Leben lang darauf hingearbeitet, immer das Ziel vor Augen gehabt, und nun, wo der Weg endlich vor mir liegt, überkommt mich das Gefühl der Unsicherheit.
Vielleicht ist es die Erwartung, der Druck, der so viele mit sich bringt, die Medizin zu studieren. Vielleicht ist es auch einfach der Gedanke, dass mein Verstand und meine Wahrnehmung nun nicht mehr nur von meiner eigenen Welt bestimmt werden, sondern von einer riesigen, komplexen Welt, die ich begreifen muss. Als zukünftige Ärztin weiß ich, dass das Lernen nie aufhören wird – dass jedes Gefühl, jede Reaktion auch eine tiefere, biologische Ursache hat. Und so beobachte ich mich selbst, analysiere mein eigenes Angstgefühl und erkenne gleichzeitig, wie sehr mein Gehirn in diesen Momenten alles auf seine wissenschaftlichen Grundlagen zurückführt. Doch das Wissen um die Mechanismen der Angst macht sie nicht weniger real, nicht weniger lähmend.
Noch nie hatte ich so ein Herzbeben in meiner Brust. Zerfressen von Selbstzweifeln, gefangen zwischen Angst und Vorfreude, Nebel in meinem Kopf. Die Angst ist so präsent, das ich die Vorfreude gar nicht zulassen kann.
Was passiert, wenn ich die falsche Entscheidung getroffen habe und damit alle enttäusche? Und vielleicht sogar am meisten mich? Was ist, wenn ich gar keinen Anschluss dort finde, wenn ich ausgegrenzt werde? Will ich überhaupt studieren oder war diese Entscheidung eine reine Kopfentscheidung?
Ich will meine Eltern unbedingt stolz machen, sie sollen wissen, dass ihre Erziehung gut war und aus mir ein tüchtiger Mensch geworden ist. Mit aller Macht schiebe ich die Zweifel beiseite, doch es gelingt mir nicht. Na gut, dann muss ich eben in Angst und mit Zweifeln tun.
Hauptsache ich tue es. Es ist das, was meine Eltern wollen. Das, was die Gesellschaft erwartet. Und das, was ich gelernt habe zu wollen, auch wenn ich oft nicht weiß, warum.
Meine Hände ruhen auf dem kalten Fensterrahmen, und ich versuche, tief zu atmen. Aber es gelingt nicht. Stattdessen spüre ich den Druck in meiner Brust, schwer und drückend, wie eine Last, die mich nach unten zieht. Sie erwarten Perfektion. Immer weiter, immer höher. Ich habe gelernt, zu funktionieren. Zu gefallen. Zu leisten.
Doch manchmal, wenn ich ganz allein bin, frage ich mich, wer ich eigentlich bin, wenn niemand hinsieht. Was will ich wirklich? Wo ist das Mädchen, das ich mal war, bevor ich all das tragen musste?
Ich drehe mich vom Fenster weg und sehe mich im Spiegel an. Mein Gesicht ist schön, gepflegt, ausdrucksstark – die Maske sitzt perfekt. Aber hinter den Augen liegt eine Leere, die ich nicht verstecken kann, auch wenn ich es versuche.
„Du schaffst das, Amber“, sage ich leise zu mir selbst.
„Du bist stark.“
Doch die Worte klingen hohl.
Ich setze mich auf das Sofa, schließe die Augen und erinnere mich an die Momente, in denen ich wirklich glücklich war. Nicht die Erfolge, nicht die Anerkennung – sondern die kleinen Dinge, die ich längst vergessen habe.
Das Lachen mit meiner besten Freundin Mia. Die Freiheit, einfach ich selbst zu sein. Der Wunsch, meinem eigenen Weg zu folgen, auch wenn ich noch nicht weiß, wohin er führt.
Vielleicht ist es an der Zeit, nicht nur für andere zu leben. Sondern für mich.
Aber wie fängt man damit an?
Ich öffne die Augen wieder und sehe auf den Stapel Bücher auf dem Couchtisch. Medizin, Anatomie, Biochemie – alles Dinge, die ich lernen muss, die ich gelernt habe, die ich lernen werde. Aber was bleibt von mir übrig, wenn all das erledigt ist? Was bleibt von mir, wenn ich endlich die Erwartungen erfülle, die von mir verlangt werden?
Mein Handy vibriert erneut. Diesmal schaue ich sofort hin. Eine Nachricht von meinen Eltern: „Wir sind so stolz auf dich, Amber. Du wirst großartig sein.“ Stolz. Ich weiß nicht, ob sie wirklich wissen, was sie von mir verlangen. Oder ob sie sehen, wie sehr ich mich manchmal frage, ob ich mich selbst verliere.
Ich lege das Handy beiseite und stehe auf. Ich brauche Bewegung, brauche Luft. Ich schlüpfe in meine Jacke und gehe die Treppen hinunter auf die Straße. Die kühle Nachtluft trifft mich und kühlt meinen Kopf. Die Stadt schläft noch nicht, Menschen eilen an mir vorbei, jeder mit seinem eigenen Ziel, seinem eigenen Leben.
Manchmal beneide ich sie. Diese Menschen, die nicht wissen, wie es ist, ständig zu funktionieren. Die nicht das Gefühl haben, immer jemand anderes sein zu müssen. Ich gehe langsam weiter, lasse meine Gedanken ziehen und frage mich, wie lange ich dieses Leben noch führen will. Wie lange ich die perfekte Tochter, die erfolgreiche Studentin, die zielstrebige junge Frau spielen kann.
Ein kleines Café leuchtet einladend an der Ecke. Ich trete ein, bestelle einen Kaffee und setze mich an einen Tisch am Fenster. Hier draußen scheint alles möglich zu sein. Hier draußen scheint die Welt groß und offen zu sein. Und ich – ich sitze hier, gefangen in meinen Erwartungen.
Mein Blick schweift über die Straße. Und irgendwo tief in mir keimt ein leiser Wunsch: nach Freiheit. Nach einem Leben, das ich selbst gestalte. Nicht nur eines, das für mich gestaltet wurde.
Ich nehme einen Schluck Kaffee und spüre, wie die Wärme mich ein wenig beruhigt. Vielleicht ist das der Anfang. Vielleicht ist es Zeit, nicht nur zu träumen, sondern auch zu handeln.
Aber der erste Schritt – der fällt mir schwer.
Ich nehme das zerknitterte Notizbuch wieder in die Hand und öffne eine Seite, auf der ich vor Monaten geschrieben habe: „Ich wünsche mir einen Ort, an dem ich einfach ich sein kann.“ Die Worte wirken plötzlich nicht mehr wie eine ferne Sehnsucht, sondern wie ein leises Versprechen. Ein Versprechen an mich selbst.
Das Telefon klingelt. Ich starre auf das Display und sehe den Namen meiner Mutter. Mein Herz schlägt schneller, und ich drücke ab. „Hallo?“
„Amber, Liebling! Wie geht es dir? Bist du schon bereit für morgen?“ Ihre Stimme klingt voller Wärme, aber auch mit einem unüberhörbaren Erwartungsdruck.
„Ja, ich bin bereit,“ antworte ich, bemüht ruhig zu klingen.
„Das freut mich so! Du wirst das großartig machen, das weiß ich.“ Sie klingt stolz, und ich will sie nicht enttäuschen.
„Danke, Mama.“ Die Stille danach ist schwer. Ich will ihr sagen, dass ich Angst habe, dass ich mich verloren fühle. Aber die Worte bleiben in meinem Hals stecken.
Nach dem Gespräch lege ich das Handy weg und spüre die Schwere in meiner Brust. Ich weiß, dass sie nur das Beste für mich wollen. Aber manchmal fühle ich mich, als würde ich in einem Käfig sitzen, dessen Tür sie fest verschlossen halten.
Ich schaue wieder auf das Notizbuch. Vielleicht ist es Zeit, an diesem Käfig zu rütteln. Vielleicht ist es Zeit, Wege zu suchen, um meine eigene Tür zu finden — egal wie klein der Schlüssel dafür sein mag.
Ich nehme einen tiefen Atemzug und lasse die Gedanken kommen und gehen. Morgen beginnt mein Studium. Ein neuer Abschnitt. Aber ich will nicht nur funktionieren. Ich will leben — auf meine Weise.
Langsam spüre ich, wie sich ein kleiner Funke in mir entzündet. Einen Funken, der vielleicht zu einem Feuer werden kann. Ein Feuer für mein Leben, für meine Träume, für mich.
Und ich weiß, ich bin bereit, diesen Funken nicht mehr zu ignorieren.
Ich sitze wieder an meinem Schreibtisch, doch ich kann mich kaum konzentrieren. Der Stoff, den ich lernen soll, fließt an mir vorbei wie Wasser, das durch meine Finger rinnt. Immer wieder schweifen meine Gedanken ab, meine Augen starren auf das Buch, aber mein Kopf ist leer.
Die Stille im Zimmer fühlt sich plötzlich schwer an, fast erdrückend. Ich höre nur mein eigenes Atmen – zu laut, zu schnell, zu unregelmäßig. Ein Gefühl zieht langsam in meiner Brust hoch, erst kaum spürbar, dann immer intensiver. Als ob sich da etwas verkrampft, als würde sich ein Knoten festziehen.
Ich lege die Hände auf den Tisch, doch meine Finger zittern. Ein seltsamer Druck steigt in mir auf, so als würde ich ersticken, obwohl ich tief ein- und ausatme. Panik? Nein, das ist kein Wort, das ich gern benutze. Aber es ist genau das, was es ist.
Mein Herz rast, und ich kann die Schläge gegen meine Rippen fast hören. Mir wird schwindelig, die Welt um mich verschwimmt. Ein beklemmendes Gefühl schnürt meine Brust ab, und ich muss mich an der Tischkante festhalten, um nicht umzufallen.
Warum? Warum jetzt? Warum hier?
Tränen steigen mir in die Augen, und ich will sie nicht zulassen. Nicht jetzt. Nicht vor mir selbst. Ich will stark sein. Ich will funktionieren.
Aber ich kann nicht.
Ich atme flach, versuche verzweifelt, die Kontrolle zurückzugewinnen. „Nur atmen“, sage ich mir. „Nur atmen.“
Langsam kehrt die Luft zurück, Stück für Stück. Aber das Gefühl bleibt. Das Gefühl, dass ich mich verliere. Dass ich mich selbst nicht mehr kenne. Dass ich zu lange versucht habe, die perfekte Tochter zu sein, die perfekte Studentin, die perfekte Tochter der Gesellschaft.
Kapitel 2
Ich sitze im Flugzeug, der Himmel ist grau, und draußen ziehen Wolken vorbei. Die Maschine hebt ab, und ich spüre, wie sich mein Magen zusammenzieht. Nicht aus Aufregung, eher aus einer Mischung aus Nervosität und Erschöpfung. Neben mir blättert jemand gelangweilt in einer Zeitschrift, und ich starre auf meine Hände, die leicht zittern.
Langsam steigt der Druck in meiner Brust, wie ein Knoten, der sich immer fester zieht. Mein Atem wird flacher, und ich merke, wie mein Herz schneller schlägt. Ich versuche, mich abzulenken, blinzele ein paar Mal, atme tief ein – doch es fühlt sich nicht besser an. Ganz im Gegenteil.
Plötzlich wird mir schwindelig, ich spüre, wie eine Welle von Panik aufsteigt. Ich lege die Hände auf meine Oberschenkel, beiße die Zähne zusammen und versuche, mich zu beruhigen. „Nur atmen“, sage ich mir leise. Nach einer Weile beruhigt sich das Gefühl, die Luft kommt wieder leichter in meine Lungen.
Ich lehne mich zurück und schließe kurz die Augen. Dieses Gefühl – diese Enge und Angst – ist mir nicht fremd. Es ist schon öfter gekommen in letzter Zeit. Und jedes Mal frage ich mich, warum ich mir das antue.
Ich habe keinen Ort, an dem ich richtig abschalten kann. Keine wirkliche Pause vom Druck, von den Erwartungen. Mein Leben fühlt sich an wie eine endlose To-do-Liste ohne Freiraum für mich selbst.
Das Flugzeug setzt zur Landung an, und ich schaue aus dem Fenster, wie die Lichter von Los Angeles langsam näherkommen. Die weite Stadt breitet sich unter mir aus – eine Mischung aus Neonlichtern, Straßen und dunklen Flecken. Alles ist so groß, so fremd und zugleich so real.
Ich spüre eine seltsame Mischung aus Erleichterung und Unsicherheit. Endlich hier, am Beginn von etwas Neuem. Doch da ist auch diese leise Stimme in mir, die sagt: „Bist du wirklich bereit dafür?“
Der Flieger rollt über das Taxiway, bis wir am Gate ankommen. Ich nehme meinen Rucksack und gehe durch den Gang, spüre das Murmeln der Passagiere, das Rollen der Koffer, die kühle Luft der Klimaanlage.
Draußen ist die Luft warm, und der Geruch von Sonne auf der Haut und Asphalt empfängt mich. Los Angeles – so lebendig und voller Möglichkeiten, aber auch ein Ort, an dem man sich leicht verloren fühlen kann.
Ich nehme mein Handy und schreibe eine kurze Nachricht an meine Eltern, bevor ich mich auf den Weg zum Gepäckband mache. Die Realität hat mich eingeholt: Hier beginnt alles. Und ich weiß, dass ich mehr als nur Noten und Prüfungen brauche, um nicht unterzugehen.
Draußen wartet ein Taxi, das mich abholt. Ich steige ein, lehne mich gegen den Sitz und lasse die Stadt an mir vorbeiziehen. Die Straßen sind voller Leben – Autos, Menschen, grelle Werbetafeln und das stetige Rauschen der Stadt.
Vorbei an Palmen, die im warmen Wind schwanken, gleiten wir durch die Viertel, die so anders sind als alles, was ich kenne. Ich beobachte die Mischung aus modernen Hochhäusern und kleinen, bunten Häusern, spüre die Hitze, die durch das geöffnete Fenster hereinkommt.
Je näher wir meinem Apartment kommen, desto mehr fühlt sich das hier wie ein fremder Traum an – aufregend, aber auch irgendwie beängstigend.
Als wir ankommen, zahle ich den Fahrer, nehme meinen Koffer und öffne die Tür zu meinem neuen Zuhause. Ein kleiner Raum, nichts Besonderes, aber mein eigener Platz.
Ich lasse mich auf das Bett fallen und schließe die Augen. Der Tag hat mich ausgelaugt.
Kapitel 3
Die Tür öffnet sich, und eine junge hübsche Frau mit roten kurzen Locken tritt ein, mit einem entspannten Lächeln und offenen Augen. „Hey, du musst Amber sein, oder? Ich bin Mia. Schön, dich endlich kennenzulernen.“
Ich lächle schüchtern und reiche ihr die Hand. „Ja, genau. Ich bin Amber. Danke, dass du hier wohnst – ich bin echt froh, nicht alleine zu sein.“
„Klar, das wäre auch öde“, sagt Mia und setzt sich auf den kleinen Sessel in der Ecke. „Wie lange bist du schon in LA?“
„Gerade erst angekommen“, antworte ich und seufze leise. „Alles ist so neu und irgendwie überwältigend.“
Mia nickt verständnisvoll. „Das kann ich verstehen. Mir ging es am Anfang genauso. Woher kommst du denn?“
„Aus einer kleinen Stadt in der Nähe von San Francisco. Meine Eltern sind Ärzte und haben immer erwartet, dass ich Medizin studiere.“
Sie sieht mich neugierig an. „Das klingt, als wäre da eine Menge Druck.“
„Ja, ziemlich viel“, gebe ich zu. „Manchmal fühlt es sich an, als würde ich nur funktionieren.“
Mia lehnt sich zurück. „Dann ist es doch gut, dass du hier bist. Vielleicht ist das deine Chance, auch mal etwas nur für dich zu machen.“
Ich nicke langsam. „Ich denke, genau das brauche ich. Etwas, das mich ablenkt.“
„Weißt du was?“, sagt Mia und lächelt breit. „Wenn du magst, kann ich dir ein paar coole Ecken in der Stadt zeigen. Hier gibt es mehr, als man auf den ersten Blick sieht.“
Für einen Moment fühle ich mich leichter. „Das wäre toll. Danke, Mia.“
Sie steht auf und klopft mir auf die Schulter. „Kein Problem. Willkommen in LA, Amber.“
„Hast du Lust, was zu essen?“, fragt Mia, als sie ihre Jacke überwirft. „Ich kenne da ein kleines Café um die Ecke, das richtig gute Burritos macht.“
Ich zögere kurz, dann nicke ich. „Klingt gut. Ich könnte was Warmes gebrauchen.“
Wir verlassen das Apartment, und die Luft draußen ist warm, selbst am Abend. Die Straßen sind lebendig, Lichter blinken, und irgendwo spielt leise Musik. Während wir laufen, erzählt Mia von ihrem Job, ihren Lieblingsplätzen in der Stadt und den kleinen Eigenheiten von Los Angeles, die man erst mit der Zeit versteht.
Wir setzen uns an den kleinen Tisch am Fenster. Das Café ist gemütlich, mit warmem Licht und dem Duft von Gewürzen in der Luft. Mia klappt die Speisekarte zu und lächelt mich an.
„Also, Amber, erzähl mal – wie fühlst du dich hier so weit?“
Ich nehme einen Schluck von meinem Wasser, überlege kurz. „Ehrlich? Irgendwie überwältigt.‘‘
Mia nickt verständnisvoll. „Das kenne ich. Als ich herkam, dachte ich auch, ich müsste sofort alles schaffen. Studium, Arbeit, Freunde finden – alles auf einmal.“
„Und?“ Ich werfe ihr einen fragenden Blick zu.
Sie lacht leise. „Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, dass es okay ist, nicht perfekt zu sein. Dass man auch mal langsam machen darf.“
Ich atme tief aus. „Das klingt so einfach, aber ich komme mir ständig vor, als würde ich an meinen eigenen Erwartungen scheitern.“
Mia lehnt sich zurück und nimmt einen Bissen von ihrem Burrito. „Hey, niemand ist perfekt. Und du bist nicht allein. Du musst nicht alles sofort wissen oder können.“
Ein paar Sekunden schweigen wir, während ich an meinem Essen kaue. Die Atmosphäre fühlt sich leicht an, als wäre eine kleine Last von meinen Schultern gefallen.
„Weißt du“, sagt Mia schließlich, „manchmal hilft es, einfach mal etwas anderes zu machen. So was wie tanzen, oder Musik hören, einfach um den Kopf frei zu kriegen.“
Ich schaue sie an und lächle schwach. „Tanzen?“
Sie grinst. „Ja, tanzen! Glaub mir, es macht Spaß. Und man vergisst für eine Weile den ganzen Stress.“
Ich nicke langsam. „Vielleicht sollte ich das wirklich mal ausprobieren.“
Mia hebt ihr Glas. „Darauf einen Burrito‘‘
Ich stoße mit ihr an und spüre, dass ich hier, trotz allem, nicht ganz allein bin.
Mach dem ersten Austausch über den Stress wird die Unterhaltung langsam persönlicher.
Mia schaut mich an, ihr Blick wird weich. „Weißt du, ich komme eigentlich aus einer kleinen Stadt in Arizona. Total anders hier. Meine Eltern waren immer ziemlich strikt, und ich hatte das Gefühl, da draußen nicht wirklich ich selbst sein zu dürfen.“
Ich nicke, kenne das Gefühl zu gut. „Das klingt hart. Bei mir ist es ähnlich. Meine Eltern sind auch so. Für sie ist klar, dass ich Medizin studiere. Alles andere wäre eine Enttäuschung.“
Mia seufzt. „Das kenne ich. Bei mir war es eher der Druck, die perfekte Tochter zu sein, dabei habe ich oft das Gefühl gehabt, nur eine Rolle zu spielen.“
„Genau das“, sage ich leise. „Ich bin so gut darin geworden, Erwartungen zu erfüllen, dass ich manchmal nicht mehr weiß, was ich wirklich will.“
Wir schweigen einen Moment, jeder in seinen Gedanken versunken. Dann frage ich vorsichtig: „Was hast du gemacht, als du hierher gezogen bist?“
Mia lächelt leicht. „Ich habe erst mal einfach versucht, mich selbst zu finden. Kleine Schritte. Ich habe angefangen zu malen, dann ein paar Freunde gefunden, die mich so nehmen, wie ich bin.“
„Das klingt schön“, sage ich. „Ich glaube, ich brauche sowas auch. Einen Ort, wo ich nicht funktionieren muss.“
Mia schaut mich an, ernst und freundlich. „Das wirst du finden. Manchmal muss man nur mutig genug sein, den ersten Schritt zu machen.“
Ich lächle schwach, fühle mich leichter als noch vor einer Stunde. „Danke, Mia. Es tut gut, das zu hören.“
„Kein Problem“, sagt sie.
Wir zahlen unsere Rechnung und machen uns langsam auf den Weg zurück. Die Straßen sind jetzt ruhiger, nur vereinzelt fahren noch Autos vorbei, und die Lichter der Stadt leuchten gedämpft in der Dunkelheit.
„Danke für den Abend, Mia“, sage ich, als wir vor dem Apartment stehen.
Sie lächelt müde. „Gern geschehen. Ich muss noch kurz zu einem Freund, der in der Nähe wohnt. Aber morgen sehen wir uns, okay?“
Ich nicke. „Klar, mach das. Bis morgen!“
Sie drückt mir kurz die Hand und verschwindet dann in der Nacht. Ich stehe allein vor der Tür, atme tief durch und spüre, wie langsam Ruhe in mir einkehrt.
Langsam öffne ich die Wohnungstür und trete ein – mein neues Zuhause. Hier fängt mein Leben wirklich an.
Ich schließe die Tür hinter mir und stelle meinen Koffer ab. Die Wohnung wirkt klein und noch ein bisschen leer, aber sie fühlt sich auf seltsame Weise auch vertraut an. Langsam ziehe ich meinen Pulli aus und beginne, meine Sachen auszupacken. Jedes Teil, das ich aus dem Koffer nehme, erinnert mich daran, wie viel ich hinter mir lasse – aber auch, wie viel vor mir liegt.
Die Stille im Raum ist ungewohnt. Ich setze mich auf das Bett, nehme mein Handy in die Hand und scrolle zu den Kontakten. Meine Finger zögern kurz, dann tippe ich auf den Namen meiner Mutter.
„Hallo Mama“, sage ich leise, als sie abnimmt. „Ich bin gut angekommen.“
Ihre Stimme klingt froh und erleichtert. „Amber, das ist schön zu hören. Wie fühlst du dich?“
„Es ist alles so neu hier. Ich bin ein bisschen müde, aber es geht mir gut.“
Wir reden ein paar Minuten, sie fragt nach dem Flug, dem Apartment, ob ich etwas brauche. Während ich ihr antworte, merke ich, wie sehr ich ihre Stimme vermisse – und wie sehr ich gleichzeitig spüre, dass ich jetzt auf eigenen Beinen stehen muss.
Nach dem Gespräch lege ich das Handy zur Seite, atme tief durch und sehe mich im Zimmer um. Das hier ist mein Startpunkt. Und vielleicht auch der Anfang von etwas, das ganz anders ist als das, was ich bisher kannte.
Kapitel 4
Ich sitze auf meinem Bett und blicke auf den halb geöffneten Koffer, der neben mir liegt. Die meisten Sachen habe ich schon ausgepackt, aber jetzt geht es darum, alles für morgen bereit zu machen. Der erste richtige Tag im Medizinstudium – und ich fühle dieses seltsame Knistern im Bauch, eine Mischung aus Vorfreude und Unsicherheit.
Langsam greife ich nach den Büchern, die ich sorgfältig vorbereitet habe. „Anatomie für Einsteiger“ liegt schwer in meinen Händen, daneben das dicke Skript aus Biochemie. Ich blättere kurz durch die Seiten, die ich in den letzten Wochen vor dem Umzug durchgesehen habe, und versuche mir vorzustellen, wie es sein wird, all das in den nächsten Semestern wirklich zu lernen – nicht mehr nur Theorie, sondern Praxis, echte Prüfungen, echter Druck.
Ich lege die Bücher auf den kleinen Schreibtisch, der an der Wand steht, und öffne dann mein Notizbuch. Die Seiten sind noch fast leer, nur ein paar handschriftliche Notizen und Termine darin. Ich streiche mit dem Finger über das Papier und denke daran, wie viel von diesem neuen Leben ich darin festhalten will – meine Gedanken, meine Fortschritte, vielleicht auch meine Zweifel.
Dann nehme ich meinen Laptop vom Nachttisch und lege ihn vorsichtig in die Tasche, zusammen mit dem Ladegerät. Ohne Technik fühlt sich heute alles irgendwie unvollständig an. Ich organisiere noch Stifte und Marker, sortiere sie in das kleine Fach der Tasche, und finde dabei meinen Lieblingsblauen, den ich seit Jahren benutze. Vielleicht wird er mir auch hier Glück bringen.
Während ich all das tue, spüre ich, wie mein Herz manchmal schneller schlägt, besonders wenn ich daran denke, wie viele Erwartungen auf mir lasten. Von meinen Eltern, von den Dozenten, von mir selbst. Und manchmal frage ich mich, ob ich all dem wirklich gerecht werden kann.
Ich halte kurz inne, atme tief ein und versuche, den Druck loszulassen – zumindest für einen Moment. Dieses Zimmer, diese Tasche, das alles sind Zeichen dafür, dass ich jetzt auf meinem eigenen Weg bin. Nicht mehr nur das Mädchen, das tut, was andere von ihr erwarten. Sondern jemand, der versucht, herauszufinden, wer sie wirklich sein will.
Langsam schließe ich die Tasche, richte sie ordentlich auf dem Boden neben meinem Bett auf und schaue noch einmal um mich. Das hier ist mein Startpunkt. Ein neuer Anfang, der vielleicht nicht immer einfach sein wird, aber meiner.
Ich lege mich zurück aufs Bett, die Tasche neben mir, und lasse die Gedanken langsam zur Ruhe kommen.
Die Sonne ist längst untergegangen, und das warme Licht der Straßenlaternen flutet sanft durch das Fenster. Ich sitze auf dem Bett, die Tasche für morgen ordentlich neben mir verstaut. Der Raum wirkt jetzt noch stiller, fast friedlich, obwohl in meinem Kopf die Gedanken noch wirbeln.
Langsam hole ich mein Handy heraus und scrolle durch ein paar Nachrichten, ohne wirklich etwas zu lesen. Dann lege ich es weg und stehe auf, um das Fenster zu öffnen. Ein leichter Wind weht herein, trägt die Geräusche der Stadt mit sich – entfernte Stimmen, das Summen der Autos, das gelegentliche Bellen eines Hundes.
Ich atme tief ein und lasse den Blick in die Dunkelheit schweifen. Hier, in dieser fremden Stadt, fühlt sich alles neu und unbekannt an. Aber auch irgendwie aufregend.
Zurück auf dem Bett greife ich nach meinem Notizbuch und beginne, einige Gedanken niederzuschreiben – Erinnerungen an den Tag, kleine Hoffnungen und Fragen, die mich beschäftigen. Das Schreiben beruhigt mich, gibt mir das Gefühl, einen Teil von mir festzuhalten, der sonst verloren gehen könnte.