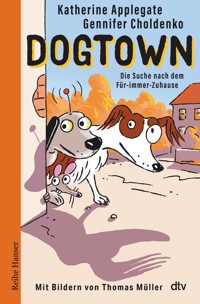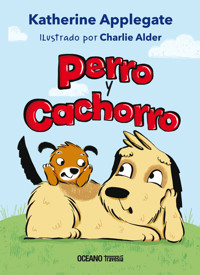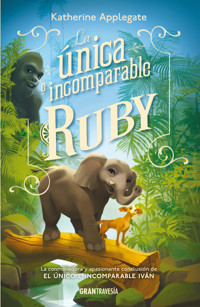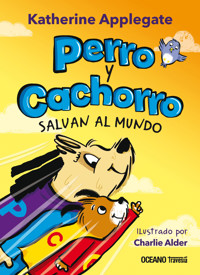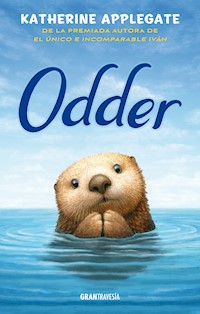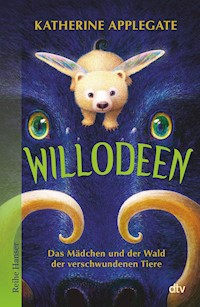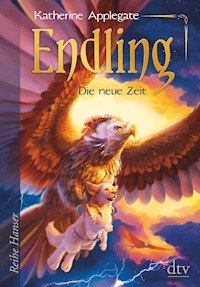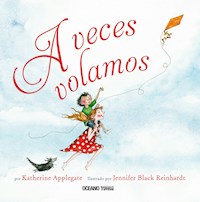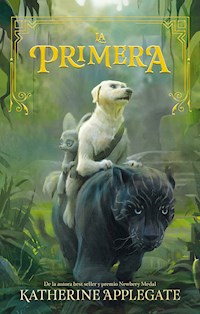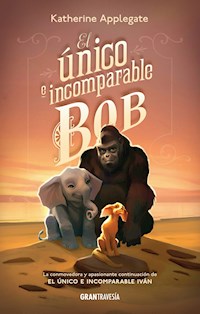7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Crenshaw ist kein gewöhnlicher Kater: Er hat nicht nur einen seltsamen Namen, sondern isst auch für sein Leben gern lila Geleebohnen. Er kann sprechen und ist riesengroß – so groß, dass man sich im Notfall gut bei ihm anlehnen kann. Vor allem aber ist Crenshaw unsichtbar. Der einzige, der ihn sehen kann, ist Jackson, obwohl der überhaupt nicht an unsichtbare Kater glaubt und im Moment ganz andere Sorgen hat. Zu Hause ist das Geld nämlich mal wieder knapp, sodass es zum Abendbrot seit einer Weile nur noch Cornflakes gibt, seine Mutter mehrere Jobs gleichzeitig annimmt und Jackson seine Sachen auf dem Flohmarkt verkaufen muss. Doch wenn alles zu schlimm wird, taucht Crenshaw auf, segelt mit dem Regenschirm durch die Lüfte, nimmt ein Schaumbad oder stellt irgendetwas anderes Verrücktes an. Er kitzelt ein Lächeln aus Jackson heraus, wenn ihm eigentlich zum Heulen zumute ist. Er versteht Jackson wie kein anderer und zeigt ihm, dass es ok ist, wütend zu sein. Denn auch ein Kater ist nicht immer gut gelaunt. Und er erinnert Jackson daran, dass es höchste Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen. Ein lustiger und berührender Roman über die magische Kraft der Phantasie, die Kinder in schwierigen Lebenssituationen retten kann. Katherine Applegate findet genau die richtigen Worte für ein hoch aktuelles Thema: die Angst vor der Armut. Mit Schwarzweißzeichnungen von Crenshaw, der auch im Buch an den verrücktesten Orten auftaucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Katherine Applegate
Crenshaw - Einmal schwarzer Kater
Über dieses Buch
Crenshaw ist kein gewöhnlicher Kater: Er hat nicht nur einen seltsamen Namen, sondern isst auch für sein Leben gern lila Geleebohnen. Er kann sprechen und ist riesengroß – so groß, dass man sich im Notfall gut bei ihm anlehnen kann. Vor allem aber ist Crenshaw unsichtbar. Der einzige, der ihn sehen kann, ist Jackson, obwohl der überhaupt nicht an unsichtbare Kater glaubt und im Moment ganz andere Sorgen hat. Zu Hause ist das Geld nämlich mal wieder knapp, sodass es zum Abendbrot seit einer Weile nur noch Cornflakes gibt, seine Mutter mehrere Jobs gleichzeitig annimmt und Jackson seine Sachen auf dem Flohmarkt verkaufen muss.
Doch wenn alles zu schlimm wird, taucht Crenshaw auf, segelt mit dem Regenschirm durch die Lüfte, nimmt ein Schaumbad oder stellt irgendetwas anderes Verrücktes an. Er kitzelt ein Lächeln aus Jackson heraus, wenn ihm eigentlich zum Heulen zumute ist. Er versteht Jackson wie kein anderer und zeigt ihm, dass es ok ist, wütend zu sein. Denn auch ein Kater ist nicht immer gut gelaunt. Und er erinnert Jackson daran, dass es höchste Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Die amerikanische Bestsellerautorin Katherine Applegate lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Irvine, Kalifornien. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Für ›Der unvergleichliche Ivan‹ erhielt sie 2013 die Newbery Medal.
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden sich auf www.blubberfisch.de und www.fischerverlage.de
Impressum
Zitat aus dem Theaterstück ›Mein Freund Harvey‹ von Mary Chase Copyright © 1944 by Mary Chase
Neuauflage Copyright © 1971 by Mary Chase
Zitate aus ›Ein Loch ist da, um gegraben zu werden. Ein erstes Buch mit ersten Definitionen‹ von Ruth Krauss. Copyright Text © 1952 by Ruth Krauss. Copyright Text Neuauflage © 1980 by Ruth Krauss
Zu diesem Buch ist bei Sauerländer audio ein Hörbuch, gelesen von Hanno Koffler, erschienen, das im Buchhandel erhältlich ist.
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel ›Crenshaw‹ bei Feiwel and Friends, an imprint of Macmillan, New York
© 2015 Katherine Applegate
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Norbert Blommel, MT-Vreden
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-0297-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Teil Eins
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Teil Zwei
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Teil Drei
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
Dank
für Jake
Dr. Sanderson »Denk genau nach, Dowd. Hast du nicht irgendwann, irgendwo jemanden gekannt, der Harvey heißt? Kennst du wirklich niemanden, der so heißt?«
Elwood P. Dowd »Nein. Nein, nicht einen einzigen, Doktor. Vielleicht hatte ich deshalb immer so darauf gehofft.«
Mary Chase, Mein Freund Harvey (1944)
Teil Eins
»Eine Tür ist da, um geöffnet zu werden
Ein Loch ist da, um gegraben zu werden. Ein erstes Buch mit ersten Definitionen – geschrieben von Ruth Krauss, illustriert von Maurice Sendak
1
Mir fielen mehrere Seltsamkeiten an dem surfenden Kater auf.
Erstens: Er war ein surfender Kater.
Zweitens: Er hatte ein T-Shirt an. Darauf stand:
KATER REGIEREN, HUNDE PARIEREN.
Drittens: Er hielt einen geschlossenen Regenschirm, als hätte er Angst davor, nass zu werden. Was beim Surfen nicht gerade das größte Problem sein dürfte.
Viertens: Niemand am Strand schien ihn zu sehen.
Er erwischte eine gute Welle und nahm sie glatt. Aber als er sich dem Strand näherte, beging er den Fehler und öffnete den Schirm. Er wurde von einer Windbö erfasst und in den Himmel gerissen. Um ein Haar wäre er mit einer Seemöwe zusammengeprallt.
Selbst die Möwe schien ihn nicht zu bemerken.
Der Kater schwebte über mir wie ein pelziger Ballon. Ich schaute zu ihm hoch. Er schaute zu mir runter. Und winkte.
Sein Fell war schwarzweiß, wie bei einem Pinguin. Fehlte nur noch eine Fliege und ein Zylinder. Er sah aus, als wäre er zu einer feinen Party unterwegs.
Trotzdem kam er mir bekannt vor.
»Crenshaw«, flüsterte ich.
Ich schaute mich um. Ich sah Sandburgenbauer, Frisbeespieler und Krabbenjäger. Aber niemand blickte zu dem schwebenden, Schirm tragenden Surferkater am Himmel.
Ich drückte die Augen zu und zählte bis zehn. Ganz langsam.
Zehn Sekunden schienen mir genau die richtige Länge, um mich vor dem Wahnsinnigwerden zu retten.
Ich war ein bisschen benommen. Aber das passiert manchmal, wenn ich hungrig bin. Seit dem Frühstück hatte ich nichts mehr gegessen.
Als ich die Augen öffnete, seufzte ich erleichtert auf. Der Kater war weg. Der endlose Himmel leer.
Wopp. Der Regenschirm landete wie ein riesiger Wurfspieß nur wenige Zentimeter vor meinen Füßen im Sand.
Er war aus rotgelbem Plastik und mit Bildern von winzigen lächelnden Mäusen verziert. Am Griff eingraviert stand:
DIESES REGENDACH GEHÖRT CRENSHAW.
Ich schloss wieder die Augen. Ich zählte bis zehn. Ich öffnete die Augen, und der Schirm – oder das Regendach, wie auch immer – war verschwunden. Genau wie der Kater.
Es war Ende Juni, angenehm warm, aber ich schauderte.
Ich fühlte mich wie in dem Moment, bevor man ins tiefe Ende eines Schwimmbeckens springt.
Man ist irgendwohin unterwegs. Man ist noch nicht da. Aber man weiß, es gibt kein Zurück.
2
Es ist so: Eigentlich bin ich nicht der Typ für einen imaginären Freund.
Im Ernst. Im Herbst gehe ich in die fünfte Klasse. In meinem Alter ist es nicht gut, wenn man als verrückt gilt.
Ich mag Fakten. Schon immer. Verlässliche Sachen. Fakten wie: Zwei plus zwei ist vier. Fakten wie: Rosenkohl schmeckt wie dreckige Turnsocken.
Okay, vielleicht ist das Zweite eher Geschmackssache. Und um ehrlich zu sein, ich habe noch nie eine dreckige Turnsocke gegessen und könnte folglich falschliegen.
Fakten sind wichtig für Wissenschaftler, und genau das möchte ich später mal werden. Am liebsten mag ich Fakten über die Natur. Besonders solche, bei denen alle sagen: »Unmöglich!«.
Zum Beispiel, dass ein Gepard eine Geschwindigkeit von bis zu 113 Stundenkilometern erreicht.
Oder dass eine kopflose Kakerlake zwei Wochen lang überleben kann.
Oder dass eine wütende Krötenechse Blut aus ihren Augen sprüht.
Ich möchte Tierwissenschaftler werden. Ich weiß noch nicht genau, auf welchem Spezialgebiet. Im Augenblick finde ich Fledermäuse toll. Aber ich mag auch Geparden, Katzen, Hunde, Schlangen, Ratten und Seekühe. Es gibt also einige Möglichkeiten.
Dinosaurier sind auch ganz gut, nur sind die alle schon tot. Eine Zeitlang wollten meine Freundin Marisol und ich Paläontologen werden und nach Dinosaurierfossilien suchen. Um schon mal das Graben zu üben, hat sie oft übrig gebliebene Hühnchenknochen in ihrer Sandkiste eingebuddelt.
Marisol und ich haben in diesem Sommer einen Hundeausführ-Service gegründet. Er heißt Spotty will laufen. Manchmal tauschen wir beim Hundeausführen Fakten über die Natur aus. Gestern hat sie mir erzählt, dass eine Fledermaus bis zu 1200 Moskitos pro Stunde frisst.
Fakten sind viel besser als Geschichten. Eine Geschichte kann man nicht sehen. Man kann sie auch nicht in den Händen halten und messen.
Eine Seekuh kann man auch nicht in den Händen halten. Aber trotzdem. Geschichten sind letztendlich nur Lügen. Und ich lass mich nicht gern anlügen.
Ich bin nie ein großer Freund von Phantasiespielen gewesen. Als ich klein war, habe ich mich nicht als Batman verkleidet oder mit Stofftieren geredet oder mich vor Monstern unter dem Bett gefürchtet.
Meine Eltern sagen, in der Vorschule hätte ich allen erzählt, ich wäre der Bürgermeister der Erde. Allerdings nur ein paar Tage lang.
Klar, ich hatte meine Crenshaw-Phase. Aber viele Kinder haben einen imaginären Freund.
Einmal war ich mit meinen Eltern im Einkaufszentrum, wir wollten den Osterhasen angucken. Wir standen auf künstlichem Rasen neben einem riesigen künstlichen Korb, in dem ein riesiges künstliches Ei lag. Als ich an die Reihe kam und mit dem Osterhasen posieren sollte, schaute ich kurz auf seine Pfote und riss sie einfach ab.
Zum Vorschein kam eine Männerhand. Mit blonden Haarbüscheln und einem goldenen Ehering.
»Das ist gar kein Hase!«, rief ich. Ein kleines Mädchen fing an zu heulen.
Der Manager des Einkaufszentrums warf uns raus. Ich bekam nicht den Gratiskorb mit Bonboneiern und auch kein Foto mit dem falschen Hasen.
Damals wurde mir zum ersten Mal klar, dass Menschen nicht immer gern die Wahrheit hören.
3
Nach dem Vorfall mit dem Osterhasen fingen meine Eltern an, sich Sorgen zu machen.
Abgesehen von meinen zwei Tagen als Bürgermeister der Erde hatte ich wohl nicht besonders viel Phantasie. Sie hielten mich für zu erwachsen. Zu ernst.
Mein Dad überlegte, ob er mir mehr Märchen vorlesen sollte. Meine Mom überlegte, ob sie mich nicht so viele Natursendungen hätte sehen lassen sollen, in denen Tiere sich gegenseitig fressen. Sie fragten meine Oma um Rat. Sie wollten wissen, ob ich für mein Alter zu erwachsen war. Meine Oma beruhigte sie und meinte, sie sollten sich keine Sorgen machen.
Egal, wie erwachsen ich wirkte, sagte sie, es würde sich bestimmt verlieren, wenn ich ein Teenager wurde.
4
Ein paar Stunden nach meiner Crenshaw-Sichtung am Strand erschien er wieder.
Diesmal ohne Surfbrett. Ohne Schirm.
Und auch ohne Körper.
Trotzdem. Ich wusste, er war da.
Es war ungefähr sechs Uhr abends. Meine Schwester Robin und ich spielten Müsliball im Wohnzimmer unserer Wohnung. Müsliball ist ein guter Trick, wenn man hungrig ist und bis zum Morgen nicht mehr viel zu essen kriegt. Wir spielten es, wenn unsere Mägen sich gegenseitig etwas vorknurrten. Mann, hätte ich jetzt gern ein Stück Salamipizza, grummelte mein Magen. Und dann grummelte ihrer zurück: Ja, oder vielleicht einen Ritz-Cracker mit Erdnussbutter.
Robin liebt Cracker.
Müsliball ist ein einfaches Spiel. Man braucht nur ein paar Cheerios oder vielleicht ein kleines zerrupftes Stück Brot. M&M’s gehen auch, falls unsere Mom nicht da ist und sagt: kein Zucker. Allerdings haben wir sowieso keine im Haus, wenn nicht gerade Halloween war.
In meiner Familie sind solche Sachen ratzfatz weg.
Zuerst bestimmt man ein Ziel, auf das geworfen wird. Eine Schale oder eine Tasse sind gut. Ein Abfalleimer eignet sich weniger, weil er Krankheitserreger enthalten könnte. Manchmal benutze ich Robins Baseballmütze. Obwohl das wahrscheinlich auch eklig ist.
Für eine Fünfjährige schwitzt sie nämlich ganz schön viel.
Man wirft also ein Müslistück und versucht, die Mütze zu treffen. Die Regel lautet, dass man das Stück nur essen darf, wenn man trifft. Das Ziel sollte möglichst weit weg stehen, sonst ist man zu schnell mit dem Essen fertig.
Der Trick ist, dass man das Spiel lange hinauszögert, weil man dann seinen Hunger vergisst. Jedenfalls für eine Weile.
Ich verwende gern Cheerios, Robin bevorzugt Cornflakes. Aber man darf nicht wählerisch sein, wenn der Schrank leer ist. Meine Mom sagt das manchmal.
Wenn kein Müsli mehr da ist und der Magen trotzdem noch knurrt, kann man auch versuchen, sich mit einem Stück Kaugummi abzulenken.
Ihn hinters Ohr zu kleben ist ein gutes Versteck, wenn man ihn zweimal verwenden will. Selbst wenn der Geschmack dann flöten ist, haben die Zähne noch was zu beißen.
Crenshaw tauchte auf – zumindest schien er aufzutauchen –, während wir eifrig die Crunchies von meinem Dad in Robins Mütze warfen. Ich war grade dran und landete einen Treffer. Als ich das Crunchiestück herausholen wollte, entdeckte ich vier lila Geleebohnen.
Ich liebe lila Geleebohnen.
Ich starrte sie ganz lange an. »Woher kommen die Geleebohnen?«, fragte ich schließlich.
Robin griff nach der Mütze. Ich wollte sie wegziehen, überlegte es mir aber anders. Robin ist zwar klein, aber man legt sich besser nicht mit ihr an.
Sie beißt nämlich.
»Das ist Zauberei!«, sagte sie und fing an, die Geleebohnen unter uns aufzuteilen. »Eine für mich, eine für dich, zwei für mich –«
»Im Ernst, Robin. Hör auf rumzualbern. Woher?«
Robin schlang zwei Geleebohnen runter. »Höaf michu näävn«, sagte sie, was ich als »hör auf mich zu nerven« in Bonbonsprache deutete.
Aretha, unser großer Labradorköter eilte herbei, um sich die Sache näher anzusehen. »Nichts Süßes für dich«, sagte Robin. »Du bist ein Hund und kriegst Hundefutter, junge Dame.«
Aber Aretha interessierte sich gar nicht für die Süßigkeiten. Sie spitzte die Ohren in Richtung Haustür und schnupperte in der Luft, als würden wir Besuch bekommen.
»Mom«, rief ich, »hast du Geleebohnen gekauft?«
»Klar«, rief sie aus der Küche zurück. »Die gibt es später zum Kaviar.«
»Ich meine es ernst«, sagte ich und hob meine beiden auf.
»Iss einfach Dads Crunchies, Jackson. Dann pupst du eine Woche lang«, antwortete Mom.
Eine Sekunde später erschien sie mit einem Geschirrtuch in den Händen in der Tür. »Habt ihr denn immer noch Hunger?« Sie seufzte. »Es sind noch ein paar Nudeln mit Käse vom Abendessen übrig. Und ein halber Apfel, den könnt ihr euch teilen.«
»Schon gut«, sagte ich schnell. Früher, als immer was zu essen im Haus war, fing ich an zu jammern, wenn meine Lieblingssachen aufgefuttert waren. Aber in letzter Zeit war immer alles aufgefuttert, und ich hatte das Gefühl, meine Eltern bedrückte das irgendwie.
»Wir haben Geleebohnen, Mom«, sagte Robin.
»Na, dann ist ja alles gut. Solange ihr etwas Nahrhaftes esst«, sagte Mom. »Morgen krieg ich meinen Lohn, dann geh ich nach der Arbeit einkaufen.«
Sie nickte leicht, als hätte sie etwas auf einer Liste abgehakt, und ging wieder in die Küche.
»Willst du deine Geleebohnen gar nicht essen?«, fragte Robin und zwirbelte ihren blonden Pferdeschwanz um die Finger. »Wenn ich dir nämlich einen großen Gefallen tun soll, könnte ich sie gern für dich essen.«
»Ich esse sie schon«, sagte ich. »Nur nicht … jetzt.«
»Warum nicht? Sie sind lila. Die magst du doch so gern.«
»Ich muss erst eine Weile nachdenken.«
»Du bist ein komischer Bruder«, sagte Robin. »Ich geh in mein Zimmer. Aretha möchte Verkleiden spielen.«