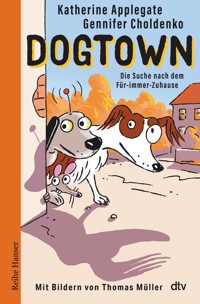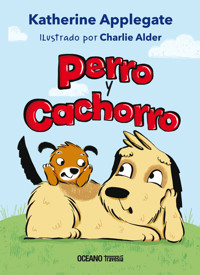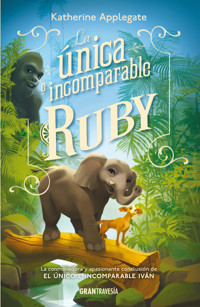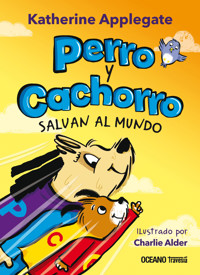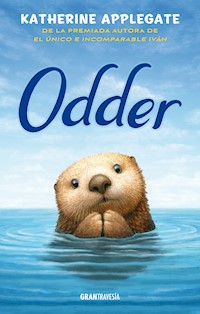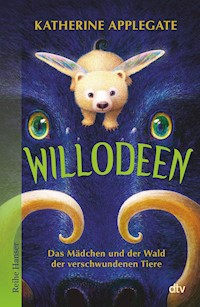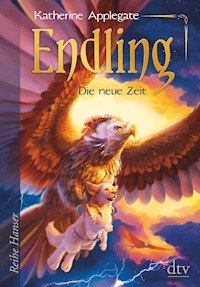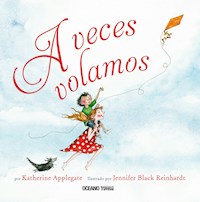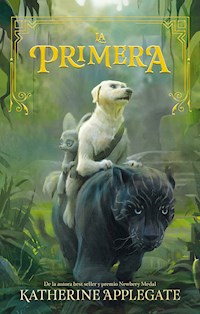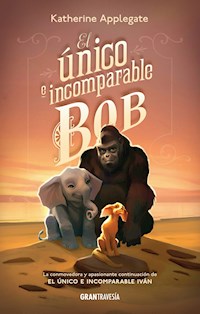9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Endling-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Die Rebellion beginnt … und das Endling-Abenteuer geht weiter! Es ist vielleicht ihr Schicksal, die Letzte ihrer Art, ein Endling zu sein – und genau davor hat das Dalkinmädchen Byx Angst. Gemeinsam mit ihren Weggefährten Tobble, Khara, Renzo und Gambler ist sie auf der Reise hoch in den Norden Nedarras, wo eventuell doch noch andere Dalkins leben könnten. Zu fünft sehen die Freunde die atemberaubende Natur, erleben aber auch ein Land, das vor einer schrecklichen Prüfung steht: Krieg liegt in der Luft. Feindlich stehen sich die Herrscher Nedarras und Dreylands gegenüber. Doch mit zunehmender Kriegsgefahr formiert sich Widerstand. Für Frieden und Freiheit wollen sich immer mehr Menschen und Tiere einsetzen! Byx wird alles dafür geben!.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Byx fürchtet, sie sei die Letzte ihrer Art, der Endling, nachdem ihr Rudel von Soldaten des Machthabers Murdano umgebracht wurde. Nur eine Hoffnung hat sie, dass hoch im Norden Nedarras eine letzte Dalkin-Kolonie lebt. Dorthin führt sie ihre Reise über schneebedeckte Berge, quer durch das Nachbarreich Dreyland. Immer mit dabei ihre mutigen und treuen Freunde Khara, Tobble, Renzo und Gambler.
Doch die Zeichen stehen auf Krieg zwischen Dreyland und Nedarra. Längst sind nicht mehr nur die Dalkins in Gefahr, sondern alle Geschöpfe ihrer Welt. Lässt sich der Krieg noch verhindern? Byx, Khara und ihre Gefährten sind fest entschlossen, alles dafür zu tun.
Für Michael
SICH SELBST ZU EROBERN IST DER GRÖSSTE ALLER SIEGE.
Plato
ENDLINGSubstantiv – end.ling – /‘en(d)-ling/
Das letzte lebende Individuum einer Art, bisweilen auch einer Unterart.
1. Die offizielle Zeremonie, bei der eine Art für ausgestorben erklärt wird; eine Eumonie.
2. (Inoffiziell) für jemanden, der eine zum Scheitern verurteilte oder sinnlose Suche unternimmt.
Kaiserlich-Amtliches Lexikon für Nedarra, 3. Auflage
1
SPÜRT DIE ANGST. WÄHLT DEN MUT
Ich bin nicht tapfer. Nicht mutig. Keine Anführerin.
Um die Wahrheit zu sagen, ich bin kein bisschen außergewöhnlich.
Es sei denn, ihr bedenkt die Tatsache, dass ich möglicherweise die Letzte meiner Art bin – der Art der Dalkins.
Ein Endling.
Aber was Tapferkeit ist, das weiß ich sehr wohl.
Tapferkeit ist, wenn man ganz allein eine Meute von Giftschlangen abwehrt, um einen jungen Dalkin und seinen kleinen Wobbyk-Freund zu retten.
Dieser junge Dalkin war ich. Und meine Retterin war Kharassande Donati, meine menschliche Weggefährtin, Anführerin und liebe Freundin.
Ich wäre gern so mutig wie Khara, so sicher, so klug. Aber Anführerinnen wie sie müssen wohl dazu geboren sein.
Mein Vater, auch er ein mutiger und herausragender Anführer, liebte kluge Sprichwörter und Redensarten. Er sagte gern zu mir und meinen sieben Geschwistern: »Spürt die Angst, wählt den Mut. Das ist es, Kinder, was einen echten Anführer ausmacht.«
Also, zumindest das mit der Angst kriege ich einwandfrei hin. Die vielen Anzeichen dafür sind mir nur zu gut vertraut: gesträubtes Fell, gefrorenes Blut, rasendes Herz, ausgefahrene Krallen.
Meine Reisegefährten – Khara, Tobble, Renzo und Gambler – sagen immer, ich sei mutiger, als ich glaube. Und manchmal in diesen vergangenen Monaten war ich wohl selbst überrascht von mir.
Doch meine wenigen Augenblicke von kühnem Auftreten sind noch lange keine Beweise für echten Mut. Sie beweisen nur, dass ich gut Theater spielen kann. Wenn ihr mich fragt: So zu tun, als hätte man keine Angst, ist nicht das Gleiche wie wahre Furchtlosigkeit. Egal, was meine Freunde sagen.
Meine starken, treuen, kampferprobten Freunde. Wie ich sie alle liebe! Ich kann längst nicht mehr zählen, wie oft sie mir immer wieder Mut gemacht haben auf unserer Suche nach anderen Dalkins.
Wir wissen, dass unsere Chancen nicht gut stehen. Es ist erst wenige Monate her, dass mein ganzes Rudel von Soldaten getötet worden ist – von den Soldaten des Murdano, des despotischen Herrschers von Nedarra, meinem Heimatland. Und ganz sicher war mein Rudel nicht das erste. In ganz Nedarra ist die Anzahl der Dalkins langsam zurückgegangen.
Ich bin die Einzige, die diesen grausamen Tag überlebt hat. Ich, die Niedrigste in der Rangfolge der Rudelmitglieder. Der Kümmerling. Der am wenigsten zu gebrauchen ist. Der am wenigsten nützlich ist.
Dessen Mut am geringsten ist.
Auch wenn ich mich an die Hoffnung klammere, fürchte ich doch, dass ich wohl nie einen anderen Dalkin zu Gesicht bekommen werde. Ein grauenvoller Gedanke, der mich manchmal mit seiner ganzen Wucht betäubt und mit stumpfem Schmerz erfüllt, als würde eine schlecht verheilte Wunde in mir pochen. An diese Furcht habe ich mich gewöhnt, sie geht Tag und Nacht neben mir her: mein hässlicher unentrinnbarer Begleiter.
Dennoch sind es die neuen Schrecken, die unerwarteten, die mir am meisten zu schaffen machen.
Sie kommen manchmal im Dunkel der Nacht, lautlos und blutdurstig.
Und manchmal, wie zum Beispiel gestern, kreisen sie am Himmel, schön, anmutig und tödlich.
2
MESSERMÖWEN
Den ganzen Vormittag waren wir auf die eisbedeckten Gipfel zugewandert, die in der Ferne jenseits der Grenze von Nedarra aufragten – unserer ungewissen Zukunft und meinen vagen Hoffnungen entgegen.
Wir waren schon drei Stunden unterwegs gewesen, und das Gehen wurde beschwerlich. Kalt war es, graue Wolken waberten um die Berge und griffen nach ihren Gipfeln. Die Dunstwolken unseres Atems schwebten vor uns her wie Geister aus unserer verworrenen Vergangenheit.
Der Pfad entlang der bedrohlichen Felswand, dem wir gefolgt waren, hatte sich zu einem dreieckigen Platz geweitet, und wir beschlossen, hier zu rasten. Der Boden war stellenweise schneebedeckt, die Vegetation welk und braun. An zwei Seiten des Rastplatzes erhoben sich die Felswände Hunderte Meter hoch. Die dritte Seite lag offen zum Meer hin.
Kaum hatten wir uns niedergelassen, durchschnitt ein großer Vogelschwarm die Wolken und kreiste über uns am Himmel. Es waren Hunderte, und sie bewegten sich in mustergültiger Formation wie gut ausgebildete Soldaten.
»Messermöwen«, sagte Renzo. »Seid auf der Hut vor ihnen. Sie haben Schnäbel wie Rasiermesser. Und sie stehlen, was sie in die Krallen kriegen können.«
»Verwandte Seelen also?«, witzelte Khara, denn Renzo war ein versierter Dieb.
»Ich musste mein Handwerk lernen«, sagte Renzo und tätschelte seinen nicht eben gut duftenden Hund Dog, der mit großem Eifer die Steine beschnupperte. »Bei den Messermöwen ist das bloßer Instinkt.«
»Sie sehen schön aus«, sagte Tobble, der kleine Wobbyk, der mein engster Freund geworden war. Der Ausdruck in seinem runden Gesicht erinnerte ein bisschen an einen Fuchs, er hatte ein vorstehendes Bäuchlein, riesige ovale Ohren und große dunkle Augen. Seine drei Schwänze waren neuerdings geflochten und mit einem Lederband zusammengehalten – in der Wobbyk-Kultur ein unentbehrliches Zeichen für den Eintritt ins Erwachsenenleben.
Fasziniert sahen wir zu, wie die rotgrauen Vögel kreisten, umherwirbelten und sich in der Luft drehten wie Treibgut in einem Wirbelsturm. »Sie versammeln sich oft in der Nähe von Bergbaugebieten und Dörfern«, sagte Renzo. »Wenn sie eine Tasche oder einen Beutel mit Schmuckstücken zu fassen kriegen, fliegen sie damit in Richtung Süden und laden alles auf Piratenschiffen ab. Dafür bekommen sie von den Piraten fangfrische Fische.« Er zog die Schultern hoch. »Als Dieb muss ich ihre Kunst bewundern.«
»Warum fangen sie ihre Fische nicht selber?«, fragte ich.
»Aus dem gleichen Grund, aus dem Piraten nicht als Farmer und Händler arbeiten«, sagte Renzo. »Stehlen ist viel spannender.«
»Ich hatte gehofft, dass wir hier rasten und etwas essen können«, sagte Khara und ließ prüfend ihren Blick über die Gegend wandern. »Meinst du, es ist sicher?«
»Einigermaßen, ja«, sagte Renzo. »Solange wir wachsam bleiben. Außerdem brauchen wir dringend ein bisschen Schlaf.«
»Hätte nichts gegen so einen kleinen Flatterhappen einzuwenden«, sagte Gambler, während seine hellblauen Felijaga-Augen den Messermöwen folgten. Gambler, eine geschmeidige, glänzend schwarze Raubkatze, hatte im Gesicht feine weiße Streifen, an den Pranken aber Krallen, die kein bisschen fein waren, sondern tödlich. »Auch nichts gegen sonst irgendeinen Happen. Denke, ich werd mal die Wiese hier auskundschaften und sehen, was ich finde.«
»Wenn du zurück bist, Gambler, wird unser Essen fertig sein«, sagte Tobble, und mein Magen stöhnte nachdrücklich. (Der Magen eines Dalkins knurrt nicht. Er stöhnt, was meiner Meinung nach sehr viel vornehmer ist.)
»Danke«, sagte Gambler, »aber ich finde hoffentlich was Besseres als Kekse.«
»Wir haben noch ein bisschen getrocknetes Cotchetfleisch«, bot Tobble an.
Gambler nickte. »Getrocknet heißt tot. Das ist keine Mahlzeit für einen Felijaga, Tobble.«
Tobble, der kein Fleisch isst, rümpfte die Nase, und Gambler machte sich auf seine unverkennbare Katzenart davon, scheinbar gemächlich und schnell zugleich.
Während ich Zweige und Brennholz sammelte, packte Tobble unsere Kochgerätschaften aus. Bald hatten wir ein kleines Feuer brennen, und leise singend kramte Tobble Kräuter und eine kleine Pfanne hervor.
Er hatte sich als der beste Koch von uns erwiesen. Auch Renzo war nicht schlecht, besonders wenn er die paar magischen Sprüche einsetzte, die er seit seinem fünfzehnten Geburtstag in diesem Jahr schon gelernt hatte. Viel brachte er allerdings noch nicht zustande: mal einen kalten Eintopf warm machen, mal ein fades Gemüse schmackhaft. Eines Abends hatte er versucht, uns mit dem Knacken von Tallin-Kernen zu beeindrucken – sie hatten sich in kleine Glühwürmchen verwandelt und waren im Wind davongetrieben.
Eindrucksvoll war das gewesen. Nur nicht essbar.
»Magie«, hatte Tobble gegrummelt, während wir den Glühwürmchen nachschauten, die wie kleine Sterne zum Himmel flogen. »Ein guter Koch braucht keine Magie.« Und damit hatte er aus dem Stand einen Schwung Kitlattis zubereitet, ein süßes Gebäck, dessen Rezept er von seiner Ur-Ur-Ur-Großmutter hatte. Es schmeckte wie kleine Wolken, falls Wolken wie Honig schmecken.
Wobbyks wie Tobble befassten sich nicht mit Magie. Das taten nur die sechs großen Arten: Menschen, Dalkins, Felijagas, Natintjes, Raptidons und Terra-Olme. (Allerdings hatte ich kaum je gesehen, dass Dalkins sich in Magie übten. Wir hatten genug zu tun, um zu überleben.)
»Gleich werden wir heißen Tee haben«, kündigte Tobble an.
»Danke, Tobble«, sagte ich. »Dann geb ich Khara und Renzo Bescheid.«
Ich traf die beiden am Rand der Wiese, von wo aus sie aufs Meer hinausschauten. »Noch mehr Messermöwen«, sagte Renzo und zeigte mit der Hand hin.
Wir sahen zu, wie sie vom Himmel herabschossen. »Sie scheinen nicht näher zu kommen«, sagte ich.
»Noch nie habe ich Vögel gesehen, die sich mit solcher Präzision bewegen«, sagte Khara und strich eine Strähne ihres gewellten dunklen Haars zur Seite, die ihr der Wind ins Gesicht geweht hatte. Khara hatte dunkle Augen mit dichten Wimpern und einen klugen, wachsamen Blick. Wie so oft war sie schlicht und bäuerlich gekleidet wie ein Wilderer – das war ihr früherer Beruf gewesen. Kharas Kleidung war nur wenig heller als ihre mattbraune Haut.
Ab und zu fand sie es unterwegs einfacher, sich als Junge auszugeben. Anscheinend haben manche Menschen keine allzu hohen Erwartungen, wenn es um die Fähigkeiten von weiblichen Wesen geht. Ich verstehe nicht, warum. In der Welt der Dalkins gelten weibliche und männliche Wesen gleich viel.
Oder vielleicht sollte ich besser sagen, galten gleich viel.
Aber im Verhalten der Menschen gibt es ohnehin vieles, das mir rätselhaft ist.
An Kharas Gürtel hing ein rostiges Schwert. Es war eine Waffe von höchst erbärmlichem Aussehen, aber wir alle hatten sie schon in Aktion gesehen und kannten ihre verborgenen Kräfte. Dieses krumme Schwert, das Licht von Nedarra, war eine Waffe mit berühmter Vergangenheit.
»Wie weit können wir noch wandern, bevor es dunkel wird, was meinst du?«, fragte Khara Renzo.
Eigentlich war Khara unsere Anführerin, doch auf diesem Teil der Reise führte uns Renzo, denn er war der Einzige von uns, der schon bis hierher in die gebirgige Gegend von Dreyland vorgedrungen war. Dreyland war eines der beiden Länder, die an Nedarra grenzten.
Renzo maß die hoch aufragenden Felswände mit einem abschätzenden Blick. »Schwer zu sagen. Das Gelände wird jetzt immer trügerischer. Zudem sieht es so aus, als könnte es schneien.«
»Wir wollen uns an den Plan halten, so lange wir können«, nickte Khara entschlossen.
Dieser Plan, so ungenau er war, sah vor, Richtung Norden zu wandern und dabei die Berge an der Küste zu umgehen, immer in der Hoffnung, dass wir eine im Wasser treibende Insel namens Tarok zu Gesicht bekämen. Wir hatten überlegt, uns mit einem Boot auf die Suche danach zu machen, doch besaßen wir nicht die Mittel, um auch nur das bescheidenste Wasserfahrzeug bezahlen zu können. Und außerdem gab es nur wenige Boote. Selbst Piraten hielten sich in dieser kalten Jahreszeit von Dreylands Felsenküste fern. Die Strömung war lebensgefährlich, die Eisschollen unberechenbar.
Warum eine lebende Insel wie Tarok Richtung Norden treiben sollte, wussten wir nicht. Was uns aber bekannt war, was mein Herz in dunklen Nächten höherschlagen ließ, war eine Sage über eine Kolonie von Dalkins, die einst dort gelebt haben soll.
Ich erinnerte mich noch an das Gedicht, das ich im Unterricht hatte lernen müssen:
Sing, o Dichter
von den Ahnen, den tapferen Dalkins,
die tückische, wilde Berge bezwangen,
über eiskalte Wasser des Nordens sich wagten
nach Dalkinholm, der lebenden Insel,
dem schwimmenden Juwel.
Die Suche danach war uns ganz unmöglich erschienen. Und doch hatte ich nach vielen Reisetagen und schmerzvollen Erfahrungen einen flüchtigen Blick auf einen anderen Dalkin erhascht, der sich auf einer schwimmenden Insel von Wipfel zu Wipfel schwang. Das war erst wenige Tage her.
Jedenfalls hatte ich gedacht, ich hätte einen gesehen.
Mein Magen stöhnte wieder. »Tobble sagt, es gibt gleich heißen …«
Mitten im Satz wurde ich vom Schwirren unzähliger Flügelschläge unterbrochen.
Die Messermöwen hatten in einzigartiger Symmetrie ihren Kurs geändert und stürzten sich nun wie wütende Bienen auf ein Ziel.
Mein Herz stockte, und schon kehrte meine alte, ungeliebte Freundin Angst zurück.
Das Ziel waren wir.
3
ANGRIFF VOM HIMMEL
Sie kommen aus dieser Richtung!«, schrie Renzo und sprang zur Seite.
»Byx! Tobble! Auf die Erde!«, rief Khara und zog ihr Schwert.
»Nimm lieber eine Fackel«, sagte Renzo. Er lief zu Tobbles kleinem Lagerfeuer und riss ein brennendes Holzstück heraus. »Rauch mögen sie nicht.«
Khara steckte ihr Schwert zurück in die Scheide und nahm sich einen glühenden Stock.
Tobble beschloss vernünftigerweise, sich wie befohlen auf den Boden zu werfen. Ich aber wollte nicht, dass Khara und Renzo den Kampf für meine Sache allein austragen mussten – obwohl ich bezweifelte, eine große Hilfe zu sein.
Ich fand einen Ast, der noch kein Feuer gefangen hatte, und stieß ein Ende in die Flammen, ich riss büschelweise feuchtes Gras aus und warf es ins Feuer. Beißend grauer Qualm kräuselte sich zum Himmel.
Hustend, weil sich der Wind gedreht hatte, schwenkte ich meine schwach brennende Fackel und stellte mich neben Khara und Renzo.
Die dunkle Formation der Vögel hatte sich aufgelöst. Jetzt flogen sie wie Hunderte Geschosse direkt auf uns zu.
Sie trafen uns wie ein Hagelschauer, prasselten gegen Brust und Kopf, stießen mit den messerscharfen Schnäbeln zu, die ihnen ihren Namen gegeben hatten. Im Nu hatte ich Schnittwunden an beiden Armen und entging nur mit Mühe und Not einer Attacke, die mir fast den Hals aufgeschlitzt hätte. Ich hörte Dog gellend jaulen vor Schmerz, als ihm eine der Messermöwen das Fell aufriss.
Mir raste das Herz in der Brust. Die Schnitte in meinen Unterarmen brannten, mit einem flüchtigen Blick sah ich hell schimmerndes Blut aus den Wunden rinnen.
»Nein!«, schrie ich, stieß meinen brennenden Ast in die Luft und schlug blindlings um mich.
Die Vögel gaben nicht auf. Die vordersten flogen davon, wendeten rasant und kamen von hinten zurück. Durch einen Tornado aus Flügeln sah ich Khara, Renzo und Tobble, die wilde Flüche ausstießen und erfolglos mit den Armen ruderten.
Während unsere Wunden bluteten, wir zunehmend schwächer wurden und trotzdem immer das qualmende Feuer zwischen uns und den Vögeln im Auge haben mussten, schienen sie überall gleichzeitig zu sein, kreischend und mit den Schnäbeln hackend. Besondere Anstrengung verwandten sie auf unsere Beutel und Bündel – zweifellos hofften sie auf Münzen –, attackierten aber auch sonst alles, was sie von uns erwischen konnten.
»Zu den Felsen!«, schrie Khara.
Ich ahnte, was sie im Sinn hatte. Einen Ausweg gab es in keiner Richtung. Wenn wir uns aber an die Felswand drückten, konnten die Vögel uns wenigstens nur von vorn und von den Seiten her erreichen.
Ich strich Tobble über den Kopf. »Komm«, sagte ich, »halt dich hinter uns!« Als ob ihm das irgendeine Sicherheit geboten hätte.
Längst war ich erschöpft vom Fackelschwingen, sie schwelte ohnehin nur noch matt. Als Kharas glimmender Ast vollends erlosch, warf sie ihn weg und zog wieder ihr Schwert, verlor aber dabei den Halt und fiel hin.
Im Nu war sie unter einer geschlossenen Decke wütend hackender Schnäbel verschwunden.
»Aaarrrhhh!«, schrie Tobble. Er stürmte zu Khara hin und war mit einem Sprung mitten im Pulk der Vögel, kratzte, trat und schrie: »Lasst sie! Lasst sie in Ruhe!«
Nicht zum ersten Mal erlebte ich das ungewöhnliche Schauspiel, wie ein Wobbyk in helle Wut geriet.
Renzo und ich mischten uns ins Getümmel und jagten immerhin so viele der wild gewordenen Vögel auseinander, dass Khara sich befreien konnte. Sie packte Tobble, nahm ihn auf die Schultern – und dann gaben wir vier und Dog jede würdevolle Haltung auf und versuchten nur noch, uns in Sicherheit zu bringen.
»Hierher!«
Gambler! Sehen konnte ich ihn durch den gefiederten Sturm nicht, aber ich hörte seine Stimme. Ich kämpfte mich weiter und versuchte, meine brennenden Wunden und das schrille, bedrohliche Kreischen der Vögel zu ignorieren.
Ich stieß gegen die Felswand, drehte mich um und drückte mich mit dem Rücken dagegen.
»Geht meiner Stimme nach!«, rief Gambler irgendwo rechts von mir.
Langsam schob ich mich an der Felswand entlang, wobei ich immer wieder vergeblich nach meinen Angreifern schlug. Plötzlich blieb mein linker Fuß an einem scharfkantigen Felsbrocken hängen, und ich landete so hart auf dem Rücken, dass mir die Luft wegblieb.
Eine wuchtige Pranke streckte sich mir entgegen. Riesige schwarze Krallen schlossen sich vorsichtig um meinen Bauchbeutel und zogen mich heran.
»Danke, Gambler!«
Ich rettete mich hinter ihn, während er mit Felijaga-Tempo die Vögel nur so aus der Luft pflückte.
Khara schob sich an Gambler vorbei und versuchte, zu mir durchzukommen. »Renzo!«, rief sie heiser.
»Ich sehe ihn«, sagte Gambler.
Mit exakt gezielten Prankenhieben bahnte sich der große Felijaga in fast übernatürlicher Geschwindigkeit seinen Weg durch die Vogelwolke. Einen der unseligen Vögel fing er und ließ ihn prompt in seinem Rachen verschwinden. Ein kleiner Imbiss. Schlieren von Möwenblut färbten rechts und links sein Maul, und kaum hatten die Vögel diese neue Bedrohung erkannt, schwirrten sie davon.
Gambler fand Renzo auf Knien liegend und immer noch seine Fackel schwingend. Blut strömte ihm aus Dutzenden Wunden.
»Halt dich an meinem Hals fest!«, rief Gambler. Dazu brauchte es keine Überredung, und er konnte Renzo über den Boden bis zu uns hinschleifen.
So blitzartig die Vögel uns bedrängt hatten, so schnell waren sie abgezogen. Ich sah mich kurz um. Wir waren in einen schmalen Spalt in der Felswand zurückgewichen – kein Ort für Lebewesen mit Flügeln. Nach oben hatte der Spalt keine Öffnung, Licht kam allein durch die offene Seite zur Wiese. Ich konnte sehen, wie draußen Messermöwen hin und her patrouillierten und darauf warteten, dass wir den Kampf wieder aufnehmen würden.
»Hier geht es in eine Höhle«, sagte Gambler. »Kommt!«
Wir folgten ihm, wobei wir blutige Spuren auf dem Steinboden hinterließen. Unsere einzige Lichtquelle war Renzos immer schwächer glimmende Fackel.
Endlich fanden wir einen weiten, von Felsblöcken umschlossenen Raum, wo wir rasten konnten. Hier verbanden wir uns gegenseitig die Wunden, und Dog versuchte wenig hilfreich, sie abzulecken.
»Und?«, sagte Khara, die gerade Renzos Unterarm umwickelte. »Raus zu den Vögeln oder rein in die Dunkelheit?«
»In die Dunkelheit«, riefen wir alle gleichzeitig.
»Na, das war ja eine leichte Entscheidung«, sagte Khara. Sie nahm Renzos schwelende Fackel, und weiter ging es in die kalte, endlose Schwärze hinein.
4
BRAVES HÜNDCHEN
Tiefer und tiefer drangen wir in die Höhle vor. Das Licht der Fackel war nur noch ein mattes Glimmen, und wir stolperten fast bei jedem Schritt. Zwar war Gamblers Sehvermögen bei Nacht viel besser als unseres, aber in absoluter Finsternis konnte auch er nichts erkennen. Wir versuchten, unser Fünkchen Licht am Leben zu halten, fanden aber als einzigen Brennstoff nur feuchtes Moos, das die Wände und den Boden überzog. In dem Moment, in dem die Fackel erlosch, würden wir unseren Weg ohne einen einzigen Lichtstrahl ertasten müssen.
»Ich habe das Gefühl, dass vor uns ein offener Raum liegt«, sagte Khara. »Die Luft ist hier anders.«
»Ja«, stimmte Gambler zu. »Aber so ohne Licht …«
Auch ich fand die Luft nicht mehr so stickig. Ich roch etwas Vertrautes und zugleich Befremdliches: Wasser. Nicht Salzwasser. Nicht klares Quellwasser. Nein, dieses Wasser verbreitete einen Geruch nach seltsamen Mineralien, nach Sumpf und Pilzen.
Ein letzter Funke stob von der Fackel auf, dann verlosch sie endgültig und stürzte uns in eine schwarze Leere. Ich hielt meine Hand ein paar Zentimeter vor mein Gesicht und sah – nichts.
Es war ein beklemmendes Gefühl, plötzlich komplett auf ein Sinnesorgan verzichten zu müssen.
»Ein bisschen kann ich sehen«, erklärte Gambler. »Halt dich an meinem Schwanz fest, Byx. Alle anderen fassen sich an den Händen.«
Im Mondschneckentempo bewegten wir uns weiter, Hand in Hand oder eben Hand an Schwanz. Ungefähr zwei Stunden, wenn nicht länger, befanden wir uns an einem Ort ohne Zeit. Während wir uns zentimeterweise vorwärtsschoben, jammerten und stöhnten wir über unsere Verbände und Schmerzen – ein Versuch, uns von dem erdrückenden Grauen abzulenken, ohne den kleinsten Lichtschimmer tief unter der Erdoberfläche zu sein.
Als uns keine Klagen mehr einfielen, sang Tobble ein altes Lied von Riesen-Schlammwürmern, die eine immerwährende Angstquelle für Wobbyks in ihren unterirdischen Tunnelbauten darstellten.
Der Refrain passte auf gruselige Weise zu unserer Situation, und bald sangen wir alle mit:
Träumen die Wobbyks ohn’ Argwohn und Leid,
kommt für den Schlammwurm die Essenszeit.
Dann nagt er an Schwänzen, an Ohren und Krallen,
Der Schlammwurm ist der Feind von uns allen!
»Hast du schon mal einen gesehen, Tobble?«, fragte ich.
»Ein Mal«, antwortete er. »Als ich noch klein war.« Ihn schauderte, und ich spürte, dass seine großen Ohren zitterten wie Blätter im Wind. »Und glaub mir, das eine Mal war mehr als genug. Sie sind riesig, glibberig und immer hungrig.«
Unsere Stimmen wurden allmählich heiser, da blieb Gambler plötzlich stehen. »Da vorn wird es heller!«, meldete er. »Dort muss es einen Weg ins Freie geben!«
Dass es heller wurde, war richtig, aber dass es sich um Sonnenlicht handelte, war ein Irrtum. Bald stellten wir fest, dass die Höhlenwände ein schwaches, gelblich schimmerndes Licht ausstrahlten. Das war uns nach der absoluten Dunkelheit mehr als willkommen.
Nach und nach gewöhnten sich unsere Augen an den Schein, und wir konnten immerhin so viel sehen, dass wir nicht mehr bei jedem zweiten Schritt stolperten. Auch das Gefühl von Weite nahm zu. Nach einer Kurve im Tunnel sahen wir vor uns einen Ring aus grünlich blauem Licht. Es kam uns strahlend hell vor, war aber wohl nicht heller als das Licht einer Mondsichel.
Der Tunnel endete gut dreißig Meter oberhalb einer großen Höhle. Wir blickten in ehrfürchtigem Staunen auf eine Szene, die jeder Vorstellung trotzte.
Die Höhle war nicht groß. Sie war auch nicht riesig. Sie war unermesslich.
Ganz Saguria, die königliche Hauptstadt von Nedarra, hätte in diesem weitläufigen Raum bequem Platz gefunden. Über uns wölbte sich eine unvorstellbar hohe Decke, die wie mit steinernen Speeren gespickt war. Der Höhlenboden hatte seine ganz eigene Beschaffenheit: Er war wie ein einziger Wald aus Steindolchen, die Spitzen nach oben gerichtet. Diese Hindernisse auf dem Boden bildeten einen Kreis um den ungewöhnlichsten Bestandteil der Höhle, einen See mit dunklem und völlig unbewegtem Wasser, das an poliertes schwarzes Glas erinnerte.
»Ich sehe Feuer«, sagte Renzo. »Drüben, über dem See, rechts. Kann sein, es sind sogar mehrere kleine Feuer.«
»Ja, ich rieche sie«, sagte ich schnuppernd.
Wir bewältigten den steilen Abstieg, dann machten wir uns auf einen beispiellosen und beschwerlichen Marsch. Der einzige Weg um den See führte durch die dicht stehenden, bizarr geformten Stalagmiten. Manche sahen aus wie gedrungene Bienenstöcke. Manche glichen Speeren von Rittern, glatt und zugespitzt. Andere erinnerten an riesige, zu grotesken Formen geschmolzene Kerzen.
Doch egal, wie sie aussahen, Wunden oder Prellungen konnten sie alle zufügen, und so kamen wir in unserem bereits geschwächten Zustand nur mühsam voran.
Als wir schließlich einen schmalen Uferstreifen aus schwarzem Sand erreichten, sanken wir endgültig zu Boden.
»Sollen wir etwas Brennbares suchen und sehen, ob wir ein Feuer in Gang bringen?«, fragte Tobble und untersuchte dabei den blutigen Verband an seinem linken Fuß.
Khara schüttelte den Kopf. »Nein. Nicht bevor wir herausgefunden haben, von wem oder was diese Feuer am anderen Seeufer stammen.«
»Braucht jemand einen neuen Verband?«, fragte ich.
Unser Vorrat an Stoffstreifen war restlos erschöpft, und wir hatten zum Verbinden unserer Wunden nichts anderes mehr als ein paar streng riechende Lammintblätter, die ich unterwegs gesammelt hatte. Es heißt, Lammintblätter haben heilende Wirkung, doch bei den zahllosen oberflächlichen Schnittwunden von den Vögeln und den vielen Kratz- und Schürfwunden von den Stalagmiten war eine Behandlung fast aussichtslos. Mein ganzer Körper war ein einziger höllisch brennender blauer Fleck.
Ich zerbröselte ein paar Lammintblätter und gab sie meinen Freunden, die sie auf ihre in der Höhle neu zugefügten Wunden drückten.
»Es tut mir so leid«, sagte ich.
»Was denn?«, fragte Renzo.
Ich deutete auf den Verband an seinem Arm. »Das da.« Und mit einer weit ausholenden Handbewegung: »Das alles. Wenn ich nicht wäre, hättet ihr jetzt gar keine Verletzungen.«
»Byx«, sagte Renzo und sah mich eindringlich an. »So darfst du nicht reden. In dieser Sache stecken wir gemeinsam drin. Wir alle zusammen.«
»Renzo hat recht. Wir haben diese Aufgabe gemeinsam auf uns genommen. Und wenn noch Dalkins leben, Byx«, sagte Khara, »werden wir sie finden.«
Ich nickte. Aber das Gefühl von Verantwortung ließ sich schwer abschütteln. Da saßen wir nun mitten im Nirgendwo, blutend und verdreckt, nur weil ich glaubte, einen anderen Dalkin gesehen zu haben. Wegen eines flüchtigen Blicks, der mein Herz hatte hüpfen lassen, waren meine neuen Freunde bereit, jede Gefahr auf sich zu nehmen.
Ich hatte mich mit der Zeit daran gewöhnt, schwere Entscheidungen zu treffen. Aber schwere Entscheidungen fallen leichter, wenn nicht die Freunde davon betroffen sind. Und das Schlimmste war: Selbst wenn wir andere Dalkins fanden, konnten wir nicht sicher sein, ob wir je gefahrlos in unsere Heimat würden zurückkehren können. Der Murdano jedenfalls hatte im Moment keine große Freude an uns. Wahrscheinlich wäre er sogar heilfroh, uns alle tot zu sehen.
Er hatte uns damals mit dem Auftrag losgeschickt, Dalkins zu suchen – in der Absicht, ein paar von ihnen zu fangen und den Rest zu töten.
Der Murdano hatte seine Gründe, so niederträchtig sie auch sein mochten. Weil Dalkins sofort merken, wenn jemand lügt, können sie für Machthaber sehr nützlich sein. Andererseits könnten zu viele Dalkins für einen wie den Murdano eine echte Bedrohung darstellen. Die Wahrheit kann eine gefährliche Angelegenheit sein. Besonders für einen Lügner.
Unser Rudelführer Dalyntor hat oft gesagt, diese besondere Fähigkeit der Dalkins ist unsere »beschwerliche Gabe«.
Wir hatten damals natürlich beschlossen, den Auftrag des Murdano nicht zu befolgen. Und soweit wir wussten, wurden wir inzwischen längst von den grausamen Soldaten des Despoten verfolgt.
Ich seufzte, lauter als beabsichtigt, und schon kam Dog mit hängender Zunge und heftig wedelndem Schwanz angetrabt. Sein Fell hatte lauter blutige Streifen, trotzdem schien er ausgelassen wie immer.
»Er will sich nur überzeugen, dasses dir gut geht«, erklärte Renzo, der aus unerfindlichen Gründen immer meint, Dog könne nie etwas falsch machen.
Ich brachte ein nachsichtiges Lächeln zustande. Was Hunde angeht, habe ich gemischte Gefühle.
Ich weiß, das ist falsch. Meine Eltern haben mir beigebracht, allen Lebewesen mit Respekt zu begegnen. Aber lasst mich der Ordnung halber eines richtigstellen: Ich bin kein Hund.
Leider werde ich regelmäßig mit einem verwechselt. Viel zu viele Fremde streicheln meinen Kopf und säuseln: »Braves Hündchen.« (Menschen sind ganz sicher nicht die aufmerksamsten Lebewesen. Es ist doch unübersehbar, dass ich kein »Hündchen« bin, weder ein braves noch sonst irgendeins.)
Erstens haben wir Dalkins Gleitflügel, dünne Hautfalten, die es uns erlauben, wie Fledermäuse durch die Luft zu gleiten. Keine langen Strecken leider. Aber hoch über der Welt dahinzusegeln – wenn auch nur für ein paar Sekunden –, ist ein Vergnügen, das eingewöhnlicher Hund nie erleben wird.
Zweitens haben wir Hände mit voll beweglichen Daumen. Sie sind mindestens so geschickt wie Menschenhände. Und tapsigen, unzuverlässigen Pfoten allemal weit überlegen.
Dazu kommt, dass wir uns gewandt in der Sprache der Menschen auszudrücken verstehen, und zwar besser, als manche Menschen das können. Wenn dagegen ein Hund mit Menschen kommunizieren will, sind seine Mittel beschränkt. Im Grunde genommen hat er wahlweise nur drei Entscheidungsmöglichkeiten: bellen, betteln oder beißen.
Und einen weiteren Vorteil gibt es, ein Dalkin zu sein. Anders als Hunde haben wir am Bauch einen Hautsack, einen Beutel also, der praktisch zum Verstauen von allerlei Dingen ist. Früher habe ich kleine Schätze darin aufbewahrt: einen glitzernden Sonnenstein, einen Ball zum Spielen mit meinen Rudelgefährten. In letzter Zeit enthält er nur wenige Dinge, darunter eine Landkarte, deren schwaches Gekritzel vielleicht über mein Schicksal bestimmen wird – oder auch nicht.
Aber das ist immer noch nicht alles. Wir Dalkins sind nicht nur besser ausgestattet als Hunde, wir benehmen uns auch besser.
Wir geraten beim Anblick eines Zebrahörnchens nicht völlig aus dem Häuschen.
Wir wälzen uns nicht in erniedrigender Weise auf dem Rücken, nur damit uns jemand den Bauch krault.
Wir schnüffeln nicht unhöflich an den Hinterteilen von Vorübergehenden.
Kurz, Hunde haben keine Manieren. Und doch scheint es in jedem Dorf von Hunden aller Gestalten und Größen zu wimmeln. Manche sind massig wie Steinwölfe, manche nicht viel größer als gut genährte Mäuse.
So viele Hunde gibt es.
Und so wenige Dalkins.
Mein Vater, möge sein Herz strahlen wie die Sonne, hatte noch einen anderen Lieblingsspruch: »Ein Dalkin allein ist so gut wie nichts.«
Er meinte damit, dass für die Art der Dalkins das Rudel alles bedeutet. Ohne die Rudelgenossen zu sein heißt aufhören, nach unserer Bestimmung zu leben.
Ich habe immer gestöhnt über die Redensarten meines Vaters. Alle meine Geschwister taten das. Doch jetzt würde ich alles darum geben, ihn noch ein einziges Mal sprechen zu hören. Oh, noch einmal meinen Namen aus seinem Mund zu hören!
Aber das wird nie mehr geschehen. Ich werde mein Rudel nie wiedersehen oder meine Familie. Obwohl ich mich an die Hoffnung klammere wie an eine unruhig brennende Fackel in einer dunklen Höhle, ahne ich doch, dass ich wohl nie wieder einen Dalkin sehen werde, egal, wie weit wir wandern, meine Freunde und ich. Egal, wie gründlich wir suchen.
Ich sah zu, wie Dog meine Hand leckte und sie dabei mit einer unappetitlichen Sabberschicht überzog. »Bist ein braves Hündchen«, sagte ich, und schon geriet sein Schwanz wieder in fieberhafte Bewegung.
Ich denke, so übel sind sie nicht, die Hunde.
Und ich brauche jeden Freund, den ich bekommen kann.
5
EIN FELIJAGA HAT ANGST
Nach einer viel zu kurzen Rast stand Khara auf und streckte sich.
»Lasst uns weitergehen«, sagte sie, und mit unwilligem Ächzen und Stöhnen setzten wir uns wieder in Marsch. Nach ungefähr zehn Minuten endete der Uferstreifen vor einer Felswand, die bis zur Decke der Höhle reichte und uns den Weg versperrte.
Mein Mut sank. Es gab kein Weiterkommen.
»Uh-oh«, murmelte Tobble.
Ich ertappte mich, wie ich mir Schreckensbilder ausmalte, nach denen wir fünf jämmerlich durch Stalagmitenwälder wanderten, bis wir vor Hunger starben.
»Ich geh mal nachsehen«, bot Renzo an.
Er watete ins Wasser und hielt sich dabei dicht an der Felswand. Als ihm das Wasser bis zur Taille reichte, drehte er sich zu uns um und rief: »Hier ist unter dem Wasser ein Vorsprung in der Felswand. Vielleicht könnten wir darauf um den See bis zur anderen Seite kommen.«
»Tobble«, sagte Khara, »du kannst auf meine Schultern klettern.« Sie ging in die Knie, und Tobble sprang hinauf.
»Komm her, Byx«, drängte Renzo. »Zeit für einen Huckepacktransport.«
Ich sah zu Gambler hin. Er lief auf und ab und starrte auf das Wasser.
»Was ist los, Gambler?«, fragte ich.
»Wasser – das ist los«, grummelte er. »Ein Bach oder eine Pfütze, das macht einem Felijaga nichts aus. Wir können schwimmen, egal, was die Leute reden. Aber große Wasserflächen? Da weiß man nie, was vielleicht unter der Oberfläche lauert.«
»Du bist zu groß, um getragen zu werden«, sagte Khara vorsichtig.
»Weiß ich selber!« So gereizt hatte ich Gambler noch nie erlebt. »Weiß ich doch. Ich weiß auch, dass ich das schaffen muss.«
Ungläubig und mit gerunzelter Stirn sah ich Gambler an. »Du hast Angst?«, sagte ich.
Der Gedanke schien absurd, und meine Frage war als Scherz gemeint. Gambler war für mich der Inbegriff von Mut. Ein Felijaga, der ganz allein einen mörderischen Feuerritter angegriffen und den Kampf überlebt hatte. Er konnte davon erzählen.
»Angst doch nicht!«, fauchte Gambler. »Nur … ich mag eben kein Wasser.«
»Ich gehe zuerst«, sagte Khara. »Sollten irgendwelche Wesen unter Wasser Appetit auf Fleisch haben, werde ich ihnen Tobble überlassen.«
»He!«, protestierte Tobble.
»War doch nur Spaß«, sagte Khara und zwinkerte mir zu.
Aber dass sie als Erste gehen würde, war nicht als Spaß gemeint. »Es ist eiskalt!«, schimpfte sie beim ersten Schritt ins Wasser. Vorsichtig ging sie weiter, tiefer und tiefer, bis sie den Vorsprung unter Wasser fand und sich langsam darauf weiterbewegte. Mit einer Hand hielt sie sich an der Felswand fest, die andere benutzte sie zum Balancieren. Mit Tobble auf der Schulter sah sie aus wie ein Mensch, dem ein komischer zweiter Kopf gewachsen war.
Als die Felswand einen Bogen machte, gerieten Khara und Tobble außer Sicht, doch nach ein paar Minuten rief sie: »Alles gut!«
»Spring auf, Byx«, sagte Renzo und bückte sich ein bisschen.
Ich schüttelte den Kopf. »Danke, aber ich reite auf Gamblers Rücken. Das hab ich schon mal gemacht.«
Ich wollte nicht zu deutlich sagen, dass Gambler Unterstützung brauchte. Felijagas sind die größten Einzelgänger aller Arten, und mir war klar, dass Gambler nicht zu den Geschöpfen gehörte, die gern Hilfe annehmen. Aber ich wollte helfen, wenn ich konnte.
Renzo verstand den Fingerzeig, nickte und ging Khara nach.
»Jetzt sind wir an der Reihe, Gambler«, sagte ich.
Gambler schoss mir einen funkelnden Blick zu, der mich früher vor Schreck hätte tot umfallen lassen. Aber inzwischen wusste ich, dass ich nichts zu fürchten hatte.
Ich sprang auf seinen starken Rücken. »Also los.«
Natürlich konnte Gambler nicht auf dem Felsenvorsprung balancieren. Er musste schwimmen.
Er drehte seinen riesigen Kopf hin und her und sah mich an. Dann ließ er sich ins Wasser gleiten, lautlos wie ein Falke durch die Wolken.
Wir bewegten uns scheinbar ohne Anstrengung voran. Weil ich aber schon einmal auf seinem Rücken geritten war, spürte ich Gamblers Angst. Seine Muskeln waren angespannt, sein Atem ging gehetzt.
Ich wunderte mich über ihn. Er war ein Kraftbündel, er war mächtig und klug und bestimmt der Letzte, gegen den man hätte kämpfen wollen.
War es möglich, dass selbst er Angst haben konnte so wie ich?
Wir stiegen schließlich auf einer weiten Fläche aus Schiefergestein aus dem Wasser. Ich sprang von Gamblers Rücken, damit er sich trockenschütteln konnte.
»Danke fürs Mitnehmen, Freund Felijaga.«
Gambler grinste und versuchte, ein ärgerliches Gesicht zu machen, aber sein Stolz war unübersehbar. Er hatte es geschafft. Einen Augenblick später nickte er mir sogar ein bisschen zu – fast wie zur Anerkennung für meine hilfreiche Unterstützung.
Die anderen warteten, durchnässt und fröstelnd. »Sieht eindeutig aus wie ein Dorf«, sagte Renzo, während er forschend zu zwei verschiedenen Feuern hinsah.
»Ich glaube, ich sehe … ich weiß nicht … Menschen sind es nicht, aber etwas bewegt sich da bei den Feuern.« Khara seufzte und warf mir einen besorgten Blick zu. »Was meinst du, Byx? Sieht so aus, als haben wir nur zwei Möglichkeiten: zurück, woher wir gekommen sind, oder hin zu diesen Wesen, was immer das für welche sind.«
Ich war sicher, dass Gambler sich bestimmt nicht darum reißen würde zurückzuschwimmen. Noch einmal die Felsenklippen bezwingen und eine Begegnung mit den Vögeln riskieren – falls wir überhaupt den Weg durch die Finsternis finden würden –, das wollte keiner von uns.
»Lasst uns rausfinden, wer sie sind«, sagte ich, wobei ich vermutlich sicherer klang, als ich mich fühlte.
Das Schiefergestein war rutschig und stellenweise von dunklem bläulichem Moos überzogen, doch im Vergleich zu vielem, was wir schon durchgemacht hatten, war es wie ein Spaziergang auf einer Wiese.
Wir waren vielleicht noch eine Viertelmeile von der Ortschaft entfernt, als uns ein schriller Alarmton in die Ohren drang.
Brrreeeet! Brrreeeet!
Es war eine ArtHorn. Zwei Alarmzeichen, dann nichts mehr.
Wir sahen uns an, abwartend, unsicher, was wir tun sollten. Noch ehe wir einen Entschluss fassen konnten, erhob sich eine Gischtwolke aus dem See neben uns.
Ein Dutzend oder mehr Geschöpfe kamen aus dem Wasser geschnellt, und zwar derart kraftvoll, dass sie ein Stück durch die Luft flogen, bevor sie sich schließlich in einer Reihe zwischen uns und dem Dorf niederließen.
Ich wusste, was das für Wesen waren. Wir alle wussten es.
»Natintjes!«, rief ich.
6
LAR CAMISSA
Natintjes sind eine der großen Hauptarten von Nedarra, aber man findet sie auch in anderen Ländern. Sie kommen in einer Vielzahl verschiedener Farben, Größen und Körperformen vor. Obwohl wir das wussten, schienen uns diese Geschöpfe hier doch äußerst ungewöhnliche Natintjes zu sein.
Normalerweise tendieren Natintjes zu Blau- und Grünschattierungen, diese hier waren jedoch farblos. Ihre Haut wirkte glatt und transparent, darunter waren ihre Arterien und Venen sichtbar. Sogar ihre inneren Organe sah ich kurz.
Wie die meisten Natintjes konnten auch diese im Wasser atmen, sie besaßen mehrere Kiemen. Doch ihr erstaunlichstes Merkmal außer dem durchscheinenden Körper waren ihre enorm großen Augen. Golden schimmernd mit einer ovalen schwarzen Iris, waren sie fast so groß wie der ganze Kopf der Natintjes. Auf stummelartigen, aber beweglichen Stängeln, die hinter ihren Kieferknochen aufragten, saß ein zweites Augenpaar. Es leuchtete unheimlich und ließ ein grünliches Licht um die Köpfe dieser Natintjes wabern.
Mich schauderte. Es war die gleiche Reaktion wie damals, als ich zum ersten Mal einen Natintje gesehen hatte, doch war mir jener im Vergleich mit diesen hier harmlos erschienen. Die Natintjes hier ließen eher an magische Wesen denken als an Geschöpfe aus Fleisch und Blut.
Sie waren außerdem mit merkwürdigen Dingen bewaffnet. Ich sah Steinäxte, Messer aus Flintstein und primitive, aber bedrohlich wirkende Speere, dazu Morgensterne: Stricke, auf die man Steine wie Riesenperlen gefädelt hatte.
Khara hob die Hände, Handflächen nach außen, um zu zeigen, dass sie unbewaffnet war. Tobble, Renzo und ich taten es ihr nach. Gambler konnte die Geste natürlich nicht nachahmen, er entschied sich für die Felijaga-Version: leicht gesenkter Kopf und eingezogene Krallen.
»Wir haben nichts Böses gegen euch im Sinn«, sagte Khara.
Die Natintjes sagten nichts. Sie hatten sich wie eine feuchte Mauer zwischen uns und dem Dorf aufgebaut, das aus zwanzig oder dreißig Steinhütten ohne Dächer bestand.
Ich warf einen raschen Blick über die Ansiedlung. Jede der Hütten ragte zum Teil ins Wasser hinein, und es gab steinerne Stege, auf denen weitere Hütten standen. Das war nicht verwunderlich, da Natintjes Wasserlebewesen sind, die sich aber auch an Land bewegen können. Auf der am weitesten vom Wasser entfernten Seite des Dorfes sah ich innerhalb einer steinernen Umzäunung ein Dutzend weiße Nacktschnecken – groß wie Ponys.
Mich schauderte schon wieder.
»Hört mich bitte an«, rief Khara. »Wir haben uns verirrt, wir wollen euch nichts Böses.«
Schweigen bei den Natintjes, aber ich hatte etwas bemerkt. »Ich glaube, da kommt gerade so was wie ein Dorfältester«, flüsterte ich.
Von der Siedlung her näherte sich eine Gruppe von sechs Natintjes. Einer von ihnen saß in gebieterischer Haltung auf einer riesigen, sanft sich wellenden Nacktschnecke. An einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit wäre das vielleicht ein komischer Anblick gewesen. Ich spürte aber, dass unser Leben in den Händen dieses Natintjes lag. Lachen war das Letzte, wonach mir jetzt der Sinn stand.
Als die Gruppe herangekommen war, erklärte Khara nochmals, dass wir uns verirrt hätten, dass wir nur auf der Durchreise wären und nichts Böses im Schilde führten.
Einer der soeben angekommenen Natintjes ergriff das Wort. Er sprach im allgemein üblichen Dialekt, wenn auch mit starkem Akzent.
»Erhebet eure Blicke auf Lar Camissa, Königin aller Natintjes von Subdur, Beschützerin des Heiligen Wassers, Entfacherin des Feuers. Lar Camissa, die Unbesiegte. Lar Camissa, die Mächtige. Lar Camissa, unser aller Mutter. Lar Camissa …«
Die Lobpreisungen und das Aufzählen der Titel gingen noch lange weiter, und es schienen sehr viele zu sein für ein Wesen, das sich von einer Nacktschnecke um das Ufer eines unterirdischen Sees tragen ließ. Doch Khara wartete geduldig, bis der Vortrag zu Ende war, ehe sie sprach. »Ich bin Kharassande Donati, ein einfaches Mädchen, das vor Gefahren flieht und nur Frieden sucht. Das hier sind meine Gefährten: Gambler, Renzo, Tobble und Byx.«
Da ergriff schließlich Lar Camissa, die Vielgepriesene, das Wort. »Verlasst augenblicklich mein Herrschaftsgebiet, oder ihr seid des Todes.«
Es war eine Drohung, doch meine erste Reaktion war nicht Angst, sondern Staunen. Lar Camissa hatte eine wunderbar melodische Stimme, in der eine Vielfalt von Klängen schwang – ihre Worte hörten sich an wie das Zusammenspiel Dutzender Instrumente.
»Es ist unser sehnlichster Wunsch, euer Gebiet zu verlassen …«, fing Khara an.
»Du willst uns beleidigen?«, unterbrach Lar Camissa herrisch.
Mit einigem Unbehagen stellte ich fest, dass Lar Camissa – anders als die gewöhnlichen Natintjes mit den auffallend schimmernden Extraaugen – mindestens vier Augen mehr besaß: Zwei leuchteten auf der Unterseite ihres Halses und zwei auf Fühlern neben ihren Schultern.
»Nein, Majestät«, sagte Khara. »Ich meinte bloß …«
»Ist mein Reich so armselig, so wertlos, dass ihr hierherkommt, um uns zu erniedrigen?« Was sie da von sich gab, musste wohl »Sprechen« genannt werden, doch erinnerte es mehr an Singen und mehr noch an harmonisches Lauten- und Harfenspiel.
»Eure Majestät, wir sind weder eine Bedrohung, noch wollen wir …«
»Bedrohung?«, trillerte Lar Camissa. Feindselig blitzten ihre Lakaien uns an und griffen nach ihren Waffen. »Ihr erdreistet euch zu behaupten, ihr hättet die Macht, mir zu drohen?« Ihr musikalischer Sprechgesang nahm jetzt Misstöne an.
»Eine Drohung wurde weder ausgesprochen noch angedeutet«, sagte Khara, die sichtlich ihre Ungeduld unterdrücken musste.
So ging es noch eine Weile hin und her. Was immer Khara sagte, verkehrte Lar Camissa in eine Beleidigung oder eine Drohung. Wieder und wieder.
Kharas Gesichtsausdruck wurde allmählichungehalten.
»Große Königin«, mischte ich mich trotz Kharas wütendem Blick ins Gespräch. »Ich heiße Byx, und ich bin ein Dalkin. Mein Volk ist bekannt für die Fähigkeit, zuverlässig die Wahrheit von der Lüge zu trennen. Ich kann bestätigen, dass meine Freundin Khara die Wahrheit spricht.«
»Ein Dalkin?« Lar Camissa schien beeindruckt. »Ich habe Berichte über deinesgleichen gehört. Hmm.« Sie legte ihren merkwürdigen Kopf schräg und wackelte nachdenklich mit den Fühlern. »Wir sind neugierig. Kommt. Gesellt euch mit uns zu einem königlichen Mahl.«
Wir wechselten zweifelnde Blicke, unsicher, ob wir erleichtert oder erschrocken sein sollten über diesen plötzlichen Sinneswandel.
Im Nu hatten die Natintjeswächter ein Ehrengeleit gebildet, und Lar Camissa spornte ihr abscheuliches Reittier an. Mit ihrer klangvoll vibrierenden Stimme forderte sie Khara auf, neben ihr zu gehen.
Wir Übrigen schlossen uns an und ließen dabei unsere Blicke über den sonderbaren Schauplatz wandern. Das Dorf der Natintjes war ganz anders als erwartet. Wir hatten geglaubt, schlichte, auf dem Schiefergrund stehende Steinhütten zu sehen. Als wir jetzt aber daran vorbeikamen, stellten wir fest, dass wir nur den von außen sichtbaren Teil des Dorfes gesehen hatten. Der größte Teil lag nämlich unter Wasser.
Im Zentrum jeder Hütte gab es ein Becken, das einen Zugang zum See hatte. Die »Hütten« waren mehr Brunnen als Häuser.
Aber leer waren sie nicht. In jeder Hütte gab es einen Trockenbereich, wo ein Natintje sitzen oder liegen konnte. Und meinen unerfahrenen Augen schien es sogar, als wären die Steinwände mit Kunstwerken geschmückt: mit kleinen Wandteppichen aus Flechten und Moos.
Lar Camissas Steinhütte war doppelt so groß wie die meisten anderen. Wir betraten sie, indem wir außen eine Leiter hinaufkletterten und innen über glitschige, in die Wand eingelassene Treppenstufen hinabstiegen. Ein imposantes Becken mit schwarzem Wasser nahm den zentralen Raum der Hütte ein. Trotzdem war der trockene Bereich um den Beckenrand groß genug, dass wir alle einen Platz zum Sitzen fanden.
Lar Camissa thronte auf einem Steinsitz, während wir uns auf dem Schieferboden niederließen. Ein Natintje tauchte mit zwei großen blauen Muschelschalen auf, in denen Wasser war.
»Trinkt mit uns und seid willkommen«, sagte Lar Camissa freundlich lächelnd.
Meine Freunde und ich nickten zögernd. Noch klangen uns die vorangegangenen Drohungen der Königin in den Ohren.
Sie nahm eine der Muschelschalen. Die zweite reichten wir untereinander weiter und probierten jeder einen zaghaften Schluck. Das Wasser schmeckte köstlich und ungewohnt, war kalt wie Eis und klar wie frische Luft – es schmeckte wie die erste Schneeflocke des Winters auf der Zungenspitze.
Nachdem das Wassertrinken erledigt war – ich hätte gern mehr getrunken –, lauschten wir Lar Camissas Erzählung von dem kriegerischen Zwist, der zwischen ihrem Volk, den Subdur-Natintjes und einem anderen Natintjes-Volk entstanden war. Die Subdur-Natintjes mussten damals um ihr Leben bangen. Sie waren ins Exil geflüchtet und hatten diesen wunderbaren Ort mit Leben spendendem Wasser gefunden.
Während sie sprach, tauchten Diener aus dem Wasser auf und servierten uns farblosen rohen Fisch und gekochten Seetang. Khara zuckte vor beidem zurück, schaffte es aber, ein paar Bissen hinunterzuwürgen und sogar ein zittriges Lächeln dabei zu zeigen. Tobble aß stillvergnügt den Seetang. Renzo verschlang sein Essen mit großem Appetit, als hätte man sein Lieblingsgericht aufgetischt.
Ich war nicht gerade versessen auf rohen Fisch. Aber unser kleines Dalkinrudel hatte so oft Hunger gelitten, dass wir gelernt hatten zu essen, was und wann immer wir konnten.
»Nun berichte mir, warum ihr hier seid und was ihr von uns wollt«, sagte Lar Camissa, während sie weitermampfte. Anscheinend war es für Natintjes normal, beim Essen zu reden. Sie sah mich kurz an und fügte hinzu: »Der Dalkin wird bestätigen, ob du die Wahrheit sprichst.«
»Wir waren gerade auf dem Weg über den Gebirgspass, da wurden wir von Messermöwen angegriffen«, erklärte Khara. »Wir flüchteten uns in eine Höhle und gelangten schließlich in das Reich Eurer Majestät.«
»Das ist richtig«, fiel ich ein. »Ihr könnt noch die Wunden sehen, die wir …«
Ich schnappte nach Luft. Ich hatte meinen Arm ausgestreckt und wollte eine meiner brennenden Schnittwunden vorzeigen, doch da war nichts mehr. War es vielleicht der andere Arm gewesen?
Ich tastete über die Wunden, an die ich mich erinnerte. Sie waren alle verschwunden.
Die Subdur-Königin lachte – es klang wie Flötenspiel. »Ihr habt vom Wasser getrunken. Es beschleunigt die Heilung.« Sie machte ein listiges Gesicht. »Warum, meint ihr, leben wir im Verborgenen? Falls das Geheimnis des Wassers bekannt wird, würde alle Welt kommen und beanspruchen, was uns gehört.«
Augenblicklich änderte sich die Stimmung. Spannung lag in der Luft. Gamblers Schwanz zuckte. Renzo versteifte sich.
»Was mich auf eure Angelegenheit bringt. Wie können wir sicher sein, dass ihr der Welt nicht unser Geheimnis verratet?«, wollte Lar Camissa wissen. »Und allen den Weg zu uns zeigt?«
Khara schien überrumpelt, und für einen Moment verfielen wir in Schweigen.
Es war Renzo, der das Wort ergriff. »Wir kennen nur den einen Weg in diese Höhle, Große Königin. Wenn Ihr die Öffnung versiegeln lasst, kennen wir keinen mehr. Und beim Verlassen Eures Reichs könnt Ihr uns die Augen verbinden, während Ihr uns hinausführen lasst.«