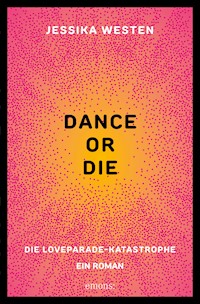
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Loveparade 2010: Die Journalistin Jessika Westen berichtete vor Ort aus Duisburg. Es ist der Tag, der alles verändert und die Schicksale vieler Menschen unwiderruflich miteinander verbindet: der 24. Juli 2010 – die Loveparade-Katastrophe in Duisburg. In Zusammenarbeit mit Angehörigen, Betroffenen, Augenzeugen und Ersthelfern zeichnet Jessika Westen, die als Live-Reporterin die Katastrophe miterlebte, den Verlauf der Tragödie in ihrem Buch nach. In Romanform schildert sie das Geschehen aus drei verschiedenen Perspektiven und mit bisher unveröffentlichten Details. Sie sprach mit Verletzten, Traumatisierten und hatte Einblicke in anwaltliche Unterlagen. Entstanden ist ein Roman mit emotionaler Tiefe, der ungemein berührt und niemanden kaltlässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Alle Personennamen sind frei erfunden. Real existierende Personen, die in das Geschehen involviert waren und die Vorlage für die fiktiven Hauptcharaktere liefern, haben dieser Publikation zugestimmt. Die Handlung ist eine fiktive Rekonstruktion der realen Geschehnisse vom 24. Juli 2010 anhand umfassender Recherchen und Interviews. Die Funksprüche sind angelehnt an Auszüge aus dem Original-Funkverkehr und wurden durch das Ändern der Funknummern anonymisiert.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer unter Verwendung eines Bildes von istockphoto.com/tatianazaets
Lektorat: Christoph Nettersheim
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-644-9
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
In Erinnerung an die 21 Todesopfer der Loveparade-Katastrophe am 24. Juli 2010 in Duisburg.
Gewidmet den unzähligen Verletzten und Traumatisierten.
1
21. Juli 2010
RENÉ
Im Tunnel war es Nacht. Obwohl die Sonne schien, fiel kaum Licht herein. Die Neonröhren waren entweder ausgefallen, oder jemand hatte sie abgestellt. Nach etwa 250 Metern bahnte sich ein bläulicher Lichtkegel den Weg in die Düsternis. Tageslicht. Hier musste es sein.
Die beiden Männer stiegen aus dem Wagen. Es roch nach Urin. Der Verkehr rauschte an ihnen vorbei. Die Wände verwandelten den Lärm der Motoren in ein fortwährendes Donnergrollen und schluckten die Wärme des Sommers. René fröstelte. Er trat einen Schritt ins Licht, drehte sich um, blickte in den Tunnel und dann hoch zu der Ruine, die einst ein Güterbahnhof war. Nun stand dort ein verlassenes Skelett aus Stahl und Beton. Von den alten Verladehallen war nicht mehr viel übrig. Die meisten Scheiben fehlten, einige hingen zerborsten am Gerippe der Dachkonstruktion. Kein einziges Gleis führte mehr hierher. Die Züge ratterten achtlos und mit einigem Abstand vorbei. Das stillgelegte Bahngelände erreichte man über eine Rampe, die den Tunnel mittig unterbrach. Sie war keine 20 Meter breit und eingepfercht zwischen Betonwänden, höher als zwei Stockwerke. Links führte eine schmale Treppe an der Wand hinauf zu einem alten Stellwerkhäuschen. Die Tür hatte jemand mit Dachpappe zugenagelt.
René blickte wieder in den Tunnel. Waren die Wände gerade ein Stück nähergekommen? Sein Puls beschleunigte sich, kaum merklich, aber doch so, dass er das Bedürfnis hatte, tief durchzuatmen.
»Und die Rampe ist wirklich der einzige Eingang?«, fragte er.
»Ja, ich glaub schon. Und auch der Haupt-Ausgang.«
Die beiden Männer stiegen wieder ins Auto. Sie fuhren auf das Gelände, drehten einige Runden, stiegen mehrfach aus und sahen sich um.
»Falls etwas passiert, müssen wir versuchen, irgendwie von außen ranzukommen«, sagte René auf der Rückfahrt zum Krankenhaus. Sein Kollege nickte.
Den Tunnel würden sie nur im äußersten Notfall befahren. Er schien viel zu eng.
Es waren noch drei Tage bis zur Loveparade.
24. Juli 2010
»Wedau 43 für 001, kommen!«
»Wedau 43 hört. Außerhalb des Tunnels klar und deutlich.«
»Jetzt bist du auch gut zu verstehen, ohne Rauschen und ohne abgehacktes Gestammel.«
»Das ist ja interessant für den Notfallplan. Also innerhalb des Tunnels keine
einwandfreie Funkverbindung möglich.«
»Das ist korrekt.«
»Verstanden, Ende.«
2
KATTY
Ich versuchte, das Knattern zu ignorieren, und wälzte mich im Bett. Verdammt! Ich wollte doch ausschlafen, und nun meinte so ein Idiot, in aller Herrgottsfrühe den Rasen mähen zu müssen. Ich war so müde, dass ich mich nicht dazu aufraffen konnte, das Fenster zu schließen. Stattdessen zog ich mir die Decke über die Ohren und vergrub das Gesicht im Kissen. Das brachte überhaupt nichts.
»Morgen, mein Engelchen, willst du nicht mal langsam aufstehen?« Meine Mutter stand neben dem Bett. Demonstrativ verkroch ich mich ein Stück tiefer unter der Decke. Nein, ich wollte nicht aufstehen. Ich war noch im Halbschlaf, und es konnte doch höchstens neun Uhr sein.
»Es ist nach elf«, sagte Mama.
Ich war schlagartig hellwach. Nach elf? In nicht mal zwei Stunden würde Tim auf der Matte stehen. Und Ines würde in weniger als einer Stunde klingeln. Wir wollten unser Styling noch gemeinsam vollenden und uns vor der Fahrt nach Duisburg ein Gläschen Sekt genehmigen. Ich sprang aus dem Bett, zog das Rollo hoch, blinzelte in die Sonne, die sich durch einen Wolkenschleier kämpfte, senkte den Blick und sah einen Rentner. Der Typ war oben ohne, hatte eine ordentliche Bierwampe und schob einen Rasenmäher vor sich her. Auf dem Kopf trug er einen Strohhut, dazu Jeans-Shorts und Sandalen mit weißen Tennissocken. Stell dir vor, du heiratest, und dreißig Jahre später wirst du neben so einem wach. Gruselig. Obwohl – Tim würde ich auch noch mit Bierwampe lieben, aber die Tennissocken in den Sandalen gingen gar nicht. Und warum mussten Rentner immer samstags den Rasen mähen? Egal.
»Scheiße, Scheiße, Scheiße«, fluchte ich.
»Wow, was ist denn mit dir los, Kleines? Du stehst ja richtig unter Dampf«, sagte Mama.
»Tim kommt gleich. Ich muss mich beeilen.«
Sie lächelte.
»Ist er gerade Single?«
»Ja«, seufzte ich.
»Wäre es dann nicht vielleicht mal Zeit, ihm zu sagen, wie sehr du ihn magst?«
»Könntest du das bitte meine Sorge sein lassen!«, zischte ich. Es war schon nervig genug, dass Ines ständig herumstichelte, was Tim und mich anging, und nun fing auch noch meine Mutter damit an. Ich wollte jetzt nicht über mein ungeklärtes Liebesleben nachdenken und schon gar nicht darüber reden. Nicht heute, nicht am Tag der Loveparade.
Das Lächeln verschwand aus Mamas Gesicht. »Entschuldigung, dass ich etwas gesagt habe«, flüsterte sie im Rausgehen.
Ich fuhr den Rechner hoch, öffnete die Musik-Bibliothek, klickte auf »The Art of Love«, die Hymne der diesjährigen Loveparade, und wippte im Takt. Dann schloss ich die Augen, drehte die Lautstärke noch ein bisschen höher, stand auf und tanzte. Bei dieser Musik konnte ich einfach keine schlechte Laune haben. Der Bass fegte die Müdigkeit aus meinen Knochen. Ich warf den Kopf hin und her, ließ die langen Haare wild durch die Luft fliegen. Plötzlich stand Philipp im Zimmer. Er war noch im Schlafanzug.
»Darf ich mittanzen?«, fragte mein kleiner Bruder schüchtern.
»Klar!«
Ich bückte mich zu ihm runter, nahm seine Hände und tanzte mit ihm. Philipp lachte. Dann nahm ich ihn auf den Arm und hüpfte mit ihm durchs Zimmer. Glückliches Kinderkreischen. Als der Song zu Ende war, ließ ich uns beide aufs Bett fallen.
»Noch mal!«, forderte Philipp. Seine Wangen waren fast so rot wie die Autos auf seinem Schlafanzug.
»Na, nun kommt erst mal frühstücken, ihr zwei!« Mein Vater stand grinsend im Türrahmen. Wahrscheinlich fand er es schön zu sehen, dass wir uns trotz des großen Altersunterschieds so gut verstanden. Als Philipp vor fünf Jahren geboren wurde, hatte ich in ihm nur die quäkende Nervensäge gesehen.
»Ein Lied noch, biiiiiitte Papa!«, bettelte er.
»Macht, was ihr wollt, aber das Rührei wird kalt.« Übersetzt hieß das so viel wie: »Wenn ihr nicht kommt, habe ich das letzte Mal Rührei für euch gemacht.« Papa versuchte, streng zu gucken, aber durch sein rundes Gesicht sah er immer freundlich aus, egal wie sehr er sich bemühte, autoritär zu wirken. Er verschwand und schloss die Tür hinter sich.
»Philipp, ich muss mich leider beeilen, wir tanzen morgen noch mal, okay?«
»Na gut«, brummte er.
»Dafür trag ich dich huckepack zum Frühstück! Na komm, spring auf.« Ich ging in die Hocke, und er hüpfte sofort auf meinen Rücken. »The Art of Looooove«, sang ich und tanzte etwas verhalten die Treppe runter. Der Duft von Rührei, gebratenem Speck und frischen Croissants lag in der Luft. Meine Eltern saßen am großen Esstisch. Mama hielt eine Milchkaffeetasse in der Hand und schöpfte mit dem Löffel den obersten Milchschaum ab, um ihn sich dann genüsslich in den Mund zu schieben. Papa stocherte in seinem Rührei rum. Er pickte sich – wie immer – zuerst den Speck raus.
Wir setzten uns dazu. Ich schmierte mir ein Buttercroissant mit meiner Lieblings-Himbeer-Vanille-Marmelade und biss hinein. Gedankenverloren schob ich die kleinen Körner der Himbeeren mit der Zunge im Mund herum.
»Von was träumst du denn?«, wollte meine Mutter wissen, um sich sofort selbst zu maßregeln: »Ach nein, ich darf ja nicht fragen.«
»Ach Mama, so hab ich das nicht gemeint. Klar darfst du fragen, aber ich will heute einfach nicht über Tim reden und am besten auch nicht nachdenken. Schon gar nicht vorm Frühstück. Und beim Frühstück auch nicht.«
Sie nickte. In einer Glasschale auf dem Tisch lagen klein geschnittene Erdbeeren. Ich nahm mir eine ordentliche Portion und übergoss sie mit Vanillejoghurt. Mein Vater runzelte die Stirn. »Tim soll bloß auf dich aufpassen, es soll ganz schön voll werden. Die haben im Radio gesagt, dass der Hauptbahnhof das Nadelöhr sein wird, weil da alle ankommen. Also seht zu, dass ihr da schnell wegkommt, okay?«
»Ja, Papa. Mach dir mal keinen Kopf. Die Loveparade gibt es seit über zwanzig Jahren, da passiert schon nichts.« Wie ich solche Predigten hasste. Mein Vater spießte ein Stück Rührei mit der Gabel auf und gestikulierte damit herum, als ob das Ei seine Aussage unterstreichen würde. »Trotzdem, sei vorsichtig und zieh bequeme Schuhe an!«
»Ja, Papa.«
Manchmal war er wirklich überängstlich. Wenn ich am Wochenende unterwegs war und morgens um vier oder fünf nach Hause kam, schlich ich mich immer ganz leise hinein. Trotzdem rief er nach wenigen Minuten: »Alles in Ordnung, Katharina?« Hatte der gar nicht geschlafen? Oder war er auch im Schlaf darauf geeicht, jedes Geräusch zu registrieren? Keine Ahnung. Wenn er sich vergewissert hatte, dass ich sicher zu Hause war, hörte ich jedenfalls wenige Minuten später sein Schnarchen aus dem Schlafzimmer. Wahrscheinlich ist es normal, dass Eltern so sind. Aber ich war volljährig. Verbieten konnten sie mir sowieso nichts mehr. Und passieren kann schließlich immer etwas. Ich hatte ein kleines, altes Auto und hätte genauso gut einen Unfall auf der Autobahn bauen können.
Nach dem Frühstück half Philipp Mama, den Tisch abzuräumen. Papa setzte sich auf die Couch und verschwand hinter seiner Zeitung. Ich sprang unter die Dusche. Nur noch eine halbe Stunde, bis Ines klingeln würde. Hektisch packte ich mir Mamas teure Haarkur auf den Kopf, putzte die Zähne und dachte jetzt doch über Tim und mich nach. Na toll. Warum gab es für solche Gedanken eigentlich keinen Aus-Knopf? Wie sollte ich ihm nur endlich sagen, dass ich mehr als nur Freundschaft wollte? Vielleicht war die Loveparade der richtige Anlass. Wirklich romantisch war das zwar nicht, aber erfahrungsgemäß peitschten die Bässe mein Ego nach vorne und übertönten meine Selbstzweifel. Das könnte helfen.
Ich hielt den geöffneten Mund unter den Duschkopf und spuckte die Reste des Zahnpastaschaums in den Ausguss. Dann legte ich den Kopf in den Nacken und spülte die Kur aus dem Haar. Einen Moment schloss ich die Augen und genoss das warme Wasser auf der Haut. Ein Kribbeln durchfuhr mich. War das die Aufregung? Wegen der Loveparade? Oder weil ich an Tim dachte? Wie auch immer. Ich drehte das Wasser ab, stieg aus der Dusche, trocknete mich ab, schlüpfte in meinen knallroten Bademantel und föhnte mir die Haare. Durch das Brummen des Föhns hörte ich meine Mutter nur schwach. Irgendetwas hatte sie gerufen. Ich zog den Stecker.
»WAAAS?«, brüllte ich.
»Ines ist da, Schatz!«
Ich hatte die Klingel gar nicht gehört. Ines war mindestens zehn Minuten zu früh. Sie klopfte an die angelehnte Badezimmertür.
»Darf ich reinkommen?«
»Ja, klar.«
Meine beste Freundin sah aus wie ein Schlumpf. Nein, eigentlich doch nicht. Schlümpfe sind komplett blau und tragen weiße Mützen. Ines hatte nur blaue Haare. Trotzdem erinnerte sie mich an einen Schlumpf. Ich musste grinsen.
»Und? Wie findest du’s?«
Jetzt bloß nichts Falsches sagen, dachte ich und suchte nach Worten.
»Auf jeden Fall irgendwie freaky«, ruderte ich herum. Ines nickte zufrieden. Freaky war auch die treffende Beschreibung für ihr Outfit: Sie trug schwarze Hotpants und darunter schwarze Netzstrümpfe. Dazu pinkfarbene Sneakers. Obenrum ein weißes Top mit ziemlich tiefem Ausschnitt, an dem sie eine große, künstliche Sonnenblume angenäht hatte. Passend zu ihren Haaren fehlte nur noch meine blaue Federboa, die Philipp allerdings seit gestern beschlagnahmt hatte. Er wollte unbedingt aussehen wie ein Raver.
Während ich die Haare fertig föhnte, wartete Ines in meinem Zimmer. Als ich zu ihr rüberkam, saß sie am Computer und suchte nach Musik. »Was hältst du von ›Gettin’ over you‹ von David Guetta und Fergie?«
»Klingt gut.«
Ines startete den Song, sprang auf und grölte: »LOVEPARADE 2010 – YEEEEEEEAAAH!« Dann tanzte sie durchs Zimmer, und ich tanzte im Bademantel mit. Wir rissen die Arme hoch, ballten die Hände zu Fäusten und sprangen wild herum. Mein Herzschlag passte sich dem Tempo des Basses an. Ines sang laut und ziemlich schief mit: »There is no geeeettin’ over you! I’m a party, and party and party and par… and par… and party.«
Und wieder stand Philipp in der Tür und wollte mitmachen. Um seinen Hals hing meine Federboa. Wir nahmen ihn zwischen uns und tanzten wie Eingeborene im Dschungel um ihn herum. Er sah zu uns hoch und stampfte mit den Füßen auf und ab. Wenn wir die Arme nach oben rissen, machte er es uns nach. Obwohl er noch kein Taktgefühl hatte, sah es ziemlich süß aus, wie mein fünfjähriger Bruder lachend seine erste Mini-Techno-Party feierte.
Als der Song vorbei war, ging Ines vor Philipp in die Hocke. Sie sah ihn mit großen Augen an und guckte fast so, als wollte sie einen Mann verführen.
»Duuuu, Philipp, wie du siehst, habe ich ja blaue Haare«, säuselte sie.
»Ja, sieht komisch aus«, stellte Philipp fest.
Ines zog die Brauen zusammen.
»Na ja, jedenfalls passt dazu total gut deine blaue Federboa. Ob du sie mir wohl für heute borgen könntest?« Sie klimperte mit den Wimpern. Eigentlich war es meine Federboa, und ich hätte auch einfach ein Machtwort sprechen können, stattdessen sah ich zu, wie Ines meinen Bruder um den Finger wickelte. Unglaublich. Philipp lächelte, nahm die Federboa von seinem Hals und legte sie ihr über die Schultern.
»Klar, hier, du kannst sie haben.«
Wow, ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach werden würde. Problem gelöst. Und während Ines noch mit Philipp rumalberte und sich in seinem Zimmer die neuesten Matchboxautos ansah, zog ich mich an. Ich zwängte mich in die enge Röhrenjeans, zog das Top mit den Schmetterlingen über, schlüpfte in die roten Ballerinas und steckte eine große Sonnenblume in meinem Haar fest. Dann kam Ines zurück.
»Dein Bruder ist jetzt beschäftigt, er malt.« Sie kramte in ihrer Umhängetasche und fingerte eine Sprühdose mit Glitzerhaarspray heraus. Außerdem hatte sie Lidschatten in mindestens zehn verschiedenen Farben dabei, jede Menge Haarnadeln und eine weitere Sonnenblume, die ich für sie in ihrem blauen, hochgesteckten Haar drapieren sollte.
»Ich krieg das selber nicht hin, die fällt immer wieder raus«, murrte sie. Mit mehreren Nadeln steckte ich die Blume mittig auf ihrem Hinterkopf fest. Das Gelb der Blüte schien durch das Blau ihrer Haare noch mehr zu leuchten.
»Kriegst du die Farbe eigentlich wieder raus?«
»Na klar, ist nur ein Haargel. Das lässt sich problemlos wieder auswaschen. Steht jedenfalls auf der Packung.«
»Dann geht’s ja.«
Ich nebelte ihre Frisur mit Glitzerspray ein. Dann nahm sie die Flasche und sprühte das Zeug auf meine Haare. Letzten Endes hatten wir überall Glitzer: im Gesicht, auf den Armen, auf den Klamotten. Aber das war okay, schließlich gingen wir zur Loveparade.
Fehlte nur noch das Make-up. Über Nacht hatte ich einen Pickel bekommen. Mitten auf der Stirn. Ausgerechnet heute. Ein dicker, roter Knubbel. Unübersehbar. Ich betupfte ihn mit einem Abdeckstift und kämmte die Haare schräg über die Stirn, sodass sie über den Pickel fielen und ihn verdeckten. Perfekt.
In diesem Moment klingelte es.
»Nein, nein, nein. Das darf noch nicht Tim sein! Ich bin noch nicht fertig! Er darf mich so nicht sehen, verdammt!«
»Schaaaatz, Tim ist da!«, rief meine Mutter.
Na toll.
»Scheiße, Ines, was mach ich denn jetzt? Ich bin noch nicht fertig«, jammerte ich.
»Ich geh runter und bespaße ihn.«
Halleluja, war ich ihr dankbar. Wenig später hörte ich, wie sie sich unten mit Tim und meinen Eltern unterhielt. Nun wartete alles auf mich. Was für ein Stress. Hektisch tuschte ich mir die Wimpern, rutschte ab und hatte prompt dicke, schwarze Streifen auf der Wange.
»Verdammt noch mal!«, fluchte ich, sprintete ins Badezimmer und suchte verzweifelt nach den Wattestäbchen. Im Schrank unter dem Waschbecken fand ich sie. Nachdem die schwarzen Streifen weg waren, hatte ich weiße Streifen auf der Wange, denn das Make-up darunter hatte ich mit abgewischt. Meine Güte, die Probleme einer Frau. Ich huschte zurück in mein Zimmer und besserte in Windeseile mein Make-up aus. Danach trug ich den braunen Lidschatten auf, den Ines mitgebracht hatte, passend zu meiner Haarfarbe. Noch etwas Lipgloss, fertig. Ich guckte in den großen Spiegel, der in meinem Zimmer neben dem Bett hing. Das Outfit war toll. Die Schmetterlinge am Top sahen super aus. Haare, Make-up, alles okay. Sogar mit meiner Figur war ich einigermaßen zufrieden. Ich hatte zugenommen, meine Beine sahen nicht mehr aus wie Streichhölzer, und dank des neuen Push-up-BHs hatte ich endlich so was wie ein Dekolleté.
So, Baby, du rockst das! Du wirst Spaß haben und einen tollen Tag mit Tim, lächelte ich mir selbst zu. Dann packte ich meine schwarze Umhängetasche: etwas Geld, Ausweis, Kaugummis, Pflaster, falls ich mir in den Ballerinas Blasen laufen würde, Handy, Haustürschlüssel, Puderdose, Lipgloss, die kleine, silberne Digitalkamera und die verhassten Ohrenstöpsel, die ich Papa versprochen hatte mitzunehmen. Mit den Dingern hörte man nur noch die Bässe, und die Melodien waren futsch. Ätzend. Aber ich musste sie ja nicht benutzen. Wasser würde ich hoffentlich auf dem Partygelände kaufen können. Die ganze Zeit eine Flasche mitschleppen wollte ich jedenfalls nicht.
Ich ging aus dem Zimmer und lauschte. Unten lachte Ines. Mein Vater sagte etwas, dann Tim. Worüber redeten die? Ich verstand kein Wort. Also musste ich wohl runtergehen. Tim sah mich nicht kommen, er stand mit dem Rücken zur Treppe. In Jeans hatte er einen verdammt knackigen Hintern. Ich blieb wortlos stehen und sah ihn an. Ines warf mir einen Blick zu, der so viel sagte wie: Ich weiß genau, was du dir da ansiehst, und dieser Hintern könnte längst dir gehören, wenn du mal aus den Puschen kämst. Doch es war viel mehr als sein Hintern. Es war die Art, wie er mich ansah. Seine Selbstsicherheit. Das schiefe Lächeln. Die zickzackförmige Narbe an seiner rechten Hand zwischen Daumen und Zeigefinger, deren Ursache er nicht verraten wollte.
»Da bist du ja Katharina, wir haben Tim gerade darum gebeten, gut auf euch aufzupassen«, wiederholte meine Mutter ihr wichtigstes Anliegen.
Tim drehte sich zu mir um. »Hey schöne Frau!«
Er fand mich schön? Mein Herz machte einen Sprung. Mir wurde flau im Magen, und ich versuchte krampfhaft, entspannt auszusehen.
Tim erzählte, dass wir mit einigen Freunden am Bahnhof verabredet seien und in zehn Minuten losmüssten, um es pünktlich zu schaffen.
»Noch genug Zeit für ein Gläschen Sekt«, trällerte Ines.
Sekt war jetzt genau das Richtige. Schon vor Tagen hatte ich für diesen Anlass eine Flasche kaltgestellt. Mama holte vier Gläser aus der Vitrine im Wohnzimmer und ich die Flasche aus dem Kühlschrank. Papa bot noch an, dass er sie aufmachen könne, da knallte der Korken schon unter die Decke. Der Sekt quoll aus der Flasche und tropfte auf den Boden. Glücklicherweise war es ein Holzboden und kein Teppich. Während mein Vater wischte, reichte meine Mutter Ines, Tim, Philipp und mir jeweils ein Glas.
»Kommt, ich schenk euch mal ein«, bot sie an. Philipp bekam natürlich nur Orangensaft, gemischt mit Sprudel, damit es genauso prickelte wie bei Sekt.
»Aber sauft nicht so viel, ihr müsst bei klarem Verstand sein!«, sagte Papa. Ich hatte gar nicht vor, viel Alkohol zu trinken, aber ein Schluck Sekt vor dem Aufbruch, das musste zur Feier des Tages einfach sein.
Und so standen wir in der Mitte unseres Wohnzimmers – meine Eltern, mein kleiner Bruder Philipp, meine beste Freundin Ines, meine große Liebe Tim und ich – und stießen gemeinsam auf die wohl größte Party unseres Lebens an, die Loveparade 2010 in Duisburg.
3
EMMA
»Rund 1,4 Millionen Raver werden heute zur Loveparade in Duisburg erwartet! Und wir machen mit euch ein kleines Warm-up! Den ganzen Morgen spielen wir die heißesten Beats!«
Emma tastete mit der Hand nach dem Radiowecker.
»Geh endlich aus, du Mistding!«, fluchte sie und drückte dabei auf verschiedenen Knöpfen herum, bis sie endlich den richtigen fand. Heute war es also so weit. Sie sollte als Reporterin überregional für das WDR-Fernsehen vom Duisburger Hauptbahnhof berichten: ankommende Raver interviewen und immer mal wieder erzählen, wie es am Bahnhof so läuft. Kommen die Züge pünktlich? Wie sind die Teilnehmer der größten Techno-Parade der Welt gelaunt? Und wie voll wird es wirklich?
Die ganze Nacht hatte Emma schlecht geschlafen, sich ständig von einer Seite auf die andere gewälzt und doch keine bequeme Position gefunden. Gegen halb vier hatte ihr Handy sie aus dem ohnehin unruhigen Schlaf gerissen. Es lag im Arbeitszimmer. Einen Moment versuchte sie, den schrillen Klingelton zu ignorieren. Dann kam ihr der Gedanke, dass es wichtig sein könnte. Wer ruft schon mitten in der Nacht an, wenn es nicht wichtig ist? Emma warf die Decke zurück, sprang aus dem Bett und donnerte im Dunkeln mit der Stirn gegen die angelehnte Schlafzimmertür.
»Auaaa«, jaulte sie, riss wütend die Tür auf und torkelte durch die Diele Richtung Büro. Wer auch immer da am Telefon war, er konnte sich auf etwas gefasst machen. Emma nahm das Gespräch an und keifte ein genervtes »Hallo?« in den Hörer.
»Hallo Engel, ich bin gut in Salt Lake City angekommen.«
Tom war dran. Er klang gut gelaunt. Im Auftrag seiner Firma war er zu einem Virologenkongress geflogen und hatte sich über die Zeitverschiebung anscheinend keine Gedanken gemacht.
»Spinnst du?«, fragte Emma. »Es ist mitten in der Nacht, und ich muss doch morgen früh raus.« Schnell beruhigte sie sich wieder. Schließlich hatte sie ihm gesagt, er solle sich nach der Landung vom Hotel aus melden. Dass sie genau in diesem Moment versuchen würde zu schlafen, hatte sie nicht einkalkuliert. Tom war Biologe und schrieb gerade an seiner Doktorarbeit. Sie hatte ihn schon vor elf Jahren kennengelernt. Damals war sie 19. Er hatte in einem kleinen Café gekellnert, um sich das Studium zu finanzieren, und sie war regelmäßig sein Gast. Er gefiel ihr auf Anhieb, schon als sie ihn zum ersten Mal sah. Emma fing an, nach Gründen zu suchen, warum sie dringend wieder dort hingehen müsste: Es ist so nett dort, die Pizza schmeckt da am besten, und es ist doch direkt in der Nähe. Fast jede ihrer Freundinnen schleppte sie mit in das kleine Café, in dem Tom arbeitete. Nachdem er ihr bei mehreren Besuchen unaufgefordert Gebäck auf den Tisch gestellt und ihr schließlich auch noch eine Eisschokolade spendiert hatte, nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und kritzelte ihre Telefonnummer auf einen Bierdeckel. Drei Tage später rief er an. Seitdem waren Tom und Emma ein Paar. Sie war sehr glücklich mit ihm, und so konnte sie ihm wegen des nächtlichen Anrufs unmöglich ernsthaft böse sein. Außerdem war Emma froh, noch mal seine Stimme zu hören, bevor sie morgen ihren großen Auftritt haben würde. Tom gab ihr Sicherheit. Nach einem kurzen Gespräch über den Flug, ein paar Turbulenzen, das Essen im Flieger und das Hotelzimmer wünschte er ihr Glück. Dann verabschiedeten sie sich.
Eine Stunde später saß sie wieder hellwach im Bett. Verdammt, sie hatte ein Problem. Das Outfit, das sie für die Moderation ausgewählt hatte, hatte einen entscheidenden Fehler: keine Taschen. Sie wollte ein schwarzes Kleid mit türkisfarbenen Blüten tragen. Es war schmal geschnitten, ging etwa bis zu den Knien, hatte kurze Ärmel und war ein gutes Mittelding zwischen Party und Seriosität. Der Ausschnitt war nicht zu tief, der Schlitz an der Seite nicht zu hoch. Und Emma hatte es in London gekauft, als sie dort vier Monate während des Studiums lebte. Es bedeutete ihr etwas. Doch jetzt fiel ihr ein, dass sie keine Chance hatte, daran den Funk-Sender zu befestigen, über den sie den Ton des WDR-Programms mithören und so auf die Fragen der Moderatoren antworten konnte.
Emma knipste die kleine, blaue Nachttischlampe an und quälte sich abermals fluchend aus dem Bett. Ich dusselige Kuh, wie krieg ich das jetzt hin? Ein Gürtel, ich brauche einen Gürtel. Wenn ich schon keine Tasche habe, in die ich den Sender stecken kann, dann kann ich ihn vielleicht an einem Gürtel befestigen.
Sie stolperte im Halbdunkel durch ihren begehbaren Kleiderschrank, den Tom für sie gebaut hatte, und suchte nach ihrem schmalsten schwarzen Gürtel. Keine Spur von dem Ding. Wie vom Erdboden verschluckt. Also suchte sie im Bad und im Büro. Da war er auch nicht. Also wieder zum Kleiderschrank. Da hing er doch, auf einem Bügel. Boah, bin ich eigentlich blind? Okay, also schnell testen: Kleid anziehen, Gürtel umschnallen. Könnte funktionieren. Alles klar, jetzt aber endlich schlafen. Der Wecker zeigte fünf Uhr. Nur noch drei Stunden, großartig.
Als Emma von der Stimme des Radiomoderators wach wurde und versuchte, den Wecker zum Schweigen zu bringen, war ihr schlecht. Was war eigentlich los mit ihr? Plötzlich hatte sie einen Brechreiz. Sie sprang hastig aus dem Bett, rannte ins Bad, öffnete den Toilettendeckel und würgte. Nichts kam. Außer ein wenig Magensäure, die in ihrem Hals brannte. Es schmeckte widerlich.
Bäh! Meine Güte, was soll denn das? Bist du eigentlich total bescheuert? Stell dich nicht so an!, schimpfte sie mit sich selbst, spuckte ins Klo und spülte sich anschließend den Mund aus. Den nervösen Magen hatte sie von ihrem Vater geerbt, aber heute gab es keinen vernünftigen Grund für Magenschmerzen. Schließlich hatte sie sich regelrecht darum gerissen, von der Loveparade zu berichten. Schon vor einem halben Jahr war Emma zu ihrem Chef gerannt und hatte sich angeboten. Sie war prädestiniert dafür, fand sie, denn sie war schon auf acht Paraden gewesen; manchmal privat, einige Male auch beruflich. Emma hatte sich schon immer gewünscht, einmal als Reporterin die Liveberichte von dort zu machen. Nun – mit dreißig – sollte es endlich so weit sein. Sie war eine der wenigen, die sich mit der Organisation und dem Konzept gut auskannten, und bisher hatte sie immer viel Spaß auf der Loveparade gehabt. Was gab es also zu befürchten?
Emma ging in die Küche. Ein paar zaghafte Sonnenstrahlen fielen durchs Dachfenster auf den hellen Parkettboden. Sie schmierte sich eine Scheibe Toast mit Pflaumenmus und machte sich einen Kaffee. Dann setzte sie sich an den kleinen Tisch direkt vor dem Fenster und blickte über die Stadt. Das Essen fiel ihr schwer. Ihr Magen protestierte gegen jeden einzelnen Bissen, aber komplett nüchtern ins Studio zu kommen war keine gute Idee. Mit viel Kaffee spülte sie das Brot hinunter. Auf Flüssigkeit reagierte ihr Magen weniger genervt.
Sie sprang unter die Dusche und verbrachte anschließend eine halbe Stunde damit, ihr Fernseh-Make-up aufzulegen. Ein bisschen goldener Glitzer auf die Augen, schließlich berichtete sie von der Loveparade. Das passt schon, dachte sie. Schnell noch die Haare mit dem Lockenstab in Form gebracht, fertig.
Es war kurz vor zehn. Um elf musste sie im Studio sein, zur Vorbesprechung und gemeinsamen Abfahrt Richtung Duisburger Hauptbahnhof. Keine drei Stunden später würde sie das erste Mal live auf Sendung gehen und für das WDR-Extra berichten. Zuerst hatte sie sich geärgert, dass ausgerechnet sie am Hauptbahnhof stehen sollte. Schließlich war sie loveparadeerfahren, es war ihre Musik, sie war schon in Berlin dabei gewesen. Warum ließen sie ausgerechnet sie am Hauptbahnhof versauern? Als sie ihren Chef drauf ansprach, sagte er nur: »Wenn du lieber tanzen willst, können wir dich auch gerne komplett aus der Planung nehmen!«
»Nein! Nein, ich will das schon machen«, ruderte Emma zurück. »Ich wäre nur einfach lieber mittendrin.«
Aber gut, wenigstens war sie dabei. Emma hatte Anfang der Woche damit begonnen, innerhalb des WDR herumzutelefonieren, ob sie noch ein Ticket für den »1Live-Float« bekommen könne. »1Live« war das junge Radio ihres Senders und nahm mit einem eigenen Wagen an der Parade teil. Emma hatte Glück. Weil sie während des Studiums mal bei »1Live« gearbeitet hatte und noch einige Leute dort kannte, bekam sie ein Ticket mit der Hauspost geschickt. Es war zwar nur ein B-Pass, was hieß, dass sie nur auf den Wagen durfte, wenn auf diesem genug Platz war, aber immerhin. Ihr Plan war, um 20 Uhr, nach allen Liveberichten, zur Parade rüberzugehen und die letzten Stunden bis Mitternacht zu feiern, dass sie den Arbeitstag hinter sich gebracht hatte, ohne sich im bundesweiten Fernsehen blamiert zu haben.
Den Gürtel für den Funk-Sender bloß nicht vergessen, dachte sie noch und packte ihn zusammen mit einem Fertig-Cappuccino aus dem Kühlschrank und zwei geschmierten Toastbroten in ihre Tasche. Dann hetzte sie aus der Wohnung und polterte die Treppe hinunter.
»Frau Weber, wollen Sie so etwa rausgehen? Es ist abgekühlt, Sie werden frieren«, fing sie ihre Nachbarin kurz vor der rettenden Haustür ab. Die Frau, Ende 70, mit kurzen, blond gefärbten Locken und gegerbter Haut von zu vielen Sonnenbädern, verwickelte Emma gerne in kurze Gespräche übers Wetter. Emma versprach, noch eine Strumpfhose zu kaufen, und konnte sich so loseisen.
Als sie rauskam, merkte sie, dass die Nachbarin recht gehabt hatte. Es war bedeckt und kühl. Also wirklich noch eine Strumpfhose kaufen. Das durfte doch nicht wahr sein. Die Strumpfhosen, die Emma im Schrank hatte, waren entweder für den Winter gedacht, also viel zu dick, oder hatten Laufmaschen. Das ging fürs Fernsehen natürlich gar nicht. Also noch schnell in die Stadt.
Emma parkte ihren schwarzen Polo im absoluten Halteverbot und rannte in ein großes Kaufhaus. Wo sind diese blöden neuen, modernen Strumpfhosen ohne Fuß?, fragte sie sich. Eine glänzende brauchte sie, passend zum Kleid. Orientierungslos hastete Emma durch die Strumpfabteilung, bis sie endlich auf eine Verkäuferin stieß. »Entschuldigung, können Sie mir weiterhelfen? Ich brauche dringend so eine Strumpfhose ohne Fuß.«
»Nylon-Leggins meinen Sie? Da sind Sie hier total falsch, da vorne müssen Sie gucken. Moment, ich komme mit und zeig es Ihnen.«
Vier Gänge weiter wurden Emma und die Verkäuferin fündig.
Größe S. Wunderbar.
Schnell zur Kasse.
Zum Glück nicht viel los.
»Sie wissen aber, dass das ein Schlafanzug ist und kein normales Hemd?« Die Verkäuferin blickte skeptisch über den oberen Rand ihrer pinkfarbenen Brille zu dem Kunden vor Emma. Sie trug eine karierte Bluse in einem Braunton, der Emma an das uralte Badezimmer ihrer Großeltern erinnerte.
»Nein, ich dachte, das ist ein Hemd.«
»Wollen Sie es trotzdem nehmen?«
»Ich weiß nicht.«
»Oder wollen Sie noch mal schauen?«
Ahhh, ich komme zu spät, entscheid dich endlich!, wollte Emma am liebsten brüllen. Sie war kurz davor zu explodieren, machte stattdessen aber lieber auf dem Absatz kehrt und sprintete zur Kasse in einer anderen Abteilung.
Falsche Entscheidung.
Hier waren mehr Leute vor ihr.
Unruhig trat Emma von einem Fuß auf den anderen und guckte immer wieder auf die Uhr.
Nachdem sie endlich bezahlt hatte, stürmte sie in eine Umkleidekabine, riss das Etikett ab, schlüpfte in die Leggins und lief sofort wieder nach draußen.
Als sie gerade in ihr Auto gestiegen war und den Motor anlassen wollte, klopfte ein dicklicher Mann mittleren Alters an das Fenster auf der Beifahrerseite. Emma drückte auf den Knopf, um es zu öffnen. Der Mann beugte sich zu ihr herunter.
»Junge Frau, Sie haben einen Strafzettel bekommen!«, sagte er in einem Tonfall, den Emma nicht interpretieren konnte. Er klang empört. Aber worüber? Darüber, dass sie falsch geparkt hatte, oder über die Tatsache, dass sie dafür bestraft wurde? Hatte er Mitleid mit ihr, oder wollte er sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen? Egal. Sie sah, dass es stimmte: Unter dem Scheibenwischer klemmte ein gelber Zettel.
»Können Sie das Ding da bitte rausziehen und wegschmeißen? Ich bin total im Stress.« Noch während er das Knöllchen unter dem Scheibenwischer wegzog, setzte Emma ein Stück zurück.
»Langsam, junge Frau! Sie wären mir beinah über den Fuß gefahren.«
»’tschuldigung!«
Der Tag fing ja gut an.
Sie fuhr auf dem kürzesten Weg auf die Autobahn und gab Gas. Während der Fahrt programmierte sie das Navi, damit es sie auf Staus und Sperrungen hinweisen würde.
»Palimpalim«, machte ihr Handy. Eine SMS. Bei Tempo 160 fischte sie das Telefon aus der Tasche auf dem Beifahrersitz und versuchte, den Blick dabei auf der Fahrbahn zu halten. »Süße, mir geht es scheiße, meld dich bitte mal bei mir!«, las sie. Ihre beste Freundin hatte mal wieder »Männerterror«. Emma rief sie an, und ein Redeschwall ergoss sich über ihr. Elena hatte kein Glück mit Männern. Gerade hatte sie wieder Streit mit ihrem Freund. Als Emma ihn das erste Mal getroffen hatte, war ihr sofort klar, dass er nicht der Richtige für ihre Freundin war. Zu einfältig, zu arrogant und insgesamt einfach unsympathisch. Aber Elena selbst sprach immer davon, wie perfekt alles mit ihm sei. Nur immer dann, wenn Elena anrief, war es gerade mal wieder nicht ganz so perfekt.
Mittlerweile war Emma in Duisburg von der Autobahn abgefahren: Überall Sperrungen wegen der bevorstehenden Techno-Parade. Kein Durchkommen. Elena redete unaufhörlich. Emma merkte, dass sie nicht zuhörte. Stattdessen suchte sie verzweifelt einen Weg zum Studio, der nicht gesperrt war.
»Bitte wenden!«, mischte sich das Navi ein.
»Scheiße, ich kann hier nicht wenden, weil da drüben alles dicht ist!«, fluchte Emma. »Elena, es tut mir leid, ich kann mich jetzt nicht auf dich konzentrieren«, bremste sie ihre Freundin und gleichzeitig das Auto. »Lass uns bitte morgen reden, ich hab in zweieinhalb Stunden meine erste Liveschalte, und ich hab schon Probleme, zum Studio zu kommen, weil hier alles dicht ist.«
Die beiden verabschiedeten sich. Auch ohne telefonische Ablenkung hatte Emma Mühe, sich zurechtzufinden. Sie verstieß mindestens gegen drei Verkehrsregeln: Links abzubiegen trotz durchgezogener Linie und mitten auf der Straße zu wenden waren die beiden harmloseren Ordnungswidrigkeiten. Die rote Ampel zu überfahren hätte sie ihren Führerschein kosten können. Aber was sollte sie machen? Dieses Ding wollte einfach nicht grün werden, auch nach fünf Minuten nicht. Wahrscheinlich war die Ampel kaputt. Emma war nicht die Einzige, der in diesem Verkehrschaos der Geduldsfaden riss. Andere Autofahrer taten es ihr gleich, fuhren hinter ihr her und ignorierten das dauerrote Verkehrshindernis.
Es war fünf nach elf, als sie vor dem WDR-Gebäude parkte, das direkt am Duisburger Innenhafen lag. Am Anleger unterhalb des Fernsehstudios ankerten mehrere kleine Motorbötchen. Hier wirkte es friedlich. Als Emma aus dem Wagen stieg, atmete sie tief durch, sah auf das Wasser und inhalierte die Ruhe. Obwohl es langsam wärmer wurde, war die Luft noch frisch.
Dann betrat sie das ovale Gebäude mit den großen Fensterfronten.
»Schönen guten Morgen, Frau Weber!«, begrüßte sie der Pförtner.
»Morgen, Eddy! Großkampftag heute, sag ich Ihnen.«
»Ach, Sie machen das schon. Wie immer.« Der bärtige Mann lächelte aufmunternd. Emma mochte ihn und hoffte, dass er recht behielt. Sie nickte und lächelte höflich zurück. Dann ging sie die Treppen hinauf in den ersten Stock. Dort waren die Redaktionsbüros.
Es war still. Sie war die Erste. Wahrscheinlich steckten die anderen auch noch im Verkehrschaos fest. Das große Büro, in dem normalerweise Planer, Senderedakteur, Nachrichtenredakteur, Moderator, Rechercheur und zwei Sekretärinnen saßen, war verwaist. Eine leere Einsatzzentrale kurz vor einem Großeinsatz. Emma bog in ein kleines Büro ab, das den Reportern und Autoren zur Verfügung stand. Es roch nach den Chemikalien, die der Drucker und der Teppich ausdünsteten. Emma riss das Fenster auf und startete einen der vier Computer.
Ein paar Minuten später kam Beate, die Kamerafrau. Sie war um die fünfzig und eine der hartgesottensten Kolleginnen, die Emma kannte. Noch nie hatte sie Beate jammern oder über Rückenschmerzen klagen hören. Und obwohl sie äußerlich herb und burschikos war, verfügte sie über ein großes Einfühlungsvermögen. Das hatte sie schon auf diversen Drehs bewiesen. Einmal hatte Emma mit ihr in einem OP bei einer Hauttransplantation gestanden. Ein 17-jähriger Junge hatte schwere Verbrennungen, weil er an Spraydosen geschnüffelt und sich dabei eine Zigarette angezündet hatte. Beate und Emma sollten einen Bericht über das Verbrennungszentrum der Unfallklinik in Duisburg drehen und waren deshalb bei einer der vielen schwierigen Operationen dabei, die dieser Junge über sich ergehen lassen musste. Gesunde Haut wurde von seinem Rücken abgehobelt, dann durch eine Art Walze gepresst und somit ausgedehnt. Anschließend wurden die Stellen, an denen die verbrannte Haut entfernt worden war, damit abgedeckt. Die gesunde Haut tackerten die Ärzte wie ein Blatt Papier an dem ausgezehrten Körper fest. Ein martialischer Vorgang, bei dem viel Blut floss. Der arme Junge zitterte schon vor der OP vor Schmerzen, und nachher musste er sich am laufenden Band übergeben. Beate und Emma sprachen mit Ärzten und den Eltern des Jungen.
Danach standen sie gemeinsam im Aufzug, und Beate sagte: »Oh Mann, Emma. Eben habe ich mich noch über meine kaputte Autotür aufgeregt. Gerade ist mir mal wieder klar geworden: Ist doch total egal.« Emma nickte. An manchen Drehtagen wurde ihr bewusst, wie klein doch viele Probleme im Alltag waren. Das war so ein Tag.
Jetzt stand Beate vor ihr, mit den langen, schwarz-grau melierten Haaren, die sie zu einem lockeren Zopf zusammengebunden hatte, und ihre schmalen Lippen formten sich zu einem Lächeln. Die Frauen umarmten sich.
»Was ist denn heute alles geplant?«, fragte die Kamerafrau.
»Lass uns warten, bis Roman da ist, dann erzähl ich dir alles.«
Roman war der Aufnahmeleiter, der sie betreuen sollte. Schließlich mussten alle wissen, was auf der Agenda stand. Also gingen Beate und Emma in die Kaffeeküche. Emma nahm eine Tasse aus dem Schrank, stellte sie in den Kaffeeautomaten und steckte ein 50-Cent-Stück in den Schlitz. Sie drückte auf den Knopf für einen Latte macchiato. Das Mahlwerk der Maschine arbeitete lautstark. Kaffee hatte auf Emma eine beruhigende Wirkung. Wenn sie sich gestresst fühlte, hatte sie den Eindruck, dass es half, sich an einer warmen Tasse festzuhalten und sich zwischendurch die Zeit zu nehmen, einen Schluck zu trinken. Beate zog sich einen Cappuccino. Die beiden Frauen setzten sich.
Äußerlich konnten sie unterschiedlicher kaum sein, und doch ähnelten sie sich. Emma schminkte sich, trug häufig hohe Schuhe und hatte die Haare meistens ordentlich zusammengebunden oder, wie an diesem Tag, mit dem Lockenstab in leichte Wellen gelegt und mit jeder Menge Haarspray fixiert. Beate war ungeschminkt, trug Jeans, ein lockeres Hemd, und ihr Haar war zwar gekämmt, aber weit davon entfernt, gestylt auszusehen. Trotzdem war Emma nicht zimperlich und sich nicht zu fein, mit hohen Absätzen über einen matschigen Acker zu laufen, wenn dort zufällig gerade eine Leiche gefunden worden war und sie darüber berichten sollte. Sie verlor kein Wort über das unpassende Schuhwerk und stapfte selbstbewusst durch den Schlamm, als hätte sie Gummistiefel an. Auch auf ihr Make-up oder ihre Frisur pfiff sie, wenn es um den Job ging. Schon häufig hatte sie bei Wind und Regen vor der Kamera gestanden und wie ein nasses Schaf ausgesehen, weil sich ihre Haare durch die Feuchtigkeit in alle Himmelsrichtungen kräuselten. Ihre Eitelkeiten warf Emma im Außeneinsatz über den Haufen. Beate wusste das. Und vielleicht verstanden sie sich deshalb so gut. Ihnen war klar, dass sie beide die gleiche Motivation hatten, diesen Job zu machen: das Leben in seiner Gänze zu erfahren – mit allen Höhen und Tiefen.
Emma erzählte von der Loveparade in Berlin, Beate von »Rock am Ring«, einem Musikfestival in der Eifel, bei dem sie schon mehrfach gedreht hatte.
Ein paar Minuten später stieß Roman dazu.
»Hey Mädels«, begrüßte er die Frauen gewohnt lässig. Er war um die vierzig und drahtig vom vielen Radfahren. Roman konnte Emma anfangs nicht leiden, das hatte er ihr selbst irgendwann einmal verraten. Warum, konnte er nicht erklären. Emma fand ihn unnahbar und konnte ihn schlecht einschätzen. Nach drei Jahren Zusammenarbeit hatte sich das Verhältnis gebessert. Die beiden hatten sich aneinander gewöhnt, mochten sich. Glaubte Emma jedenfalls. Wirklich sicher war sie sich nicht. Aber eigentlich spielte das keine Rolle. »Du musst nicht everybody’s darling sein«, hatte Tom ihr oft genug eingetrichtert, und sie versuchte, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, auch wenn es ihr schwerfiel.
Roman zog sich einen Kaffee. Er trank ihn schwarz. Dann setzte er sich zu den Frauen, verschränkte die Arme und lehnte sich zurück. »Also, gibt es noch etwas, das ich wissen muss?«
Emma fingerte einen Zettel aus ihrer Handtasche: die Disposition, auf der alle Informationen zum Sendeablauf standen. Sie sah auf das Papier und fasste zusammen:
»Okay, wir melden uns heute wahrscheinlich fünfmal live vom Bahnhof. Geplant ist Folgendes: Eine Schalte relativ zu Beginn der WDR-Extra-Sendung gegen 13 Uhr 50, eine noch mal eine Stunde später so gegen 14 Uhr 55 und dann noch eine dritte gegen Ende der Extra-Sendung um etwa 18 Uhr 30. Dann schalten wir noch in die Aktuelle Stunde und in die Lokalzeit aus Duisburg. Genaue Zeiten und Längen stehen noch nicht fest. Inhalt: die Situation am Hauptbahnhof. Für das Extra eher serviceorientiert und atmosphärisch: Ankommende Raver, Partystimmung, wie sieht es aus mit überfüllten Zügen und Verspätungen? Für die Aktuelle Stunde ist es eher journalistisch gewünscht, also: Wie verlief der Tag am Bahnhof? Gab es Probleme? Und wenn ja, welche?«
»Mit Einspielern?«, wollte Beate wissen.
»Ja, ich würde gerne an den Bahnsteigen ein paar Bilder drehen und natürlich auch ein paar O-Töne von Ravern über ihre Ankunft vorproduzieren und dann während der Schalten einspielen.«
»Alles klar, dann starten wir gleich«, sagte Roman und klopfte mit der flachen Hand auf den Tisch.
Beate ging in die Tiefgarage, um die Ausrüstung ins Auto zu packen: Kamera, Stativ, Licht, Akkus, Mikrofon. Emma setzte sich noch kurz an den Computer und öffnete das Programm, das die Meldungen der Nachrichtenagenturen anzeigte. Sie wollte wissen, ob es schon Informationen zur Anreise der Raver gab. Aber da war nichts. Mittlerweile saßen mehrere Kollegen im Großraumbüro und fingen an, die Sendung für den Abend zu planen.
»Fenster schließen! Schnell! Macht die Fenster zu!«, brüllte plötzlich jemand über den Gang. Emma leistete Folge, ohne zu wissen warum.
»Es brennt, es brennt! Gegenüber! Im Lager von Staples!«, rief ein Kollege aufgeregt.
Emma suchte ein Fenster mit Blick auf den Bürofachmarkt. Und tatsächlich, es brannte. Dicke Rauchschwaden stiegen auf, direkt gegenüber vom Studio. Der Geruch von verbranntem Kunststoff hatte seinen Weg in die Redaktionsräume gefunden. Ein komischer Tag. Doch das änderte nichts daran, dass Emma, Beate und Roman losmussten.
»Wedau 12 für Jupiter 1, kommen!«
»Wedau 12 hört.«
»Uns ist zu Ohren gekommen, dass auf dem Veranstaltungsgelände noch keinerreingelassen wird, ist das richtig?«
»Positiv. Angeblich verzögert sich der Einlassauf zwölf Uhr, weil Bühnentechnik undLautsprecheranlage noch nicht funktionieren.«
»Verstanden. Wie viele Personen stehen im Eingangsbereich?«
»Aktuelle Personenzahl Eingang West 1000 bis 1500, Eingang Ost circa 600.«
»Verstanden.«
4
RENÉ
Die Straßen in der Innenstadt waren so gut wie leer: kein Auto weit und breit, alles war abgeriegelt. Erst vereinzelt zogen kleine Gruppen von Ravern um die Häuser. Es war ruhig. Zu ruhig. René langweilte sich. Seit fast drei Stunden standen Frank und er nun schon gemeinsam mit unzähligen anderen Einsatzkräften und über zwanzig Rettungswagen am großen Einsatzstützpunkt zwischen Veranstaltungsgelände und Hauptbahnhof. Einige Meter hinter ihnen parkte ein roter Reisebus. »EINSATZLEITUNG« stand darauf. Die Fenster waren mit Kunststoffblenden abgedeckt, sodass man nicht hineinsehen konnte. Weiter die Straße runter war ein Lazarett aufgebaut.
René kaute auf einem Salamibrötchen herum und nippte an seinem Kaffee. Frank rauchte eine Zigarette nach der anderen. Offenbar langweilte auch er sich. Mit der freien Hand cremte er sich die Halbglatze mit Sonnenschutzmittel ein.
»Kreisrunder Haarausfall, was?«, zog René ihn auf.
»Ein schönes Gesicht braucht eben Platz«, konterte Frank. »Außerdem: Komm du erst mal in mein Alter, dann reden wir weiter.«
Frank war 42, René 40. Aber an dem Argument mit dem Gesicht war was dran. Die Halbglatze stand ihm. Den noch übrigen blonden Haarkranz hatte er sich so kurz rasiert, dass es fast so aussah, als ob er gar keine Haare mehr hätte. Dagegen wirkte René wie einer von der Kelly Family. Die braunen Haare fielen ihm wuschelig ins Gesicht.
Für den Einsatz auf der Loveparade hatten sich die beiden freiwillig gemeldet. Das war mal was anderes, fanden sie. René stand zwar nicht auf Techno, aber das Spektakel an sich reizte ihn. Er freute sich darauf, die Musikwagen zu sehen und vielleicht einen Blick hinter die Bühnen zu werfen. Denn als Sanitäter kam man in Bereiche, zu denen andere keinen Zutritt hatten. René interessierte sich für die Organisation solcher Megaevents, wie er es gerne nannte. Vor allem für die Technik, die Musik- und Lautsprecheranlagen, die Lichteffekte, eben für alles, was hinter einer solchen Veranstaltung steckte. Er hatte Bilder von der Loveparade in Berlin gesehen und im Fernsehen die Berichterstattung über die Paraden in Essen und Dortmund verfolgt. Sicher war es ein Erlebnis, diese ganzen verrückt gestylten Partybesucher mal live zu sehen und etwas von der Stimmung an einem solchen Tag mitzubekommen. Allerdings würde der Einsatz nicht nur Spaß bringen, sondern vor allem anstrengend werden. Sie hatten eine 24-Stunden-Schicht, und ein Kollege, der bei der Loveparade in Dortmund im Einsatz gewesen war, hatte von im Schnitt dreißig Krankentransporten in zwölf Stunden gesprochen. Man konnte sich leicht ausrechnen, wie viel Zeit da pro Patient blieb, nämlich genau 24 Minuten. Das war nicht viel. Wenn sich jemand den Fuß umgeknickt hatte, reichten 24 Minuten vielleicht aus, bei einem Kreislaufkollaps oder Drogenmissbrauch war die Zeit allerdings knapp. Aber letzten Endes konnten sie ohnehin nur so viele Einsätze fahren, wie sie eben schafften. Und bisher hatten sie keinen einzigen.
»Wenn das so bleibt, wird das aber eine extrem ruhige Nummer.« René klang enttäuscht.
»Wart’s ab, ist noch früh.«
Das einzig Interessante waren die ersten schrill verkleideten Loveparade-Besucher.
»Guck dir die an, ich glaub, die hat nur ein Höschen an, der Rest ist ein Bodypainting«, bemerkte Frank und lachte.
»Heißes Gerät«, grölte ein Kollege von hinten. Renés Grinsen verwandelte sich in ein Gähnen.
Um 7 Uhr 30 hatten er und Frank den Rettungswagen an einem Stützpunkt für ehrenamtliche Einsatzkräfte abgeholt. Das Gebäude stand etwas abgelegen, am Rande eines Wohngebiets, direkt neben einer Weide, auf der Kühe grasten. Es war schon hell, aber die Luft war noch kühl und feucht. Überall Morgentau. Die beiden Männer gingen hinein und ließen sich den Wagenschlüssel geben. Wie die Piloten im Cockpit eines Flugzeuges überprüften sie anschließend die Ausrüstung und die Geräte im Wagen. Das EKG funktionierte einwandfrei: Die Kabel waren in Ordnung, die Elektroden vollständig, das Testprogramm lief ohne Fehlermeldungen durch, und im Drucker lag genug Papier, um mindestens zwanzig EKGs zu schreiben. Der Defibrillator war einsatzbereit, und der Druck in der Flasche des Sauerstoffgeräts zeigte an, dass sie voll war. René überprüfte das Absauggerät. Bei zu hohem Unterdruck musste es sich automatisch abschalten. Das war in etwa so wie bei einem Staubsauger, der blockiert, wenn er einen Widerstand spürt, weil er beispielsweise einen Schnürsenkel aufgesaugt hat. Schaltet das Absauggerät trotz heftigen Widerstands nicht ab, saugt es im schlimmsten Fall zu viel aus einem Körper heraus. Renés Chef hatte es in der Ausbildung noch drastischer ausgedrückt: »Dann hast du nachher die Eingeweide am Sauger hängen.« Dieser Satz hatte sich eingeprägt. Deshalb kontrollierte René das Gerät meistens doppelt, auch dieses Mal. Frank öffnete den Reißverschluss seines Notfallrucksacks: Medikamente, Verbandsmaterialien, Intubations-Utensilien für die Beatmung. Er hakte alles auf einer Checkliste ab. René packte noch einige Decken und Laken für die Trage in den Wagen. Frank schnappte sich einen Pack Wasserflaschen. Wasser war oft wichtiger als alles andere, denn bei Großveranstaltungen wie dieser bekamen erfahrungsgemäß viele Menschen Kreislaufprobleme.
Gegen acht waren sie mit der Überprüfung des Rettungswagens fertig und machten sich auf den Weg zur Einsatzbesprechung. In einer halben Stunde müssten sie dort sein. René saß hinterm Steuer, Frank dösend daneben. Die ersten Kilometer Richtung Innenstadt fuhren sie über eine Landstraße. Durch die Schatten, die die Bäume auf die Fahrbahn warfen, flackerte das Tageslicht. Die gleiche hinterhältige Idylle wie vor drei Jahren. Verdammt, warum konnte René das Thema nicht endlich abhaken? Jedes Mal, wenn er auf einer Landstraße unterwegs war, dachte er an diesen einen beschissenen Tag.
Damals hatten sie die Meldung bekommen: »Schwerer Verkehrsunfall, mehrere Verletzte«. Als sie am Unfallort ankamen, stolperte René über einen Teddybären, der auf der Straße lag. Es war ein brauner Bär, der besonders plüschig und weich aussah, mit hellbraunen Tatzen. Ein Ohr hatte jemand mit einem schwarzen Faden und groben Stichen wieder angenäht. Einige Meter weiter lag etwas im Gras, direkt neben der Straße. Der leblose Körper eines kleinen Mädchens. Es trug ein dunkelblaues Kleid, dazu auffällig rote Ballerinas.
Während die Polizei die Unfallstelle sicherte und sich zwei weitere Rettungsteams um die Insassen der beiden zusammengestoßenen Autos kümmerten, versuchten René und Frank, die Kleine wiederzubeleben. René strich ihr die blonden Locken aus dem Gesicht, um Platz für die Beatmung zu schaffen. Äußerlich war sie kaum verletzt. Sie sah friedlich aus, als ob sie schlief. Nur aus dem feinen Kratzer auf ihrer Stirn quoll etwas Blut. Frank und René sahen sich an. Sie würden alles geben, um das Mädchen zu retten. Es war höchstens vier Jahre alt.
Das Zirpen der Grillen dröhnte in Renés Kopf. Es war schwül, und die Sonne brannte in seinem Nacken. Frank zog die Träger des Kleids der Kleinen herunter und befestigte die Elektroden für das EKG auf ihrer Brust. Nulllinie. René begann mit der Herzdruckmassage, während Frank den Beatmungsbeutel hielt und in regelmäßigen Abständen Luft in ihre Lungen drückte.
Die Landstraße lag malerisch zwischen Feldern, umsäumt von großen, alten Platanen. Ein paar Meter vom Unfallort entfernt war eine Einbiegung. Dort stand der zweite Unfallwagen. Offenbar hatte der ältere Mann am Steuer die Vorfahrt missachtet. Die Mutter des Mädchens hatte noch versucht auszuweichen, doch der Wagen war ausgebrochen und hatte sich mehrfach überschlagen. Warum zum Teufel war die Kleine nicht angeschnallt? Vielleicht hatte sie den Gurt selbst gelöst, oder die Mutter hatte vergessen, sie anzuschnallen.
Als der Notarzt eintraf, konnte er nur noch den Tod des Mädchens feststellen. René und Frank hatten alles gegeben, alles richtig gemacht und doch nichts mehr tun können.
Bei älteren Menschen konnte René das akzeptieren, er hatte sich die nötige Distanz, den Selbstschutz, den man als Rettungssanitäter brauchte, hart erarbeitet. Bei Kindern war die Distanz weg. Zumal René selbst zwei hatte. Beides Jungs, sechs und neun, die den Job ihres Papas unglaublich spannend fanden und immer wissen wollten, was er bei seinen Einsätzen alles erlebte. Von diesem Einsatz hatte er ihnen nichts erzählt.
Mit Frank verstand er sich seitdem wortlos. Über das kleine Mädchen mit den roten Ballerinas sprachen sie nie wieder. Sie kannten nicht mal seinen Namen.
»Hey! Anhalten! Hast du das Stoppschild nicht gesehen?«, brüllte Frank.
René stieg auf die Bremse.
»Pennst du noch, oder was ist los? Soll ich fahren?«
»Nein, tut mir leid, alles okay. Ich hab nur kurz nicht aufgepasst.«
Zehn Minuten später kamen sie am Stützpunkt an, einem abgesperrten Verkehrsknotenpunkt in unmittelbarer Nähe zur A 59. Wie an einem riesigen Taxistand reihten sich die Rettungswagen hintereinander ein. Auch der große Reisebus, der als Zentrale der Abschnittsleitung diente, stand schon dort. Im Minutentakt kamen weitere Rettungswagen hinzu. Die weiß-rote Schlange wurde länger und länger. Auch mitten auf der Straße parkten die Wagen schräg versetzt nebeneinander, sodass im Ernstfall mehrere gleichzeitig losfahren konnten. Aus jedem stiegen mindestens zwei Rettungssanitäter oder -assistenten aus. Hinzu kamen mehrere Notärzte.
Am Ende waren es an die 70 Einsatzkräfte, die ein gut gelauntes Murmeln produzierten.
»Schönen guten Morgen zusammen!« Die Begrüßung des Einsatzleiters klang blechern und ein wenig verzerrt, er sprach durch ein Megafon. Die Helfer versammelten sich im Halbkreis um ihn herum.
»Wir vergeben jetzt die Nummern für die Rettungswagen. Wer einen Einsatz bekommt, wird aufgerufen. Sie holen sich Ihren Einsatz dann an der Abschnittsleitung ab.«
Die Nummern für die Wagen wurden in der Reihenfolge vergeben, in der sie sich in die Schlange eingereiht hatten. René und Frank saßen auf RTW 6.
»Wo sind denn eigentlich genau die Absperrungen? Und wo ist überhaupt der Eingang zur Veranstaltung?«, fragte ein Kollege.
Der Einsatzleiter guckte skeptisch. »Hatten Sie kein Briefing?«, fragte er streng.
»Nein.«
»Okay, kommen Sie gleich mal zu mir!«
Die Teams waren aus ganz Nordrhein-Westfalen nach Duisburg geschickt worden. Auch viele Ehrenamtliche waren dabei. Und nicht jeder kannte sich in der Stadt aus. René und Frank eigentlich auch nicht, sie kamen aus Krefeld.
»Ich bin echt froh, dass wir uns das Gelände und den Eingangsbereich vorher schon mal angeguckt haben«, sagte René.
Frank nickte.
»Hast du auch die Mappe mit, die wir gestern vom Chef bekommen haben? Die mit dem Lageplan und den Telefonnummern der Krankenhäuser?«
»Ja sicher, liegt schon im Wagen.«
Die Jahre zuvor, bei den Loveparades in Dortmund und Essen, hatte es für auswärtige Teams noch Lotsen gegeben, die mit auf den Rettungswagen saßen und bei der Orientierung halfen. Dieses Mal mussten die Einsatzkräfte mit Navigationsgeräten und Karten zurechtkommen. Ein Team bestand erfolgreich darauf, einen ortskundigen Kollegen zugeteilt zu bekommen.
»Hoffentlich kriegen wir nicht den Pat 5-24«, witzelte ein jüngerer Sani mit heftigen Aknenarben im Gesicht. »Pat« stand für Patient, die »5« für ein e, den fünften Buchstaben im Alphabet, die »24« für ein x. Also: Patient ex, mit anderen Worten: Patient tot. Rettungssanitäter sprachen nicht gerne über tote Menschen. »Pat ex« oder »Pat 5-24« machte vieles leichter. Außerdem verstand so nicht jeder, der den Funk abhörte, worum es gerade ging. Der jüngere Kollege wollte es also nicht mit einem Toten zu tun bekommen. Verständlich. Ein bis zwei Tote waren bei Veranstaltungen wie dieser einkalkuliert. Das klang makaber, aber auch bei »Rock am Ring« war bisher fast jedes Jahr jemand gestorben. Manchmal war es Drogenmissbrauch, manchmal ein Diabetiker, der nicht rechtzeitig Insulin spritzte, oder ein schlichter Herzinfarkt.
René wollte den statistischen Toten auch nicht.
»Komm, wir gehen erst mal die Lage checken«, lenkte er sich von dem Gedanken ab.
»Alles klar«, sagte Frank.
Ganz in der Nähe sollte es einen Aufenthaltsraum und einen großen Behandlungsplatz geben. Beides wollten sie inspizieren. René holte die Karte aus dem Wagen, faltete sie auseinander und ließ den Blick darüber wandern. An einer Schule, ein paar Straßen weiter, entdeckte er eine Markierung. Da musste es sein. Es war nicht weit, vielleicht drei Minuten zu Fuß. Und doch lag die Schule fernab von den Hauptstrecken, die zur Loveparade führten, und damit von dem noch zu erwartenden Trubel.
Auf dem Schulhof hatte das Deutsche Rote Kreuz mehrere Behandlungszelte aufgebaut. Die Türen der Turnhalle standen offen, und René und Frank gingen hinein. Es roch nach Schweißsocken und Desinfektionsmitteln, gemischt mit dem typischen Geruch des Linoleumbodens. Die Halle sah aus wie ein kleines Krankenhaus: überall Betten, Notfallrucksäcke, Infusionen und viele Ersthelfer, die sich besprachen. »Behandlungsplatz 50« hieß dieser Ort. Die »50« stand für die Anzahl der Patienten, die gleichzeitig behandelt werden konnten. Ziemlich beeindruckend, fand René.





























