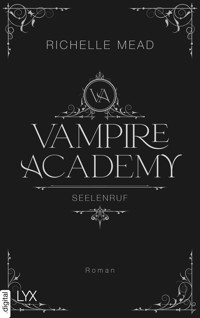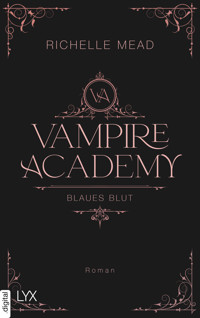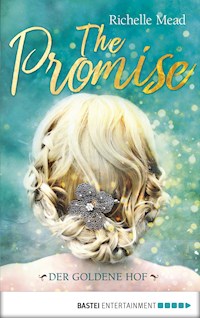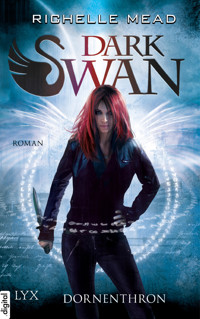9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dark-Swan-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein schrecklicher Krieg verwüstet das Dornenland. Als seine Königin muss Eugenie Markham alles daran setzen, um das Töten zu beenden und den Frieden wiederherzustellen. Sie begibt sich auf die Suche nach der Eisenkrone, einem magischen Gegenstand, den selbst die Feinen fürchten. Unterstützung erhält sie dabei von dem Feenkönig Dorian und dem Gestaltwandler Kiyo, ihrem Ex-Geliebten. Aber kann sie den beiden wirklich trauen? Die größte Prüfung steht Eugenie jedoch noch bevor: Die Krone verleiht ihrem Besitzer fantastische Kräfte und unvorstellbare Macht. Kann Eugenie dieser Verlockung widerstehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
TITEL
WIDMUNG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
DANKSAGUNG
IMPRESSUM
Richelle Mead
Roman
Ins Deutsche übertragen von Frank Böhmert
Für David, meinen ersten Leser
KAPITEL 1
Man darf Feenköniginnen nicht mit Feenprinzessinnen durcheinanderbringen.
Wo ich herkomme, träumen Mädchen, die gern eine Feenprinzessin sein möchten, normalerweise von hauchzarten Flügeln und Rüschenkleidern. In Pink, versteht sich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zu so einer Prinzessin auch bunte Glassteine gehören, außerdem schicke Zauberstäbe mit Stern obendran, die Wünsche wahr werden lassen. Feenprinzessinnen malen sich ein schönes Leben des Luxus und des Müßiggangs aus, inklusive kleiner Geschöpfe des Waldes, die nur darauf warten, sie bedienen zu dürfen.
Als Feenkönigin kann ich bestätigen, dass man tatsächlich ein bisschen öfter mit Geschöpfen des Waldes zu tun hat, als man erwarten sollte. Aber ansonsten? Ein totaler Witz. Feen– jedenfalls die Sorte, für die ich zuständig bin– haben nur selten Flügel. Mein Zauberstab ist mit Rohedelsteinen angereichert, und ich schicke damit Kreaturen der Anderswelt ins Jenseits. Ich habe damit auch schon ein paar Menschen eins übergebraten. Mein Leben ist dreckig, hart und tödlich, da bleiben Rüschenkleider auf der Strecke. Ich trage Jeans. Und, am wichtigsten, ich sehe grauenhaft aus in Pink.
Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, dass sich Feenprinzessinnen nicht schon am frühen Morgen mit solchem Mist herumschlagen müssen.
„Ich habe sie getötet… Eugenie Markham.“
Die Worte trugen laut und deutlich durch einen Speisesaal, in dem vielleicht dreißig Leute an runden Holztischen saßen. Die Decke war gewölbt, und die groben Steinwände ließen das Ganze nach mittelalterlichem Schloss aussehen… was ja praktisch auch stimmte. Die meisten Frühstücksgäste waren Soldaten und Wachen, aber es waren auch einige Beamte und Würdenträger darunter, die im Schloss lebten und arbeiteten.
Dorian, König des Eichenlands und mein auf Bondage stehender Lover, saß am Kopf der Tafel und sah von seinem Frühstück auf, um zu schauen, wer da eine dermaßen gewagte Behauptung aufgestellt hatte. „Verzeihung, sagtest du etwas?“
Der Sprecher, der auf der anderen Seite des Tisches stand, wurde so rot wie die Uniform, die er trug. Er schien Mitte zwanzig zu sein, in Menschenjahren, war also wahrscheinlich um die hundert, in Feen- oder, wie ich lieber sage, in Feinenjahren. Er kniff, um Würde bemüht, die Lippen zusammen, drückte das Kreuz durch und funkelte Dorian an.
„Ich sagte, ich habe Eugenie Markham getötet.“ Der Mann– ein Soldat anscheinend– sah vom einen Gesicht zum anderen und hoffte zweifelsohne darauf, dass seine Neuigkeit entsetzte Reaktionen hervorrief. Im Wesentlichen sorgten seine Worte für harmlose Verwirrung, vor allem deshalb, weil die halbe Gesellschaft mich draußen im Gang stehen sehen konnte. „Ich habe Eure Königin ermordet, und nun bröckelt Eure Macht. Ergebt Euch auf der Stelle, dann wird Ihre Majestät, Königin Katrice vom Vogelbeerland, Gnade walten lassen.“
Dorian machte keinen sonderlich besorgten Eindruck. Er tupfte sich vorsichtig den Mund mit einer brokatenen Serviette ab und legte sie wieder in seinen Schoß. „Tot? Bist du sicher?“ Er sah zu einer dunkelhaarigen Frau hinüber, die neben ihm saß. „Shaya, haben wir sie nicht gestern erst gesehen?“
„Ja, Sire“, erwiderte Shaya und tat Sahne in ihren Tee.
Dorian strich sich das herbstrote Haar aus dem Gesicht und machte sich wieder daran, den zuckrigen, mit Mandeln überzogenen Kuchen zu zerschneiden, der seine wichtigste Mahlzeit des Tages darstellte. „Nun, da hast du es. Sie kann nicht tot sein.“
Der Soldat aus dem Vogelbeerland starrte ihn an und verlor immer mehr seine Fassung, während die Leute ihn entweder neugierig ansahen oder gar nicht weiter beachteten. Nur eine ältere Feine, die auf Dorians anderer Seite saß, machte ansatzweise einen besorgten Eindruck. Sie hieß Ranelle und war eine Gesandte aus dem Lindenland. Sie war erst gestern eingetroffen und eindeutig noch nicht mit den hiesigen schrägen Einlagen vertraut.
Der Soldat wandte seine Aufmerksamkeit wieder Dorian zu. „Seid Ihr wahrhaftig so verrückt, wie man sich erzählt? Ich habe die Dornenkönigin getötet! Seht.“ Er warf ihm eine Halskette aus Silber und Mondsteinen hin. Sie klapperte über die harten Bodenfliesen, und die bleichen, schimmernden Steine fingen einen Tick Morgenlicht ein. „Das hier habe ich ihr vom toten Leib geschnitten. Jetzt werdet Ihr mir doch wohl glauben?“
Nun wurde es doch einigermaßen still im Saal; selbst Dorian stutzte. Die Halskette gehörte wirklich mir, und ich berührte bei ihrem Anblick unwillkürlich die nackte Stelle an meiner Kehle. Dorians Miene drückte wie immer Langeweile aus, aber ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass hinter seinen grünen Augen ein Mahlstrom von Gedanken wirbelte.
„Wenn das wahr ist“, entgegnete er schließlich, „warum hast du uns dann nicht gleich ihren Leichnam mitgebracht?“
„Der ist bei meiner Königin“, sagte der Soldat selbstgefällig. Er glaubte wohl, endlich Boden zu gewinnen. „Sie hat ihn als Trophäe behalten. Wenn Ihr kooperiert, könnte sie ihn Euch überlassen.“
„Ich glaube dir nicht.“ Dorian sah den Tisch hinab. „Rurik, reichst du mir einmal das Salz? Ah, danke.“
„König Dorian“, sagte Ranelle nervös, „vielleicht solltet Ihr dem, was dieser Mann zu sagen hat, mehr Aufmerksamkeit schenken. Wenn die Königin tot ist–“
„Sie ist nicht tot“, sagte Dorian entschieden. „Und diese Sauce ist köstlich.“
„Warum glaubt Ihr mir nicht?“ Nun klang der Soldat fast wie ein kleiner Junge. „Meint Ihr, sie wäre unbesiegbar gewesen? Meint Ihr, niemand hätte sie töten können?“
„Nein“, gab Dorian zu. „Ich bezweifle nur, dass du sie hättest töten können.“
Rachelle versuchte es erneut. „Mylord, woher wisst Ihr, dass die Königin nicht–“
„Weil sie dort hinten steht. Können wir jetzt vielleicht aufhören und in Ruhe essen?“
Diese Einmischung– und damit das Ende dieser Farce– kam von Jasmine, meiner Schwester im Teenageralter. Wie ich war sie halb menschlich. Im Gegensatz zu mir war ihr absolut nicht zu trauen, und darum frühstückte sie in lockeren, aber magiehemmenden Handschellen. Außerdem hatte sie Kopfhörer auf; die Frühstücksdebatte musste ihre gerade laufende Playlist übertönt haben.
Dreißig Gesichter wandten sich zum Eingang um, wo ich stand, und es gab ein wüstes Schieben von Stühlen, als praktisch alle für eine hastige Verbeugung aufstanden. Ich seufzte. Ich hatte mich gemütlich an die Wand gelehnt, um nach einer harten Nacht kurz von der Reise zu verschnaufen, und dabei zugesehen, wie sich in meinem Zuhause in der Anderswelt diese absurde Szene abspielte. Jetzt stand mein Auftritt an. Ich straffte die Schultern und schritt mit so viel Königinnenwürde in den Speisesaal, wie ich nur aufbrachte.
„Die Berichte über meinen Tod waren stark übertrieben.“ Ich hegte den Verdacht, dass ich das Mark-Twain-Zitat verhunzt hatte, aber unter den hier Versammelten verstand sowieso niemand diese Anspielung. Die meisten hielten es einfach nur für eine Tatsachenfeststellung. Was ja auch wieder stimmte.
Der eben noch zornesrote Soldat wurde blass, und seine Augen traten hervor. Er machte ein paar Schritte nach hinten und sah sich unsicher um. Aber er konnte nirgendwo anders hin.
Ich bedeutete denen, die aufgestanden waren, dass sie sich wieder setzen sollten, und ging zu meiner Halskette hinüber. Ich hob sie auf und musterte sie kritisch. „Du hast den Verschluss zerbrochen.“ Ich funkelte den Soldaten an. „Und zwar, als du sie mir während unseres Kampfes vom Hals gerissen hast– und dabei hast du mich nicht getötet, wie man sieht.“ Ich konnte mich kaum daran erinnern, mit diesem Kerl gerungen zu haben. Er war ja nicht der Einzige gewesen. Ich hatte ihn in dem Chaos aus den Augen verloren, aber nachdem er nun schon dieses „Beweisstück“ errungen hatte, fand Katrice es anscheinend gut, ihn mit einem Bluff hierherzuschicken.
„Für eine Tote seht Ihr hinreißend aus, meine Liebe“, erklärte Dorian. „Ihr solltet Euch wirklich zu uns setzen und diese Sauce probieren, die Ranelle mitgebracht hat.“
Ich ging nicht darauf ein– zum einen, weil er das von mir erwartete, und zum anderen, weil ich natürlich absolut nicht hinreißend aussah. Meine Kleidung war zerrissen und schmutzig, und ich hatte mir in dem Kampf letzte Nacht einige Schrammen geholt. Dem roten Schleier nach zu schließen, den ich in den Augenwinkeln sehen konnte, waren meine Haare verfilzt und standen in alle möglichen Richtungen ab. Der Tag versprach, heiß zu werden, und mein stickiges Schloss ließ mich stark schwitzen.
„Nein“, keuchte der Soldat aus dem Vogelbeerland. „Ihr könnt nicht am Leben sein. Balor hat geschworen, dass er Euch fallen sah– er hat es der Königin erzählt–“
„Lasst ihr das jetzt endlich mal bleiben?“, herrschte ich ihn an undschob mein Gesicht dicht an seines heran. Das veranlasste einige meiner Wachen, näherzutreten, aber ich machte mir keine Sorgen. Diese Null würde nichts versuchen, und außerdem konnte ich mich selber verteidigen. „Wann verkneift es sich eure bekloppte Königin endlich mal, jedes Gerücht über Dorians oder meinen Tod zu einer Riesenproklamation aufzublasen? Habt ihr noch nie etwas von Persönlichkeitsrechten gehört? Schon gut, vergiss es. Habt ihr natürlich nicht.“
„Aber dafür“, warf Dorian ein, „können wir Glanzvollen uns doch rühmen, rechte Persönlichkeiten zu sein.“
„Es würde ja noch nicht mal funktionieren“, grollte ich den Soldaten an. „Selbst wenn ich tot wäre, würde das unsere Königreiche nicht daran hindern, euch zu zermalmen.“
Das riss ihn aus seiner Verblüffung. Zorn ließ seine Züge aufleuchten– Zorn mit einem Schuss wahnhaftem Eifer. „Ihr halbblütiges Hexenweib! Ihr seid es, deren Existenz ausgelöscht werden wird! Ihr, der Eichenkönig und alle anderen, die in Euren verfluchten Landen leben. Unsere Königin ist mächtig und groß! Sie steht bereits in Verhandlung mit dem Espen- und dem Weidenland, um sich gegen Euch zu verbünden! Sie wird Euch unter dem Absatz zermalmen und sich dieses Land nehmen, es sich nehmen und–“
„Darf ich ihn töten? Bitte.“ Das war Jasmine. Sie hatte die Kopfhörer abgenommen und sah mich aus ihren grauen Augen bettelnd an. Was pubertäre Provokation hätte sein müssen, war in Wirklichkeit todernst gemeint. Es waren Tage wie dieser, an denen ich es bereute, sie in der Anderswelt behalten zu haben, anstatt sie zurückzuschicken, damit sie unter Menschen lebte. Es war bestimmt noch nicht zu spät für die Besserungsanstalt. „Ich habe nie jemanden von deinen Leuten getötet, Eugenie. Das weißt du. Überlass ihn mir. Bitte.“
„Er steht unter dem Schutz der Parlamentärsflagge“, gab Shaya automatisch zu bedenken. Protokollfragen waren ihr Spezialgebiet.
Dorian drehte sich zu ihr um. „Verdammt noch mal, Weib! Ich hab dir doch gesagt, dass du aufhören sollst, sie unter Immunität hier hereinzulassen. Verfluchtes Kriegsrecht.“ Shaya lächelte nur; sein gespielter Zornesausbruch beunruhigte sie nicht.
„Aber unter Schutz steht er trotzdem“, sagte ich und fühlte mich plötzlich wie ausgelaugt. Die Schlacht der vergangenen Nacht– eigentlich mehr ein Scharmützel– hatte mit einem Patt zwischen meinen und Katrices Heeren geendet. Was extrem frustrierend war und den Verlust an Leben auf beiden Seiten völlig sinnlos wirken ließ. Ich winkte einen meiner Wachsoldaten heran. „Schafft ihn hier raus. Setzt ihn auf ein Pferd und schickt ihn fort. Ohne Wasser. Wir bauen darauf, dass die Wege heute freundlich zu ihm sind.“
Die Wachen verneigten sich gehorsam, und ich wandte mich wieder zu Katrices Mann um.
„Und du kannst Katrice ausrichten, dass sie ihre Zeit verschwendet, ganz egal, wie oft sie noch behaupten will, dass sie mich getötet hat– oder sogar, wenn sie es schafft. Wir werden diesen Krieg trotzdem fortsetzen, und sie wird ihn am Ende verlieren. Sie ist zahlenmäßig unterlegen und an den Grenzen ihrer Kapazitäten. Sie hat ihn wegen einer persönlichen Auseinandersetzung begonnen, und niemand wird ihr dabei zu Hilfe eilen. Sag ihr, wenn sie sich sofort ergibt, lassen wir vielleicht Gnade walten.“
Der Soldat aus dem Vogelbeerland funkelte mich an. Sein Groll war mit Händen zu greifen, aber er antwortete nicht. Er schaffte es nur, auf den Boden zu spucken, bevor die Wachen ihn nach draußen schleiften. Mit einem weiteren Seufzer wandte ich mich ab und sah zum Frühstückstisch. Sie hatten mir schon einen Stuhl hingestellt.
„Gibt es Toast?“, fragte ich und setzte mich müde.
Toast stand normalerweise nicht auf dem Speiseplan der Feinen, aber die Dienerschaft hatte sich an meine menschlichen Vorlieben gewöhnt. Sie brachten immer noch keinen anständigen Tequila zustande, und an Pop-Tarts war überhaupt nicht zu denken. Aber Toast? Toast hatten sie drauf. Jemand reichte mir einen Korb voll, und alle aßen friedlich weiter. Na ja, fast alle. Ranelle starrte uns an, als hätten wir sie nicht mehr alle, was ich verstehen konnte.
„Wie könnt Ihr so ruhig bleiben?“, rief sie. „Nachdem dieser Mann gerade– gerade– und Ihr…“ Sie musterte mich voller Staunen. „Vergebt mir, Eure Majestät, aber Eure Kleider… Ihr kommt eindeutig gerade vom Schlachtfeld. Und doch sitzt Ihr hier, als wäre all dies völlig normal.“
Ich bedachte sie mit einem belustigten Blick, da ich unseren Gast weder vor den Kopf stoßen noch ein Bild der Schwäche abgeben wollte. Ich hatte dem Soldaten gerade gesagt, dass seine Königin nie irgendwelche Verbündeten gewinnen würde, aber seine Bemerkung über ihre Verhandlungen mit dem Espen- und dem Weidenland war mir nicht entgangen. Katrice und ich waren in diesem Krieg beide sehr um Verbündete bemüht. Dorian war der meine, was mir im Moment einen zahlenmäßigen Vorteil verschaffte, und ich wollte jedes Risiko vermeiden, dass sich daran etwas änderte.
Dorian fing meinen Blick und schenkte mir wieder einmal sein kleines, lakonisches Lächeln. Es erfüllte mich mit Wärme und verringerte meinen Frust etwas. An manchen Tagen schien einzig Dorian mich durch diesen Krieg zu bringen, in den ich unabsichtlich hineingestolpert war. Ich hatte den Krieg nicht gewollt. Ich hatte auch nie Königin eines magischen Reichs werden und dazu gezwungen sein wollen, meine Zeit zwischen hier und meiner menschlichen Existenz in Tucson aufzusplitten. Ich hatte definitiv nicht im Zentrum einer Prophezeiung stehen wollen, der zufolge ich den Eroberer der Menschheit zur Welt bringen würde; eine Prophezeiung, die Katrices Sohn dazu getrieben hatte, mich zu vergewaltigen. Dorian hatte ihn dafür getötet, was ich nach wie vor richtig fand, obwohl ich jeden Tag des Krieges hasste, der auf diesen Tod gefolgt war.
Von alldem durfte ich natürlich Ranelle nichts erzählen. Sie sollte einen Eindruck von Zuversicht und Stärke mit in ihr Land zurücknehmen, damit ihr König es für einen klugen Schachzug hielt, sich mit uns zu verbünden. Für einen brillanten Schachzug am besten. Ich durfte Ranelle nichts von meinen Befürchtungen sagen. Ich durfte ihr nicht sagen, wie sehr mich der Anblick der Flüchtlinge schmerzte, die mein Schloss aufsuchten; arme Bittsteller, deren Heimatdörfer durch den Krieg zerstört worden waren. Ich durfte ihr nicht sagen, dass Dorian und ich abwechselnd unsere Truppen besuchten und mit ihnen in den Kampf zogen– und dass derjenige, der gerade nicht kämpfte, in diesen Nächten keinen Schlaf fand. Mir war klar, dass Dorian trotz seiner lässigen Art auf die Behauptung des Soldaten mit einem Anflug von Besorgnis reagiert hatte. Katrice versuchte ständig, uns zu demoralisieren. Wir fürchteten beide den Tag, an dem einer ihrer Herolde aufkreuzen und es nicht mit einem Bluff würde versuchen müssen. Was dazu führte, dass ich am liebsten auf der Stelle mit Dorian durchgebrannt wäre, um das alles hinter uns zu lassen und mich einfach nur in seine Arme zu kuscheln.
Aber genau solche Gedanken musste ich wegschieben. Ich beugte mich zu Dorian hinüber und gab ihm einen sanften Kuss auf die Wange. Das Lächeln, mit dem ich Ranelle bedachte, war auch nicht weniger gewinnend und optimistisch als seines immer. „Also eigentlich“, erklärte ich, „ist das für uns ein ganz normaler Tag.“
Das Traurige daran? Es stimmte.
KAPITEL 2
Sobald die Etikette es zuließ, zog ich mich auf mein Zimmer zurück und ließ mich prompt aufs Bett fallen. Dorian war mitgekommen, und ich legte mir einen Arm über die Augen und ächzte.
„Was meinst du, hilft diese Szene eben dabei, Ranelle auf unsere Seite zu ziehen, oder wirkte sie eher abstoßend?“
Ich spürte, wie Dorian sich neben mir auf das Bett setzte. „Schwer zu sagen. Zumindest glaube ich nicht, dass sich ihr König nun gegen uns stellen wird. Dafür sind wir zu beängstigend und zu wenig berechenbar.“
Ich lächelte und nahm den Arm vom Gesicht, sah in diese grün-goldenen Augen. „Wenn sich dieser Ruf nur überallhin verbreiten würde. Ich habe gerüchteweise gehört, dass sich das Jelängerjelieberland vielleicht mit Katrice verbündet. Ehrlich, wie man sein Land so nennen kann, ohne mit der Wimper zu zucken, ist mir ein Rätsel.“
Dorian beugte sich über mich, strich mir ein paar Haare aus dem Gesicht und fuhr mit den Fingern meinen Wangenknochen entlang. „Es ist eigentlich sehr schön dort. Tropisch beinahe. Kein Vergleich natürlich zu dem kargen Ödland eines Wüstenkönigreichs, aber so schlimm nun auch wieder nicht.“
Ich war seine Spötteleien über mein Königreich inzwischen dermaßen gewöhnt, dass sie fast etwas Tröstliches hatten. Seine Finger wanderten zu meinem Hals hinunter und wurden rasch durch seine Lippen ersetzt. „Ehrlich, dieses Jelängerjelieberland bereitet mir keine Sorgen. Da gibt es ganz andere potenzielle Verbündete. Hey, lass das.“ Seine Lippen waren zu meinem Schlüsselbein weitergewandert, und mit der Hand schob er gerade mein Shirt hoch. Ich entwand mich ihm. „Ich hab keine Zeit.“
Er hob den Kopf und zog überrascht eine Augenbraue hoch. „Musst du noch irgendwohin?“
„Ja, genau das.“ Ich seufzte. „Ich hab einen Job drüben in Tucson. Außerdem bin ich völlig verdreckt.“
Davon ließ sich Dorian nicht abschrecken. Er versuchte erneut, mir das Shirt auszuziehen. „Ich helf dir beim Waschen.“
Ich schlug seine Hand weg, aber dann zog ich ihn näher, damit ich meine Arme um ihn legen und ihn an mich pressen konnte. Mir war klar, dass er auf mehr als Kuscheln aus war, aber dafür fehlte mir die Energie. In Anbetracht seines pingeligen Naturells überraschte es mich, dass er bereitwillig den Kopf auf meine Brust legte, wo mein Shirt doch dermaßen verdreckt und zerrissen war.
„Nichts für ungut, aber ich ziehe eine Dusche jederzeit einem Badezuber vor, für den erst ein Diener das Wasser anschleppen muss.“
„Du kannst erst gehen, wenn du mit Ranelle gesprochen hast“, stellte er klar. „Und so kannst du dich nicht mit ihr treffen.“
Ich verzog das Gesicht und strich mit der Hand über sein schimmerndes Haar. „Verdammt.“ Er hatte recht. Ich hatte dieses ganze Regierungszeug immer noch nicht drauf, aber es stimmte: Wenn ich die Hilfe des Lindenkönigs wirklich wollte, dann waren gutes Aussehen und gute Argumente angesagt. So viel zu tun. Und nie genug Zeit. Ermüdend, das Ganze.
Dorian hob den Kopf und sah zu mir. „War es schlimm?“
Damit meinte er die Schlacht der vergangenen Nacht. „Schlimm ist es immer. Ich kann mich einfach nicht damit anfreunden, dass andere für mich kämpfen, für mich sterben. Und das nur wegen einer Demütigung.“ Auch die Lebenden hatten unter diesem Krieg zu leiden. Ständig kamen Flüchtlinge und baten um Nahrung und Schutz.
„Ihr Königreich steht auf dem Spiel“, sagte er. „Ihre Heimat. Und das war weit mehr als eine Demütigung. Das Ganze auf sich beruhen zu lassen hätte das Dornenland schwach aussehen lassen– wie Beute. Damit hättest du zu einer Invasion eingeladen, was mit einer Kapitulation gleichzusetzen ist. Dein Volk möchte das nicht. Es muss kämpfen.“
„Aber warum kämpft deines?“
Dorian sah mich an, als wäre diese Frage völlig abwegig. „Weil ich es ihm sage.“
Ich beließ es dabei und wies einen Diener an, mir den Badezuber in der Kammer nebenan zu füllen. Diese anstrengende Arbeit trug ich niemandem gern auf, auch wenn Dorian zweifellos argumentiert hätte, dass es eben zu ihren Aufgaben zählte. Die Magie, die ich von meinem Vater, dem Tyrannen, geerbt hatte, verlieh mir Gewalt über die Sturmelemente; also hätte ich das Wasser direkt in den Zuber rufen können, anstatt es von meiner Dienerschaft eimerweise hier heraufschaffen zu lassen. Aber das Dornenland war dermaßen trocken, dass das Heraufbeschwören solcher Wassermengen sowohl die Luft im Schloss noch mehr ausgetrocknet und wahrscheinlich sogar die umliegende Vegetation hätte absterben lassen.
Die Dienerschaft hatte einen eigenen Zugang zum Bad, und kaum hörten wir sie schleppen und plätschern, da grinste Dorian und zog mich zurück aufs Bett. „Siehst du? Jetzt haben wir Zeit.“
Ich protestierte nicht noch mal. Und als wir unsere Kleidung los waren und ich die Hitze seiner Lippen spürte, musste ich zugeben, dass ich nichts gegen Sex einzuwenden hatte, nicht ernsthaft. Wir riskierten bei diesem Krieg ständig unser Leben, und Dorian hatte sich Sorgen um mich gemacht. Mich jetzt hier zu haben und sich körperlich mit mir zu vereinigen, damit vergewisserte er sich wohl, dass mir wirklich nichts passiert war. Und mir tat es auch gut, mit dem Mann zusammen zu sein, in den ich mich gegen jede Vernunft verliebt hatte. Früher hatte ich die Feinen gefürchtet und gehasst– entsprechend lange hatte ich gebraucht, bis ich Dorian vertraute.
Der Sex war überraschend zahm für unsere Verhältnisse. Sonst landeten wir immer bei schlimmen, versauten Sachen, wo Sex ein Spiel um Macht und Kontrolle war, das ich gleichzeitig toll fand und pervers. Nun saß ich auf ihm und schlang ihm die Beine um die Hüften, nahm ihn in mich auf. Ein seliger Seufzer entfuhr seinen Lippen, und als ich anfing, mich langsam zu bewegen und ihn zu reiten, schlossen sich seine Augen. Einen Moment später hoben sich seine Lider wieder, und er sah mir mit solcher Liebe und Lust in die Augen, dass mir ganz anders wurde.
Es erstaunte mich jedes Mal, dass er mich so begehrenswert fand. Ich hatte einige seiner früheren Geliebten gesehen– erotische, kurvenreiche Frauen, die an klassische Hollywoodschönheiten erinnerten. Mein Körper war schlank und sportlich von der ganzen Action ständig; meine Brüste besaßen eine ziemlich schöne Form– waren aber kaum Pornostarmaterial. Und doch hatte er, seit wir vor ein paar Monaten offiziell ein Paar geworden waren, keine andere Frau mehr angeguckt. Er hatte nur Augen für mich, und sein Blick war sogar in völlig unromantischen Momenten hungrig.
Ich erhöhte mein Tempo, beugte mich vor und schaukelte uns, sodass sich mehr von meinem Körper an ihm rieb, was mich dichter an den Orgasmus brachte. Kurz darauf kam ich, meine Lippen teilten sich lautlos, als mich eine süße Ekstase schüttelte und jeder Nerv in meiner Haut zu entflammen schien. Ich beugte mich vor, küsste ihn, ließ seine Zunge meinen Mund erkunden, während seine Finger meine Nippel streichelten.
Plötzlich öffnete sich die Tür zum Bad, und ich riss den Kopf hoch. Eine Dienerin schaute herein. „Eure Majestät? Das Bad ist bereit.“ Sie sagte es ganz sachlich und verschwand so schnell, wie sie gekommen war. Dass ich nackt über Dorian kauerte, war für sie anscheinend keine große Sache– und war es ja wahrscheinlich auch nicht. Die Feinen hatten eine wesentlich lockerere Sexualmoral als Menschen; öffentliche Zurschaustellungen waren etwas ganz Normales. Es wäre ihr wahrscheinlich viel merkwürdiger vorgekommen, wenn ihre Monarchen nicht gleich beim ersten Wiedersehen zur Sache gekommen wären.
An diesen lockeren Umgang mit Sex hatte ich mich noch nicht gewöhnt, und Dorian wusste das. „Nein, nein“, sagte er, als er spürte, dass ich vor Schreck langsamer wurde. Die Hände, die meine Brüste hielten, wanderten zu meinen Hüften. „Lass uns das erst zu Ende bringen.“
Ich riss meinen Blick von der Tür los, wandte meine Aufmerksamkeit wieder ihm zu und spürte, wie die Erregung zurückkehrte. Er rollte mich herum und hielt sich jetzt, wo ich gekommen war, nicht mehr zurück. Er drängte sich gegen mich, stieß so hart und schnell in mich hinein, wie er konnte. Momente später durchlief ihn ein Beben, und seine Finger gruben sich in meine Arme, an denen er mich gehalten hatte. Ich liebte es, ihm dabei zuzusehen, liebte es zu sehen, wie dieser süffisante, selbstsichere König zwischen meinen Schenkeln die Kontrolle verlor. Als er fertig war, gab ich ihm noch einmal einen langen, innigen Kuss, dann ließ ich mich neben ihn gleiten.
Er atmete zufrieden aus und sah mich wieder mit dieser Mischung aus Begierde und Liebe an. Er sagte es nie, aber ich wusste, dass er immer heimlich hoffte, dass ich irgendwie, irgendwann schwanger werden würde, wenn wir miteinander schliefen. Ich hatte ihm hundertmal erklärt, wie die Pille funktionierte, aber die Feinen hatten Schwierigkeiten mit dem Kinderkriegen und waren entsprechend fixiert darauf. Dorian behauptete, ein Kind nur um unseretwillen zu wollen, aber die Prophezeiung, dass mein erstgeborener Sohn die Menschenwelt erobern würde, verlockte ihn natürlich auch. Mir gefiel diese Vorstellung natürlich überhaupt nicht– darum mein Beharren auf Verhütungsmitteln. Dorian hatte sich mir zuliebe angeblich von diesem Traum verabschiedet, aber es gab Tage, da hatte ich den Verdacht, dass er auch nichts dagegen einzuwenden hätte, einen solchen Eroberer zu zeugen. Tatsächlich machte uns unsere Allianz jetzt schon gefährlich. Er liebte mich, da war ich mir sicher, aber er strebte auch nach Macht. Die Vereinigung unserer Königreiche stellte, wenn wir wollten, eine gute Ausgangslage für die Eroberung weiterer Reiche dar.
Es fiel mir schwer, ihn zu verlassen, aber es gab zu viel zu erledigen. Ich zog mich ins Bad zurück und wusch mir sowohl den Sex als auch die Schlacht ab. Leben und Tod. Der Zuber war nur groß genug für eine Person, aber Dorian schien völlig damit zufrieden, mir zuzusehen und die Trägheit danach zu genießen. Die Kleidung, die ich auswählte, begeisterte ihn weniger. Als Königin besaß ich einen ganzen Schrank voller aufwendiger Kleider, in denen er mich sehr gern sah. Als Schamanin hatte ich dafür gesorgt, dass es auch Menschenkleidung gab. Er musterte meine Jeans und mein Tanktop mit Bestürzung.
„Ein Kleid dürfte mehr Eindruck auf Ranelle machen“, sagte er. „Vor allem eines, das dein hübsches Dekolleté zur Geltung bringt.“
Ich verdrehte die Augen. Wir befanden uns wieder im Schlafzimmer, und ich rüstete mich gerade mit Waffen aus: mit magisch aufgeladenem Schmuck und einem Eisenathame, dazu noch einen Rucksack, der eine Pistole, einen Zauberstab und ein Silberathame enthielt. „Eindruck auf dich, meinst du wohl. Was jetzt eh Verschwendung wäre.“
„Stimmt nicht.“ Er stand vom Bett auf, immer noch nackt, und schob mich sanft gegen die Wand zurück, wobei er auf die scharfe Klinge des Athame aufpasste. „Ich bin schon wieder so weit.“
Das merkte ich, und ehrlich gesagt hätte ich auch nichts dagegen gehabt, wieder ins Bett zu steigen. Ob aus Begierde oder weil ich meinen Pflichten ausweichen wollte, war schwer zu sagen.
„Später.“ Ich hauchte ihm einen Kuss auf die Lippen.
Er sah mich misstrauisch an. „Später kann bei dir alles Mögliche heißen. Eine Stunde. Ein Tag.“
Ich lächelte und küsste ihn erneut. „Höchstens ein Tag.“ Ich überlegte. „Oder vielleicht zwei.“ Das Gesicht, das er zog, brachte mich zum Lachen. „Ich werde sehen, was ich tun kann. Jetzt zieh dir etwas an, bevor du die Frauen hier zur Raserei bringst.“
Er bedachte mich mit einem vorwurfsvollen Blick. „Ich fürchte, das wird sich auch in bekleidetem Zustand nicht vermeiden lassen, meine Teure.“
Als wir uns schließlich voneinander lösen konnten, machte ich mich auf den Weg zu Ranelles Gemächern. Meine postkoitale gute Stimmung verflog rasch. Ein bisschen Luftmagie sorgte dafür, dass meine Haare einigermaßen trocken waren, als ich dort ankam. Ich fand Ranelle am Schreibtisch vor, wo sie mit einem Brief beschäftigt war. Als sie mich sah, sprang sie auf und machte einen Knicks.
„Eure Majestät.“
Ich bedeutete ihr, sich wieder zu setzen, und zog mir einen Stuhl heran. „Lasst gut sein. Ich wollte nur kurz mit Euch reden, bevor ich in die Menschenwelt zurückkehre.“ In ihrem Gesicht tat sich etwas, aber als erfahrene Gesandte kam sie anscheinend rasch über die Befremdung hinweg, die meine Bemerkung wohl auslöste. Für Feine war die Leichtigkeit, mit der ich zwischen den Welten hin- und hersprang, nicht normal. „Die grässliche Szene heute früh tut mir leid. Und dass ich während Eures Besuchs nur so kurz da gewesen bin.“
„Ihr befindet Euch im Krieg, Majestät. Da lässt sich so etwas kaum vermeiden. Überdies hat mich König Dorian während Eurer Abwesenheit sehr gastlich aufgenommen.“
Ich verkniff mir ein Schmunzeln. In Raserei war Ranelle zwar nicht verfallen, aber es lag auf der Hand, dass sie Dorians Charme erlegen war, wie so viele Frauen. „Da bin ich froh. Schreibt Ihr gerade Eurem König?“
Sie nickte. „Ich wollte ihm meinen Bericht sofort schicken, auch wenn ich ohnehin heute noch abreise.“
Die Feinen waren wie die Anderswelt voller Magie, und manche besaßen die Fähigkeit, Nachrichten zu übermitteln. Magische E-Mails sozusagen. Das sorgte dafür, dass Klatsch schnell die Runde machte, und auch Ranelles Brief würde lange vor ihr in ihrer Heimat ankommen. Ich warf einen Blick auf die Zeilen auf dem Tisch.
„Was werdet Ihr ihm sagen?“
Sie zögerte. „Darf ich offen sein, Eure Majestät?“
„Selbstverständlich.“ Ich schmunzelte. „Ich bin ein Mensch. Jedenfalls ein halber.“
„Ich fühle mit Euch. Ich verstehe Euren Groll und weiß, dass es König Damos ebenso gehen wird.“ Sie vermied sorgfältig jede deutliche Angabe, dass Leith mich vergewaltigt hatte. „Aber so tragisch Eure Lage auch ist… es bleibt eben Eure Lage. Ich glaube nicht, dass wir dafür das Leben unserer Soldaten riskieren sollten– bitte vielmals um Verzeihung, Eure Majestät.“ Schlechte Neuigkeiten zu überbringen machte sie nervös. Mein Vater, ehrenhalber auch der Sturmkönig genannt, war für seine große Macht und Grausamkeit bekannt gewesen. Ich war nicht so hart drauf, aber den einen oder anderen gruseligen Machtbeweis hatte ich auch schon geliefert.
„Ich nehme Euch das nicht übel“, versicherte ich ihr. „Aber… wenn ich ebenso offen sein darf, Euer König ist in einer prekären Lage. Er wird langsam alt. Seine Macht wird schließlich nachlassen. Dann ist Euer Königreich allen, die es sich holen wollen, schutzlos preisgegeben.“
Ranelle erstarrte. Die Länder der Anderswelt banden sich an jeden, der die Macht besaß, sie für sich zu beanspruchen. „Droht Ihr uns, Majestät?“, fragte sie leise.
„Nein. Ich habe kein Interesse an einem zusätzlichen Königreich– erst recht nicht an einem, das so weit entfernt ist.“ Die Entfernung spielte in der Anderswelt keine große Rolle, aber zum Lindenland brauchte man schon ein wenig länger als etwa zum Vogelbeerland oder zu Dorians Eichenland.
„Das mag sein“, sagte sie unsicher. „Doch ist es kein Geheimnis, dass König Dorian seinen Machtbereich gern ausweiten würde. Darum hat er Euch ja zur Gefährtin genommen, nicht wahr?“
Nun erstarrte ich. „Nein. Darum geht es überhaupt nicht. Keiner von uns hat Interesse an Eurem Land. Aber Eure Nachbarn– oder einige Eurer Landsleute selbst– wahrscheinlich schon. Nach allem, was ich gehört habe, hätte Damos gern seine Tochter als Thronfolgerin.“
Ranelle nickte langsam. Die Thronfolge wurde durch die Macht festgelegt, nicht durch das Blut. Aber die meisten Monarchen wünschten sich dennoch Nachfolger aus der eigenen Familie– wenn sie schon das Glück hatten, überhaupt Kinder zu haben. Ich bedachte Ranelle mit einem wissenden Lächeln.
„Ob sie das Land beherrschen kann, hängt natürlich von ihrer eigenen Macht ab. Aber wenn Damos uns jetzt helfen würde, könnten wir sicher später Beistand leisten, gegen jedweden… Thronräuber, der darauf baut, das Lindenland für sich beanspruchen zu können.“
Ein Attentat, ein ausgewachsener Krieg. Die Methode war nicht so wichtig wie meine Aussage an sich. Ranelle schwieg, ließ sich das zweifellos durch den Kopf gehen. War ein solches Versprechen es wert, ihre Heere auszuschicken? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, dass ihr König darüber nachdachte.
„Und darüber hinaus“, fügte ich beiläufig hinzu, um uns von diesem gefährlichen Thema wegzubringen, „würde ich mich freuen, mit Eurem König in Verhandlung über äußerst günstige Handelsvereinbarungen zu treten.“
Womit ich meinte, dass meine Leute verhandeln würden. Ich konnte Wirtschaftsfragen und Handelspolitik nicht ausstehen. Aber mein Königreich war heiß, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Es Arizona nachzuformen hatte zu harten Lebensbedingungen geführt– aber auch reichhaltige Kupferlager mit sich gebracht. In einer Welt, die nicht mit Eisen umgehen konnte, war Kupfer das wichtigste Metall.
Ranelle nickte erneut. „Ich verstehe. Ich werde ihn darauf aufmerksam machen.“
„Gut.“ Ich stand auf. „Ich muss jetzt leider gehen, aber wenn Ihr noch irgendetwas braucht, dann lasst es mein Personal wissen. Und richtet Damos meine Grüße aus.“
Ranelle versicherte mir, dass sie das tun würde, und ich verließ sie, wobei ich ziemlich zufrieden mit mir war. Ich mochte solche diplomatischen Gespräche beinahe ebenso wenig wie Handelsgespräche, vor allem wegen meiner mangelnden Kompetenz. Aber dieses war gut gelaufen, und selbst wenn sich das Lindenland uns nicht anschloss, war ich sicher, dass Dorian recht hatte: Gegen uns in den Krieg ziehen würde es auch nicht.
Ich ging gerade Richtung Ausgang, da ich vorhatte, das nächstgelegene Tor zurück zur Menschenwelt zu nehmen, als ich an einem bestimmten Gang vorbeikam. Ich zögerte, starrte ihn hinunter und kämpfte mit mir. Dann verzog ich das Gesicht, änderte mein Ziel und bog um die Ecke. Der Raum, zu dem ich wollte, war leicht zu finden, da zwei Wachsoldaten davorstanden. Sie gehörten zu Dorians Truppen, was Absicht war, denn wenn schon jemand den Thronerben des Sturmkönigs zeugen sollte, dann doch bitte ihr Herr. Und alle Welt wusste, dass ich die Mutter war, die ihm vorschwebte, und nicht die Bewohnerin dieses Raumes.
Der eine Soldat klopfte an und öffnete die Tür einen Spaltbreit. „Die Königin ist hier.“
Ich brauchte in meinem Schloss nicht erst eine Erlaubnis, um einen beliebigen Raum zu betreten, wartete aber trotzdem die Antwort ab.
„Komm rein.“ Jasmine saß im Schneidersitz auf dem Bett und versuchte sich an einer Art Stickerei. Als sie mich erblickte, warf sie die Handarbeit genervt beiseite. „Das ist das Blödeste, was ich je gemacht habe. Ich wünschte, die Glanzvollen hätten Hobbys, die mehr Spaß machen. Ich wünschte, ich könnte reiten gehen.“
Den letzten Satz sprach sie mit wissendem Unterton, und ich ersparte mir eine Antwort. Jasmine stand unter Hausarrest, und ich ließ definitiv keine Aktivität zu, bei der die Gefahr bestand, dass sie den Wachen entwischte. Ich hob das grüne Stück Samt auf, an dem sie gearbeitet hatte, und sah mir die Stickerei an.
„Goldfisch?“
„Narzissen!“, rief sie.
Ich legte die Handarbeit rasch wieder hin. Ehrlich, angesichts der locker sitzenden Eisenketten um Jasmines Handgelenke war es schon beeindruckend, dass sie überhaupt sticken konnte.
„Ich gehe wieder rüber nach Tucson“, sagte ich. „Und wollte vorher mal sehen, wie’s dir so geht.“
Sie zuckte die Achseln. „Alles okay so weit.“
Trotz ihres jungen Alters hatte sie mit dem Thronerben des Sturmkönigs schwanger werden wollen– und wollte es vermutlich immer noch. Die Prophezeiung legte sich da nicht fest. Sie besagte bloß, dass der erstgeborene Enkel des Sturmkönigs der Eroberer werden würde. Das machte es zu einem Wettlauf zwischen uns beiden– nur dass ich nicht mitspielte. Ihr Zwangsaufenthalt hier stellte sicher, dass bei ihr auch nichts draus wurde. Anfangs hatte sie mich dafür gehasst, aber seit Kriegsbeginn hielt sie sich zurück. Sie betrachtete Leiths Untat als Affront gegen unsere Familie. Ein abstruser Gedankengang, gegen den ich aber nichts einzuwenden hatte, weil mir dadurch ihre Wutanfälle erspart blieben.
„Ähm… brauchst du irgendwas?“ Eine blödere Frage konnte man jemandem, der seine Freiheit wollte, kaum stellen.
Sie zeigte auf den iPod, der neben ihr lag. „Er muss mal wieder aufgeladen werden.“ Er musste ständig wieder aufgeladen werden. Was nichts mit den normalen Akku-Laufzeiten zu tun hatte; die Anderswelt schadete Elektrogeräten. „Und ein paar Bücher oder Zeitschriften. Für einen Fernseher könnte ich töten.“
Der überstieg meine Fähigkeiten. Ich schmunzelte. „Ich manchmal auch, wenn ich hier bin.“
„Wie lief es denn mit der Lindenlady? Helfen sie uns, Katrice fertigzumachen?“ Jasmine guckte plötzlich nicht mehr kläglich, sondern aggressiv. Sie besaß vergleichbare Kräfte wie ich, zwar nicht im gleichen Ausmaß, aber es ließ sich jede Menge Unheil damit anrichten. Wenn ich Jasmine losließ, marschierte sie wahrscheinlich schnurstracks ins Vogelbeerland und versuchte, das Schloss zum Einsturz zu bringen.
„Keine Ahnung. Viel Hoffnung mache ich mir nicht.“
In Jasmines graue Augen trat ein berechnender Blick, der sie klüger aussehen ließ, als sie mit ihren fünfzehn Jahren hätte sein dürfen. „Solange ihr beiden zusammenbleibt, Dorian und du, ist mit euch nicht zu spaßen– vor allem mit dir nicht.“ Überraschenderweise lag diesmal kein Spott in ihrer Stimme. „Aber ihr müsst aufpassen, dass Maiwenn sich nicht Katrice anschließt. Dir ist klar, dass sie darüber nachdenkt.“
Jawohl, so schmollend und kindisch Jasmine auch oft drauf war, sie hatte Köpfchen. „Das stimmt. Aber darüber nachdenken und es tun sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wie du selber sagst: Mit Dorian und mir ist nicht zu spaßen. Ich glaube nicht, dass sie sich mit uns anlegen möchte.“
Es hatte etwas Tröstliches, mit jemandem reden zu können, der nicht ständig die förmliche Sprechweise der Feinen benutzte.
„Wahrscheinlich nicht. Aber sie hat einen Riesenschiss, dass du Vaters Thronerben zur Welt bringst.“ Sie sah mich aufmerksam an. „Du hast deine Meinung doch nicht geändert, oder? Oft genug zugange seid ihr zwei jedenfalls.“
„Das geht dich nichts an.“ Ich fragte mich, ob diese Dienerin bereits herumerzählte, was sie vorhin gesehen hatte.
„Sag das mal Dorian. Der prahlt doch ständig damit rum.“
Ich ächzte. Das stimmte garantiert. „Na ja, jedenfalls werde ich so bald keine Kinder kriegen.“
„Solltest du aber. Oder lass mich machen. Dann würde Katrice sofort klein beigeben.“
„Und Maiwenn sich wirklich gegen uns stellen.“ Maiwenn herrschte über das Weidenland und wollte erklärtermaßen verhindern, dass die Prophezeiung in Sachen Sturmkönig eintraf. Sie hatte auch noch ein paar andere Gründe, meine Allianz mit Dorian nicht gutzuheißen– oder besser, ihre Mitstreiter hießen sie nicht gut.
„Ja, gut“, sagte Jasmine. „Aber dann verpasst du ihr eben einen ordentlichen Arschtritt.“
Ich stand auf und schnappte mir den iPod, verstaute ihn in meinem Rucksack. „Kümmern wir uns mal um einen Arschtritt nach dem anderen.“
Verlegene Stille machte sich breit. Wie merkwürdig, dass wir eben ein ganz normales Gespräch gehabt hatten. Ich war als Einzelkind aufgewachsen und hatte mir manchmal eine Schwester gewünscht. Nun hatte ich eine, und sie erfüllte meine Erwartungen überhaupt nicht; aber vielleicht war das auch besser so.
„Tja“, sagte ich schließlich. „Ich bin bald wieder zurück.“
Sie nickte, griff nach ihrer Handarbeit und starrte darauf, als hätte das Teil sie persönlich beleidigt. Ich war fast schon bei der Tür, als sie plötzlich fragte: „Eugenie?“
Ich sah mich um. „Ja?“
„Bringst du mir Twinkies mit?“
Ich schmunzelte. „Klar.“
Sie sah nicht von ihrer Stickerei auf, aber ich war mir fast sicher, dass sie auch schmunzelte.
KAPITEL 3
Gut, ich hatte mich allmählich damit angefreundet, Königin des Dornenlands zu sein, und man fühlte sich zwangsläufig zu einem Ort hingezogen, mit dem man spirituell verbunden war. Trotzdem kam nichts, was die Anderswelt zu bieten hatte, an mein Zuhause in Tucson ran. Das Haus war klein, lag aber in einer netten Gegend nördlich der Stadt, in der Nähe der Catalina Mountains. Tore zwischen den Welten gab es überall, was das Reisen erleichterte, aber ich besaß zu Hause einen „Anker“, was bedeutete, dass ich, wenn ich in der Anderswelt durch ein Tor trat, direkt in meinem Schlafzimmer wieder rauskommen konnte. Als Anker konnte jeder Gegenstand dienen, der mit der eigenen Essenz verbunden war.
Mein Mitbewohner Tim, der mich ein paar Tage nicht gesehen hatte, bekam verständlicherweise einen Schreck, als ich in die Küche spazierte.
„Himmel, Eug!“ Er stand am Herd und wendete gerade einen Pancake. „Wir müssen dir wirklich mal ein Glöckchen um den Hals hängen oder so.“
Ich grinste und hatte das unerklärliche Bedürfnis, ihn zu umarmen– wobei ich wusste, dass er dann erst recht ausgeflippt wäre. Nach den ganzen Verrücktheiten der Anderswelt war seine Normalität ein willkommener Anblick. Na ja, Normalität in Anführungszeichen. Tim war ein großer, dunkelhaariger und gut aussehender Mann und irgendwann auf die Idee gekommen, sich– mehr schlecht als recht– als Indianer auszugeben, um Frauen aufreißen und den Leuten seine schrecklichen Gedichte andrehen zu können. Er spielte diverse Stämme durch und hatte sich meines Wissens zuletzt als Tlingit ausgegeben, weil es die hiesigen Indianer weniger nervte, wenn er in das Outfit eines Stammes schlüpfte, der etliche Hundert Kilometer entfernt lebte. Ich konnte froh sein, dass er heute nur ganz normal Jeans und T-Shirt trug.
„Machst du genug für zwei?“ Ich steuerte gleich mal die volle Kaffeekanne an. Er wohnte mietfrei bei mir, übernahm dafür aber Kochen und Hausarbeit.
„Ich mache immer genug für zwei. Aber das meiste landet im Müll.“ Den letzten Satz grummelte er. Früher hatte er sich darüber beschwert, mein „Sklave“ zu sein; jetzt fehlte ich ihm.
„Irgendwelche Nachrichten?“
„An der üblichen Stelle.“
Ich ließ mein Handy bei Tim, wenn ich in die Anderswelt wechselte. Dadurch war er gezwungen, meine Sekretärin zu spielen, was er nicht ausstehen konnte, zumal ich bereits eine beschäftigte. Tatsächlich stammten die meisten Nachrichten, die er auf die weiße Kühlschrankfläche gekritzelt hatte, von ihr.
Di 11:00– Lara: zwei Jobangebote
Di 14:30– Lara: potenzieller Klient braucht schnellstmöglich Hilfe
Di 17:15– Lara: möchte dich immer noch sprechen
Di 17:20– Lara: braucht dich für die Steuern
Di 22:30– Lara: ruft ständig an
Mi 8:00– Lara: wer klingelt Leute denn dermaßen früh raus?
Mi 11:15– Miststück
Mi 11:30– Sams Renovierservice: interessiert an Fassadenverkleidungaus Vinyl?
Ich fand es toll, wie genau er alles aufschrieb– von seinen Kommentaren mal abgesehen–, aber es versetzte mir einen Stich, wenn ich sah, wer auffallend fehlte. Jedes Mal, wenn ich heimkam, hoffte ich insgeheim, ihre Namen dort zu finden. Meine Mutter erkundigte sich manchmal heimlich, still und leise nach mir. Aber mein Stiefvater, Roland? Er rief überhaupt nicht mehr an, seit er von meiner Verbundenheit mit der Anderswelt erfahren hatte.
Tim war mit Kochen beschäftigt und sah mein Gesicht nicht. „Ich verstehe nicht, warum sie immer wieder anruft. Sie weiß doch, dass du ihre Nachrichten nicht bekommen kannst. Warum muss sie dann mehr als eine hinterlassen? Es ist ja nicht so, dass die hundertste dann auf magische Weise zu dir durchdringt.“
„So ist sie eben. Sie ist effizient.“
„Das ist nicht effizient. Das hat was vom Borderlinesyndrom an sich.“
Ich seufzte und fragte mich nicht zum ersten Mal, ob ich Anrufe nicht lieber an die Mailbox gehen lassen sollte. Obwohl sie sich nie kennengelernt hatten, waren Tim und Lara telefontechnische Todfeinde. Ihre abfälligen Bemerkungen übereinander ödeten mich an. Allein schon beim Anblick dieser protokollierten Anrufe schlief ich fast ein. Früher hatte ich mal ein florierendes Geschäft als Schamanin fürs Grobe gehabt, hatte also Geister und andere nervtötende übernatürliche Wesen rausgeworfen, wenn sie Menschen belästigten. Jetzt, wo ich Schwarzarbeit als Feenkönigin machte, war ich in der Auswahl meiner Klienten viel wählerischer geworden. Ich konnte mit der hiesigen Nachfrage nicht mehr mithalten, und das bereitete mir ein schlechtes Gewissen. Vermutlich übernahm Roland alles, was ich nicht schaffte, aber sicher war das nicht.
Ich zögerte es bis nach dem Frühstück hinaus, mich mit Lara zu beschäftigen. Pancakes, Würstchen und Kaffee gaben mir die Kraft, mit diesem neuesten Packen Anfragen umzugehen. Da Lara meine Nummer zweifellos auf dem Display sah, hielt sie sich nicht mit Formalitäten auf, als ich endlich anrief.
„Wurde ja auch Zeit“, rief sie. „Hat er Ihnen meine Nachrichten ausgerichtet?“
„Gerade eben. Ich war für drei Tage weg. Sie wissen doch, dass Sie ihn dann nicht weiter piesacken müssen.“
„Ich wollte sicherstellen, dass Sie auch erfahren, dass ich angerufen habe.“
„Er schreibt jeden Anruf auf, jeden einzelnen. Und meine Liste der entgangenen Anrufe sagt mir auch, dass Sie sich gemeldet haben… immer wieder.“
„Hmph.“ Sie beließ es dabei. „Also, Sie kriegen in der letzten Zeit jede Menge Anfragen. Ich habe sie schon ausgedünnt, aber Sie werden trotzdem auswählen müssen.“
Es war fast Februar. Weit und breit keine größeren Hochfeste in Sicht, bei denen die paranormalen Aktivitäten immer zunahmen. Aber manchmal geschah das auch ohne Grund. Anscheinend hatten wir gerade so eine Phase– ausgerechnet, wo ich mitten in einem Krieg steckte. Oder, wurde mir klar, vielleicht geradedeshalb. Meine Doppelrolle als Königin und Schamanin hatte sich herumgesprochen. Vielleicht bauten sie darauf, ihre Ziele besser durchsetzen zu können, während ich abgelenkt war. Zur Hälfte kreuzten sie aus eigennützigen Gründen in unserer Welt auf, zur Hälfte wollten sie mir mit Gewalt ein Kind machen, den Erben des Sturmkönigs.
„Na schön“, sagte ich. „Das Wichtigste zuerst.“
„Wir müssen Ihre Steuern fertig machen.“
„Das ist nicht das Wichtigste. Weiter.“
„Alleinstehende Frau, die von einem Fetch verfolgt wird.“
„Das ist ernst. Darum muss ich mich kümmern.“
„Baum-Elementar. In Ihrer Nachbarschaft.“
„Okay, der ist meinetwegen hier. Der wird niemandem was tun.“
„Phantomverseuchte neue Siedlung.“
„Ehemaliges Friedhofsgelände?“
„Ja.“
„Geben Sie ihnen einen Termin, und denken Sie dran, den doppelten Satz zu berechnen. Die sind selber dran schuld als Erschließungsfirma.“
„Alles klar. Dann hätten wir noch die üblichen schrägen Geschichten. Lichter am Himmel. Ein UFO wahrscheinlich.“
„War das wieder Will?“
„Ja.“
„Verdammt! Haben Sie ihm gesagt, dass es bloß das Militär ist?“
„Ja. Außerdem meinte er, es hätte ein paar Bigfoot-Sichtungen gegeben–“
Ich erstarrte. „Bigfoot? Wo?“
„Nach Einzelheiten habe ich nicht gefragt. Ich dachte, er spinnt wieder nur. Haben Sie nicht auch mal gesagt, dass es in Arizona keine gibt?“
„Gibt es auch nicht. War irgendwas Ungewöhnliches in den Nachrichten? Todesfälle?“
Ich hörte das Rascheln von Papier. „Drüben in Coronado sind zwei Wanderer verunglückt, in der Nähe vom Rappel-Rock-Wanderweg. Dem Bericht zufolge sind sie abgestürzt. Hat ein paar Tage gedauert, bis man ihre Leichen gefunden hat. Hässliche Geschichte. Irgendwelche Tiere waren früher da.“
Ich fuhr so schnell von meinem Stuhl auf, dass das Geschirr auf dem Küchentisch klirrte. Tim, der gerade in einer Zeitschrift blätterte, sah alarmiert auf.
„Rufen Sie Will an“, sagte ich zu Lara und versuchte, mir während des Telefonierens die Stiefel anzuziehen. „Stellen Sie fest, wo diese Bigfoot-Sichtungen gewesen sind, von denen er gehört hat. Wenn nicht in Coronado, rufen Sie mich zurück. Wenn doch, brauchen Sie sich nicht zu melden.“ Will war Jasmines Halbbruder, und ich vermied es nach Möglichkeit, selbst mit ihm zu reden. Einmal, weil er immer nach ihr fragte. Und außerdem war er ein durchgeknallter, paranoider Verschwörungstheoretiker. Diesmal lag er vielleicht richtig.
Lara war verständlicherweise entsetzt. „Aber Sie sagten doch, in Arizona gibt es keine–“
„Das ist auch kein Bigfoot.“
„Vergessen Sie mir bloß nicht Ihren anderen Auftrag heute Abend!“
„Keine Sorge.“
Ich legte auf und kümmerte mich um den anderen Stiefel. Tim beobachtete mich misstrauisch. „Gefällt mir nicht, wenn du diesen Blick kriegst.“
„Da sind wir schon zwei.“
Er sah zu, wie ich zu unserem Kleiderschrank im Flur ging und einen selten getragenen Ledermantel herausholte. „Du fährst nach Coronado?“
„Ja.“
„Ins Hochgebirge?“
„Ja.“
Er seufzte und zeigte zu unseren Schlüsselhaken bei der Tür. „Nimm meinen Wagen. Der kommt besser mit Schnee klar.“
Ich hängte mir meinen Rucksack über die Schulter und bedachte ihn mit einem dankbaren Lächeln. Er ermahnte mich, vorsichtig zu sein, aber ich war schon mit den Schlüsseln aus der Tür raus und ging zu seinem Subaru.
Ich nahm die Straße kaum wahr, als ich zum Coronado State Park fuhr. Bigfoot. Nein, da draußen fand man keinen Bigfoot, nicht einmal in den Catalinas. Nun sagen wir mal, es hätte eine Sichtung im Pazifischen Nordwesten gegeben? Oder irgendwo in Kanada? Aber hallo, dann wäre Jagdzeit auf Bigfoot. Aber hoch oben auf der Liste stünde das nicht. Die Viecher waren eigentlich harmlos.
Hier? Wenn man in Tucson von einer Bigfoot-Sichtung hörte, steckte ein Dämonenbär dahinter. Ja doch– schon klar. Ein alberner Name, aber er brachte rüber, worum es ging– und zum Lachen war an diesen Viechern wirklich nichts. Sie kamen aus der Unterwelt und waren absolut tödlich. Angesichts ihrer hochgewachsenen und pelzigen Erscheinung lag auf der Hand, warum das ungeübte Auge sie mit dem Bigfoot der Populärkultur verwechselte. Dämonenbären waren außerdem keine Faulpelze. Wenn es bis jetzt nur zwei Tote gegeben hatte, dann bloß, weil dieser hier noch nicht lange in der Gegend war. Wir hatten Glück– also die beiden Wanderer natürlich nicht. Weder Nager noch Füchse hatten ihre Leichen angefressen.
Im eigentlichen Tucson genossen wir unser typisches mildes Winterwetter– knapp unter 25 Grad heute, schätzte ich. Während ich weiter in die Berge rauffuhr, fiel die Temperatur rapide. Bald sah ich Schneefelder und Hinweisschilder für die Skigebiete am Mount Lemmon. Andere Schilder wiesen mir den Weg zu beliebten Wander- und Klettergebieten– darunter auch Rappel Rock. Alles in allem war es eine beliebte Gegend für Leute, die gern in der freien Natur waren. Durch die Nähe zu den Skigebieten war es zu dieser Jahreszeit doppelt gefährlich, dass sich dort ein Dämonenbär herumtrieb.
Schließlich erreichte ich den Anfang des Wanderwegs und parkte auf einer Schotterfläche. Dort waren nur wenige andere Autos abgestellt; immerhin etwas. Ich stieg aus dem Subaru und konnte den eiskalten Wind nicht fassen. Solche Temperaturen war ich absolut nicht gewöhnt. Ich war nicht gemacht für sie. Monster und Geistwesen? Kein Problem. Aber kaltes Wetter? Da knickte ich ein. Ich hätte die Luft mit Magie anpassen können, hob mir meine Kräfte aber besser auf. Stattdessen machte ich mich, während ich mein Arsenal hinter den Gürtel klemmte– was unbequem war, aber leichten Zugriff sicherstellte–, an eine Beschwörung. Ich sprach die rituellen Worte, und einige Sekunden später erschien ein kleiner, koboldartiger Kerl vor mir.
„Meine Herrin ruft“, sagte er mit ausdrucksloser Stimme, „und ich komme, zweifelsohne für irgendeine banale Aufgabe.“
„Wir wollen uns einen Dämonenbär schnappen.“ Ich bewegte mich forsch Richtung Wanderweg und gab mir alle Mühe, die Kälte zu ignorieren. Mein Mantel taugte überhaupt nicht für soches Wetter, aber einen besseren hatte ich nicht.
„Eine größere Herausforderung als sonst meist“, stellte er fest.
Ich ignorierte seine herablassende Art und blieb vor dem Schild stehen, auf dem die verschiedenen Kletter- und Wandertouren mit ihren Schwierigkeitsgraden dargestellt waren. Volusian war eine verfluchte Seele, die ich mir gefügig gemacht und versklavt hatte. Seine Macht stellte einen Aktivposten dar– aber einen riskanten. Er hasste mich und verbrachte einen Großteil seiner Zeit mit dem Planen der Tode, die er mich sterben lassen würde, sollte ich je die Kontrolle verlieren, die es brauchte, ihn zu binden.
Ich schloss die Augen und versuchte, lieber eins mit der Luft zu werden statt nur ihr Opfer. Die Welt war still hier, bis auf das Rascheln des Windes in den Kiefern und die Lebenslaute von Vögeln und kleinen Tieren. Ich breitete meine Sinne aus, suchte nach etwas, das nicht hier hingehörte. Meine Fähigkeiten waren nicht perfekt, aber oft konnte ich spüren, wenn etwas anwesend war, das nicht von dieser Welt stammte.
„Dort.“ Ich öffnete die Augen und zeigte neben einen Wanderweg, der als „mittelschwer“ ausgewiesen war. „Spürst du irgendwas?“
Volusian besah sich das Gelände und benutzte ebenfalls seine Sinne. „Ja. Aber mehr dort.“ Er zeigte nicht in die Richtung, die der Weg nahm, sondern mehr links davon, mitten in den Wald rein. Ich verzog das Gesicht, aber mir war klar, dass seine Sinne etwas besser waren als meine.
„Querfeldein. Toll.“
Wir machten uns auf den Weg. Volusian ging in eine geisterhaftere Gestalt über und schwebte neben mir her, anstatt durch das Unterholz stapfen zu müssen wie ich. Ich kam schon damit klar, aber so ging es natürlich langsam voran. Und während ich wanderte und wanderte, nahm das magische Gefühl zu.
„Er wird Euch ebenfalls spüren, Herrin“, gab Volusian ausnahmsweise einmal unaufgefordert einen Kommentar von sich.
Ich bezweifelte es nicht. „Und wird er auf mich losgehen? Oder abhauen?“
„Abhauen? Nein. Sich verstecken? Wahrscheinlich.“ Eine wohlgesetzte Pause. „Er wird jedoch nicht versuchen, Euch seine Sexualität aufzuzwingen. Das Blut der Glanzvollen ist zu verlockend. Er wird Euch schlicht fressen wollen.“
„Wie beruhigend. Ich kümmere mich um die Verbannung. Du lenkst ihn ab.“
Bald brauchte ich keine besonderen Sinne mehr, um zu wissen, dass wir unser Ziel erreicht hatten. Es war totenstill geworden im Wald. Keine Vögel oder sonstige Zeichen von Leben mehr. Ein starkes Gefühl von… Falschheit erfüllte die Luft. Die Welten lagen hintereinander: Menschenwelt, Anderswelt, Unterwelt. Durch die direkte Nachbarschaft konnten sich Wesen aus der Anderswelt manchmal hier frei bewegen, ohne dass ich auch nur einen Hauch davon mitbekam. Etwas aus der Unterwelt war zu fremdartig. Es fiel auf.
„Wir sind fast da“, sagte ich leise. „Wir stolpern praktisch jeden– uumph!“
Hinter einem Dickicht schwang ein kräftiger Arm hervor und traf mich in den Bauch, warf mich schmerzhaft nach hinten. Ich konnte meinen Sturz auf Felsen und spitze Stöcke nicht verhindern, schaffte es aber, im Fallen meinen Zauberstab zu ziehen.
Eine riesenhafte Gestalt ragte über mir auf, beinahe zweieinhalb Meter groß. Mit ihren lang gestreckten Gliedmaßen, den Klauen an Füßen und Händen und dem muskulösen Körperbau konnte man einen Dämonenbären leicht für einen Bigfoot halten. Seine Ohren– eindeutig die eines Bären– lagen flach am Schädel, was den menschenähnlichen Eindruck verstärkte. Er brüllte, ließ ein Maul voller scharfer Zähne sehen. Schwarze Augen, in denen nichts als hirnlose Aggression stand, starrten auf mich runter.
Volusian, der an meine Befehle gebunden war, warf sich dem Vieh entgegen. Die Macht, die Volusians Körper ausstrahlte, besaß die Massivität von einer Tonne Wackersteine. Das Wesen taumelte zurück und sah meinen Hilfsgeist wütend an. Die Tatsache, dass Volusian es nicht von den Füßen gerissen hatte, war beunruhigend. Sie waren entweder gleich stark oder der Dämon war sogar noch mächtiger als Volusian. Letzteres wäre problematisch– angesichts der Tatsache, dass ich nicht stark genug war, um Volusian zu verbannen.
Wobei, im Grunde war ich nicht stark genug, ihn zu verbannen, während ich mit ihm kämpfte. Ich konnte entweder das eine oder das andere. Wenn dieser Dämonenbär es also draufhatte, Volusian zu besiegen, dann war es aus mit mir. Hoffentlich konnte der Dämonenbär ihn nicht mehr fertigmachen, wenn er gleichzeitig abgelenkt wurde– durch mich. Ich machte, dass ich wieder auf die Beine kam, streckte meinen Zauberstab aus und begann, ein Tor in die Unterwelt zu öffnen. Volusian und der Dämon droschen aufeinander ein; keiner war in der Lage, den anderen zu töten.
Ich sammelte meine Willenskraft, bündelte die Macht meiner Seele, sodass sie über diese Welt und die Anderswelt hinaus bis zur Unterwelt vordrang. Auf meinem Arm begann das Tattoo eines schwarzen und weißen Schmetterlings zu brennen; es war Persephone geweiht, und ihr Reich berührte ich jetzt. Die Luft neben dem Dämon löste sich auf, bildete eine Öffnung zur Unterwelt. Ich griff mit der freien Hand nach dem Silberathame und näherte mich den Kämpfenden, behielt sie und das sich formende Tor im Auge.
Volusian schwebte über dem Dämon, der dadurch nach oben sehen musste. Ich schlich mich unbemerkt an. Mit der Schnelligkeit langer Übung ließ ich das Athame vorschießen und zeichnete dem Dämon ein Symbol auf die Brust. Normalerweise konnte ein Dämon, der zurück in sein Reich verbannt wurde, nicht gleich wieder zurückkehren. Ein solches Bindezeichen stellte das sicher. Ich wollte kein Risiko eingehen.
Das wütende Brüllen des Dämons hallte durch die Bäume, und er wandte sich zu mir um. Damit hatte ich gerechnet und war bereits zurückgewichen, hielt mich aus seiner Reichweite. Ehrlich, ich hatte Glück gehabt bei seinem ersten Treffer vorhin. Er besaß die Kraft, mich mit einem Schlag zu töten. Volusian ging auf ihn los, um seine Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen– es klappte bloß nicht. Der Dämon begriff, welche Bedrohung ich darstellte, und konnte spüren, dass sich ein Tor öffnete. Volusian, der wieder und wieder angriff, war ein Quälgeist– und er bereitete wirklich Qualen–, aber der Dämon konnte sie anscheinend wegstecken und weiter auf mich zukommen.
„Scheiße“, sagte ich. Ich wich weiter zurück, aber der Dämon überwand die Distanz rasch. Seine massigen Füße zertrampelten das Unterholz einfach, das mich verlangsamte. Es war gar nicht so einfach, die verzweifelte Lage, in die ich geraten war, zu ignorieren und mich stattdessen auf den Durchgang zu konzentrieren. Das Tor wurde fester, und rasch begann seine Macht seinesgleichen zu rufen– den Dämon zurückzusaugen. Das Wesen hielt in seinem Angriff inne. Das Problem war, dass das Tor auch Volusian holen wollte. Befehle hin oder her, er ging aus Gründen des Selbstschutzes außer Reichweite, was ich ihm kaum vorwerfen konnte. Nur dass der Dämon jetzt, wo mein Hilfsgeist nicht mehr auf ihn einprügelte, über gerade genug Kraft verfügte, gegen das Tor anzukämpfen und weiter auf mich zuzukommen. Ihm musste klar sein, dass das Tor in sich zusammenbrechen würde, sobald er mich erledigt hatte.
Plötzlich hörte ich etwas auf uns zukommen; Äste und Blätter zerbrachen unter kräftigen Füßen– oder genauer gesagt, Pfoten. Ein Rotfuchs– viel größer als ein normaler– sprang auf den Rücken des Dämons und senkte seine Fänge in den braunen Pelz. Das ließ den Dämon erneut aufbrüllen– und verschaffte mir eine Verschnaufpause. Ich richtete all meine Kraft auf das Tor und riss den Dämon darauf zu. Er schlug um sich, konnte aber nichts dagegen machen, zurück in seine Welt geschickt zu werden. Der Fuchs besaß Verstand genug, aus dem Weg zu gehen, da seine Dienste nicht länger benötigt wurden. Der Dämon gab einen letzten klagenden Schrei von sich und ward nicht mehr gesehen. Ich reckte den Zauberstab zu der Stelle, wo der Dämon verschwunden war, und sandte meine Kraft durch die Edelsteine des Stabs, um auch das Tor zu verbannen und diese Welt wieder abzuriegeln.
Stille folgte, von meinem heftigen Atem mal abgesehen. Langsam begannen wieder Vögel zu singen, und der Wald kehrte in seinen natürlichen Zustand zurück. Ich lehnte mich erleichtert gegen eine hohe, blattlose Eiche. Die Verbannung war schwerer gewesen als erwartet, aber es hätte schlimmer enden können– mit meinem Tod zum Beispiel.
„Wir haben deine Hilfe gar nicht gebraucht“, sagte ich. „Wir sind prima klargekommen.“
Der Fuchs war nicht mehr da, wie ich mir schon gedacht hatte. Er hatte sich in einen hochgewachsenen, muskulösen Mann mit dunkler, goldbrauner Haut und schwarzen Haaren verwandelt, die ihm knapp bis auf die Schultern fielen. Er war ein Kitsune, ein gestaltwandelnder japanischer Fuchs aus der Anderswelt. Also eigentlich war er zur Hälfte ein Kitsune. Mütterlicherseits. Väterlicherseits stammte er von einem Sterblichen aus Arizona ab. Kräftemäßig machte es keinen Unterschied.
„Klar doch.“ Kiyo verschränkte die Arme vor der Brust. Er brauchte keinen Mantel und trug einfach nur ein burgunderrotes T-Shirt. „Ihr hattet alles im Griff.“
„Wir standen knapp davor.“
„Tatsächlich, Herrin“, sagte Volusian trocken, „stand eher Euer Tod nahe bevor.“
„Ach, halt den Mund“, schnappte ich. „Du bist entlassen. Geh zurück in die Anderswelt.“ Volusian löste sich auf.