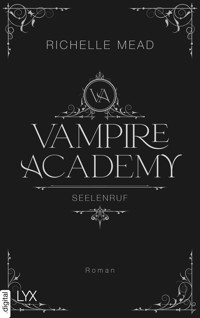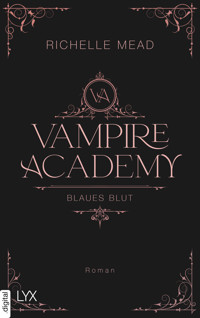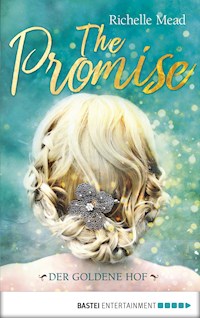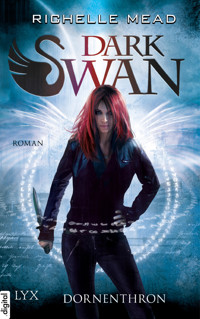9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dark-Swan-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine geheimnisvolle Seuche breitet sich im Dornenland aus, die magischen Ursprungs ist. Als Königin des Reiches will Schamanin Eugenie Markham der Sache auf den Grund gehen. Unterstützung erhält sie von Feenkönig Dorian. Doch kann sie ihm wirklich trauen? Und auch Eugenies Ex-Geliebter, der Gestaltwandler Kiyo, scheint Geheimnisse vor ihr zu verbergen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
RICHELLE MEAD
DARK SWAN
SCHATTENKIND
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Frank Böhmert
Für meinen Bruder Steve,
der unserer Familie dabei hilft, auf Kurs zu bleiben.
Kapitel 1
Ohio ist bestimmt eine total schöne Ecke, wenn man sich erst mal eingewöhnt hat. Für mich kam es zu Anfang aber einem der inneren Höllenkreise gleich.
»Wie kann es sein«, wollte ich wissen, »dass die Luftfeuchtigkeit hier dermaßen hoch ist? Da kommt man sich ja vor wie in einem Schwimmbecken.«
Meine Schwester, mit der ich gerade in der Spätnachmittagssonne zu Fuß unterwegs war, grinste. »Halte sie dir eben mit deiner Magie vom Leib.«
»Zu viel Arbeit. Sie kommt ja eh gleich wieder zurück«, schimpfte ich. Jasmine war wie ich in der trockenen Hitze von Arizona aufgewachsen; darum konnte ich auch nicht verstehen, wieso sie den monsunartigen Hochsommer im Mittleren Westen so locker wegsteckte. Wir beherrschten beide die Wettermagie, nur lag bei ihr der Fokus auf Wasser, was vielleicht ihre arrogante Art erklärte. Vielleicht wurde sie auch nur dank ihrer jugendlichen Vitalität so gut damit fertig, schließlich war sie zehn Jahre jünger als ich. Oder vielleicht, ganz vielleicht, verdankte sie es auch nur der Tatsache, dass sie nicht im fünften Monat schwanger war und keine zehn oder noch mehr Pfund Nachwuchs mit sich herumschleppte, der anscheinend voll darauf abfuhr, mich in Schweiß ausbrechen zu lassen, meine Reserven aufzuzehren und mir auch die allerkleinste banale Aktivität richtig schön zu vermiesen.
Außerdem machten mich möglicherweise die Hormone ein ganz klein wenig reizbar.
»Wir sind fast da«, sagte eine höfliche Stimme auf meiner anderen Seite. Sie gehörte Pagiel. Er war der Sohn von Ysabel, einer der zickigsten Feinenfrauen, die ich kannte – und sie konnte sich noch nicht mal mit durchdrehenden Hormonen herausreden. Zum Glück hatte Pagiel ihr Temperament nicht geerbt; auch wechselte er mit einer Leichtigkeit zwischen der Anderswelt und der Menschenwelt, wie ich sie sonst von Jasmine und mir kannte. Er war in demselben Alter wie meine Schwester, und die Tatsache, dass ich für meine Arzttermine auf eine Teenie-Eskorte angewiesen war, machte alles, was ich in den letzten Monaten hatte aushalten müssen, nur noch schlimmer.
Einen Block weiter vor uns stand die Hudson-Frauenklinik zwischen ihren sorgsam gestutzten Birnbäumen und ordentlichen Geranienbeeten. Die Klinik befand sich direkt an der Grenze zwischen den Geschäfts- und Wohnvierteln der Stadt und versuchte sich den Anstrich zu geben, dass sie zu Letzteren gehörte. Es war nicht die schöne Landschaftsgestaltung, derentwegen ich immer wieder in diese Sauna zurückkehrte und einen Spaziergang von einer halben Meile zwischen dem Tor zur Anderswelt und der Klinik zurücklegte. Es war nicht einmal die medizinische Versorgung, die, soweit ich das beurteilen konnte, sehr gut war. In Wirklichkeit besaß dieser Ort letzten Endes den Riesenvorteil, dass mich hier bisher niemand zu ermorden versucht hatte.
Diese verfluchte feuchte Hitze sorgte dafür, dass ich in Schweiß gebadet war, als wir bei dem Gebäude ankamen. Ich war Schwitzen von der Wüste her gewöhnt, aber das hiesige Klima sorgte irgendwie dafür, dass ich mich ekelhaft klebrig fühlte. Zum Glück wehte uns klimatisierte Luft an, als wir durch die Tür traten. Für mich war es herrlich, aber für Pagiel das reinste Wunder. Ich sah immer wieder gern sein Gesicht, wenn ihn dieser erste Schwall traf. Er war in der Anderswelt aufgewachsen, wo die Magie der Feen – oder Feinen, wie ich sie lieber nannte – wahre Wunder schuf. Magische Glanzleistungen, die einen Menschen mit offenem Mund dastehen lassen würden, entlockten ihm nicht einmal ein Wimperzucken. Aber das hier? Kalte Luft, die von einer Maschine erzeugt wurde? Es haute ihn noch jedes Mal aus den Socken. Nicht etwa, dass er welche trug.
»Eugenie«, sagte die Frau an der Anmeldung. Sie war mittleren Alters, mollig und hatte eine herzlich-nachbarschaftliche Art. »Wieder in Begleitung der Familie, wie ich sehe.«
Wir hatten Pagiel, um die Sache nicht unnötig kompliziert zu machen, als unseren Bruder ausgegeben. Tatsächlich fiel es nicht weiter schwer, sich uns als verwandt vorzustellen. Jasmines Haare waren rotblond, meine leuchtend rot und Pagiels rotbraun. Wir hätten glatt Werbung für die Solidaritätsgruppe amerikanischer Rotschöpfe machen können, falls es so etwas gab. Anscheinend fand es in der ganzen Klinik niemand seltsam, dass ich meine jüngeren Geschwister mitbrachte, also war das vielleicht ganz normal.
Wir setzten uns ins Wartezimmer, und Pagiel wand sich kurz unbehaglich in seiner Jeans. Ich tat so, als würde ich es nicht bemerken, und verbarg mein Schmunzeln. Er fand Menschenkleidung primitiv und unansehnlich, aber Jasmine und ich hatten darauf bestanden, dass er, wenn er zu meiner Geburtsvorbereitungs-Security gehören wollte, welche anzog. Eigentlich trugen die Feinen lieber Sachen aus Samt und Seide mit allen Schikanen wie Puffärmeln und Umhängen. Damit hätte er vielleicht an der Westküste durchkommen können, aber nicht hier mitten in Amerika.
Die beiden blieben zurück, als die Schwester mich holen kam. Jasmine hatte mich anfangs immer begleitet, aber nach einem peinlichen Zwischenfall, als Pagiel sich auf jemanden mit einem Milli-Vanilli-Klingelton gestürzt hatte, wollten wir ihn besser nicht mehr allein lassen. Wobei ich zugeben muss, dass man ihm seinen Angriff kaum vorwerfen konnte.
Ich ging zunächst einmal zum Ultraschall. Als werdende Mutter von Zwillingen fiel ich in eine Risikogruppe und musste mehr Ultraschall-Untersuchungen über mich ergehen lassen als jemand mit einer ›normalen‹ Schwangerschaft. Die Assistentin platzierte mich auf der Liege und klatschte mir Gel auf den Bauch, dann berührte sie ihn mit der Sonde. Und schwupp, war von meiner schlechten Laune, meinem ganzen Sarkasmus, von sämtlichen Gefühlen, mit denen ich hier so hochmütig hereinspaziert war, nichts mehr übrig.
Stattdessen empfand ich nackte Angst.
Da waren sie, die Viecher, für die ich mein Leben riskiert hatte – und das Schicksal der Welt. Gerechterweise muss ich hinzufügen, dass sie auf dem Bildschirm immer noch nicht nach viel aussahen. Es waren nur schemenhafte Schwarz-Weiß-Umrisse, aber mit jedem Besuch erinnerten sie mehr an Babys. Das stellte schon irgendwie eine deutliche Verbesserung dar, denn eine Zeit lang war ich überzeugt gewesen, mit irgendwelchen Aliens schwanger zu gehen und nicht mit Menschen oder Feinen.
»Ah ja, da haben wir Ihren Sohn.« Die Assistentin zeigte auf die linke Bildschirmseite. »Hab ich mir doch gedacht, dass wir ihn heute erwischen.«
Mir blieb die Luft weg. Mein Sohn. Als sie die Sonde bewegte, um einen besseren Winkel zu bekommen, trat plötzlich sein Profil deutlich hervor, kleine Arme und Beine und ein gerundeter Kopf, der sehr menschlich aussah. Dieses winzige Geschöpf, dessen schlagendes Herz ebenso deutlich zu sehen war, hatte überhaupt nichts von einem Eroberer der Welten an sich. Er kam mir sehr klein und verletzlich vor, und ich fragte mich nicht zum ersten Mal, ob es nicht ein Fehler gewesen war, diese Schwangerschaft fortzusetzen. Hatte ich mich austricksen lassen? Hatte ich mich von dieser unschuldigen Fassade hereinlegen lassen? Ließ ich gerade den Mann in mir heranwachsen, der versuchen würde, die Menschheit zu versklaven, wie es in dieser Prophezeiung hieß?
Als hätte sie meine Gedanken gespürt, regte sich auf der anderen Bildschirmhälfte seine Schwester. Sie war der Hauptgrund für meine Entscheidung gewesen, diese Schwangerschaft nicht abzubrechen. Bei einer Abtreibung mit dem Ziel, die Welt vor meinem Sohn zu retten, hätte ich auch den Tod seiner Schwester verantworten müssen. Das konnte ich ihr nicht antun. Und ihm letzten Endes auch nicht. Es spielte keine Rolle, was die Prophezeiung sagte. Sie verdienten beide die Chance, ihr Leben frei von dem zu leben, was ihnen das Schicksal angeblich auferlegt hatte.
Bloß wäre es schön gewesen, ich hätte das den ganzen Leuten begreiflich machen können, die mich deshalb umbringen wollten.
»Es sieht alles ganz prima aus«, erklärte die Assistentin. Sie legte die Sonde beiseite, und der Bildschirm wurde schwarz und hüllte meine Kinder wieder in Schatten. »Völlig normal.«
Normal? Wohl kaum.
Doch als ich in einen Untersuchungsraum verfrachtet wurde, um dort mit der Ärztin zu sprechen, sah die das ganz genauso. Normal, normal, normal. Sicher, Zwillinge erforderten zusätzliche Aufmerksamkeit, aber ansonsten waren anscheinend alle überzeugt, dass ich geradezu eine Bilderbuchschwangerschaft hinlegte. Niemand hier hatte auch nur die geringste Ahnung, was für einen Kampf ich jeden Tag durchmachte. Niemand hier wusste, dass mich jedes Mal, wenn ich meinen Bauch anschaute, Bilder der Gewalt quälten, die meinetwegen verübt wurde, Bilder des Schicksals, das beiden Welten drohte.
»Haben Sie schon Kindsbewegungen gespürt?«, fragte die Ärztin. »Es ist jetzt allmählich die Zeit dafür.«
Irgendwie musste ich an Aliens denken. »Nein, glaube nicht. Wie fühlen die sich denn an?«
»Na ja, mit fortschreitender Schwangerschaft werden sie immer deutlicher. In diesem frühen Stadium fangen Sie an, ein Flattern zu spüren. Manche Frauen finden, es fühlt sich an wie ein Fisch, der herumschwimmt. Sie merken es dann schon. Keine Sorge – die werden nicht versuchen, sich ihren Weg ins Freie zu treten. Jedenfalls nicht am Anfang.«
Mich überlief ein Schaudern. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das finden sollte. Trotz der körperlichen Veränderungen fiel es mir immer noch leicht, das hier einfach als medizinische Untersuchung anzusehen. Nur die Ultraschalle erinnerten mich daran, dass da wirklich Menschen in mir lebten. Irgendwie war ich noch nicht darauf vorbereitet, zu spüren, wie sie sich da drin wanden.
Die Ärztin sah wieder auf ihr Klemmbrett. »Wirklich, das sieht alles ganz prima aus«, wiederholte sie noch einmal die Worte ihrer Assistentin.
»Ich bin ständig müde«, hielt ich dagegen. »Und ich werde kurzatmig. Und ich habe Probleme mit dem Bücken. Ich meine, ich kann es noch, aber es fällt mir schwer.«
»Das ist alles ganz normal.«
»Nicht für mich.« Schließlich verdiente ich mein Geld eigentlich damit, Gespenster zu verbannen und Monster zu verprügeln.
Sie zuckte mit den Achseln. »In Ihnen wachsen zwei Kinder heran. Das Schlimmste kommt erst noch.«
»Aber ich muss alle möglichen Sachen erledigen. Ich führe ein sehr, ähm, aktives Leben.«
Sie wirkte wenig beeindruckt. »Dann werden Sie es entsprechend anpassen müssen.«
Trotz meiner Klagen bescheinigte sie mir einen guten Gesundheitszustand und sagte, ich solle mir meinen nächsten Termin geben lassen. Im Warteraum saßen Jasmine und Pagiel noch genau so da, wie ich sie zurückgelassen hatte. Sie blätterte eine Ausgabe von People durch und versuchte ihm zu erklären, was Reality-TV war und was daran toll war.
Vielleicht zog niemand wegen meiner ›Geschwister‹ die Augenbrauen hoch, weil ich einfach zu viele andere komische Angewohnheiten hatte. Ich zahlte zum Beispiel für jeden Besuch in bar. Wenn man Ultraschall oder Blutuntersuchungen oder Ähnliches in Anspruch nahm, kamen da ansehnliche Summen zusammen. Ich hatte immer das Gefühl, nur noch einen Schritt davon entfernt zu sein, hier mafiamäßig mit einem Geldkoffer aufzukreuzen. Aber eine Alternative gab es nicht. Ich durfte nichts machen, was meine Feinde auf meine Spur brachte. Das Ganze über eine Krankenversicherung abzuwickeln, hätte eine Papierspur hinterlassen, ein schlichter Scheck oder eine Kreditkartenzahlung ebenfalls. Bei den meisten Feinen brauchte ich mir in der Hinsicht keine Sorgen zu machen. Die hatten in der Regel wie Pagiel keine Ahnung, wie Bank- oder Postverkehr funktionierten, geschweige denn, wie man mich darüber ausfindig machen konnte. Unglücklicherweise verfügten meine Feinde in der Anderswelt jedoch über sehr gute Verbindungen zu Menschen hierzulande, die unsere Abläufe in- und auswendig kannten. Wegen dieser Menschen war ich überhaupt gerade in Ohio. Tucson war gefährlich geworden.
Als die Arzthelferin gerade mein Rezept ausdruckte, kam eine Frau herein, deren Schwangerschaft viel weiter fortgeschritten war als meine. Ein Windstoß wehte hinter ihr herein, und sie hatte Mühe, die Tür abzufangen und wieder zuzudrücken. Pagiel bekam zwar Technik nicht in seinen Kopf, aber er wusste aus der Anderswelt, was sich für einen Kavalier gehörte, und sprang auf, um ihr zu helfen.
»Danke«, sagte sie zu ihm und schenkte uns allen ein vergnügtes Lächeln. »Nicht zu fassen, dieser plötzliche Wetterumschwung. Eine Kaltfront aus heiterem Himmel.«
Die Arzthelferin nickte weise. »So ist das um diese Jahreszeit. Heute Abend gibt es garantiert ein Unwetter.«
Als hätte es noch einen Grund mehr gebraucht, den Mittelwesten nicht zu mögen. Gott, wie sehr ich Tucsons ewig gleiches Klima vermisste. Während ich mit Jasmine und Pagiel hinausging, ging mir auf, dass ich unfair war. Ich litt einfach unter meinem selbst auferlegten Exil. Eigentlich hasste ich Ohio weniger, als ich Arizona vermisste. Sobald wir wieder zurück in der Anderswelt waren, konnte ich das Königreich aufsuchen, über das ich herrschte und das quasi eine Entsprechung von Tucson war. Diese Gestalt hatte ich ihm gegeben. Aber trotzdem … es war nicht dasselbe. Ich gab immer dem Wetter die Schuld, aber es war ja mehr als das, was eine Gegend ausmachte. Jede Gegend hatte ihre eigene Kultur, ihr eigenes Lebensgefühl, geprägt von der jeweiligen Bevölkerung. Das Dornenland war toll, aber es konnte meine Heimatstadt nicht ersetzen.
»Verdammt«, sagte Jasmine und versuchte, ihre Haare zu bändigen. Der heftige Wind peitschte ihr immer wieder Strähnen ins Gesicht. »Diese Frau hat nicht übertrieben.«
Ich tauchte lange genug aus meinem Selbstmitleid auf, um zu begreifen, dass sie recht hatte. Die Temperatur war gefallen, und diese dicke, erstickende Luft von vorhin war jetzt, wo irgendwelche Druckfronten aufeinanderstießen, gewaltig in Bewegung. Die hübsch gestutzten Bäume schwankten wie aufeinander abgestimmte Tänzer. Am Himmel ballten sich dunkle Wolken, die einen krankhaften Grünstich aufwiesen. Mich überlief ein Schaudern, das mit der Abkühlung nichts zu tun hatte. Mein ganz und gar nicht feiner Feinenvater, dem ich diese Prophezeiung verdankte, dass mein Sohn die Menschheit unterjochen würde, hatte mir außerdem seine Gabe der Wettermagie vererbt. Ich war auf sämtliche Elemente abonniert, die einen Sturm ausmachten: Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, sogar die geladenen Teilchen, die einen Blitz ankündigten. Ich hatte empfängliche Sinne dafür, und alle diese Faktoren jetzt auf mich einstürmen zu spüren, hatte schon etwas Überwältigendes.
»So viel zum Thema Süßkram einkaufen«, schimpfte ich und sah zum zornigen Himmel hinauf. Mir waren die Milky Ways ausgegangen, und ich brauchte dringend Nachschub. »Wir können von Glück reden, wenn wir nicht ersaufen, bevor wir am Tor ankommen.« Nicht zum ersten Mal wünschte ich mir für diese Ausflüge nach Ohio ein Auto; bloß hätte das nichts gebracht. Eigentlich kam ich nur wegen der Klinik hierher, und die lag in Fußnähe zu dem Tor, das zurück in die Anderswelt führte. Es gab keine praktikable Möglichkeit, mir hier einen Wagen zu halten. Und außerdem hätte eine Mitfahrt für Pagiel tödlich sein können.
Immer wieder sah ich zum Himmel hinauf, vor allem um mich davon zu überzeugen, dass die Lage wirklich so schlimm war, wie sie mir vorkam, als mich plötzlich etwas stehen bleiben ließ. In Richtung Norden konnte ich über einem Baumgebiet den Rand der Gewitterwolken sehen. Der schwarze Himmel über uns erstreckte sich nur eine Meile weit, und wo er abrupt endete, schien die Sonne am knallblauen Himmel. Ich wäre jede Wette eingegangen, dass dort außerdem die Luft auch erstickend heiß und feucht war. Ein Rundblick ergab überall das gleiche Bild. Direkt über uns war der Himmel stockfinster, aber die Wolken endeten wie abgeschnitten. Als befänden wir uns unter einer perfekten, runden Kuppel. Überall an dieser schroffen Außenkante brachen Sonnenstrahlen durch.
Meine Begleiter waren ebenfalls stehen geblieben; Jasmine und ich sahen uns an. »Ich kann sie spüren …«, sagte sie leise. »Zuerst nicht, da war zu viel los …«
»Ging mir genauso«, sagte ich. Wir beide nahmen nicht nur die Elemente eines Sturms wahr, sondern waren auch gegenüber der Magie empfindlich, die damit einherging. Was wir jetzt gerade spürten, war kein natürliches Ereignis. Es gab dermaßen viele Sinnesreize, dass ich die dahinterliegende Magie anfangs gar nicht mitbekommen hatte – was zweifelsohne beabsichtigt gewesen war. Hier waren Kräfte aus der Anderswelt am Werk. Und als ich das begriff, wurde mir noch etwas anderes klar: Man hatte uns aufgespürt. Mein sicherer Zufluchtsort im Mittleren Westen war nicht mehr sicher. »Scheißdreck.«
Pagiel sah mich ernst an. »Was machen wir jetzt?« Er hatte das luftmagische Talent seiner Mutter geerbt, also konnte er sich wahrscheinlich denken, dass etwas nicht stimmte.
Ich ging weiter. »Wir müssen zum Tor. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Drüben sind wir sicher.«
»Wer immer das hier gerade veranstaltet, weiß zwangsläufig über das Tor Bescheid«, stellte Jasmine klar. »Man könnte uns auf der anderen Seite erwarten.«
»Ich weiß. Bloß müssten sie davor erst mal unsere sämtlichen Soldaten dort besiegt haben.« Dieses Tor in Hudson führte nicht direkt in eines meiner Königreiche, man kam jedoch einigermaßen nah an meinen Verbündeten hinaus, und die sichere medizinische Behandlung in der Menschenwelt war den weiten Weg durchaus wert. Trotzdem hatten wir ihn drüben nie ohne eine ebenso stattliche wie bewaffnete Eskorte unternommen.
Der Wind nahm anscheinend noch zu; er blies uns ins Gesicht und verlangsamte unser Vorankommen. Ich hätte ihn mit meiner Magie unterwerfen können, aber wir hielten uns besser zurück, bis wir dem Urheber dieses Unwetters gegenüberstanden – oder besser, den Urhebern. Es gab nur zwei Personen in der bekannten Geschichte der Feinen, die ein solches Unwetter ohne fremde Hilfe heraufbeschwören und beherrschen konnten. Die eine war mein verstorbener Vater gewesen. Die andere war ich. Es war davon auszugehen, dass hier mehrere magisch Begabte zusammenarbeiteten; eine Vorstellung, die mich mit den Zähnen knirschen ließ. In das hier war jede Menge Planung eingeflossen, was bedeutete, dass meine Feinde schon länger über Hudson Bescheid wissen mussten.
Fast ebenso ärgerlich wie entdeckt worden zu sein, war es, mit meinen körperlichen Einschränkungen klarkommen zu müssen. Ich war keine lahme Ente, das konnte man wirklich nicht sagen. Ich watschelte nicht einmal. Aber wie schon zu der Ärztin gesagt, konnte ich Sachen nicht mehr, die ich eigentlich draufhatte. Eine halbe Meile war keine große Entfernung, absolut nicht, zumal auf einem Gehweg in der Vorstadt. Vor meiner Schwangerschaft wäre ich einfach locker losgerannt und hätte die Strecke rasch hinter mich gebracht. Jetzt bekam ich bestenfalls ein anfängermäßiges Joggen hin und war mir der Tatsache sehr bewusst, dass Jasmine und Pagiel meinetwegen langsam machen mussten.
Wir bogen von der Hauptstraße ab und durchquerten die Ausläufer eines großen, baumbestandenen Parks. Tore zur Anderswelt befanden sich selten in stark bevölkerten, städtischen Gegenden, und dieses lag mitten im Park. Die Bäume brachen die unmittelbare Wucht des Windes, aber die Äste schwankten heftig und ließen Zweige und Blätter auf uns niederrieseln. Wir waren die Einzigen hier draußen, da die meisten vernünftigen Menschen längst Schutz gesucht hatten.
»Hier dürfte es passieren«, rief ich meinen Begleitern über den Wind hinweg zu. Aus der Schultertasche, die ich mit dem Gurt quer über dem Oberkörper trug, zog ich meinen Zauberstab und ein Athame mit Eisenklinge. »Wenn sie uns angreifen, dann –«
Sie griffen an.
Fünf Geister, zwei Wasserelementare und dann noch ein Elementar, der glühte wie ein Irrlicht. Elementare waren Feine, die nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt in unsere Welt überwechseln konnten. Sie manifestierten sich als annähernd menschenförmige Wesen, die aus dem Element bestanden, das stark mit ihrer Magie verbunden war. Das Ausmaß des Unwetters ließ darauf schließen, dass in der Nähe noch mehr auf der Lauer lagen, aber die waren dann wahrscheinlich schwächer und brauchten ihre gesamte Kraft schon allein dafür, diese Wetterbedingungen aufrechtzuerhalten, sodass sie nicht obendrein noch kämpfen konnten. Unsere Angreifer waren die stärksten, und die Geister dienten zur Verstärkung; das hatte ich schon öfters erlebt. Geister landeten sowieso irgendwann in der Unterwelt, da war es ihnen egal, wer über die Menschen- oder die Anderswelt herrschte. Entsprechend leicht hatte der Feine, der gegen mich opponierte, sie rekrutieren können.
Die Elementare waren nicht die Einzigen mit Unterstützung von jenseits des Grabes.
»Volusian!« Ich intonierte rasch die Worte, mit denen sich mein untoter Hilfsgeist heraufbeschwören ließ. Die Laute verloren sich im Wind, aber das spielte keine Rolle. Es zählten nur meine Absicht und meine Kraft, und binnen Sekunden materialisierte sich Volusian. Er war kleiner als ich, mit spitzen Ohren, roten Augen und einer glatten, schwarzen Haut, die mich immer an einen Salamander denken ließ. »Die Geister!«, rief ich knapp.
Mehr Ansporn brauchte Volusian nicht. Er hasste mich. Er wollte mich sogar umbringen. Aber solange ich ihn als meinen Diener band, war er gezwungen, meine Anweisungen zu befolgen. Er griff die Geister mit solcher Heftigkeit an, dass seine Magie in der Schattenlandschaft bläulich-weiß aufgleißte. Jasmine widmete sich bereits den Wasserelementaren, während Pagiel sich das Irrlicht vorknöpfte, das vermutlich mit der Luft oder der atmosphärischen Ladung verbunden war.
Und ich? Hielt mich zurück. Was mir überhaupt nicht gefiel, aber mir blieb nichts anderes übrig. Wir hatten das immer wieder durchgespielt. Die Entscheidung zum Austragen der Zwillinge war hinfällig, wenn ich zuließ, dass man mich herumschleuderte oder sogar tötete. Indem ich mich selbst schützte, schützte ich auch sie, und wenn mir das noch so sehr gegen den Strich ging. Zum Glück war ich nicht völlig nutzlos. Unsere Angreifer wollten mich, hatten aber zu viel mit meinen Verbündeten zu tun. Das ermöglichte mir, das Unwetter mithilfe meiner Magie ein bisschen abzuschwächen. Es ermöglichte mir außerdem, die Geister zu verbannen. Volusian war ihnen locker gewachsen, aber mit je weniger von ihnen er sich herumschlagen musste, desto besser natürlich.
Ich richtete meinen Zauberstab auf einen der beiden Geister, die gerade zusammen gegen Volusian vorgingen. Es handelte sich um durchsichtige, gespensterhafte Wesen, die in der Luft schwebten und in der Sonne kaum zu sehen gewesen wären. Die Schatten und die Wolken machten sie auf unheimliche Weise erkennbar. Ich öffnete meine Sinne und griff über diese Welt und die Anderswelt hinaus. Ich streifte die Tore der Unterwelt und stellte eine Verbindung her, die stabil war, mich aber nicht hinüberzog. Geister in die Anderswelt zu verbannen, ging leichter und war meine bevorzugte Taktik gewesen, als ich sie noch für verängstigte Vorstädter verbannt hatte. Aber dorthin geschickte Geister konnten zurückkehren, und dieses Risiko durfte ich nicht mehr eingehen. Je weniger von ihnen es noch einmal bei mir versuchen konnten, desto besser. Unterwelt oder gar nichts war die Devise.
Ich richtete meine Willenskraft auf mein Ziel aus und verwendete die Menschenzauber, die ich als Schamanin zur Vertreibung eines Geistes aus dieser Welt gelernt hatte. Er kreischte zornerfüllt auf, als er den Sog der Unterwelt spürte, und ein paar Sekunden später löste er sich in nichts auf. Sofort wandte ich mich dem nächsten Geist zu und schaute nur kurz, wie weit Pagiel und Jasmine waren.
Zu meinem Erstaunen hatte Pagiel das Irrlicht bereits besiegt. Keine Ahnung, wie er das hinbekommen hatte. Ich war mächtig genug, auch Elementare zurück in die Anderswelt zu verbannen, aber meine beiden Helfer konnten eigentlich nur mit ihnen kämpfen. Pagiel musste den Elementar mit seiner Magie vernichtet, ihn buchstäblich ausgelöscht haben. Dass er magisch sehr begabt war, wusste ich, aber bis jetzt hatte ich ihn noch nie kämpfen gesehen. Er war stärker als Jasmine, wurde mir klar. Er eilte ihr sofort gegen einen Wasserelementar zu Hilfe, den er mit einem Sturmwind zurückzwang, während sie das in der Gestalt des Elementars gebundene Wasser mit ihrer Magie rief und das Wesen so in Stücke riss. Währenddessen verbannte ich den zweiten Geist.
»Eugenie, mach schon!«, rief Jasmine und sah kaum zu mir herüber, während Pagiel und sie sich den letzten Elementar vorknöpften. Volusian hatte nur noch einen Geist vor sich. Jetzt waren wir in der Überzahl. Keiner dieser Angreifer würde Gelegenheit bekommen, sich loszureißen und mich zu verfolgen.
Ich verzog das Gesicht, lief aber los. Auch das gehörte zu unserem Plan. Diese Wesen waren meinetwegen hier. Wenn ich weg war und sie dann überhaupt noch existierten, dann hauten sie wahrscheinlich ab, sobald ihnen klar wurde, dass nur noch Jasmine und Pagiel hier waren – und Volusian. Ich kam mir schrecklich feige vor und musste mich immer wieder ermahnen: Wenn du stirbst, sterben die Zwillinge auch.
Ich verfiel wieder in dieses Pseudojoggen und schwächte weiterhin mit meiner Magie das Unwetter ab, um besser voranzukommen. Vor mir hob sich ein Ring aus leuchtend gelben Butterblumen von einer grünen Rasenfläche ab. Die Landschaftsgärtner konnten mähen, so oft sie wollten, binnen eines Tages waren die Butterblumen wieder da. Sie markierten das Tor.
Ich war nur noch ein paar Schritte davon entfernt, als mich von links etwas so heftig rammte, dass ich zur Seite flog. Ich schaffte es gerade noch, mich so zu drehen, dass ich die Wucht des Aufpralls mit den Knien abfangen konnte. Es war dumm gewesen, davon auszugehen, dass das Tor unbewacht sein würde. Auch dieser Angreifer war ein Elementar und bestand offensichtlich aus Moos und Blättern. Sie verfaulten und verschoben sich vor meinen Augen, was deutlich zeigte, wie schwach dieser Elementar in Wirklichkeit war. Er konnte in dieser Welt kaum existieren. Seine Überlebenschancen waren gering, und doch riskierte er bereitwillig sein Leben und kam hierher, um mir das meine zu nehmen.
Ich kämpfte mich noch hoch, da stürzte er sich auf mich. In der einen Blätterhand hielt er einen Kupferdolch, dessen Spitze höllisch scharf aussah. Kupfer war das härteste Metall, mit dem Feine umgehen konnten, und es war zwar nicht so effektiv wie Stahl, aber durchaus tödlich. Die Bewegungen des Elementars waren ungelenk und schwerfällig, was mir selbst in meinem angeschlagenen Zustand genug Zeit gab, wieder auf die Beine zu kommen. Ich hatte immer noch das Eisenathame in der Hand und stellte reichlich befriedigt fest, dass ich trotz meiner Schwangerschaft schneller war als diese Dumpfbacke von einem Elementar. Er schwang sein Messer nach mir, dem ich problemlos ausweichen konnte, und gab mir so eine Öffnung in seiner Deckung. Das Athame kam durch, zerschnitt ihm die grüne Brust. Der Elementar kreischte schmerzerfüllt auf, und ich beschloss prompt, ihn nicht zu vernichten. Ich konnte es mir nicht leisten, einen auf Heldin zu machen. Diese Verletzung reichte völlig, um den Elementar so weit zu verlangsamen, dass ich es zum Tor schaffte. Ich machte, dass ich in den Ring von Butterblumen kam, und griff nach der Anderswelt aus. Das Tor war stark und ganzjährig vorhanden, sodass es jemandem, der sich auskannte, keine Mühen machte. Was ebenfalls dafür gesprochen hatte, in Hudson unterzutauchen.
Die Pfade zwischen den Welten öffneten sich, und ich spürte eine leichte Desorientierung, als würde ich auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werden. Binnen Sekunden fand ich mich mitten zwischen meinen Soldaten stehend im Jelängerjelieberland wieder. Nirgendwo gab es Anzeichen für Feinde, und den erschrockenen Gesichtern meiner Wache nach zu urteilen, kam mein zerzauster Zustand für sie völlig überraschend. Sie vergeudeten jedoch keine Zeit mit Fragen, sondern hatten bereits ihre Waffen gezogen, als der Elementar mir durch das Tor folgte.
Nur, dass es jetzt kein Elementar mehr war. Es war nicht einmal ein ›Er‹. Sondern eine Sie – eine Feine, die nicht älter war als ich und ihre braunen Haare zu einem Dutt hochgesteckt hatte. Sie stolperte zwei Schritte auf mich zu, den Kupferdolch immer noch in der Hand, dann fiel sie zu Boden. Blut quoll aus ihrer Brust und zeigte, wie schwer ich sie verwundet hatte. Mit einer Klinge aus Eisen, dem Fluch der Feinen, und dazu noch in der Menschenwelt, wo sie am schwächsten waren. Hier in der Anderswelt hätte die Frau eine solche Verwundung vielleicht überlebt, aber nun war es zu spät. Das Messer entglitt ihren Händen, als sie sich kläglich an die blutende Brust griff. Dabei ließ sie mich nicht einen Moment aus den Augen.
»Tod … der Prophezeiung …«, brachte sie heraus, dann holte sie selbst der Tod. Die hasserfüllten Augen erloschen, und bald sahen sie nichts mehr. Mir war speiübel.
Eine weitere Bewegung beim Tor zog die Aufmerksamkeit meiner Wachen auf sich, aber es waren nur Jasmine und Pagiel. Man sah ihnen an, dass sie gekämpft hatten, aber von ernstlichen Schäden war nichts zu sehen. Jasmine schaute als Erstes zu mir, und trotz ihres harten Blicks wusste ich, dass sie mich auf Verletzungen checkte, genauso wie ich sie. Kaum zu glauben, dass wir einmal Feinde gewesen waren.
Als sie sich davon überzeugt hatte, dass mit mir alles in Ordnung war, warf sie einen Blick auf die Tote, dann sah sie wieder mich an, jetzt ein bisschen entspannter. »Tja«, sagte sie. »Wenigstens kannst du dir Ohio ab jetzt sparen.«
Kapitel 2
Die geografische Beschaffenheit der Anderswelt widerspricht der menschlichen Physik. Es gibt keine geraden Linien von Punkt A nach Punkt B, nicht einmal wenn man eine Straße entlanggeht, die anscheinend ohne Kurve oder Abzweigung verläuft. Ein Vorwärtsschritt auf einer Straße bringt einen in ein Königreich, von dem man dachte, dass man es vor zehn Meilen hinter sich gelassen hätte. Die meisten Reiche neigen dazu, im selben Abstand voneinander zu bleiben, aber Garantien gibt es keine. Eine Straße, deren Macken man in- und auswendig zu kennen glaubt, kann sich ohne jede Vorwarnung verändern.
Zum Glück gab es diesmal keine solchen Überraschungen. Die Straße, die wir zum Hudsontor genommen hatten, brachte uns schließlich, mit nur den erwarteten Schlenkern durch befreundete Länder, ins Eichenland zurück. Das Eichenland war keines meiner Reiche. Es wurde von meinem mächtigsten Verbündeten regiert, der mich gleichzeitig auch am meisten nervös machte. Dorian und ich waren einmal ein Paar gewesen und hatten gemeinsam in der Anderswelt Krieg geführt. Zur Trennung war es gekommen, als er mich in eine Schatzsuche hineinmanipuliert hatte, die insgeheim dazu gedacht gewesen war, ein Reich zu erobern, das ich gar nicht haben wollte. Eine Zeit lang waren wir uns sehr feindselig begegnet, aber mit meiner Schwangerschaft hatte sich unser Verhältnis verändert. Er gehörte zu den Verfechtern der Prophezeiung, die besagte, dass der erste Enkelsohn meines Vaters die Menschheit unterjochen würde, und hatte daher geschworen, meinen Kindern zu helfen und sie zu beschützen, obwohl er nicht ihr Vater war.
Allerdings zeigte er, nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass ich am Leben war und dass es mir gut ging, wenig Mitgefühl, als er von unserem Hinterhalt erfuhr.
»Ich habe nie verstanden, was du überhaupt in diesem Ohoho wolltest«, sagte er und schenkte sich Wein ein. »Ich sage: und tschüss!«
Ich seufzte. »Es heißt Ohio. Und du weißt genau, was ich dort wollte. Die Zwillinge brauchen medizinische Versorgung.«
»Behauptest du. Sie können ihre ›medizinische Versorgung‹ auch hier bekommen. Unsere taugt ebenso viel wie die der Menschen. Möchtest du ein Glas?« Er hielt die Weinflasche hoch.
Ich verdrehte die Augen. »Nein. Und genau darum geht es. Die hiesige Medizin ist völlig anders. Wein ist absolut nichts für Babys.«
Dorian kam mit großen Schritten durch den Salon und drapierte sich elegant auf einem Zweiersofa, das seine Robe aus Purpursamt am vorteilhaftesten zur Schau stellte. »Nun, das versteht sich doch wohl von selbst. Ich würde mir im Traum nicht einfallen lassen, einem kleinen Kind Wein zu geben! Wofür hältst du mich, für einen Barbaren? Aber was dich betrifft … Nun, vielleicht hilft er dir dabei, ein Stück weit deine Nervosität abzulegen. Es ist in letzter Zeit rundweg unerträglich, sich in deiner Nähe aufzuhalten.«
»Ich darf auch keinen Wein trinken. Den bekommen dann die Babys in meinem Bauch ab.«
»Unsinn«, sagte er und schnippte seine langen, rotbraunen Haare über die Schulter zurück. Ohne sein gutes Aussehen wäre mein Leben leichter gewesen. »Meine Mutter hat täglich Wein zu sich genommen, und schau, was aus mir geworden ist.«
»Damit hast du mir gerade das beste Argument überhaupt geliefert«, sagte ich trocken. »Schau mal, ich weiß, du findest hier alles bestens und siehst keinen Grund für mich, je einen Fuß aus der Anderswelt zu setzen, aber ich komme mir einfach unsicher vor, wenn ich diese Schwangerschaft nicht regelmäßig durch einen … Menschenarzt untersuchen lasse.« Ich hatte fast ›richtigen Arzt‹ gesagt, mich aber gerade noch gefangen. Klar, ich hatte bei den Feinen einige verblüffende Heilerfolge miterlebt. Ich hatte buchstäblich dabei zugesehen, wie man abgeschlagene Gliedmaße wieder angefügt hatte. Doch selbst die beste Feinenmagie konnte mir nicht dieselbe Sicherheit einflößen wie die beruhigenden Zahlenwerte und Pieptöne der Gerätemedizin. Ich war schließlich ein halber Mensch und wie ein ganzer aufgewachsen.
»Du kommst dir ›unsicher‹ vor, hm?« Dorian schenkte mir sein lakonisches Lächeln. »Nun sag, wiegt die Vergewisserung, die du heute durch deine Menschenärztin erfahren hast, denn den potenziellen Schaden auf, den du hättest nehmen können, als dieser Elementar dich umgeworfen hat?«
Ich warf ihm einen finsteren Blick zu und sah weg. Obwohl ich den Sturz einigermaßen hatte abfangen können, hatte ich mich gleich nach dem Passieren des Tores von Dorians Heilern durchchecken lassen. Sie hatten einige kleinere Zauber zur Minimierung von Blutergüssen angewendet und geschworen, dass den Zwillingen nichts passiert war. Sie verfügten über keinerlei diagnostische Ausrüstung, um es zu beweisen, aber die Heiler der Feinen besaßen ein angeborenes Gespür für derartige Vorgänge im Körper, so wie ich für die Bestandteile von Unwettern empfänglich war. Ich musste einfach darauf vertrauen, dass die Heiler richtiglagen.
»Wir hätten besser vorbereitet sein müssen, das ist alles«, schimpfte ich leise.
»Wie vorbereitet willst du denn noch sein?« Dorian sprach immer noch so leichthin, als wäre das alles ein einziger Witz, aber ich konnte die Härte in seinen grünen Augen sehen. »Du spazierst doch längst mit einem veritablen Heer im Rücken durch diese Welt. Willst du es jetzt auch noch mit hinüber in die Menschenwelt nehmen?«
»Natürlich nicht. So viele Jeanshosen sind im ganzen Land nicht aufzutreiben.«
»Du setzt dein Leben aufs Spiel. Du setzt ihr Leben aufs Spiel.« Dorian zeigte auf meinen Bauch – nur für den Fall, dass nicht restlos klar war, wen er meinte. »Du solltest nicht hinüber in die Menschenwelt wechseln. Ehrlich gesagt solltest du nicht einmal hier von einem Land ins andere reisen. Wähl dir eines aus. Eines von deinen, meines; es ist einerlei. Nur bleib irgendwo und lass dich beschützen, bis sie auf die Welt gekommen sind.«
»Ich bin nicht sehr gut darin, irgendwo zu bleiben«, erklärte ich, und mir entging nicht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen diesem Gespräch und dem vorhin mit der Ärztin in Sachen Frust über meinen körperlichen Zustand.
Zu meiner Überraschung glättete sich Dorians Miene zu Mitgefühl. »Ich weiß, meine Liebe. Ich weiß. Aber dies sind ungewöhnliche Zeiten. Eines gebe ich gern zu: Wenn du in Bewegung bleibst, wird es für sie schwerer, dich zu finden. Maiwenn und Kiyo können nur eine bestimmte Anzahl Orte gleichzeitig überwachen, also spricht durchaus auch etwas dafür, nicht ständig an einem Ort zu bleiben.«
Maiwenn und Kiyo. Mein Herz krampfte sich zusammen. Wir sprachen diese Namen kaum einmal aus. Normalerweise sagten wir einfach »der Feind« oder »sie«. Doch obwohl es eine große Anzahl Feine gab, die verhindern wollten, dass sich die Prophezeiung des Sturmkönigs bewahrheitete, wussten wir alle, dass die eigentliche Bedrohung aus zwei ganz bestimmten Personen bestand. Maiwenn war die Königin des Weidenlands und einmal eine Freundin gewesen. Kiyo war mein Ex und wie ich zur Hälfte menschlich.
Und außerdem war er der Vater meiner Kinder.
Kiyo …
Wenn ich zu lange an ihn dachte, überwältigten mich meine Gefühle. Selbst als unsere Beziehung allmählich den Bach runtergegangen war, hatte ich noch etwas für ihn empfunden. Dann hatte er klargestellt, dass er die Zwillinge und mich als akzeptable Verluste ansah, wenn es darum ging, eine Bedrohung für die Menschheit abzuwenden. Ich hatte definitiv auch keine Lust, mit anzuschauen, wie die Feinen die Menschenwelt eroberten, aber bei seinen Aktionen hatte es mir die Sprache verschlagen. Es fiel mir immer noch schwer, die Tatsache zu akzeptieren, dass ich jemanden so gut kennen konnte … und doch überhaupt nicht kannte.
»Was, meinst du, sollen wir wegen der Hochzeit machen?«, zwang ich mich zu einem Themenwechsel. »Sie wissen, dass ich dort sein werde.« Zwei meiner Untergebenen, Shaya und Rurik, wollten demnächst heiraten, und ich richtete das Fest aus.
Dorian nickte und kniff nachdenklich die Augen zusammen. »Sie wissen auch, dass all deine Verbündeten und eine Anzahl derjenigen, die sich einfach gut mir dir stellen wollen, dort sein werden. Solange wir dafür sorgen können, dass du sicher zurück ins Dornenland kommst, dürfte es keine –«
»Es ist mir gleich, womit er gerade beschäftigt ist! Ich werde auf der Stelle mit ihm reden!«
Dorian und ich wandten uns zur Tür um, hinter der die Frau keifte. Wachsoldaten brummten Erklärungen, wobei es klar war, dass sie ignoriert werden würden.
Ein zutiefst resignierter Ausdruck huschte über Dorians Gesicht. »Ist schon gut«, rief er. »Lasst sie ein.«
Ich hatte es mir auf einer Chaiselongue bequem gemacht, beinahe ebenso entspannt wie Dorian, aber nun richtete ich mich auf. Ich wusste, wer da kam, und wollte lieber gewappnet sein.
Ysabel kam in den Raum gefegt, in einem Kleid, das selbst nach den Maßstäben der Feinen kunstvoll war. Ich fand immer, dass sich die hiesige Mode am besten mit ›wild gewordenem Mittelalter‹ beschreiben ließ. Ihr Kleid war aus schwerem silbernen Satin gefertigt, mit einem V-Ausschnitt, der ihr fast bis zum Bauch reichte. Zuchtperlen säumten sämtliche Nähte und zierten auch ihre langen rotbraunen Haare. Ich fragte mich, ob sie auf dem Weg zu einem festlichen Ereignis war oder sich einfach nur immer noch darum bemühte, Dorian zurückzugewinnen. Sie war einmal seine Mätresse gewesen, bevor er und ich zusammengekommen waren, aber nach unserer Trennung hatte er nicht wieder daran angeknüpft.
Noch erstaunlicher als ihre Aufmachung war vielleicht, dass sie nicht allein kam. In ihrem Schlepptau kamen Pagiel und ihre beeindruckende und zumeist unfreundliche Mutter Edria. Der Junge musste sich beeilen, mit den beiden Schritt zu halten, und machte ein jämmerliches Gesicht. Kurz darauf trat auch noch seine jüngere Schwester Ansonia ein. Sie hatte lange Haare, fast von derselben Farbe wie meine, und schien Angst zu haben, hier zu sein.
»Eure Majestät«, rief Ysabel und blieb vor Dorian stehen. Ich konnte nicht sagen, ob ihre Wangen vor Zorn oder von schlechtem Make-up gerötet waren. Wenn man bedachte, dass die Feinen ihre Kosmetika gern aus Nüssen und Beeren herstellten, hätten mich beide Möglichkeiten nicht überrascht. »Das kann ich nicht zulassen.«
»Mutter –«, begann Pagiel, als er bei ihr ankam.
Ysabel zeigte mit zornblitzenden Augen auf mich. »Ich werde nicht länger zulassen, dass sie meinen Sohn immer wieder in Gefahr bringt! Stellt Euch vor, er ist heute beinahe gestorben!«
»Bin ich gar nicht!«, rief Pagiel.
Dorian musterte ihn ruhig von oben bis unten. »Auf mich macht er einen vortrefflichen Eindruck.«
»Um Haaresbreite wäre es anders ausgegangen«, erklärte Edria mit Grabesstimme.
»Nicht, dass ich wüsste«, sagte ich und dachte daran, wie schnell Pagiel seinen Gegner ausgeschaltet hatte. »Nach dem, was ich gesehen habe, hatte er die Sache im Griff.«
»Woher wollt denn Ihr das wissen?«, fragte Ysabel mit einem höhnischen Grinsen. »Ihr seid doch weggelaufen.«
Ich spürte, wie mir selbst die Röte in die Wangen schoss. Da konnte es noch so einleuchtend sein, dass ich mich außer Gefahr zu bringen hatte, während andere meine Verteidigung übernahmen; es schmeckte mir trotzdem nicht.
»He, ich habe auch meinen Teil übernommen«, sagte ich.
Ysabel hatte sich bereits abgewandt und sagte zu Dorian: »Es ist nicht rechtens, dass mein Sohn für sie sein Leben riskiert.«
»Das sehe ich genauso«, sagte Edria. Ihr schwarzes Haar war so fest zurückgebunden, dass es ihr – ich schwöre – die Gesichtshaut straff zog. Vielleicht war es die Feinenvariante davon, sich liften zu lassen. »Er hat nichts mit dieser ominösen Prophezeiung zu schaffen. Er schuldet der Königin nichts.«
Pagiel versuchte immer wieder, auch etwas zu sagen, und jedes Mal fuhren ihm seine Mutter und Großmutter über den Mund. Er tat mir leid, zumal er der einzige Mann in der Familie war. Sein Vater war vor Jahren gestorben, und Ysabels Vater war angeblich ein Taugenichts gewesen, der die Familie im Stich gelassen hatte. Pagiel war nur von Frauen umgeben.
Dorian sah zwischen Ysabel und Edria hin und her. »Ich befehle ihm nicht, irgendetwas für die Königin zu tun. Er begleitet sie aus freien Stücken.«
»Aber das ist gefährlich«, sagte Ysabel.
Es konnte ihn nicht erweichen. »Ich sage noch einmal, er begleitet sie aus freien Stücken. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was ihr von mir erwartet. Dein Sohn ist ein freier Bürger meines Reiches und alt genug, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen.«
Ysabel sah so aus, als ob sie gleich mit dem Fuß aufstampfen würde. »Es ist gefährlich! Ist es nicht Eure Aufgabe, Eure Untertanen vor Unbill zu bewahren?«
»Gewiss«, sagte Dorian. »Und zugleich habe ich mich um die Belange meines Reiches zu kümmern. In Kriegszeiten kann ich wohl kaum dafür Sorge tragen, dass keinem Soldaten ein Leid geschieht, nicht wahr? Und selbst wenn wir uns streng genommen derzeit nicht im Krieg befinden, so unterstützt dieses Reich die Königin des Vogelbeer- und Dornenlandes. Damit gehen gewisse unvermeidbare Risiken einher, aber daran lässt sich nichts ändern. Deshalb meine Verwendung des Wörtchens ›unvermeidbar‹. Ich kann ihm schwerlich vorwerfen, dass er ihr beistehen möchte. Und tatsächlich gebührt ihm dafür, dass er alles Erdenkliche tut, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, Lob und Anerkennung – wie das heutige Scharmützel deutlich gezeigt hat.«
Pagiel strahlte über das Lob seines Königs, aber Ysabels Miene wurde nur noch finsterer. Ein bisschen tat sie mir schon leid. Schließlich war sie nur eine Mutter, die versuchte, ihren Sohn zu beschützen. Aber zugleich fiel es mir schwer, das einer Frau zuzugestehen, die ihren Sohn oft zu ihrem eigenen Vorteil eingesetzt hatte. Nach dem Tod ihres Mannes war Ysabel einzig mit dem Ziel an Dorians Hof gekommen, einen Mann – vorzugsweise den König – zu verführen, der dann für sie sorgen würde. Mit dem Kniff, Pagiel und Ansonia mitzubringen, hatte Ysabel die eigene Anziehungskraft verstärken wollen. Die Feinen taten sich schwer mit dem Kinderkriegen und machten sich ständig Sorgen um ihre Fruchtbarkeit oder Zeugungsfähigkeit. Durch die Zurschaustellung ihrer beiden Kinder hatte Ysabel unterstreichen wollen, was für eine gute Partie sie war.
»Da, seht ihr?«, fragte Pagiel triumphierend, als er endlich einmal zu Wort kam. »Ich habe die Unterstützung des Königs. Ich glaube an das, was ich tue. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass die Prophezeiung eintrifft.«
Das ließ mich schon ein bisschen zusammenzucken. Ich war zwar über jeden froh, der dabei half, mich vor Kiyo und Maiwenn zu beschützen, aber diese Dankbarkeit wurde durch das Wissen getrübt, dass die meisten mich in der Hoffnung unterstützten, dass mein Sohn wirklich einmal die Menschheit unterjochen würde. Beide Völker hatten einst dieselbe Welt geteilt, aber die Feinen hatten sich mit der Schwächung der Magie und dem Aufkommen der Technik aus ihr zurückgezogen. Zu einem großen Teil waren sie der Meinung, dass ihnen ein Unrecht geschehen war und sie Anspruch auf die Menschenwelt hatten.
»Du bist ein dummes Kind«, fauchte Edria. »Und du hast nicht den Schimmer einer Ahnung, woran du glaubst. Dass du hier bist, liegt doch zu einem Gutteil nur an ihrer Schwester.«
Ich sah kurz Verlegenheit in Pagiels Gesicht, aber er ließ sich nicht fertigmachen. Es stimmte, dass ich ihn im Grunde nur kannte, weil er romantische Gefühle für Jasmine entwickelt hatte. Mit der Zeit jedoch hatte er sich als entschiedener Gegner von Leuten erwiesen, die ungeborene Kinder bedrohten, und sich auf meine Seite gestellt.
Er funkelte Mutter und Großmutter an. »Meine Beweggründe gehen nur mich etwas an. Ich habe mich entschieden, das zu tun, und ihr könnt mich nicht daran hindern.«
Die drei hatten uns anscheinend vergessen und waren wieder in ihre familiären Zwistigkeiten verfallen. Im Hintergrund schmollte Ansonia. Ich ging davon aus, dass ihre Mutter sie mitgeschleift hatte, damit sie Familienzusammenhalt bewies.
»Pagiel war umwerfend«, sagte ich in der Hoffnung, ihn damit ein bisschen zu unterstützen. »Die Wahrheit ist, dass er zu unseren Gängen in die Menschenwelt einen entscheidenden Beitrag geleistet hat. Wenige andere Fei– äh, Glanzvolle verfügen dort über solche Kräfte.«
»Kräfte, die vergeudet werden«, sagte Edria mit einem Naserümpfen. »Er hat Wichtigeres zu tun, als Euren Laufburschen abzugeben.«
»Großmutter, so darfst du nicht zu ihr sprechen!« Pagiel war offensichtlich fassungslos. »Sie ist die Königin von Vogelbeere und Dorn.«
»Und wenn sie die Königin von –«
»Genug«, sagte Dorian und hob die Hand. Seine gesamte Haltung war immer noch locker und entspannt, aber in seiner Stimme war eine Strenge, die sämtliche Aufmerksamkeit auf sich zog. »Dieses Gespräch ist beendet. Es gibt nichts, was ich tun kann – oder will. Ihr beiden zauberhaften Damen werdet akzeptieren müssen, dass Pagiel ein Mann ist und sein Leben selbst bestimmt. Doch falls euch das tröstet« – er warf mir einen kurzen, amüsierten Blick zu –, »ich bezweifle, dass er so bald wieder in der Menschenwelt umherstreifen wird, nun da das Geheimversteck Ihrer Majestät nicht länger geheim ist.«
Ich machte ein finsteres Gesicht, widersprach aber nicht – denn er hatte recht.
Pagiels blaue Augen leuchteten. »Ich werde Euch helfen, ein neues zu finden«, erklärte er. »Ich überprüfe sämtliche Tore und schaue, wohin sie in der Menschenwelt führen.«
Ich lächelte nachsichtig. Ich dachte schon langsam, dass Dorian recht hatte und ich mich besser hier in der Anderswelt verkroch, aber ich wollte Pagiel vor Ysabel und Edria nicht den Wind aus den Segeln nehmen. »Vielen Dank, Pagiel.«
Ysabel sah aus, als ob sie jeden Moment explodieren würde. »Darüber unterhalten wir uns noch.«
»Ach so?«, sagte Dorian. »Du kannst davon ausgehen, dass wir das nicht tun werden. Nun geht. Alle.«
Er sprach wieder in diesem Befehlston, und nach einigen obligatorischen Knicksen und Verneigungen huschte die gesamte Familie davon.
»Sie sind immer so reizend«, sagte Dorian.
»Nicht das erste Wort, das mir da in den Sinn kommt.« Ich sah zu, wie die Wachen die Tür wieder schlossen. Ich seufzte. »Wobei es mir wirklich kein bisschen gefällt, dass andere ihr Leben für mich riskieren. Zumal Pagiel. Ich kann ihn gut leiden.«
»Das ist ja das Unschöne daran«, sagte Dorian lächelnd. »Es sind immer Leute, die man gut leiden kann. Feinde neigen eher nicht dazu, ihr Leben für einen zu riskieren. Einzig deine Freunde sind zu diesem Opfer bereit. Wobei ich davon ausgegangen bin, dass du über dieses moralische Dilemma schon hinweg wärest, seit wir gegen Katrice in den Krieg gezogen sind.«
»Dass ich wirklich darüber hinweg bin, würde ich nicht sagen. Eigentlich habe ich nur gelernt, damit umzugehen.«
»Das könnte sich leicht als dauerhafte Philosophie erweisen.«
»Könnte sein.« Ich stand auf und streckte mich, um einen Schmerz im Rücken loszuwerden, der mir neu war. Na toll. Noch ein Beweis dafür, dass mein Körper den Bach runterging. »Ich sollte mal langsam ins Dornenland zurückgehen.
Dorian stand ebenfalls auf. »Langsam, aber noch nicht jetzt.«
Ich warf ihm einen misstrauischen Blick zu. »Zielst du darauf ab, mich noch ein bisschen hierzubehalten?«
»Rein aus Vernunftgründen. Maiwenn lässt diese Burg wahrscheinlich beobachten, um zu schauen, ob du nach ihrem Hinterhalt noch zurückkehren wirst. Falls sich ihre Spitzel noch immer hier herumtreiben, nimmst du, ob nun Eskorte oder nicht, am besten nicht die Straßen. Einmal das, und außerdem gehen sie wahrscheinlich davon aus, dass du mir berichtest und dann sofort nach Hause zurückkehrst. Warte noch einen Tag, und sie geben auf und verschwinden.«
»Ich hasse Intrigenspiele«, schimpfte ich, obwohl ich wusste, dass er wieder einmal recht hatte.
»Dabei verstehst du dich so gut darauf.«
Dann streckte er ohne Vorwarnung den Arm aus und legte mir eine Hand auf den Bauch. Ich machte einen Satz nach hinten. »Hey! Frag gefälligst erst.«
»Ich wollte mich nur einmal bei meinen kleinen Wunderkindern bemerkbar machen«, sagte er wenig beeindruckt. Er trat erneut auf mich zu. »Darf ich?«
»Das sind nicht deine Wunderkinder.« Ich nickte widerwillig, und seine Hand kehrte zurück. »Wozu die Mühe? Bis jetzt hab noch nicht mal ich irgendwelche Kindsbewegungen gespürt. Da wirst du erst recht keine spüren.«
»Und wenn schon, mir gefällt die Verbundenheit. Wir werden einander sehr nahestehen, diese beiden und ich. Also falls du aufhörst, so störrisch zu sein, und es zulässt, dass ich sie adoptiere.«
Dieses Angebot, das meinen Kindern Ehelichkeit und Status in der Anderswelt verschaffen würde, machte er mir ständig. Bloß konnte ich ihnen als Königin zweier Reiche auch ohne seine Hilfe jede Menge Status sowie ein anständiges Erbe mitgeben. Dorian behauptete ständig, einfach nur an unserem Leben teilhaben zu wollen. Aber mein Misstrauen war begründet, und ich ging davon aus, dass es ihm dabei auch um die Möglichkeit ging, Einfluss auszuüben.
»Ich denke immer noch darüber nach«, sagte ich ausweichend.
Er gluckste in sich hinein. »Irgendetwas lässt mich vermuten, dass du noch die nächsten zwanzig Jahre lang ›darüber nachdenken‹ wirst.«
Das war alles, was er sagte, und die Hand nahm er auch nicht weg. Er war anscheinend ganz selig über die Berührung, und ich hätte zu gern gewusst, was er gerade empfand. Dorian war ein Meister darin, zu verbergen, was in ihm vorging. Das rührte zum Teil daher, dass er König war, und zum Teil einfach nur daher, dass er eben … Dorian war. Während wir dort standen, wurde ich mir bald der Wärme seiner Hand und seiner körperlichen Nähe bewusst. Es beunruhigte mich und wühlte zu viele gemeinsame Erinnerungen auf. Ich war sehr in ihn verliebt gewesen, damals, als er mich hintergangen hatte, und es war mir schwergefallen, die Beziehung zu lösen. Ich hatte unsere Vertrautheit und die intensive Sinnlichkeit absolut noch nicht vergessen. Als er seine Hand zu meiner Hüfte hinuntergleiten ließ, entzog ich mich abrupt.
»Da sind sie nicht.« Es klang hoffentlich eher verärgert als geschmeichelt. Ich machte ein paar Schritte auf die Tür zu. »Ich bleibe noch einen Tag oder so, und dann kehre ich zurück.«
Er verschränkte die Hände vor sich und nickte. »Wie du wünschst. Wir sehen uns bestimmt noch. Falls nicht, dann bis zur Hochzeit.«
»Ja, genau.« Ich hielt seinem Blick für einige Sekunden stand und wandte mich dann rasch ab, weil ich Angst vor dem hatte, was ich vielleicht in seinen Augen sehen würde. Über seine Gefühle herumrätseln zu müssen, konnte frustrierend sein, aber das war noch lange nicht so gruselig, wie sie wirklich zu kennen.
Kapitel 3
Es kränkte mich nicht, dass Shaya und Rurik lieber im Vogelbeerland als im Dornenland heiraten wollten. Sicher, im Dornenland hatten sie sich während der Arbeit für mich ineinander verliebt, aber mir war längst klar, dass nur wenige Feine meine Liebe zu der ewigen Hitze und den weiten Wüstenlandschaften meines eigentlichen Königreichs teilten. Aber auch das Vogelbeerland stand unter meiner Herrschaft, und selbst ich musste zugeben, dass es dort wirklich herrlich war. Genau so eine Landschaft hatte man vor Augen, wenn man an Picknicks auf dem Lande und an idyllische Nachmittage dachte. Überall blühten Blumen, und die niedrigen Bergketten am Horizont gaben einen hübschen Hintergrund ab. Wenn ich überhaupt etwas gegen das Vogelbeerland einzuwenden hatte, dann einfach, dass ich eben nie seine Königin hatte sein wollen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!