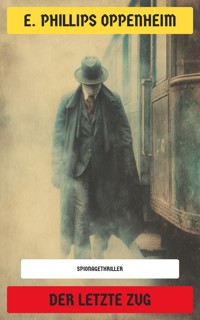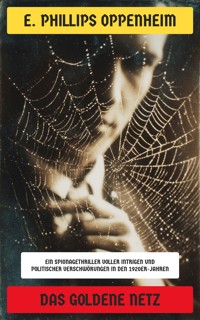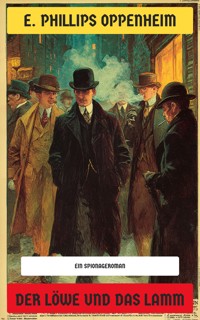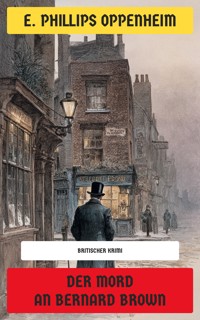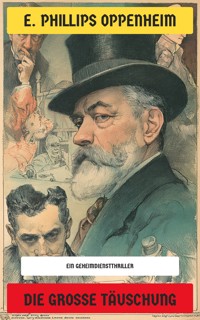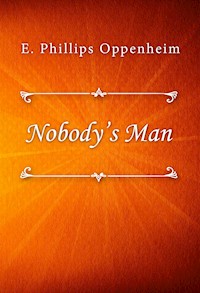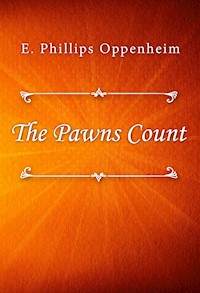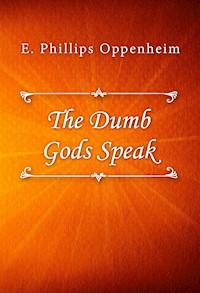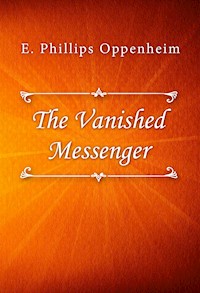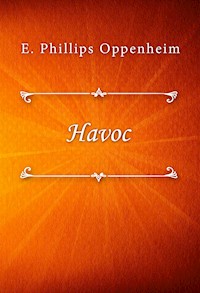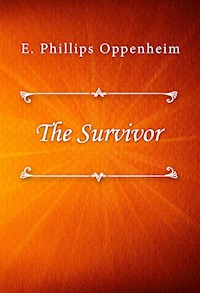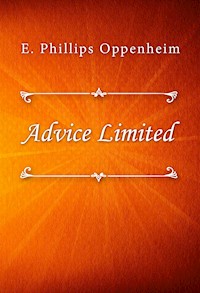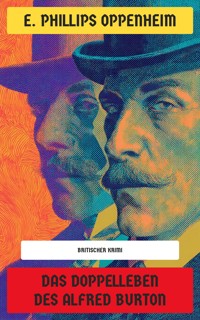
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Das Doppelleben des Alfred Burton" von E. Phillips Oppenheim ist ein faszinierender Roman über Wandlung, Versuchung und die Macht des Gewissens. Zu Beginn lernen wir Alfred Burton kennen – einen unscheinbaren Hausmakler, der durch Zufall ein geheimnisvolles Artefakt entdeckt: eine kleine Schachtel mit exotischen Bohnen, versteckt in einem alten Haus, das er gerade besichtigen soll. Neugierig probiert er eine davon – und in diesem Moment verändert sich sein Leben vollständig. Aus dem gewöhnlichen, leicht berechnenden Geschäftsmann wird plötzlich ein anderer Mensch: ehrlich, sensibel, voller Idealismus und moralischer Reinheit. Doch diese wundersame Veränderung bringt ihn in große Schwierigkeiten. Seine Frau und sein Umfeld verstehen den neuen Burton nicht mehr. Er kann nicht länger lügen, keine Geschäfte aus Eigennutz betreiben, keine Oberflächlichkeit ertragen. Sein ganzes Wesen ist jetzt von einer beinahe kindlichen Reinheit erfüllt. Dabei gerät er in Konflikt mit der Gesellschaft, die auf Täuschung, Ehrgeiz und materiellen Werten basiert. Eine Begegnung mit der schönen und klugen Edith Mallory entfacht in ihm eine tiefe Bewunderung und führt ihn in Kreise, die ihn gleichermaßen faszinieren wie herausfordern. Während er versucht, das neue Leben mit seinen alten Verpflichtungen in Einklang zu bringen, steht Burton vor der größten inneren Prüfung: Kann wahre Güte in einer Welt voller Kompromisse bestehen? Mit psychologischem Tiefgang und einer Prise Fantastik erzählt Oppenheim eine Geschichte, die zwischen Satire und Moraldrama schwebt. Der Leser folgt gebannt dem Wandel eines Mannes, der alles verliert – und doch vielleicht das Wertvollste gewinnt. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Doppelleben des Alfred Burton
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL I
Herr Alfred Burton stand, obwohl er sich dessen glücklicherweise und vollkommen unbewusst war, an der Schwelle des Schicksals. Er war ein wenig außer Atem, und sein Zylinderhut war ihm in den Nacken gerutscht. In seinem Mund steckte eine große Zigarre, von der er sicher war, dass sie ihm nicht bekommen würde, aber er rauchte sie, weil sie ihm wenige Minuten zuvor von dem Kunden, den er gerade betreute, angeboten worden war. Er hatte ziemlich tief liegende blaue Augen, die attraktiv gewesen wären, wenn sie nicht einen gewissen scharfen Ausdruck gehabt hätten, der in gewisser Weise auf die Methoden und den Charakter des jungen Mannes selbst hindeutete; ein blasses, charakterloses Gesicht, einen struppigen, sandfarbenen Schnurrbart und eine ernsthafte, um nicht zu sagen überzeugende Art. Er war so gekleidet, wie man es vom Chefsekretär der Firma Waddington & Forbes, einem drittklassigen Auktionshaus und Immobilienmakler, erwarten würde. Er ließ einen Schlüsselbund in seiner Hand baumeln.
„Wenn Ihnen dieses Haus nicht zusagt, Sir“, erklärte er selbstbewusst, „dann gibt es im gesamten West End kein anderes, das Ihnen gefallen würde. Das ist jedenfalls meine Meinung. In unseren Unterlagen gibt es nichts, was in Bezug auf Wert und Ausstattung damit vergleichbar wäre. Wir hätten es letzte Woche beinahe an Lord Leconside vermietet, aber Ihre Ladyschaft – sie hat sich selbst mit mir umgesehen – entschied, dass es ein klein wenig zu groß sei. Tatsächlich, Sir“, fuhr der energische junge Mann vertraulich fort, „hat der Gouverneur auf einer Kaution bestanden, und das schien nicht gerade praktisch zu sein. Es sind nicht immer die Leute mit Titeln, die das Geld haben. Das merken wir in unserem Geschäft, Sir, genauso schnell wie alle anderen. Was die Dampfheizung angeht, von der Sie gesprochen haben, Mr. Lynn, nun, die ist für New York vielleicht in Ordnung“, fuhr er überzeugend fort, „aber hier ist das Klima dafür nicht geeignet – Sie können mir glauben, dass das so ist, Mr. Lynn. Ich vermiete genauso viele Häuser wie die meisten anderen Leute, und du kannst dich auf meine Erfahrung verlassen, dass sie hier keine haben wollen – zu keinem Preis, Sir. Wir finden es äußerst ungesund, und es führt immer zu einer seltenen Häufung von Erkältungen und Husten, die denen, die an ein ehrliches Kohlefeuer gewöhnt sind, unbekannt ist. Es ist schließlich alles eine Frage des Klimas, nicht wahr?“
Der junge Mann machte eine Pause, um Luft zu holen. Sein Kunde, der aufmerksam, aber mit düsterer Miene und ohne Wertschätzung zugehört hatte, nahm seine Zigarre aus dem Mund. Er war ein Amerikaner mittleren Alters, dessen Frau und Töchter aus New York zu ihm kommen würden, und seine Aufgabe war es, vor ihrer Ankunft ein Haus zu finden. Es war keine Arbeit, die ihm gefiel, aber er machte das Beste daraus. Dieser junge Mann sprach seinen Geschäftssinn an.
„Sag mal“, bemerkte er anerkennend, „du hast gelernt, wie man in deinem Beruf redet!“
Durch diese Ermutigung angespornt, setzte Alfred Burton seinen Hut etwas fester auf, holte tief Luft und machte sich erneut an die Arbeit.
„Aber ich gönne mir heute Morgen eine Pause, Sir!“, erklärte er. „Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, Ihnen mehr als die nackten Fakten zu erzählen. Über dieses Haus muss man nicht reden – es braucht kein Wort der Erklärung. Die letzten Worte, die Ihre Ladyschaft an uns richtete – Lady Idlemay, die Besitzerin des Hauses – waren: ‚Mr. Waddington und Mr. Burton‘, sagte sie – sie sprach zu uns beiden, denn der Gouverneur stellt mich meinen Kunden immer als denjenigen vor, der den größten Teil der Vermietungen übernimmt – ‚Mr. Waddington und Mr. Burton', sagte sie, 'wenn ein Mieter kommt, von dem ihr glaubt, dass ich ihn gerne in meinen Zimmern wohnen und meine Möbel benutzen lassen würde, sozusagen meine Luft atmen lassen würde, dann vermietet das Haus ruhig, denn die Mieten sind momentan erschreckend niedrig, wegen der Krise in der Landwirtschaft und was weiß ich noch alles, aber lieber verzichte ich auf das Geld, als es nicht an vornehme Leute zu vermieten', erklärte Ihre Ladyschaft. „Sie sind genau die Art von Mieter, die sie hier gerne hätte. Da bin ich mir ganz sicher, Mr. Lynn. Es wäre mir eine Freude, Sie beide zusammenzubringen.“
Mr. Lynn grunzte. Er war sich völlig bewusst, dass das Haus für seine Frau und seine Töchter allein schon deshalb attraktiver erscheinen würde, weil es einer „Lady“ gehörte. Er war sich auch völlig bewusst, dass sein Begleiter dies vermutet hatte. Die Betrachtung dieser Tatsachen ließ ihn jedoch unbeeindruckt. Wenn überhaupt, war er geneigt, die Klugheit des jungen Mannes zu bewundern, der einen externen Vorteil erkannt hatte.
„Nun, ich habe mir alles ziemlich genau angesehen“, bemerkte er. „Ich werde jedenfalls mit Ihnen ins Büro zurückgehen und mit Herrn Waddington sprechen. Übrigens, was ist das für ein Raum hinter Ihnen?“
Der junge Mann warf einen flüchtigen Blick auf die Tür des Schicksalszimmers und dann auf den Schlüsselbund, den er in der Hand hielt. Er kicherte sogar, als er antwortete.
„Ich wollte gerade die Sache mit diesem Raum ansprechen, Sir“, antwortete er, „denn wenn der Mieter einverstanden ist, möchte Ihre Ladyschaft ihn gerne verschlossen halten.“
„Verschlossen?“, wiederholte Mr. Lynn. „Und warum?“
„Eine seltsame Geschichte, Sir“, erklärte der junge Mann vertraulich. „Der verstorbene Graf war, wie Sie vielleicht gehört haben, ein großer Reisender im Osten, und er stöberte immer in irgendwelchen Ruinenstädten in der Wüste herum, sammelte Dinge und machte Entdeckungen. Als er das letzte Mal aus dem Ausland zurückkam, brachte er einen alten Ägypter oder Araber mit – ich weiß nicht, was er war, aber er war braun –, ließ ihn in diesem Zimmer wohnen – in seinem eigenen Haus, wohlgemerkt – und wollte auf keinen Fall, dass man ihn störte oder sich einmischte. Der alte Mann arbeitete hier Tag und Nacht an irgendwelchen Schriften, und dann, was natürlich war, da er nicht das Essen bekam, das er mochte, und nie vor die Tür ging, krepierte er.
„Er was?“, warf Mr. Lynn ein.
„Er ist gestorben“, erklärte der junge Mann. „Das war ungefähr zu der Zeit, als der Earl selbst krank war. Seine Lordschaft gab die Anweisung, dass die Leiche beerdigt und das Zimmer verschlossen werden sollte, für den Fall, dass die Erben des alten Mannes auftauchen sollten. Anscheinend hatte er ein paar seltsame Sachen mitgebracht – nichts von Wert. Jedenfalls war das der Wunsch von Lord Idlemay, und seitdem ist das Zimmer verschlossen.“
Mr. Lynn war interessiert.
„Sie haben doch nichts dagegen, wenn wir uns kurz umsehen, oder?“
„Überhaupt nicht“, erklärte der junge Mann prompt. „Ich wollte selbst einen Blick hineinwerfen. Los geht's!“
Er steckte den Schlüssel ins Schloss und drückte die Tür auf. Mr. Lynn machte einen Schritt nach vorne und wich dann hastig zurück.
„Danke!“, sagte er. „Das reicht! Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte – und gerochen!“
Herr Alfred Burton hatte, zum Glück oder zum Pech, eine weniger empfindliche Nase und eine unerschütterliche Neugier. Der Raum war dunkel und stickig, und als die Tür aufging, schlug ihnen eine Welle stechenden Geruchs entgegen. Trotzdem machte er sie nicht sofort wieder zu.
„Einen Moment!“, murmelte er und spähte hinein. „Ich schaue mich nur kurz um und vergewissere mich, dass alles in Ordnung ist.“
Er überschritt die Schwelle und betrat den Raum. Es war zweifellos eine seltsame Wohnung. Die Wände waren nicht mit Tapeten, sondern mit Teppichen aus orientalischem Material behängt, was die Düsternis noch verstärkte. Es gab weder Stühle noch Tische – eigentlich überhaupt keine nennenswerten Möbel –, aber in der hintersten Ecke lag ein großer Stapel Kissen, und daneben auf dem Boden stand ein schlichter Streifen Sandelholz, bedeckt mit einem purpurfarbenen Tuch, auf dem mehrere quadratische Blätter Papier, ein Messing-Tintenfass und ein Bündel Federkiele lagen. Am äußersten Ende dieses Holzstreifens, der offenbar von jemandem, der auf den Kissen lag, als Schreibtisch benutzt worden war, befand sich der seltsamste Gegenstand von allen. Alfred Burton starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Es war eine winzige Pflanze, die aus einem kleinen Blumentopf wuchs, mit echten grünen Blättern und einer Traube seltsamer kleiner brauner Früchte, die zwischen ihnen herabhingen.
„Mensch!“ rief der Angestellte aus. „Ich meine, Mr. Lynn, Sir!“
Aber Mr. Lynn war wieder in den Speisesaal gegangen, um dort auf und ab zu gehen. Burton ging langsam vorwärts und bückte sich über die Kissen. Er nahm die Blätter Papier, die auf der Sandelholzplatte lagen. Sie waren mit völlig unentzifferbaren Zeichen bedeckt, bis auf die letzte Seite, und dort sah er, während er sie in den Fingern hielt, unter dem abschließenden Absatz dieser unverständlichen Hieroglyphen ein paar Worte in blasser englischer Schrift, mühsam gedruckt, wahrscheinlich eine Übersetzung. Er zündete ein Streichholz an und las sie langsam für sich selbst:
„Es ist vollbracht. Die neunzehnte Generation hat gesiegt. Wer von den braunen Früchten dieses Baumes isst, wird die Dinge des Lebens und des Todes so sehen, wie sie sind. Wer isst ...“ Die Übersetzung endete abrupt. Mr. Alfred Burton nahm seinen Zylinderhut ab und kratzte sich nachdenklich am Kopf.
„Was für ein seltsamer Witzbold muss das gewesen sein“, sagte er zu sich selbst. „Ich frage mich, worauf er hinauswollte?“
Sein Blick fiel auf den kleinen Baum. Er fühlte die Erde im Topf – sie war ziemlich trocken. Der Baum selbst war jedoch frisch und grün.
„Hier kommt eine braune Bohne“, fuhr er fort und pflückte eine.
Selbst als er sie zwischen den Fingern hielt, zögerte er noch.
„Ich glaube nicht, dass sie mir schaden wird“, murmelte er zweifelnd.
Natürlich kam keine Antwort. Mr. Alfred Burton lachte nervös vor sich hin. Die Schatten im Raum und der seltsame Duft waren ein wenig beunruhigend.
„Ich riskiere es trotzdem“, entschied er. „Los geht's!“ Er hob die kleine braune Frucht, die tatsächlich ein bisschen wie eine Bohne aussah, an seinen Mund und schluckte sie. Er fand sie ziemlich geschmacklos, aber kaum hatte er das getan, erschreckte ihn ein komisches Summen in seinen Ohren und ein kurzzeitiger, aber seltsamer Gedächtnisverlust. Er saß da und sah sich um wie jemand, der geschlafen hat und plötzlich in einer fremden Umgebung aufgewacht ist. Dann riss ihn die Stimme seines Kunden plötzlich wieder in die Realität zurück. Er sprang auf und spähte durch die Dunkelheit.
„Wer ist da?“, fragte er scharf.
„Hey, junger Mann, ich warte auf dich, wenn du fertig bist“, sagte Mr. Lynn von der Türschwelle aus. „Seltsame Atmosphäre hier drin, nicht wahr?“
Mr. Alfred Burton kam langsam heraus und schloss die Tür des Raumes ab. Selbst dann war ihm noch vage bewusst, dass etwas mit ihm passiert war. Er hasste den muffigen Geruch des Ortes, den staubigen, ungefegten Flur und die allgemeine Atmosphäre der Verlassenheit. Er wollte raus auf die Straße und drängte seinen Mandanten zur Eingangstür. Sobald er abgeschlossen hatte, atmete er erleichtert auf.
„Was für ein herrlich sanfter Wind!“, rief er aus und nahm seinen unansehnlichen Hut ab. „Wirklich, ich finde, wenn wir einen sonnigen Tag wie diesen haben, ist der April fast unser schönster Monat.“
Mr. Lynn starrte seinen Begleiter an, der nun langsam die Stufen hinunterging.
„Sagen Sie mal, was dieses Haus angeht“, begann er, „ich glaube, ich nehme es besser. Es ist vielleicht nicht ganz das, was ich mir wünsche, aber es scheint mir so nah wie alles andere zu sein, was ich finden könnte. Wir gehen gleich zum Büro und regeln alles.“
Herr Alfred Burton schüttelte zweifelnd den Kopf.
„Ich würde es an deiner Stelle nicht nehmen, Mr. Lynn“, sagte er.
Mr. Lynn blieb auf dem Bürgersteig stehen und schaute seinen Begleiter erstaunt an. Dieser wirkte, als würde ihn das Gesprächsthema kaum interessieren. Er beobachtete zustimmend, wie ein Blumenverkäufer mitten auf der Straße eine Schubkarre voller Flieder und anderer Frühlingsblumen vorbeischob.
„Was für ein herrlicher Duft!“, murmelte der junge Mann begeistert. „Erinnert Sie das nicht an einen wunderschönen Garten irgendwo auf dem Land, Mr. Lynn – einen dieser altmodischen Gärten mit schmalen Wegen, auf denen man sich durch die Blumen drängen muss und wo es immer große Beete mit rosa und weißen Stockrosen am Rand gibt? Und haben Sie bemerkt – natürlich nur zufällig –, was für eine zarte Farbkombination der Flieder und die gelben Narzissen bilden?“
„Ich kann nichts riechen“, erklärte der Amerikaner etwas ungeduldig, „und ich weiß auch nicht, ob ich das gerade möchte. Ich bin hier, um über Geschäfte zu reden, wenn es dir nichts ausmacht.“
„Einen Moment“, antwortete Burton. „Entschuldige mich bitte kurz.“
Er eilte über die Straße und kam einen Moment später mit einem Strauß Veilchen in der Hand zurück. Mr. Lynn beobachtete ihn, teils erstaunt, teils missbilligend. Von dem klugen, geschäftstüchtigen jungen Mann, dessen Methoden ihm noch vor kurzem widerwillige Bewunderung abgerungen hatten, schien nur noch wenig übrig zu sein. Mr. Alfred Burtons Gesichtsausdruck hatte sich völlig verändert. Seine Augen hatten ihr berechnendes Funkeln verloren, sein Mund war weicher geworden. Ein freundliches, aber etwas abwesendes Lächeln hatte seine gezwungene Freundlichkeit ersetzt.
„Sie werden mir doch verzeihen, oder?“, sagte er, als er wieder auf den Bürgersteig trat. „Ich habe vor diesem Jahr wirklich noch nie Veilchen gerochen. Der Frühling kommt für uns Londoner so plötzlich.“
„Also, wegen dem Haus“, drängte der Amerikaner etwas scharf.
„Klar“, antwortete Burton und nahm widerwillig seinen Blick von dem vorbeifahrenden Handkarren ab. „Ich glaube wirklich nicht, dass du es nehmen solltest, Mr. Lynn. Weißt du, es ist zwar nicht allgemein bekannt, aber es besteht kein Zweifel, dass Lord Idlemay dort Typhus hatte.“
„Typhus!“, rief Mr. Lynn ungläubig aus.
Sein Begleiter nickte.
„Zwei der Bediensteten hatten es auch“, fuhr er fort. „Wir haben Lady Idlemay, als sie uns das Haus zur Miete anbot, gebeten, die Abflüsse gründlich in Ordnung zu bringen, aber als wir ihr den Kostenvoranschlag vorlegten, lehnte sie das rundweg ab. Um ehrlich zu sein, hatten unter diesen Umständen alle guten Makler abgelehnt, das Haus überhaupt in ihr Angebot aufzunehmen. Deshalb haben wir es bekommen.“
Mr. Lynn nahm die Zigarre für einen Moment aus dem Mund. Er runzelte leicht die Stirn. Er war verwirrt.
„Sag mal, du willst mich doch nicht aus irgendeinem Grund angreifen, oder?“, fragte er.
„Mein lieber Herr!“, protestierte Burton eifrig. „Ich tue nur meine Pflicht und sage Ihnen die Wahrheit. Das Haus ist nicht in einem Zustand, in dem es an irgendjemanden vermietet werden kann – schon gar nicht an einen Mann mit Familie. Wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten: Sie gehen nicht den richtigen Weg, um ein geeignetes Haus zu finden. Sie sind einfach in unser Büro gekommen, weil Sie das Schild gesehen haben, und haben sich alles angehört, was der Chef zu sagen hatte. Wir haben überhaupt keine Häuser im West End in unserem Bestand. Das ist leider nicht unser Geschäft. Miller & Sons oder Roscoe's sind die besten Adressen. Niemand würde Sie im Idlemay House auch nur besuchen wollen, geschweige denn dort wohnen – das Haus hat einen so schlechten Ruf.“
„Dann erklär mir doch bitte, warum du vor ein paar Minuten so begeistert davon gesprochen hast“, verlangte Mr. Lynn empört. „Ich hätte das verdammte Haus fast genommen!“
Mr. Burton schüttelte reumütig den Kopf.
„Ich fürchte, ich kann es dir nicht erklären, Sir“, gestand er. „Um ehrlich zu sein, verstehe ich selbst nicht, wie ich mich dazu bringen konnte, so unehrlich zu sein. Ich bin nur dankbar, dass kein Schaden entstanden ist.“
Sie hatten die Straßenecke erreicht, an der sich die Büros von Messrs. Waddington & Forbes befanden. Mr. Lynn blieb abrupt stehen.
„Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht hier trennen sollten, junger Mann“, erklärte er. „Nachdem du mir das erzählt hast, macht es keinen Sinn, dass ich mit in dein Büro komme.“
„Das hat es wirklich nicht“, gab Mr. Burton offen zu. „Es ist sogar besser, wenn Sie gehen. Mr. Waddington würde sicherlich versuchen, Sie zu überreden, das Haus zu nehmen. Wenn Sie meinen Rat annehmen möchten, Sir, gehen Sie zu Miller & Sons in St. James's Place. Die haben die besten Häuser in ihrem Angebot und werden mit ziemlicher Sicherheit etwas finden, das Ihnen gefällt.“
Mr. Lynn schaute seinen Begleiter noch einmal neugierig an.
„Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie ich dich einschätzen soll“, sagte er. „Zuerst dachte ich, du wärst ein seltener kleiner Gauner, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Ich war gegen dieses Haus, und doch hast du mich fast davon überzeugt, es zu nehmen. Was ist eigentlich mit dir los?“
Mr. Burton schüttelte zweifelnd den Kopf.
„Ich fürchte, es hat keinen Sinn, mich zu fragen“, antwortete er, „denn ich weiß es selbst nicht so recht.“
Mr. Lynn blieb noch einen Moment stehen. Je länger er seinen Begleiter ansah, desto mehr schätzte er die subtile Veränderung in seinem Verhalten und seiner Sprache, die Mr. Alfred Burton zweifellos verwandelt hatte.
„Es war, nachdem du aus diesem kleinen Raum gekommen bist“, fuhr er nachdenklich fort, „in dem dieser Orientalische Typ eingesperrt war. Je mehr ich darüber nachdenke, desto seltsamer kommt es mir vor. Du warst munter wie ein Hase, als du hineingegangen bist, und seit du herausgekommen bist, bist du irgendwie benommen.“
Mr. Burton hob seinen Hut.
„Guten Tag, Sir!“, sagte er. „Ich hoffe, Sie finden eine Wohnung, die Ihnen gefällt.“
Mr. Lynn schlenderte mit verwirrtem Stirnrunzeln davon, und Alfred Burton schob mit einer leichten Geste der Abneigung die Schwenktüren auf, die zu den Büros von Messrs. Waddington & Forbes führten.
KAPITEL II
Burton blieb einen Moment lang an der Türschwelle des Büros stehen und schaute sich um. Plötzlich verspürte er eine neue und seltsame Abneigung gegen diese vertraute Umgebung. Zum ersten Mal wurde ihm bewusst, wie hässlich dieser Ort war, an dem er jeden Tag arbeitete. Der lange Schreibtisch, mit Tintenflecken übersät und ziemlich runtergekommen, war voll mit unordentlichen Papierstapeln, von denen einige ziemlich staubig waren; an den Wänden hingen schäbige Aktenordner und eine Reihe zerfledderter Rechnungen; in jeder Ecke gab es Spinnweben, und der Linoleumboden hatte Lücken. Vor dem Bürogehilfen – einem etwa vierzehnjährigen Jugendlichen, der das einzige verbleibende Büropersonal der Firma darstellte – waren mehrere Illustrationen aus Comic Cuts, Police News und verschiedenen anderen Publikationen ähnlicher Art aufgehängt. Als Burton sich umschaute, wuchs seine Abneigung. Es schien ihm unmöglich, dass er jemals auch nur eine Stunde in einer solchen Umgebung verbracht hatte. Die Aussicht auf die Zukunft war ihm plötzlich äußerst zuwider.
Ganz langsam zog er seinen Mantel aus und kletterte auf seinen abgenutzten Pferdehaarschemel, ohne sich mit dem einzigen verbliebenen Mitarbeiter wie sonst üblich scherzhaft zu unterhalten. Der Bürogehilfe, der sich etwas Witziges zu sagen überlegt hatte, war ziemlich verärgert über sein Schweigen. Das zwang ihn, die Initiative zu ergreifen, was ihn von Anfang an in eine ungünstige Lage brachte.
„Hatten Sie Glück mit dem Yankee, Mr. Burton?“, fragte er mit besorgter Höflichkeit.
Burton schüttelte den Kopf.
„Überhaupt nicht“, gab er zu. „Er wollte nichts mit dem Haus zu tun haben.“
„Glaubst du, jemand hat ihm davon erzählt?“
„Ich glaube nicht“, antwortete Burton. „Ich glaube nicht, dass ihm jemand davon erzählt hat. Er scheint hier ein völliger Fremder zu sein.“
„Sie waren vielleicht nicht ganz bei sich, Mr. Burton? Nicht so eloquent wie sonst, oder?“
Der Junge grinste und duckte sich dann, weil er mit einem Wurfgeschoss rechnete. Es kam jedoch keines. Alfred Burton war sehr verwirrt und zeigte weder Groll, noch empfand er welchen. Er drehte sich um und sah seinen Untergebenen an.
„Ich weiß es wirklich nicht, Clarkson“, gab er zu. „Ich bin mir sicher, dass ich sehr höflich war und ihm alles gezeigt habe, was er sehen wollte, aber natürlich musste ich ihm die Wahrheit über diesen Ort sagen.“
„Die Wahrheit?“, fragte der junge Clarkson verwirrt.
„Die Wahrheit“, wiederholte Burton.
„Was meinst du damit?“
„Über die Typhuserkrankung und so“, erklärte Burton ruhig.
Der Bürogehilfe dachte einen Moment nach. Dann öffnete er langsam ein Hauptbuch, zog ein Tagesbuch zu sich heran und machte mit seiner Arbeit weiter. Er wurde natürlich auf den Arm genommen, aber das war ihm im Moment zu subtil. Er beschloss, den nächsten Schritt abzuwarten. Burton beobachtete seinen Untergebenen jedoch weiterhin, und allmählich zeigte sich ein Ausdruck schmerzhafter Missbilligung in seinem Gesicht.
„Clarkson“, sagte er, „wenn Sie mir gestatten, eine rein persönliche Angelegenheit anzusprechen: Warum tragen Sie so unbequeme Kragen und eine so unvorteilhafte Krawatte?“
Der Bürogehilfe drehte sich auf seinem Hocker um. Sein Mund stand weit offen wie der eines Kaninchens. Er fingerte an den beanstandeten Kleidungsstücken herum.
„Was stimmt denn damit nicht?“, fragte er und brachte seine Frage in einem einzigen Atemzug heraus.
„Deine Kragen sind viel zu hoch“, wies Burton ihn hin. „Man sieht, wie sie dir in den Hals schneiden. Und warum trägst du eine Krawatte in diesem leuchtenden Lila, wenn deine Kleidung mit den blauen und gelben Streifen schon auffällig genug ist? Das Ganze wirkt unharmonisch, es fehlt jeglicher Geschmack, was deprimierend wirken kann. Der Gesamteindruck, den du auf den Betrachter machst, ist abscheulich. Du nimmst mir das hoffentlich nicht übel, dass ich das erwähne?“
„Was ist mit deiner eigenen roten Krawatte und deinem schmutzigen Kragen?“, fragte der junge Clarkson empört. „Was ist mit deiner 8-Shilling-6-Pence-Hose mit den blauen Streifen und den Fettflecken? Was ist mit dem unechten Diamantknopf in deinem Weste und deinen 7,5 cm langen, angehefteten Manschetten? Du findest dein Aussehen vielleicht schick! Ich würde in so einer Aufmachung nicht auf die Straße gehen!“
Burton hörte sich die Attacke seines jüngeren Kollegen ohne Groll, aber mit wachsender Verwirrung an. Dann stand er von seinem Stuhl auf und ging hastig zum Spiegel, den er von seinem Nagel nahm. Er betrachtete sich lange und aufmerksam aus jedem möglichen Blickwinkel. Wahrscheinlich sah er sich damals zum ersten Mal in seinem Leben so, wie er wirklich war. Er war unscheinbar, von unbedeutender Erscheinung, er war krank und geschmacklos gekleidet. Er stand vor dem billigen Spiegel und trank den Kelch der Demütigung.
„Meine Krawatte, ja!“ murmelte der Bürogehilfe, und sein schwelender Groll brachte ihn wieder auf den Angriff. „Ein Geschenk von meiner besten Freundin, und sie weiß, was gut ist. Eine junge Dame, die in einem Hutgeschäft im West End arbeitet. Wenn das kein guter Geschmack ist, dann weiß ich auch nicht. Schau dir auch deine Socken an, die rutschen dir über die Stiefel! Hässliche, schmutzige rosa und grüne Streifen! Und noch was zu meinem Kragen“, fuhr er fort und sprach mit neuer Ernsthaftigkeit, als er die Fassungslosigkeit seines Vorgesetzten bemerkte. „Der war gestern sauber, und das ist mehr, als man von deinem sagen kann – oder vom Tag davor!“
Burton zitterte, als er sich endlich von dem Spiegel abwandte. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war unbeschreiblich.
„Es tut mir leid, dass ich etwas gesagt habe, Clarkson“, entschuldigte er sich demütig. „Ich habe offenbar vergessen, dass ich selbst – ich kann mir nicht vorstellen, wie ich solche schrecklichen, unverzeihlichen Fehler begehen konnte.“
„Wo wir gerade dabei sind“, fuhr sein Untergebener gnadenlos fort, „warum schrubbst du dir nicht ab und zu mal die Fingernägel? Du könntest auch deinen Mantel ab und zu bürsten, wenn du schon dabei bist. Er ist voller Hautschuppen und Staub um die Schultern! Ich bin ganz für Sauberkeit, wirklich.“
Burton sagte nichts. Er war am Boden und sein Junior trat ihn.
„Ich würde gerne die Farbe deines Hemdes sehen, wenn du diese Papiermanschetten abnehmen würdest!“, rief dieser aus. „Warum wirfst du dieses miese Unterhemd nicht weg? Cave!“
Die Tür zum Privatbüro wurde abrupt geöffnet. Mr. Waddington, das einzige noch lebende Mitglied der Firma, kam herein – ein großer, ungepflegt aussehender Mann, ebenfalls sehr unvorteilhaft gekleidet und mit einem schlecht gebürsteten Seidenhut auf dem Hinterkopf. Er wandte sich sofort an seinen rechten Mann.
„Na, hast du ihn an Land gezogen?“, fragte er mit einer gewissen Ungeduld.
Burton schüttelte bedauernd den Kopf.
„Es war völlig unmöglich, sein Interesse für das Haus zu wecken, Sir“, erklärte er. „Zuerst schien er geneigt zu sein, es zu nehmen, aber sobald er die Situation verstanden hatte, wollte er nichts mehr damit zu tun haben.“
Mr. Waddingtons Gesicht verzog sich. Er war enttäuscht. Er war auch verwirrt.
„Die Situation verstanden“, wiederholte er. „Was zum Teufel meinst du damit, Burton? Welche Situation?“
„Ich meine die Typhuserkrankung, Sir, und Lady Idlemays Weigerung, die Abflüsse reparieren zu lassen.“
Mr. Waddingtons Gesichtsausdruck war für einen Moment interessant und aufschlussreich. Sein Kiefer war heruntergefallen, aber er war immer noch zu verwirrt, um die Situation richtig zu begreifen.
„Aber wer hat ihm das gesagt?“, keuchte er.
„Ich“, antwortete Burton sanft. „Ich konnte ihn unmöglich in Unkenntnis über die Tatsachen lassen.“
„Du konntest nicht – was?“
„Ich konnte ihm das Haus nicht überlassen, ohne ihm alle Umstände zu erklären, Sir“, erklärte Burton und beobachtete seinen Vorgesetzten besorgt. „Ich bin sicher, Sie hätten mir so etwas nicht gewünscht, oder?“
Was Mr. Waddington sagte, war unwichtig. Er vergaß nur sehr wenig und war ein Auktionator mit einer Kundschaft aus der Unterschicht und einer gewandten Ausdrucksweise. Als er fertig war, war der Bürogehilfe sprachlos vor Bewunderung. Burton sah ein wenig gequält aus und hatte den schockierten Gesichtsausdruck eines Musikers, der eine Reihe von Disharmonien gehört hat. Ansonsten blieb er ungerührt.
„Deine Aufgabe war es, dieses Haus zu vermieten“, schloss Mr. Waddington und schlug mit der Faust auf seine Handfläche. „Wofür bezahle ich Ihnen vierundvierzig Schilling pro Woche, würde ich gerne wissen? Damit Sie jedem Kunden, der hereinkommt, Geschäftsgeheimnisse ausplaudern? Wenn Sie ihn nicht dazu bringen konnten, den Mietvertrag zu unterschreiben, hätten Sie zumindest eine Kaution aushandeln sollen. Die hätte er dann auch dann verloren, wenn er es später herausgefunden hätte.“
„Es tut mir leid“, sagte Burton mit einer für ihn ungewöhnlich leisen Stimme, aber mit einer seltsamen Selbstsicherheit. „Es wäre moralisch falsch gewesen, wenn ich so was versucht hätte. Ich konnte Herrn Lynn oder irgendjemand anderem das Haus unmöglich anbieten, ohne seine Nachteile offenzulegen.“
Das Gesicht des Auktionators war noch röter geworden. Seine Augen schienen aus seinem Kopf herauszuspringen. Er wurde fast unverständlich.
„Gott segne meine Seele!“, stammelte er. „Bist du verrückt geworden, Burton? Was ist seit heute Morgen mit dir los? Hast du dich in einen kompletten Idioten verwandelt, oder was?“
„Ich glaube nicht, Sir“, antwortete Burton ernst. „Ich kann mich im Moment nicht genau erinnern“, fuhr er mit leicht gerunzelter Stirn fort. „Mein Kopf scheint ein wenig verwirrt zu sein, aber ich kann nicht glauben, dass es unsere Gewohnheit ist, unsere Geschäfte auf die von Ihnen vorgeschlagene Weise zu führen.“
Mr. Waddington ging im Büro auf und ab und hielt seinen Kopf in den Händen.
„Ich nehme nicht an, dass einer von uns beiden um diese Uhrzeit schon getrunken hat“, murmelte er, als er wieder stehen blieb. „Hör mal, Burton, ich will nichts Übereiltes tun. Geh nach Hause – egal wie spät es ist – geh sofort nach Hause, bevor ich wieder ausraste. Komm morgen früh wie gewohnt. Dann reden wir darüber. Gott segne meine Seele!“, fügte er hinzu, als Burton mit einem leisen Seufzer der Erleichterung seinen Hut nahm und sich zur Tür wandte. „Entweder bin ich betrunken oder der Kerl ist zum Glauben gekommen oder so etwas! Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Unsinn gehört!“
„Er hat gerade eine böse Bemerkung über meine Krawatte gemacht, Sir“, sagte Clarkson mit Würde, als sein Vorgesetzter verschwunden war. „Völlig unangebracht. Ich glaube nicht, dass es ihm gut geht.“
„Hast du ihn schon mal so erlebt?“, fragte Mr. Waddington.
„Nie, Sir. Ich fand, er wirkte heute Morgen, als er ging, fröhlicher als sonst. Seine letzten Worte waren, dass er mit mir um eine Packung Woodbines wetten würde, dass er den alten Narren für sich gewinnen würde.“
„Er ist verrückt geworden!“, entschied der Auktionator, als er sich wieder in Richtung seines Heiligtums umdrehte. „Entweder ist er verrückt geworden oder er hat getrunken. Der letzte Mensch auf der Welt, von dem ich das gedacht hätte!“
Alfred Burtons Gemütsverfassung, als er auf die Straße hinaustrat, war in mancher Hinsicht eigentümlich. Er empfand nicht im Geringsten Reue über das, was geschehen war. Im Gegenteil, er ertappte sich bei dem Wunsch, man hätte ihm nicht noch einen Tag Aufschub gewährt und sein Abschied von der Arbeitsstelle wäre endgültig gewesen. Er befand sich in der Lage eines Mannes, der ohne Vorwarnung oder Ankündigung von den Straßen Londons auf die Straßen Pekings versetzt worden ist. Jedes Ding, das er sah, betrachtete er mit anderen Augen. Jedes Gesicht, an dem er vorüberging, hinterließ einen anderen Eindruck. Er blickte um sich mit der Gier eines Menschen, der sich plötzlich eines großen Vorrats ungenutzter Eindrücke bewusst wird. Es war wie eine zweite Geburt. Er verstand die Situation weder noch versuchte er, sie zu analysieren. Er war sich lediglich eines höchst angenehmen und unerklärlichen Frohsinns bewusst und einer Fülle von Empfindungen, die ihm in jedem Augenblick neue Freude zu bereiten schienen. Seine erste und dringendste Sorge war eine seltsame: Er verabscheute sich selbst von Kopf bis Fuß. Er schauderte, wenn er an Schaufenstern vorbeiging, aus Angst, sein eigenes Spiegelbild zu erblicken. Zielstrebig begab er sich zu einem Herrenausstatter und von dort, mit einem Bündel unter dem Arm, zu den Bädern. Es war ein ganz anderer Alfred Burton, der ein oder zwei Stunden später wieder auf die Straße trat. Verschwunden war der junge Cockney mit dem sandfarbenen Schnurrbart, dem billigen Seidenhut, den er in wechselnden Schräglagen trug, um sich ein verwegenes Aussehen zu geben, die auffällige Kleidung, billig und prahlerisch, das selbstsichere, um nicht zu sagen großspurige Auftreten, das er so eifrig dem Gebaren seines Arbeitgebers abgeschaut hatte. An seine Stelle trat ein neuer, völlig verwandelter Alfred Burton, ein harmlos wirkender junger Mann in einem schlichten grauen Anzug, mit einer lavendelfarbenen Krawatte von zarter Nuance, einem Flanellhemd ohne jeglichen Anspruch auf Manschetten, aber mit einem makellos umgelegten Kragen, einem weichen Homburg-Hut und glatt rasiertem Oberlippenbart. Mit einem neuen Gefühl von Selbstachtung und einer ungeheuren Erleichterung wandte Burton, nach kurzem Zögern, seine Schritte der Nationalgalerie zu. Er war vor Jahren einmal dort gewesen, an einem verregneten Feiertag, und ein schwacher Instinkt der Erinnerung, der irgendwie die Last seiner tristen Tage überdauert hatte, regte sich plötzlich wieder. Er stieg die Stufen empor und durchschritt die Pforte mit dem klopfenden Herzen eines Entdeckers, der seinen letzten Hügel erklimmt. Dies war sein Eintritt in die neue Welt, deren Ruf an seinen Herzenssaiten zerrte. Er kaufte keinen Katalog, stellte keine Fragen. Von Saal zu Saal schritt er mit unermüdlichen Schritten. Sein ganzes Wesen war erfüllt von unermesslicher Erleichterung, von fast leidenschaftlicher Freude, wie sie nur der empfinden kann, der zum ersten Mal einen neuen und wunderbaren Hunger stillen darf. Mit seinen Augen, seiner Seele, all diesen spät erwachten, fremden, empfänglichen Kräften diente er einem Verlangen, das unstillbar schien. Es war bereits dämmerig, als er wieder hinaustrat, mit brennenden Wangen und leuchtenden Augen. Er trug eine neue Musik in sich, eine ganze Welt neuer Freuden, doch seine tiefste Empfindung war ein glühendes, leidenschaftliches Mitgefühl. Großartig waren sie, diese Helden, die die Wahrheit erkannt und gerungen hatten, ihr mit Stift oder Pinsel oder Meißel Leben zu verleihen, damit auch andere sehen und verstehen konnten. Wenn man doch nur seinen kleinen Teil dazu beitragen könnte!
Er ging langsam weiter, in Gedanken versunken, ohne zu merken, wohin ihn seine Schritte führten. Als er schließlich stehen blieb, stand er vor einem Theater. Der Name Ibsen war gut sichtbar auf dem Schild zu sehen. Aus den verborgenen Winkeln seines Gedächtnisses kam eine vage Erinnerung – ein oder zwei zufällig gelesene Worte, ein Eindruck, den er nur halb verstanden hatte, dessen Keim aber überlebt hatte. Ibsen! Ein Prophet der Wahrheit, ganz sicher! Er schaute gespannt auf das Plakat, um die Ankündigungen und die Eintrittspreise zu sehen. Und dann überkam ihn plötzlich eine kalte Dusche der Erinnerung, die seinen neuen Enthusiasmus dämpfte. Da war Ellen!
KAPITEL III
Da war Ellen tatsächlich! Wie ein Mann auf dem Weg ins Gefängnis nahm Alfred Burton seinen Platz in einem Wagen der dritten Klasse seines üblichen Zuges nach Garden Green ein. Ned Miles, der im Ölhandel tätig war, kam auf ihn zu und klopfte ihm auf die Schulter.
„Sag mal, du Angeber, was hast du mit dir gemacht?“, fragte er erstaunt. „Hast du eine Bank ausgeraubt und bist jetzt verkleidet unterwegs? Die Frau wird dich nicht wiedererkennen!“
Burton zuckte ein wenig zurück. Seine Augen schienen von einer unbestimmten Abneigung erfüllt zu sein, als er den Blick des anderen erwiderte.
„Ich mag meine alte Art, mich zu kleiden, nicht mehr“, antwortete er einfach, „und meinen Schnurrbart auch nicht.“
„Du magst ihn nicht mehr – du meine Güte!“, rief sein ehemaliger Freund aus. „Ich hätte dich nie erkannt! Du magst den nicht mehr – hey, Alf, ist das ein Scherz?“
„Überhaupt nicht“, antwortete Burton ruhig. „Es ist die Wahrheit. Es ist eine dieser Angelegenheiten, denke ich“, fuhr er fort, „die in erster Linie einen selbst betreffen.“
„Kein Grund, sich darüber aufzuregen“, meinte Mr. Miles, immer noch ein wenig benommen. „Komm rein und trink ein Bierchen mit den Jungs. In dieser Aufmachung werden sie dich nicht erkennen. Wir werden unseren Spaß mit ihnen haben.“
Burton schüttelte den Kopf. Wieder konnte er die Abneigung in seinen Augen und seiner Stimme nicht verbergen.
„Heute Abend nicht, danke.“
Der Zug fuhr gerade los, also musste Miles sich beeilen, aber in Garden Green musste Burton sich den Spott und die Hohnrufe der Jungs anhören, als er den Bahnsteig entlangging. Gestern hatte er sie noch für gute Sportler und tolle Typen gehalten. Heute hatte er keine Worte für sie. Er wusste nur, dass sie ihm auf die Nerven gingen und dass er sie nicht ausstehen konnte. Zum ersten Mal bekam er Angst. Was war mit ihm passiert? Wie sollte er sein normales Leben weiterführen?