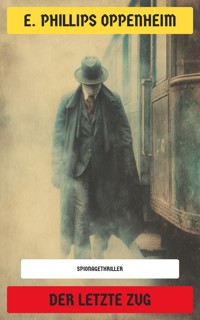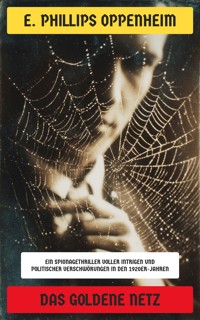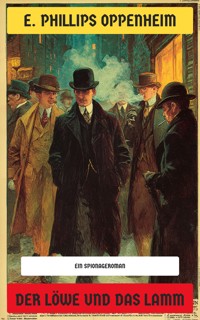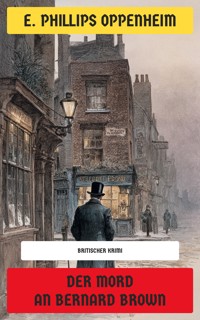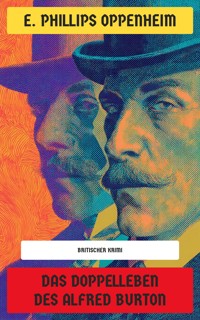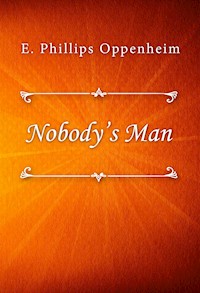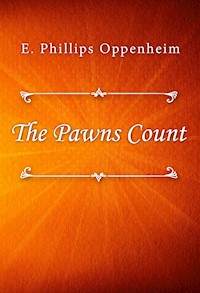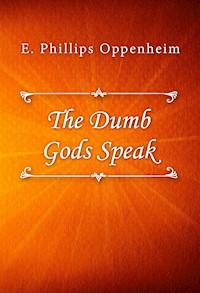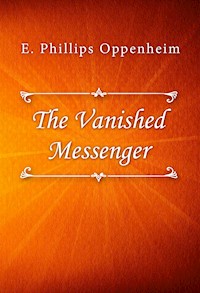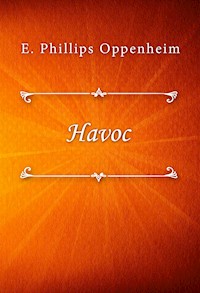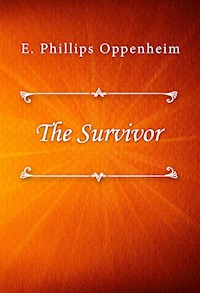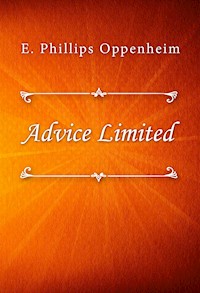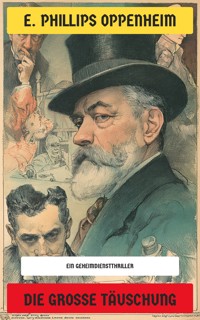
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die große Täuschung entfaltet das Duell zwischen Sir Everard Dominey und seinem deutschen Doppelgänger, dem Offizier Leopold von Ragastein: Wenn nach Jahren in Afrika ein Mann auf sein englisches Landgut zurückkehrt, weiß niemand, ob der Heimkehrer der echte Dominey oder ein eingeschleuster Spion ist. Vor dem Halbdämmer der letzten Vorkriegsjahre verdichtet Oppenheim eine raffinierte Mischung aus Landhaus-Atmosphäre, diplomatischen Salons und geheimdienstlichem Schattenwerk. Elegante, ökonomische Prosa, pointierte Dialoge und subtile Andeutungen treiben Themen wie Identität, Loyalität und soziale Ordnung voran. E. Phillips Oppenheim (1866–1946), der vielfach als "Prince of Storytellers" bezeichnete Pionier des Spionageromans, stammte aus dem Handelsbürgertum und kannte die Welt der europäischen Diplomatie aus Reisen und gesellschaftlichen Kreisen. 1919 schrieb er diesen Roman im Nachhall des Krieges: ein Spiegel der britischen Invasionsängste, des Misstrauens gegenüber Eliten und der Verführbarkeit durch glatte Maskenspiele. Dieses Buch empfiehlt sich Leserinnen und Lesern, die intelligente Spannungsliteratur mit historischer Tiefenschärfe suchen. Wer psychologische Verwandlung, politische Intrige und die Kunst der Täuschung schätzt, findet hier einen stilvollen Klassiker, der zugleich als Schlüsseltext des Genres und als zeitdiagnostische Studie besticht. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die große Täuschung
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL I
Die Probleme, die zu großen Ereignissen führen sollten, fingen an, als Everard Dominey, der sich seit einer Dreiviertelstunde durch das Gestrüpp zu den dünnen, spiralförmigen Rauchschwaden gekämpft hatte, sein Pony zu einer letzten verzweifelten Anstrengung antrieb und durch den großen Oleanderstrauch krachte, um dann mit dem Kopf voran auf der kleinen Lichtung zu landen. Am nächsten Morgen wurde ihm klar, dass er sich zum ersten Mal seit vielen Monaten wieder auf einem Rollbett befand, zwischen Leinenlaken, mit einem kühlen, aus Bambus geflochtenen Dach zwischen ihm und der unerbittlichen Sonne. Er richtete sich ein wenig im Bett auf.
„Wo zum Teufel bin ich hier?“, fragte er.
Ein schwarzer Junge, der mit gekreuzten Beinen am Eingang der Banda saß, stand auf, murmelte etwas und verschwand. Nach wenigen Augenblicken beugte sich eine große, schlanke Gestalt eines Europäers in makellos weißer Reitkleidung vor und kam zu Dominey herüber.
„Geht es dir besser?“, fragte er höflich.
„Ja, geht es mir“, war die etwas schroffe Antwort. „Wo zum Teufel bin ich hier, und wer bist du?“
Der Neuankömmling wurde steif. Er war eine Person mit würdevoller Haltung, und sein Tonfall verriet eine gewisse Vorwurfsvollheit.
„Sie befinden sich eine halbe Meile vom Iriwarri-Fluss entfernt, falls Sie wissen, wo das ist“, antwortete er, „etwa 72 Meilen südöstlich der Darawaga-Siedlung.“
„Verdammt! Dann bin ich in Deutsch-Ostafrika?“
„Ohne Zweifel.“
„Und du bist Deutscher?“
„Ich habe diese Ehre.“
Dominey pfiff leise.
„Tut mir echt leid, dass ich störe“, sagte er. „Ich bin vor zweieinhalb Monaten mit zwanzig Jungs und jeder Menge Vorräten aus Marlinstein aufgebrochen. Wir waren auf einer großen Expedition auf der Suche nach Löwen. Ich habe ein paar neue Askaris mitgenommen, die Ärger gemacht haben – sie haben eines Nachts die Vorräte geplündert, und dann gab es Ärger. Ich musste ein oder zwei erschießen, und die anderen sind abgehauen. Sie haben meinen Kompass mitgenommen, diese Mistkerle, und jetzt bin ich fast hundert Meilen von meinem Kurs abgekommen. Könntest du mir vielleicht was zu trinken geben?“
„Gerne, wenn der Doktor einverstanden ist“, war die höfliche Antwort. „Hier, Jan!“
Der Junge sprang auf, hörte sich ein paar kurze Befehle in seiner Sprache an und verschwand durch das hängende Gras, das zu einer anderen Hütte führte. Die beiden Männer tauschten Blicke aus, die mehr als nur normales Interesse zeigten. Dann lachte Dominey.
„Ich weiß, was du denkst“, sagte er. „Ich war ziemlich überrascht, als du hereinkamst. Wir sehen uns verdammt ähnlich, nicht wahr?“
„Es gibt eine sehr starke Ähnlichkeit zwischen uns“, gab der andere zu.
Dominey stützte seinen Kopf auf seine Hand und musterte seinen Gastgeber. Die Ähnlichkeit war offensichtlich, obwohl der Mann, der mit verschränkten Armen neben dem Feldbett stand, eindeutig im Vorteil war. Everard Dominey hatte die ersten 26 Jahre seines Lebens wie ein gewöhnlicher junger Engländer seiner Stellung gelebt – Eton, Oxford, ein paar Jahre in der Armee, ein paar Jahre in der Stadt, in denen es ihm gelungen war, seine ohnehin schon belasteten Ländereien noch hoffnungsloser zu verwahrlosen: ein paar Monate Tragödie, dann eine Leere. Danach folgten zehn Jahre – zunächst in den Städten, dann in den dunklen Gegenden Afrikas –, Jahre, über die niemand etwas wusste. Der Everard Dominey von vor zehn Jahren war zweifellos gutaussehend gewesen. Die fein geformten Gesichtszüge waren geblieben, aber die Augen hatten ihren Glanz verloren, seine Figur ihre Elastizität, sein Mund seine Festigkeit. Er sah aus wie ein Mann, der vorzeitig gealtert war, ausgezehrt von Fieber und Ausschweifungen. Nicht so sein jetziger Begleiter. Seine Gesichtszüge waren ebenso fein geformt, aber noch kräftiger, wenn auch ähnlich. Seine Augen waren hell und voller Feuer, sein Mund und sein Kinn fest, was auf einen Mann der Tat hindeutete, seine große Gestalt war geschmeidig und beweglich. Er strahlte perfekte Gesundheit aus, war geistig und körperlich in Topform, ein Mann, der trotz seines leicht ernsten Gesichtsausdrucks mit Würde und einer gewissen Zufriedenheit lebte.
„Ja“, murmelte der Engländer, „die Ähnlichkeit ist unbestreitbar, obwohl ich wohl mehr wie du aussehen würde, wenn ich besser auf mich geachtet hätte. Aber das habe ich nicht. Das ist das Schlimme daran. Ich habe den umgekehrten Weg eingeschlagen; ich habe versucht, mein Leben wegzuwerfen, und das ist mir auch fast gelungen.“
Das vertrocknete Gras wurde beiseite geschoben, und der Arzt kam herein – ein kleiner, rundlicher Mann, ebenfalls in makellosem Weiß gekleidet, mit goldgelbem Haar und einer dicken Brille. Sein Landsmann zeigte auf das Bett.
„Würden Sie unseren Patienten untersuchen, Herr Doktor, und ihm das verschreiben, was er braucht? Er hat um etwas zu trinken gebeten. Geben Sie ihm Wein oder was auch immer ihm gut tut. Wenn es ihm gut genug geht, wird er an unserem Abendessen teilnehmen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich muss noch eine Depesche schreiben.“
Der Mann auf der Couch drehte den Kopf und beobachtete die sich entfernende Gestalt mit einem Hauch von Neid in den Augen.
„Wie heißt mein Retter?“, fragte er den Arzt.
Dieser sah ihn an, als seien die Fragen respektlos.
„Es ist Seine Exzellenz, der Generalmajor Baron Leopold von Ragastein.“
„So was!“, murmelte Dominey. „Ist er der Gouverneur oder so was in der Art?“
„Er ist der Militärkommandant der Kolonie“, antwortete der Arzt. „Er hat hier auch eine besondere Mission.“
„Für einen Deutschen sieht er verdammt gut aus“, meinte Dominey unüberlegt und frech.
Der Arzt blieb unbeeindruckt. Er fühlte den Puls seines Patienten. Ein paar Minuten später beendete er seine Untersuchung.
„Du hast in letzter Zeit viel Whisky getrunken, oder?“, fragte er.
„Ich weiß nicht, was dich das angeht“, war die knappe Antwort, „aber ich trinke Whisky, wann immer ich ihn kriegen kann. Wer würde das in diesem miesen Klima nicht tun!“
Der Arzt schüttelte den Kopf.
„Das Klima ist gut, solange er behandelt wird“, erklärte er. „Seine Exzellenz trinkt nur leichten Wein und Selterswasser. Er ist seit fünf Jahren hier, nicht nur hier, sondern auch in den Sümpfen, und er war noch keinen einzigen Tag krank.“
„Nun, ich stand schon ein Dutzend Mal vor dem Tod“, erwiderte der Engländer etwas leichtsinnig, „und es macht mir nichts aus, wenn ich meine Schecks einreiche, aber bis es soweit ist, werde ich Whisky trinken, wann immer ich ihn kriegen kann.“
„Der Koch bereitet Ihnen ein Mittagessen zu“, verkündete der Arzt, „und es wird Ihnen gut tun, etwas zu essen. Ich kann Ihnen im Moment keinen Whisky geben, aber Sie können etwas Hock und Selterswasser mit Lorbeerblättern haben.“
„Schick es her“, war die begeisterte Antwort. „Was für eine Konstitution ich wohl haben muss, Doktor! Der Geruch des Essens draußen macht mich hungrig.“
„Ihre Konstitution ist immer noch gut, wenn Sie nur darauf achten würden“, war die beruhigende Zusicherung.
„Gibt es irgendwelche Neuigkeiten über den Rest meiner Gruppe?“, fragte Dominey.
„Einige Leichen von Askaris wurden aus dem Fluss angespült“, informierte ihn der Arzt, „und zwei Ihrer Ponys wurden von Löwen gefressen. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss die Wunden eines Einheimischen versorgen, der letzte Nacht von einem Jaguar gebissen wurde.“
Der Reisende, allein gelassen, lag still in der Hütte und seine Gedanken schweiften zurück. Er blickte hinaus auf das kahle, mit Gestrüpp bewachsene Stück Land, das für dieses Lager gerodet worden war, auf die Masse von Büschen und blühenden Sträuchern dahinter, geheimnisvoll und undurchdringlich, bis auf den rauen Elefantenpfad, auf dem er gereist war; auf den breiten Fluss, blau wie der Himmel darüber, und auf die Berge, die dahinter im Nebel verschwanden. Das Gesicht seines Gastgebers hatte ihn in die Vergangenheit zurückversetzt. Verwirrte Erinnerungen rissen an den Fäden seines Gedächtnisses. Später, beim Abendessen, als sie drei, der Kommandant, der Arzt und er selbst, an einem kleinen Tisch direkt vor der Hütte saßen, um die leichte Brise aus den Bergen zu genießen, die die schnell hereinbrechende Dunkelheit ankündigte, fiel es ihm ein. Einheimische Diener fächelten ihnen mit Bambusfächern Luft zu, um die Insekten fernzuhalten, und die Luft war fast unerträglich schwer vom Duft eines widerlichen, exotischen Strauchs.
„Aber du bist doch Devinter!“, rief er plötzlich aus. „Sigismund Devinter! Du warst mit mir in Eton – im Horrock's House – im Halbfinale im Racquet.“
„Und danach in Magdalen, Nummer fünf im Boot.“
„Und warum zum Teufel hat mir der Arzt hier gesagt, dass du Von Ragastein heißt?“
„Weil es zufällig die Wahrheit ist“, war die etwas zurückhaltende Antwort. „Devinter ist mein Familienname, unter dem ich in England bekannt war. Als ich jedoch nach dem Tod meines Onkels die Baronie und die Ländereien erbte, musste ich auch den Titel annehmen.“
„Die Welt ist doch klein!“, rief Dominey aus. „Was hat dich eigentlich hierher gebracht – Löwen oder Elefanten?“
„Weder noch.“
„Du meinst, du hast dich nur aus Interesse für diese Art von Politik entschieden, nicht wegen des Sports?“
„Ganz genau. Ich benutze nicht einmal im Monat ein Sportgewehr, außer wenn es nötig ist. Ich bin aus anderen Gründen nach Afrika gekommen.“
Dominey trank einen großen Schluck von seinem Hock und Selters, lehnte sich zurück und beobachtete, wie die Glühwürmchen über dem hohen Gras und den stämmigen Buschbüscheln aufstiegen und wie kleine Sterne in der klaren, violetten Luft schwebten.
„Was für eine Welt!“, sagte er leise. „Siggy Devinter, Baron von Ragastein, hier draußen, schuftet für Gott weiß was, drillt Nigger, um gegen Gott weiß wen zu kämpfen, eine politische Maschine, nehme ich an, zukünftiger Generalgouverneur von Deutsch-Afrika, was? Du warst immer stolz auf dein Land, Devinter.“
„Mein Land ist ein Land, auf das man stolz sein kann“, war die feierliche Antwort.
„Nun, du meinst es jedenfalls ernst“, fuhr Dominey fort, „du meinst etwas ernst. Und ich – nun, für mich ist es vorbei. Es wäre schon gestern Abend vorbei gewesen, wenn ich nicht den Rauch deiner Feuer gesehen hätte, und es ist mir ziemlich egal – das ist das Problem. Ich mache einfach weiter. Ich nehme an, irgendwann wird es irgendwie zu Ende gehen – Kann ich etwas Rum oder Whisky haben, Devinter – ich meine Von Ragastein – Eure Exzellenz – oder wie soll ich Sie anreden? Sehen Sie diese Nebelschwaden unten am Fluss? Die bedeuten Malaria für mich, wenn ich keinen Alkohol bekomme.“
„Ich habe etwas Besseres als beides“, antwortete Von Ragastein. „Du sollst mir deine Meinung dazu sagen.“
Der Ordonnanzoffizier, der hinter dem Stuhl seines Chefs stand, bekam einen geflüsterten Befehl, verschwand in der Kommissariatshütte und kam kurz darauf mit einer Flasche zurück, bei deren Anblick der Engländer nach Luft schnappte.
„Napoleon!“, rief er aus.
„Ich habe mir nur ein paar Flaschen schicken lassen“, erklärte sein Gastgeber. „Ich freue mich, sie jemandem anbieten zu können, der sie zu schätzen weiß.“
„Bei Gott, daran gibt es keinen Zweifel!“, erklärte Dominey und schwenkte den Wein in seinem Glas. „Was für eine Welt! Ich hatte seit dreißig Stunden nichts mehr gegessen, als ich gestern Abend hier ankam, und tagelang nichts als schmutziges Wasser getrunken. Heute Abend gibt es Hühnerfrikassee, Weißbrot, Kabinett-Hock und Napoleon-Brandy. Und morgen wieder – nun, wer weiß? Wann reisen Sie weiter, Von Ragastein?“
„Erst in ein paar Tagen.“
„Was zum Teufel machen Sie so weit weg vom Hauptquartier, wenn Sie keine Löwen oder Elefanten jagen?“, fragte sein Gast neugierig.
„Wenn du es wirklich wissen willst“, antwortete Von Ragastein, „ich nerve deine politischen Vertreter ziemlich, indem ich von Ort zu Ort ziehe und Einheimische für Drillübungen sammle.“
„Aber wozu willst du sie ausbilden?“, hakte Dominey nach. „Ich habe vor einiger Zeit gehört, dass du viermal so viele Einheimische unter Waffen hast wie wir. Du brauchst hier keine Armee. Es ist unwahrscheinlich, dass du dich mit uns oder den Portugiesen streiten wirst.“
„Es ist unser Brauch“, erklärte Von Ragastein etwas belehrend, „in Deutschland und überall, wo wir Deutschen hingehen, nicht nur auf das vorbereitet zu sein, was wahrscheinlich passieren wird, sondern auch auf das, was möglicherweise passieren könnte.“
„Ein Krieg in meiner Jugend, als ich in der Armee war“, sinnierte Dominey, „hätte vielleicht einen Mann aus mir gemacht.“
„Hatten Sie hier draußen nicht Ihre Chance?“
Dominey schüttelte den Kopf.
„Mein Bataillon hat das Land nie verlassen“, sagte er. „Wir waren die ganze Zeit in Irland eingesperrt. Das war der Grund, warum ich die Armee verlassen habe, als ich eigentlich noch ein Junge war.“
Später zogen sie ihre Stühle ein Stück weiter in die Dunkelheit hinaus, rauchten Zigarren und tranken einen ziemlich guten Kaffee. Der Arzt war weggegangen, um einen Patienten zu besuchen, und Von Ragastein war nachdenklich. Ihr Gast hingegen schwärmte weiter in Erinnerungen.
„Unser Treffen“, bemerkte er und streckte träge die Hand nach seinem Glas aus, „sollte für Psychologen sehr interessant sein. Hier sind wir nun, durch einen wundersamen Zufall zusammengeführt, um eine Nacht unseres Lebens im afrikanischen Dschungel zu verbringen, zwei Menschen gleichen Alters, die Tausende von Kilometern voneinander entfernt aufgewachsen sind und auf die ewige Dunkelheit zusteuern, auf Wegen, die so weit auseinander liegen, wie es sich der Verstand nur vorstellen kann.“
„Dein Blick ist auf genau diese Dunkelheit gerichtet“, flüsterte Von Ragastein, „hinter der die Sonne bei Tagesanbruch aufgehen wird. Du wirst sehen, wie sie genau an dieser Stelle hinter den Bergen aufgeht, wie eine neue, strahlende Welt.“
„Komm mir nicht mit Allegorien“, widersprach sein Begleiter gereizt. „Die ewige Dunkelheit existiert ganz sicher, auch wenn meine Metapher fehlerhaft ist. Ich bin geneigt, philosophisch zu sein. Lass mich weiterreden. Hier bin ich, ein Faulenzer in meiner Kindheit, ein harmloser Vergnügungssüchtiger in meiner Jugend, bis ich mit einer Tragödie konfrontiert wurde, und seitdem ein Herumtreiber, ein Herumtreiber mit einem langsam wachsenden Laster, der ohne bestimmtes Ziel durchs Leben schlendert, ohne bestimmte Hoffnung oder Wünsche, außer“, fuhr er etwas schläfrig fort, „dass ich gerne irgendwo am Fuße dieser Berge begraben werden möchte, auf der anderen Seite des Flusses, hinter dem, wie du sagst, jeden Morgen die Sonne aufgeht wie eine Welt in Flammen.“
„Du redest Unsinn“, protestierte Von Ragastein. „Wenn es eine Tragödie in deinem Leben gegeben hat, hast du Zeit, darüber hinwegzukommen. Du bist noch nicht einmal vierzig Jahre alt.“
„Dann denke ich an dich“, fuhr Dominey fort und ignorierte die Bemerkung seines Freundes völlig. „Du bist nur so alt wie ich und siehst zehn Jahre jünger aus. Deine Muskeln sind hart, deine Augen sind so strahlend wie in deiner Schulzeit. Du bewegst dich wie ein Mann mit einem Ziel. Der Arzt hat mir erzählt, dass du jeden Morgen um fünf Uhr aufstehst und abends erschöpft hierher zurückkommst. Du verbringst jeden Moment deiner Zeit damit, diese schmutzigen Schwarzen zu drillen. Wenn du das nicht tust, bist du auf der Suche nach neuen Vorkommen, überwachst Berichte nach Hause und versuchst, das Beste aus deinen paar Millionen Morgen Fiebersümpfen zu machen. Der Arzt verehrt dich, aber wer sonst weiß das schon? Warum tust du das, mein Freund?“
„Weil es meine Pflicht ist“, war die ruhige Antwort.
„Pflicht! Aber warum kannst du deine Pflicht nicht in deinem eigenen Land erfüllen, ein normales Leben führen, den weißen Männern die Hand geben und den weißen Frauen in die Augen schauen?“
„Ich gehe dorthin, wo ich am meisten gebraucht werde“, antwortete Von Ragastein. „Es macht mir keinen Spaß, Einheimische zu drillen, es macht mir keinen Spaß, die Jahre als Ausgestoßener zu verbringen, fernab von den gewöhnlichen Freuden des menschlichen Lebens. Aber ich folge meinem Stern.“
„Und ich meinem Irrlicht“, lachte Dominey spöttisch. „Die ganze Sache ist so klar wie Kloßbrühe. Du magst ein langweiliger Typ sein – du warst schon immer eher ernst –, aber du bist ein Mann mit Prinzipien. Ich bin ein Faulpelz.“
„Der Unterschied zwischen uns“, erklärte Von Ragastein, „ist etwas, das den Jugendlichen unseres Landes eingeimpft wird und das Ihren Jugendlichen nicht eingeimpft wird. In England erwarten Ihre jungen Männer mit ein wenig Geld und einer guten Herkunft, dass die Welt ein Spielplatz für Sport und ein Garten für die Liebe ist. Der mächtigste deutsche Adlige, der je gelebt hat, hat seine Arbeit zu tun. Es ist Arbeit, die Charakter formt und dem Leben Ausgewogenheit verleiht.“
Dominey seufzte. Seine Zigarre, die ihm so viel bedeutet hatte, war zwischen seinen Fingern kalt geworden. In dieser duftenden Dunkelheit, die nur vom schwachen Schein der hinter ihm stehenden Lampe erhellt wurde, wirkte sein Gesicht plötzlich blass und alt. Sein Gastgeber beugte sich zu ihm hinüber und sprach zum ersten Mal in dem freundlicheren Ton ihrer Jugend.
„Du hast eine Tragödie angedeutet, mein Freund. Du bist nicht allein. Auch in mein Leben ist eine Tragödie getreten. Wären die Dinge anders gelaufen, hätte ich vielleicht Arbeit an freudvolleren Orten gefunden, aber das Leid hat mich ereilt, und so bin ich hier.“
Ein kurzer Ausdruck von Mitgefühl huschte über Domineys Gesicht.
„Wir sind auf unterschiedliche Weise in Schwierigkeiten geraten“, stöhnte er.
KAPITEL II
Dominey schlief bis spät in den nächsten Morgen hinein, und als er endlich aus einem langen, traumlosen Schlaf erwachte, fiel ihm eine merkwürdige Stille im Lager auf. Der Arzt, der ihn besuchen kam, erklärte ihm das gleich nach seiner morgendlichen Begrüßung.
„Seine Exzellenz“, verkündete er, „hat wichtige Depeschen aus der Heimat erhalten. Er ist zu einem Treffen mit einem Gesandten aus Daressalam aufgebrochen. Er wird drei Tage lang abwesend sein. Er wünscht, dass Sie bis zu seiner Rückkehr sein Gast bleiben.“
„Das ist sehr nett von ihm“, murmelte Dominey. „Gibt es irgendwelche Neuigkeiten aus Europa?“
„Ich weiß es nicht“, war die stoische Antwort. „Seine Exzellenz bat mich, Ihnen mitzuteilen, dass, wenn Sie Lust auf einen kurzen Ausflug entlang des Flussufers in Richtung Süden haben, ein Dutzend Jungen und einige Ponys zur Verfügung stehen. Es gibt viele Löwen, und an ein oder zwei Orten, die die Einheimischen kennen, kann man Nashörner sehen.“
Dominey badete und zog sich an, trank seinen ausgezeichneten Kaffee und schlenderte in unbestimmter Stimmung durch die Gegend. Als sie am späten Nachmittag zusammen Tee tranken, schüttete er dem Arzt sein Herz aus.
„Ich bin überhaupt nicht an der Jagd interessiert“, gestand er, „und ich fühle mich wie ein schrecklicher Schmarotzer, aber trotzdem habe ich das seltsame Gefühl, dass ich Von Ragastein gerne wiedersehen würde. Ihr schweigsamer Häuptling fasziniert mich irgendwie, Herr Doktor. Er ist ein Mann. Er hat etwas, das ich verloren habe.“
„Er ist ein großartiger Mann“, erklärte der Arzt begeistert. „Was er sich vornimmt, das macht er auch.“
„Ich hätte wohl auch so sein können“, seufzte Dominey, „wenn ich einen Anreiz gehabt hätte. Ist dir die Ähnlichkeit zwischen uns aufgefallen, Herr Doktor?“
Dieser nickte.
„Das ist mir schon bei deiner Ankunft aufgefallen“, stimmte er zu. „Ihr seid euch sehr ähnlich und doch sehr unterschiedlich. In eurer Jugend muss die Ähnlichkeit noch auffälliger gewesen sein. Die Zeit hat eure Gesichtszüge entsprechend euren Verdiensten verändert.“
„Nun, du musst mir das nicht unter die Nase reiben“, protestierte Dominey gereizt.
„Ich reibe Ihnen nichts unter die Nase“, antwortete der Arzt mit unerschütterlicher Gelassenheit. „Ich sage nur die Wahrheit. Hätten Sie die gleiche moralische Stärke wie Seine Exzellenz gehabt, hätten Sie vielleicht Ihre Gesundheit und die Dinge, die zählen, bewahren können. Sie hätten Ihrem Land vielleicht genauso nützlich sein können wie er seinem.“
„Ich nehme an, ich bin ziemlich angeschlagen?“
„Ihre Konstitution wurde überstrapaziert. Sie verfügen jedoch noch über viel Vitalität. Wenn Sie sich ein paar Monate lang in Selbstbeherrschung üben würden, wären Sie ein anderer Mensch. – Entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe zu tun.“
Dominey verbrachte drei unruhige Tage. Selbst der Anblick einer Herde Elefanten im Fluss und der seltsame, wilde Chor der Nachtgeräusche, als Raubtiere lautlos um das Lager schlichen, konnten ihn nicht bewegen. Für den Moment schien seine Liebe zum Sport, sein letzter Halt in der Welt der realen Dinge, tot zu sein. Was machte es schon aus, ob ein Tier mehr oder weniger getötet wurde? Seine Gedanken kreisten unruhig um die Vergangenheit, immer auf der Suche nach etwas, das er nicht finden konnte. Im Morgengrauen beobachtete er die seltsam wundersame, verwandelnde Geburt des Tages, und nachts saß er vor der Banda und wartete, bis die Berge auf der anderen Seite des Flusses ihre Konturen verloren hatten und in der violetten Dunkelheit verschwanden. Sein Gespräch mit Von Ragastein hatte ihn verunsichert. Ohne genau zu wissen warum, wollte er ihn wieder zurückhaben. Erinnerungen, die ihn schon lange nicht mehr quälten, drängten sich erneut in sein Bewusstsein. Am ersten Tag hatte er versucht, sie auf die übliche Weise zu verdrängen.
„Doktor, Sie haben doch Whisky, oder?“, fragte er.
Der Arzt nickte.
„Irgendwo hier muss noch eine Flasche stehen“, gab er zu. „Seine Exzellenz hat mir gesagt, ich solle dir nichts abschlagen, aber er rät dir, bis zu seiner Rückkehr nur Weißwein zu trinken.“
„Hat er wirklich diese Nachricht hinterlassen?“
„Genau so, wie ich sie überbracht habe.“
Das Verlangen nach Whisky verschwand, kam wieder, wurde aber zurückgedrängt, kehrte in der Nacht zurück, sodass er mit Schweißperlen auf der Stirn und ausgetrockneter Zunge dasaß. Stattdessen trank er Lithiumwasser. Am späten Nachmittag des dritten Tages ritt Von Ragastein ins Lager. Seine Kleidung war zerrissen und mit schwarzem Schlamm aus den Sümpfen bespritzt, sein Gesicht war dick mit Staub und Schmutz bedeckt. Sein Pony brach fast zusammen, als er sich abseilte. Trotzdem hielt er inne, um seinen Gast mit akribischer Höflichkeit zu begrüßen, und in seinen Augen blitzte echte Zufriedenheit auf, als die beiden Männer sich die Hand gaben.
„Ich bin froh, dass du noch hier bist“, sagte er herzlich. „Entschuldige mich bitte, ich werde mich erst mal waschen und umziehen. Wir werden etwas früher zu Abend essen. Bis jetzt habe ich heute noch nichts gegessen.“
„War es ein langer Weg?“, fragte Dominey neugierig.
„Ich bin weit gereist“, war die leise Antwort.
Zur Essenszeit war Von Ragastein wieder ganz der Alte, makellos in weißer Kleidung, mit sauberer Wäsche, rasiert und ohne jede Spur von Müdigkeit. Allerdings war etwas anders an ihm, eine Veränderung, die Dominey verwirrte. Er war seinem Gast gegenüber sofort aufmerksamer, aber gleichzeitig in Gedanken und Sympathie weiter von ihm entfernt. Er hielt das Gespräch mit seltsamer Beharrlichkeit auf Ereignisse aus ihrer Schul- und Studienzeit, auf das Thema Domineys Freunde und Verwandte und auf die späteren Episoden seines Lebens. Dominey fühlte sich die ganze Zeit dazu ermutigt, über sein früheres Leben zu sprechen, und die ganze Zeit war er sich bewusst, dass sein Gastgeber aus irgendeinem Grund jedem seiner Worte größte Aufmerksamkeit schenkte. Champagner wurde reichlich serviert, und Dominey redete, bis er fast an der Schwelle zu dieser einen geheimen Kammer angelangt war, redselig und ohne Vorbehalte. Nach dem Essen wurden ihre Stühle wie zuvor ins Freie gezogen. Der schweigsame Ordonnanz brachte noch größere Zigarren, und Dominey sah, dass sein Glas erneut mit dem wunderbaren Brandy gefüllt wurde. Der Arzt hatte sie verlassen, um das fast eine Viertelmeile entfernte Lager der Einheimischen zu besuchen, und der Ordonnanz war damit beschäftigt, den Tisch abzuräumen. Nur die schwarzen Silhouetten der Diener waren schwach zu erkennen, als sie ihre Fächer schwenkten – und über ihnen funkelten die Sterne. Sie waren allein.
„Ich habe eine Menge Unsinn über mich selbst erzählt“, sagte Dominey. „Erzähl mir doch ein wenig über deine Karriere und dein Leben in Deutschland, bevor du hierher gekommen bist.“
Von Ragastein antwortete nicht sofort, und eine seltsame Stille breitete sich zwischen den beiden Männern aus. Ab und zu schoss ein Stern über den Himmel. Der rote Rand des Mondes stieg ein wenig höher hinter den Bergen empor. Die Stille des Busches, die immer die geheimnisvollste aller Stille ist, schien allmählich von unausgesprochener Leidenschaft erfüllt zu sein. Bald begannen die Tiere um sie herum zu rufen und krochen immer näher an das Feuer heran, das am Ende der Lichtung brannte.
„Mein Freund“, sagte Von Ragastein schließlich mit der Haltung eines Mannes, der lange nachgedacht hat, „Sie sprechen zu mir von Deutschland, meiner Heimat. Vielleicht haben Sie erraten, dass es nicht allein die Pflicht ist, die mich hierher in diese wilde Gegend geführt hat. Auch ich habe eine Tragödie hinter mir gelassen.“
Domineys spontane Sympathie wurde durch die strenge, fast harte Zurückhaltung des anderen unterdrückt. Die Worte schienen ihm aus der Kehle gerissen worden zu sein. In seinem starren Gesicht war kein Funken von Zärtlichkeit oder Bedauern zu sehen.
„Seit dem Tag meiner Verbannung“, fuhr er fort, „habe ich kein Wort über diese Angelegenheit verloren. Heute Abend überkommt mich keine Schwäche, sondern der Wunsch, mich dem seltsamen Arm des Zufalls hinzugeben. Du und ich, Schulkameraden und Collegefreunde, obwohl Söhne verschiedener Länder, treffen uns hier in der Wildnis, jeder mit Eisen in seiner Seele. Ich werde dir erzählen, was mir widerfahren ist, und du sollst mir von deinem eigenen Fluch berichten.“
„Ich kann nicht!“, stöhnte Dominey.
„Aber du wirst es tun“, war die strenge Antwort. „Hör zu.“
Eine Stunde verging, und die Stimmen der beiden Männer verstummten. Das Heulen der Tiere hatte mit dem Erlöschen der Feuer nachgelassen, und eine langsame, melancholische Brise wehte durch den Busch und plätscherte über die Oberfläche des Flusses. Es war Von Ragastein, der aus dieser fast tranceartigen Stille heraustrat. Er stand auf, verschwand im Banda und tauchte einen Moment später mit zwei Bechern wieder auf. Einen stellte er auf die dafür vorgesehene Ablage am Arm des Stuhls seines Gastes.
„Heute Abend breche ich mit einer Regel, die ich mir auferlegt habe“, verkündete er. „Ich werde einen Whisky mit Soda trinken. Ich werde auf die neuen Dinge trinken, die uns beiden noch bevorstehen mögen.“
„Gibst du deine Arbeit hier auf?“, fragte Dominey neugierig.
„Ich bin Teil einer großen Maschine“, war die etwas ausweichende Antwort. „Ich habe nichts anderes zu tun, als zu gehorchen.“
Ein Funken Leidenschaft verzerrte Domineys Gesicht und flammte für einen Moment in seinem Tonfall auf.
„Bist du zufrieden damit, so zu leben und zu sterben?“, fragte er. „Willst du nicht dorthin zurückkehren, wo eine andere Art von Sonne dein Herz erwärmt und deinen Puls beschleunigt? Diese primitive Welt ist auf ihre Weise kolossal, aber sie ist nicht menschlich, sie ist kein Leben für Menschen. Wir wollen Straßen, Von Ragastein, du und ich. Wir wollen die Menschenmassen um uns herum, das Rauschen der Räder und das Summen der Stimmen. Verflucht seien diese Tiere! Wenn ich noch länger in diesem Land lebe, werde ich auf allen vieren gehen.“
„Du lässt dich zu sehr von deiner Umgebung beeinflussen“, meinte sein Begleiter. „Im Leben der Städte wärst du ein Sentimentalist.“
„Keine Stadt und kein zivilisiertes Land wird mich jemals wieder für sich beanspruchen können“, seufzte Dominey. „Ich würde niemals den Mut aufbringen, mich dem zu stellen, was kommen könnte.“
Von Ragastein stand auf. Die schemenhafte Silhouette seiner aufrechten Gestalt wirkte irgendwie majestätisch. Er schien den Mann, der vor ihm im Sessel saß, zu überragen.
„Trink deinen Whisky und Soda aus, auf unser nächstes Treffen, mein Schulfreund“, bat er. „Morgen, bevor du aufwachst, werde ich weg sein.“
„So bald?“
„Bis morgen Abend“, antwortete Von Ragastein, „muss ich auf der anderen Seite dieser Berge sein. Das muss unser Abschied sein.“
Dominey war weinerlich, fast schon erbärmlich. Plötzlich hasste er die Einsamkeit.
„Ich muss selbst direkt nach Westen reisen“, protestierte er, „oder nach Osten oder Norden – das ist nicht so wichtig. Können wir nicht zusammen reisen?“
Von Ragastein schüttelte den Kopf.
„Ich bin auf einer offiziellen Reise und muss alleine reisen“, sagte er. „Was dich betrifft, so werden sie morgen hier aufbrechen, aber sie werden dir eine Eskorte zur Seite stellen und dich in die Richtung bringen, in die du reisen möchtest. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Für uns muss es ein Abschied sein.“
„Nun, ich kann mich dir nicht aufdrängen“, sagte Dominey ein wenig wehmütig. „Es kommt mir aber seltsam vor, uns hier draußen zu treffen, weit weg von den Nebenwegen des Lebens, nur um uns die Hand zu geben und weiterzuziehen. Ich habe die Nase voll von Niggern und Tieren.“
„Es ist Schicksal“, entschied Von Ragastein. „Wohin ich auch gehe, ich muss allein gehen. Leb wohl, lieber Freund! Wir werden den Toast trinken, den wir in unserer letzten Nacht in deinen Zimmern in Magdalen getrunken haben. Der Sanskrit-Mann hat ihn für uns übersetzt: “Möge jeder finden, was er sucht!„ Wir müssen unserem Stern folgen.“
Dominey lachte ein wenig bitter. Er zeigte auf ein Licht, das unregelmäßig im Busch leuchtete.
„Mein Irrlicht“, murmelte er leichtsinnig, „das mich dorthin führt, wo ich ihm folgen werde – in die Sümpfe!“
Ein paar Minuten später warf sich Dominey auf seine Couch, seltsam und unerklärlich schläfrig. Von Ragastein, der hereingekommen war, um ihm gute Nacht zu sagen, stand einige Augenblicke lang mit bedeutungsvoller Intensität da und sah auf ihn herab. Dann, überzeugt davon, dass sein Gast wirklich schlief, drehte er sich um und ging durch den hängenden Vorhang aus getrocknetem Gras in die nächste Banda, wo der Arzt, noch vollständig bekleidet, auf ihn wartete. Sie unterhielten sich auf Deutsch und mit gedämpften Stimmen. Von Ragastein hatte etwas von seiner Gelassenheit verloren.
„Läuft alles nach meinen Anweisungen?“, fragte er.
„Alles, Exzellenz! Die Jungs werden verladen, und ein Bote ist nach Wadihuan gegangen, um Ponys vorzubereiten.“
„Wissen sie, dass ich bei Tagesanbruch aufbrechen möchte?“
„Alles wird vorbereitet sein, Exzellenz.“
Von Ragastein legte seine Hand auf die Schulter des Arztes.
„Komm mit nach draußen, Schmidt“, sagte er. „Ich muss dir was über meine Pläne erzählen.“
Die beiden Männer setzten sich auf die langen Korbstühle, der Arzt in einer Haltung strenger Aufmerksamkeit. Von Ragastein drehte den Kopf und lauschte. Aus Domineys Quartier drang das Geräusch tiefen, regelmäßigen Atmens.
„Ich habe einen großartigen Plan ausgearbeitet, Schmidt“, fuhr von Ragastein fort. „Weißt du, welche Neuigkeiten mich aus Berlin erreicht haben?“
„Eure Exzellenz hat mir ein wenig davon erzählt“, erinnerte ihn der Arzt.
„Der Tag kommt“, verkündete von Ragastein mit vor tiefer Erregung zitternder Stimme. Er hielt einen Moment inne, um nachzudenken, und fuhr dann fort: „Der Zeitpunkt, sogar der Monat, steht fest. Ich werde von hier zurückgerufen, um den Platz einzunehmen, für den ich bestimmt bin. Du weißt, welcher Platz das ist? Du weißt, warum ich auf eine englische Privatschule und ein englisches College geschickt wurde?“
„Ich kann es mir denken.“
„Ich werde meinen Wohnsitz in England nehmen. Ich werde eine besondere Mission haben. Ich werde dort meinen Platz als Engländer finden. Die Mittel dazu bleiben meinem Einfallsreichtum überlassen. Hör zu, Schmidt. Ich habe eine großartige Idee.“
Der Arzt zündete sich eine Zigarre an.
„Ich höre, Exzellenz.“
Von Ragastein stand auf. Da ihm das Geräusch des regelmäßigen Atmens nicht ausreichte, ging er zur Öffnung der Banda und blickte auf Domineys schlafende Gestalt. Dann kehrte er zurück.
„Ist es etwas, das der Engländer nicht hören soll?“, fragte der Arzt.
„Ja.“
„Wir sprechen Deutsch.“
„Sprachen“, war die vorsichtige Antwort, „sind zufällig die einzige Fähigkeit dieses Mannes. Er spricht Deutsch genauso fließend wie du oder ich. Das ist jedoch ohne Bedeutung. Er schläft und wird weiter schlafen. Ich habe ihm ein Schlafmittel in seinen Whisky mit Soda gemischt.“
„Ah!“, brummte der Arzt.
„Was ich in England am meisten brauche, ist eine Identität“, erklärte von Ragastein. „Ich habe mich entschieden. Ich werde die Identität dieses Engländers annehmen. Ich werde als Sir Everard Dominey nach England zurückkehren.“
„Ach so!“
„Wir sehen uns ziemlich ähnlich, und Dominey hat seit acht oder zehn Jahren keinen Engländer mehr gesehen, der ihn kennt. Alle Schul- oder Collegefreunde, denen ich begegnen könnte, werde ich überzeugen können. Ich habe bei Dominey gewohnt. Ich kenne Domineys Verwandte. Heute Nacht hat er stundenlang geplappert und mir viele Dinge erzählt, die ich gut wissen sollte.“
„Was ist mit seinen nahen Verwandten?“
„Er hat keine näheren Verwandten als Cousins.“
„Keine Frau?“
Von Ragastein hielt inne und drehte den Kopf. Das tiefe Atmen im Banda hatte tatsächlich aufgehört. Er stand auf, schlich unruhig zur Öffnung und blickte auf den ausgestreckten Körper seines Gastes hinunter. Dominey schien noch immer tief zu schlafen. Nach ein oder zwei Augenblicken kehrte Von Ragastein an seinen Platz zurück.
„Darin liegt seine Tragödie“, vertraute er ihm an und senkte seine Stimme ein wenig. „Sie ist verrückt – verrückt, wie es scheint, aufgrund eines Schocks, für den er verantwortlich war. Sie hätte das einzige Hindernis sein können, und nun ist es, als existiere sie nicht.“
„Das ist ein großartiger Plan“, murmelte der Arzt begeistert.
„Es ist ein wunderbarer Plan! Diese große und verborgene Macht, Schmidt, die über unser Land wacht und es zur Herrscherin der Welt machen wird, muss diesen Mann zu uns geführt haben. Meine Position in England wird einzigartig sein. Als Sir Everard Dominey werde ich in die inneren Kreise der Gesellschaft vordringen können – vielleicht sogar in das politische Leben. Ich werde, wenn nötig, auch nach dem Ausbruch des Sturms in England bleiben können.“
„Angenommen“, warf der Arzt ein, „dieser Dominey sollte nach England zurückkehren?“
Von Ragastein drehte den Kopf und sah seinen Fragesteller an.
„Das darf er nicht“, sagte er.
„So!“, murmelte der Doktor.
Am späten Nachmittag des nächsten Tages ritt Dominey, begleitet von ein paar Jungs und mit seinem Gewehr über der Schulter, auf demselben Weg, auf dem er gekommen war, in den Busch. Der kleine, dicke Doktor stand da und sah ihm nach, winkte mit seinem Hut, bis er außer Sichtweite war. Dann rief er den Ordonnanz.
„Heinrich“, sagte er, „bist du sicher, dass der Herr Engländer den Whisky dabei hat?“
„Die Wasserflaschen sind mit nichts anderem gefüllt, Herr Doktor“, antwortete der Mann.
„Es ist kein Wasser oder Sodawasser im Rucksack?“
„Kein Tropfen, Herr Doktor.“
„Wie viel Proviant?“
„Eine Tagesration.“
„Ist das Rindfleisch gesalzen?“
„Es ist sehr salzig, Herr Doktor.“
„Und der Kompass?“
„Er zeigt zehn Grad falsch an.“
„Haben die Jungs ihre Befehle?“
„Sie haben alles verstanden, Herr Doktor. Wenn der Engländer nicht trinkt, bringen sie ihn um Mitternacht zu dem Ort, an dem Seine Exzellenz am Ufer des Blauen Flusses sein Lager aufgeschlagen hat.“
Der Doktor seufzte. Im Grunde war er kein unfreundlicher Mensch.
„Ich denke“, murmelte er, „es ist besser für den Engländer, wenn er trinkt.“
KAPITEL III
John Lambert Mangan von Lincoln's Inn starrte mit blankem Erstaunen auf die Karte, die ihm ein junger Angestellter gerade gegeben hatte – ein Erstaunen, das schnell in Bestürzung überging.
„Meine Güte, siehst du das, Harrison?“, rief er und reichte die Karte seinem Manager, mit dem er sich gerade beraten hatte. „Dominey – Sir Everard Dominey – zurück in England!“
Der Chefangestellte warf einen Blick auf das schmale Stück Pappe und seufzte.
„Ich fürchte, Sie werden ihn als ziemlich schwierigen Kunden empfinden, Sir“, meinte er.
Sein Chef runzelte die Stirn. „Natürlich werde ich das“, antwortete er gereizt. „Aus den Ländereien ist kein zusätzlicher Penny zu holen – das weißt du, Harrison. Die letzten beiden Quartalszulagen, die wir nach Afrika geschickt haben, kamen aus dem Holzgeschäft. Warum zum Teufel ist er nicht dort geblieben, wo er war!“
„Was soll ich dem Herrn sagen, Sir?“, fragte der Junge.
„Oh, lass ihn rein!“, wies Mr. Mangan mürrisch an. „Ich nehme an, ich werde ihn früher oder später sehen müssen. Ich werde diese eidesstattlichen Erklärungen nach dem Mittagessen fertigstellen, Harrison.“
Der Anwalt nahm eine freundliche Miene an, um einen Mandanten zu empfangen, der, so schwierig seine Angelegenheiten auch geworden waren, immer noch eine Familie vertrat, die seit mehreren Generationen geschätzte Kunden der Kanzlei waren. Er war darauf vorbereitet, einen schäbig aussehenden und heruntergekommenen Menschen zu begrüßen, der älter aussah, als er war. Stattdessen reichte er einem der bestgekleideten und attraktivsten Männer die Hand, die jemals die Schwelle seines nicht besonders einladenden Büros überschritten hatten. Einen Moment lang starrte er seinen Besucher sprachlos an. Dann fielen ihm bestimmte vertraute Merkmale auf – die wohlgeformte Nase, die ziemlich tief liegenden grauen Augen. Diese Überraschung ermöglichte es ihm, seine Begrüßung mit ein wenig echter Herzlichkeit zu versehen.
„Mein lieber Sir Everard!“, rief er aus. „Was für eine unerwartete Freude – wirklich unerwartet! Wie schade, dass wir Ihnen erst vor ein paar Tagen einen Scheck für Ihre Zuwendung geschickt haben. Meine Güte – verzeihen Sie mir, dass ich das sage – wie gut Sie aussehen!“
Dominey lächelte, als er sich in einen Sessel setzte.
„Afrika ist ein wunderbares Land, Mangan“, bemerkte er mit einem Hauch von Herablassung in der Stimme, der seinen Zuhörer in die Zeit des Vaters seines derzeitigen Klienten zurückversetzte.
„Es hat – verzeih mir, dass ich das sage – Wunderbares für dich bewirkt, Sir Everard. Mal sehen, es muss elf Jahre her sein, seit wir uns kennengelernt haben.“
Sir Everard klopfte mit dem Ende seines Spazierstocks auf die Spitzen seiner sorgfältig geputzten braunen Schuhe.
„Ich habe London verlassen“, murmelte er in Erinnerung, „im April 1902. Ja, elf Jahre, Mr. Mangan. Es kommt mir seltsam vor, wieder in London zu sein, wie Sie sicher verstehen können.“
„Genau“, murmelte der Anwalt. „Ich habe mich gerade gefragt, ob die letzte Überweisung, die wir Ihnen geschickt haben, vielleicht gestoppt werden könnte. Ich bin mir sicher, dass Sie sich über etwas Bargeld freuen würden“, fügte er mit einem zuversichtlichen Lächeln hinzu.
„Danke, ich glaube, ich brauche im Moment nichts“, war die überraschende Antwort. „Wir werden später über finanzielle Angelegenheiten sprechen.“
Mr. Mangan kniff sich metaphorisch in den Arm. Er kannte seinen jetzigen Mandanten schon seit seiner Schulzeit, hatte ihn schon oft zu Besuch gehabt und konnte sich nicht daran erinnern, dass jemals das Thema Finanzen so beiläufig abgetan worden wäre.
„Ich nehme an“, sagte er, hauptsächlich um etwas zu sagen, „dass du vorhast, dich jetzt für eine Weile hier niederzulassen?“
„Ich bin fertig mit Afrika, wenn du das meinst“, war die etwas ernste Antwort. „Was das Niederlassen hier angeht, nun, das hängt ein wenig davon ab, was du mir zu sagen hast.“
Der Anwalt nickte.
„Ich denke“, sagte er, „Sie können sich in Bezug auf Roger Unthank ganz beruhigt zurücklehnen. Seit dem Tag, an dem Sie England verlassen haben, hat man nichts mehr von ihm gehört.“
„Seine Leiche wurde nicht gefunden?“
„Auch keine Spur davon.“
Es entstand eine kurze Stille. Der Anwalt sah Dominey eindringlich an, und Dominey sah den Anwalt ebenfalls eindringlich an.
„Und Lady Dominey?“, fragte der Anwalt schließlich.
„Der Zustand Ihrer Ladyschaft ist, glaube ich, unverändert“, war die etwas zurückhaltende Antwort.
„Wenn die Umstände günstig sind“, fuhr Dominey nach einer weiteren kurzen Pause fort, „halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass ich mich entschließen werde, mich in Dominey Hall niederzulassen.“
Der Anwalt schien skeptisch.