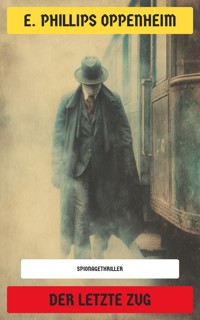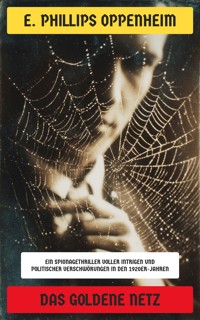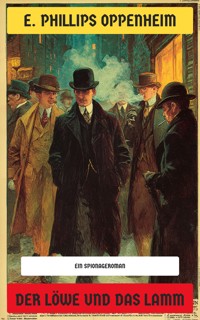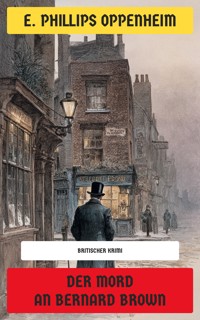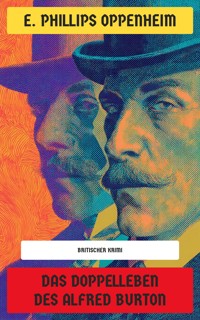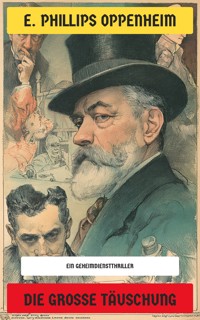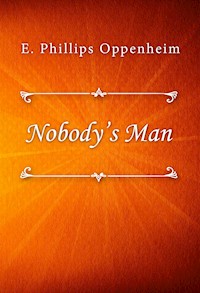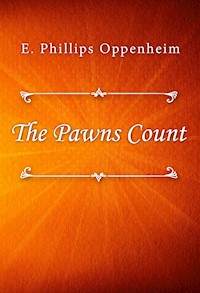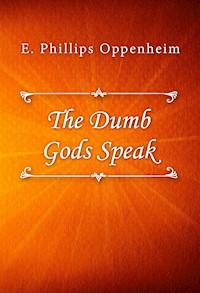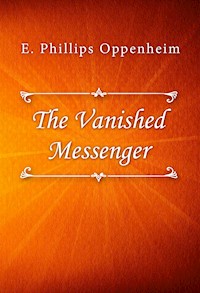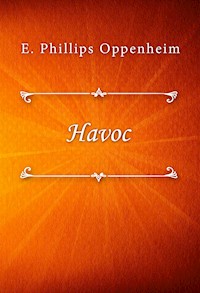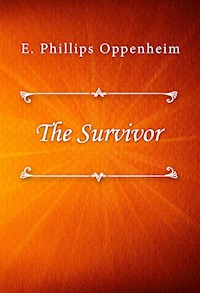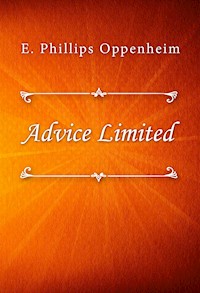0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
E. Phillips Oppenheims 'Gestalter der Geschichte' ist ein faszinierender Roman, der meisterhaft Elemente von Spionage und politischer Intrige miteinander verwebt. Vor dem Hintergrund der politischen Spannungen des frühen 20. Jahrhunderts entfaltet sich eine packende Erzählung, in der Intrigen, Machtspiele und geheime Absprachen im Vordergrund stehen. Oppenheims präziser Schreibstil und sein Gespür für dramatische Spannung schaffen eine Atmosphäre des Misstrauens und der Unsicherheit, die den Leser in ihren Bann zieht. Der Roman reflektiert die damaligen geopolitischen Strömungen und die Kunst der Manipulation hinter den Kulissen der Macht, was ihn sowohl literarisch als auch historisch bedeutsam macht. E. Phillips Oppenheim, ein produktiver Schriftsteller seiner Zeit, war bekannt für seine Versiertheit in der Darstellung internationaler Verstrickungen und seiner vielschichtigen Charaktere. Geboren im viktorianischen England, nutzte Oppenheim seine umfassende Kenntnis der politischen Landschaft und der sozialen Dynamiken, um ein Werk zu schaffen, das nicht nur Unterhaltung ist, sondern auch tiefere Einblicke in die menschliche Natur und ihre Schwächen gewährt. Sein Hintergrund und seine sorgfältige Beobachtungsgabe ermöglichten es ihm, authentische und fesselnde Geschichten zu schreiben, die die Leser bis heute faszinieren. 'Gestalter der Geschichte' ist ein Muss für jeden, der sich für die Kunst des Thrillers interessiert und ein Gespür für historische Details hat. Oppenheims Werk bietet nicht nur eine spannende Erzählung, sondern auch eine kluge Analyse der Kräfte, die unsere Welt formen. Es richtet sich an Leser, die ein tiefgehendes und anspruchsvolles literarisches Erlebnis suchen, das sowohl unterhält als auch zum Nachdenken anregt. Diese Mischung aus Spannung, literarischer Tiefe und historischer Thematik macht das Buch zu einem wertvollen Beitrag zur Bibliothek eines jeden Literatur- und Geschichtsbegeisterten. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gestalter der Geschichte
Inhaltsverzeichnis
BUCH I
KAPITEL I
EIN ZUFÄLLIGER SPION
Der Junge setzte sich auf und rieb sich die Augen. Er war steif, hatte schmerzende Füße und fröstelte ein wenig. Es gab keinen Diener, der ihm ein Bad und Kleidung bereitstellte, keinen angenehmen Duft von Kaffee – keinen der kleinen Luxusgüter, an die er gewöhnt war. Im Gegenteil, er hatte die ganze Nacht auf einem Bett aus Farnkraut geschlafen, ohne andere Decke als die steifen Kiefernnadeln der hohen schwarzen Bäume, deren raschelnde Musik ihn in den Schlaf gewiegt hatte.
Er setzte sich auf und erinnerte sich plötzlich daran, wo er war und wie er dorthin gekommen war. Er gähnte und wollte gerade aufstehen, als er eine Veränderung in seiner Umgebung bemerkte. Ein Instinkt, vielleicht einfache Neugier, aber mit weitreichender Wirkung, veranlasste ihn, zurück in sein Versteck zu kriechen und zu beobachten.
Letzte Nacht, nach vielen Stunden schmerzhaften Gehens, hatten sich nur zwei Dinge in sein Bewusstsein eingebrannt: der dunkle, unendliche Wald und die doppelte Eisenbahnschiene, die sich mit der absoluten Geradlinigkeit exakter Wissenschaft hinter und vor ihm erstreckte, bis die Baumwipfel in der Ferne sich zu berühren schienen und die Schienen selbst im schwarzen Herzen der dicht wachsenden Kiefern zu verschwinden schienen. Kilometerweit humpelte er über den schmerzlich holprigen Weg, ohne auch nur das geringste Anzeichen einer Unterbrechung des Waldes oder eines Menschen zu sehen. Schließlich überkam ihn das Verlangen nach Schlaf. Er war ein robuster junger Engländer, und eine Nacht im Freien mitten im Juni unter diesen duftenden Kiefern erschien ihm lediglich als ein nicht unangenehmes Abenteuer. Fünf Minuten, nachdem ihm dieser Gedanke gekommen war, schlief er ein.
Und nun, am grauen Morgen, blickte er auf eine ganz andere Szenerie. Kaum ein Dutzend Meter von ihm entfernt stand ein einzelner dunkelgrüner Reisewagen, der von einer schweren Lokomotive gezogen wurde. In Abständen von kaum zwanzig Schritten entlang der Gleise, soweit er sehen konnte, standen Soldaten wie Wachposten. Sie schauten aufmerksam in alle Richtungen, und er konnte sogar die Schritte anderer hören, die durch den Wald stapften. Aus dem Zug waren bereits drei oder vier Männer in langen Mänteln ausgestiegen. Sie standen auf den Gleisen und unterhielten sich.
Der junge Mann hinter dem Farn befand sich in einer Zwickmühle. Aus dem wartenden Wagen kam ein herrlicher Duft von frischem Kaffee, und es schien keinen Grund zu geben, warum er nicht aus seinem Versteck hervorkommen und die Gastfreundschaft dieser Leute in Anspruch nehmen sollte. Er war ein völlig harmloser Mensch, mit ordnungsgemäßen Papieren und einer ausreichenden Erklärung für seine Anwesenheit dort. Andererseits drängte ihn sein für sein Alter typischer Abenteuergeist dazu, zu bleiben, wo er war, und zu beobachten. Er war sich sicher, dass etwas passieren würde. Außerdem sahen diese Soldaten aus, als würden sie nach jemandem suchen, den sie erschießen könnten!
Während er noch zögerte, passierte tatsächlich etwas. Es ertönte ein schriller Pfiff, in der Ferne stieg eine weiße Rauchwolke auf, und ein weiterer Zug näherte sich aus der entgegengesetzten Richtung.
Er hielt nur wenige Meter von dem Zug entfernt, der bereits wartete. Fast sofort stiegen ein halbes Dutzend Männer aus, die bereits auf dem Bahnsteig standen. Einer von ihnen kam schnell herbei und grüßte die Person in der Mitte der Gruppe, die sich auf den Gleisen unterhalten hatte. Nach einem kurzen Gespräch stiegen die beiden, gefolgt von einem weiteren Mann, der eine Aktentasche trug, auf den Bahnsteig des zuerst angekommenen Zuges und verschwanden im Inneren.
Der junge Mann, der das Ganze beobachtete, gähnte.
„Also kein Duell!“, murmelte er vor sich hin. „Ich bin fast geneigt, hinauszugehen.“ Dann fiel sein Blick auf einen besonders grimmig aussehenden Soldaten, der seinen Finger bereits am Abzug seiner Waffe hatte, und er beschloss, dort zu bleiben, wo er war.
Etwa eine halbe Stunde später tauchten die beiden Männer wieder auf dem Bahnsteig des Waggons auf. Gleichzeitig wurde das Fenster des Abteils, in dem sie gesessen hatten, geöffnet, und man konnte den dritten Mann sehen, der vor einem kleinen Tisch stand und einige Papiere ordnete. Plötzlich wurde er von draußen gerufen. Er warf seinen Hut auf die Papiere und eilte der Aufforderung nach.
Eine kleine Brise, die durch das Öffnen und Schließen der Tür entstand, löste eines der Blätter aus dem Halt des Hutes. Es flatterte aus dem Fenster und lag einen Moment lang auf der Seite der Gleise. Niemand bemerkte es, und in ein oder zwei Sekunden flatterte es unter den Farnbüschel, hinter denen sich der junge Engländer versteckt hatte. Er streckte seine Hand aus und sicherte es ruhig.
In weniger als fünf Minuten war der Ort verlassen. Inmitten vieler hastiger Abschiede, die für den Beobachter völlig unverständlich waren, trennten sich die beiden Gruppen von Männern und stiegen in ihre jeweiligen Züge. Sobald alle außer Sichtweite waren, stand der Engländer mit einem kleinen Grunzen der Zufriedenheit auf und streckte sich.
Er warf einen ersten Blick auf das Blatt Papier und steckte es, als er sah, dass es auf Deutsch geschrieben war, in seine Tasche. Dann begann er nervös nach Rauchutensilien zu suchen und fand schließlich eine Pfeife, eine zerknüllte Packung Tabak und zwei Streichhölzer.
„Gott sei Dank!“, rief er aus und zündete sich die Pfeife an. „Und jetzt geht's auf Wanderschaft.“
Er stapfte eine Stunde oder länger stetig die Gleise entlang. Die ganze Zeit über befand er sich mitten im Wald. Fasanen, Kaninchen und Eichhörnchen kreuzten ständig seinen Weg. Einmal fuhr ein Zug vorbei, und ein aufgeregter Schaffner rief Drohungen und Warnungen, auf die er in fließendem, aber unwirksamem Englisch antwortete.
„Die Briten scheinen zu denken, ich würde unbefugt ihr Gelände betreten!“, sagte er mit gekränktem Tonfall zu sich selbst. „Ich kann doch nichts dafür, dass ich mich auf ihrer verdammten Bahnlinie befinde!“
Groß, mit glattem Gesicht und blond, ging er mit den langen Schritten und der leichten Anmut eines athletischen jungen Engländers seiner Zeit. Er war gut gekleidet in Tweedkleidung, die von einem guten Schneider geschnitten worden war, ein wenig zerknittert von seiner Nacht im Freien, aber ansonsten makellos. Er summte eine beliebte Melodie vor sich hin und hielt den Kopf hoch. Wenn er nur nicht so hungrig wäre.
Dann kam er an einem Bahnhof an. Es war kaum mehr als ein paar Reihen Bretter mit einem Chalet an einem Ende – aber ein sehr willkommener Anblick erwartete ihn. Ein kleiner Stapel Gepäck mit seinen Initialen, G. P., stand am Ende des Bahnsteigs, der ihm am nächsten war.
„Dieser Schaffner war ein vernünftiger Kerl“, rief er aus. „Gut, dass ich ihm ein Trinkgeld gegeben habe. Hallo!“
Der Bahnhofsvorsteher in Uniform kam eilig heraus. Der junge Engländer nahm seinen Hut ab und holte ein Sprachführer aus seiner Tasche. Er ignorierte den Wortschwall, den der Bahnhofsvorsteher mit vielen Gesten bereits von sich gab.
„Mein Gepäck“, sagte er bestimmt, legte eine Hand auf den Stapel und winkte mit dem Sprachführer.
Der Bahnhofsvorsteher stimmte herzlich zu. Er wurde wieder redegewandt, aber der Engländer war mit dem Sprachführer beschäftigt.
„Hungrig! Hotel?“, versuchte er es.
Der Bahnhofsvorsteher zeigte auf eine Stelle, an der Rauch aus etwa zwanzig Häusern in einer Entfernung von etwa einer halben Meile aufstieg. Der Engländer war zufrieden mit sich selbst. Draußen stand eine seltsam aussehende Kutsche, und auf dem Kutschbock schlief tief und fest ein sehr dicker Mann mit einem glänzenden Hut, der mit einem Federbüschel verziert war. Er zeigte auf das Gepäck, dann auf die Kutsche und schließlich auf das Dorf.
„Gepäck, Hotel, Kutsche!“, schlug er vor.
Der Bahnhofsvorsteher strahlte über das ganze Gesicht. Mit einem Ruf, der bis ins Dorf zu hören gewesen sein muss, weckte er den schlafenden Mann. In weniger als fünf Minuten waren der Engländer und sein Gepäck in der Kutsche verstaut. Der Bahnhofsvorsteher hatte sein Ticket geprüft und lächelnd akzeptiert. Es gab weitere Verbeugungen und Verabschiedungen, dann fuhr die Kutsche los. Mr. Guy Poynton lehnte sich in den schimmeligen Ledersitzen zurück und lächelte selbstzufrieden.
„Mit einem Sprachführer und etwas Verstand kommt man in einem fremden Land am leichtesten zurecht“, sagte er sich. „Mann, habe ich Hunger!“
Er fuhr in ein Dorf mit etwa einem halben Dutzend Häusern, das ihn an die abgebildeten Behausungen von Noah und seinen Brüdern erinnerte. Ein erstaunter Gastwirt, dessen Morgenkleidung offenbar aus Hose, Hemd und Brille bestand, führte ihn in einen kargen Raum mit einem Tischbock. Guy holte seinen Sprachführer hervor.
„Hungrig!“, sagte er lautstark. „Möchte essen! Kaffee!“
Der Mann schien ihn zu verstehen, aber um sicherzugehen, dass es keine Missverständnisse gab, folgte Guy ihm in die Küche. Der Fahrer, der keine Zeit verloren hatte, war bereits dort und hatte ein großes Glas Bier vor sich stehen. Guy holte eine Mark heraus, legte sie auf den Tisch, berührte sich selbst, den Gastwirt und den Fahrer und zeigte auf das Bier. Der Gastwirt verstand, und das Bier war gut.
Der Fahrer, der natürlich lächerlich überbezahlt worden war, machte es sich in seiner Ecke bequem und verkündete seine Absicht, dieses höchst außergewöhnliche und vom Himmel gelenkte Ereignis bis zum Ende mitzuverfolgen. Der Wirt und seine Frau waren mit dem Frühstück beschäftigt, und Guy machte ab und zu Bemerkungen aus seinem Sprachführer, die meist unverständlich waren, außer wenn sie sich auf eine weitere Lieferung Bier bezogen. Mit tapferer Akzeptanz der Höflichkeiten des Landes hatte er eine Zigarre vom Kutscher angenommen und dachte bereits über den schrecklichen Moment nach, in dem er sie anzünden müsste. In diesem Moment kam es zu einer Unterbrechung.
Es war etwas sehr Offizielles, aber Guy konnte nicht sagen, ob es sich um Militär oder Polizei handelte. Es schritt mit klirrenden Sporen in den Raum, und sowohl der Kutscher als auch der Gastwirt standen respektvoll auf. Es salutierte Guy. Guy nahm seinen Hut ab. Dann fielen Worte, aber Guy war mit seinem Sprachführer beschäftigt.
„Ich kann kein Wort Deutsch!“, verkündete er schließlich.
Es kam zu einer Pattsituation. Der Wirt und der Kutscher eilten herbei. Es kam zu einer heftigen Diskussion. Guy nutzte den Moment, um die Zigarre in seine Tasche zu stecken und sich eine Zigarette anzuzünden. Schließlich drehte sich der Offizier um und ging abrupt davon.
„Dolmetscher“, verkündete ihm der Kutscher triumphierend.
„Dolmetscher“, wiederholte der Wirt.
Guy schlug das Wort in seinem Sprachführer nach und fand heraus, dass es „Dolmetscher“ bedeutete. Dann widmete er sich ganz der Vorbereitung des Frühstücks.
Endlich war das Essen fertig. Es gab Eier, Schinken und Kalbfleisch, dunkles Brot und Kaffee, genug für etwa ein Dutzend Personen. Der Kutscher übernahm die Rolle des Gastgebers, und Guy setzte sich mit einem lauten Lachen an seinen Platz und aß. Mitten während des Essens tauchte der Offizier wieder auf und führte einen kleinen, runzligen Mann mit unverkennbar englischem Aussehen herein. Guy drehte sich auf seinem Stuhl um, und der Neuankömmling berührte seine Stirn.
„Hallo!“, rief Guy. „Sie sind Engländer!“
„Ja, Sir!“, antwortete der Mann. „Ich bin hergekommen, um Polo-Ponys für den Prinzen von Haepsburg zu trainieren. Ich hoffe, Sie haben keine Probleme, Sir?“
„Nein“, antwortete Guy fröhlich. „Stört es Sie, wenn ich mein Frühstück fortsetze? Was ist denn los? Wer ist der Herr mit dem Feuerwehrhelm und was macht er hier?“
„Er ist ein Polizeibeamter, Sir, im Sonderdienst“, antwortete der Mann. „Sie wurden heute Morgen wegen unbefugten Betretens des Staatsbahnhofs angezeigt.“
„Hausfriedensbruch, pah!“, antwortete Guy. „Ich habe meine Fahrkarte bis zur Grenze. Wir wurden etwa sechs Meilen von hier durch ein Signal aufgehalten, und ich bin ausgestiegen, um mir die Beine zu vertreten. Ich habe verstanden, dass wir etwa eine halbe Stunde lang nicht weiterfahren konnten. Sie haben mich nicht daran gehindert, auszusteigen, und dann sind sie ohne Vorwarnung weitergefahren und haben mich dort zurückgelassen.“
„Ich werde dem Beamten übersetzen, Sir“, sagte der Mann.
„Okay!“, sagte Guy. „Mach das.“
Es gab ein lebhaftes Gespräch zwischen den beiden. Dann fing der kleine Mann wieder an.
„Er sagt, dass dein Zug um Mitternacht hier vorbeigefahren ist und du erst nach sechs angekommen bist.“
„Ganz richtig!“, gab Guy zu. „Ich bin eingeschlafen. Ich wusste nicht, wie weit es bis zum Bahnhof war, und ich war todmüde.“
„Der Beamte möchte wissen, ob in der Nacht viele Züge an Ihnen vorbeigefahren sind?“
„Kann ich nicht sagen“, antwortete Guy. „Ich schlafe sehr tief und habe nach den ersten paar Minuten meine Augen nicht mehr geöffnet.“
„Der Beamte möchte wissen, ob du irgendwas Ungewöhnliches auf den Gleisen gesehen hast“, fragte der kleine Mann.
„Überhaupt nichts“, meinte Guy ganz cool. „Er ist ein bisschen neugierig, oder?“
Der kleine Mann kam näher an den Tisch heran.
„Er möchte deinen Reisepass sehen, Sir“, sagte er.
Guy reichte ihm diesen, außerdem ein Akkreditiv und mehrere andere Dokumente.
„Er will wissen, warum du zur Grenze wolltest, Sir!“
„Ich habe einfach Lust gehabt, zu sagen, dass ich in Russland war, das ist alles!“, antwortete Guy. „Sagen Sie ihm, dass ich ein völlig harmloser Mensch bin. Ich war noch nie im Ausland.“
Der Beamte hörte zu und machte sich Notizen zu deinem Reisepass und dem Akkreditiv in seinem Notizbuch. Dann verabschiedete er sich mit einem formellen Salut, und sie hörten die Hufe seines Pferdes auf der Straße draußen klappern, als er davon galoppierte. Der kleine Mann kam näher an den Tisch heran.
„Entschuldigen Sie bitte, Sir“, sagte er, „aber Sie scheinen die Beamten sehr verärgert zu haben, weil Sie letzte Nacht auf der Strecke waren. Es gibt einige Gerüchte – aber vielleicht ist es besser, wenn Sie davon nichts wissen. Darf ich Ihnen einen Rat geben, Sir?“
„Lass mich dir einen geben“, erklärte Guy. „Probier dieses Bier!“
„Ich danke Ihnen, Sir“, antwortete der Mann. „Das werde ich gerne tun. Aber wenn Sie wirklich ein gewöhnlicher Tourist sind, Sir – und daran habe ich keinen Zweifel –, dann lassen Sie sich von diesem Mann nach Streuen fahren und nehmen Sie den Zug zur österreichischen Grenze. Das könnte Ihnen eine Menge Unannehmlichkeiten ersparen.“
„Das werde ich tun!“, sagte Guy. „Wien war sowieso mein nächstes Ziel. Sag dem Mann, wohin er mich bringen soll, okay?“
Der Mann sprach schnell mit dem Fahrer.
„Ich glaube, man wird Ihnen folgen, Sir“, fügte er hinzu und wandte sich an Guy, „aber wahrscheinlich wird man Sie nicht belästigen. Der Zug wurde gestern Abend aus staatlichen Gründen zwanzig Meilen zurückgehalten. Keiner von uns weiß warum, und es bringt nichts, hier zu neugierig zu sein, aber man vermutet, dass Sie entweder Journalist oder Spion sind.“
„Civis Britannicus sum!“ , antwortete der Junge lachend.
„Das hat nicht mehr ganz die gleiche Bedeutung wie früher, Sir“, antwortete der Mann ruhig.
KAPITEL II
IM CAFÉ MONTMARTRE
Genau eine Woche später, fünf Minuten nach Mitternacht, betrat Guy Poynton in Abendgarderobe das Café Montmartre in Paris. Er bahnte sich einen Weg durch die bunt gemischte kleine Gruppe von Männern und Frauen, die an der Bar etwas tranken, vorbei an der scharlachrot gekleideten Orchestergruppe, in den hinteren Raum, wo die Tische für das Abendessen gedeckt waren. Monsieur Albert, zufrieden mit dem Aussehen seines neuen Kunden, führte ihn sofort zu einem kleinen Tisch, reichte ihm die Weinkarte und rief einen Kellner herbei. Mit einigen Schwierigkeiten, da sein Französisch kaum besser war als sein Deutsch, bestellte er das Abendessen, zündete sich dann eine Zigarette an, lehnte sich gegen die Wand und sah sich um, ob er irgendwelche Engländer oder Amerikaner entdecken konnte.
Der Raum war nur mäßig gefüllt, denn für dieses Viertel von Paris war es noch etwas früh. Trotzdem erkannte er schnell eine gewisse Boheme-Atmosphäre, die ihm gefiel. Alle unterhielten sich mit ihren Nachbarn. Ein Amerikaner am anderen Ende des Raumes hob sein Glas und trank auf seine Gesundheit. Ein hübsches blondes Mädchen beugte sich von ihrem Tisch zu ihm herüber und lächelte ihn an.
„Monsieur möchte sich mit mir unterhalten, eh?“
„Englisch?“, fragte er.
„Nein. De Wien!“
Er schüttelte lächelnd den Kopf.
„Wir würden uns nicht verstehen“, erklärte er. „Ich spreche die Sprache nicht.“
Sie hob protestierend die Augenbrauen, aber er schaute weg und schlug eine Illustrierte neben sich auf. Zuerst blätterte er nur so vor sich hin, aber dann hielt er plötzlich inne. Er pfiff leise vor sich hin und starrte auf die beiden Fotos, die die Seite füllten.
„Meine Güte!“, sagte er leise zu sich selbst.
Es raschelte in den Röcken neben seinem Tisch. Eine unverkennbar englische Stimme sprach ihn an.
„Ist das etwas Interessantes? Zeig es mir doch!“
Er schaute auf. Mademoiselle Flossie, die von seinem Aussehen angetan war, hatte auf ihrem Weg durch den Raum innegehalten.
„Komm und setz dich, dann zeige ich es dir!“, sagte er und stand auf. „Du bist Engländerin, nicht wahr?“
Mademoiselle Flossie winkte ihren Freunden zum Abschied zu und nahm die Einladung an. Er schenkte ihr ein Glas Wein ein.
„Bleib doch und iss mit mir zu Abend“, bat er sie. „Ich muss bald los, aber ich hab's satt, allein zu sein. Das ist zum Glück meine letzte Nacht hier.“
„Okay!“, antwortete sie fröhlich. „Ich muss danach gleich zu meinen Freunden zurück.“
„Bestell dir, was du möchtest“, bat er sie. „Ich kann mich diesen Leuten nicht verständlich machen.“
Sie lachte und rief den Kellner.
„Und jetzt zeig mir, was du dir in der Zeitung angesehen hast“, drängte sie.
Er zeigte auf die beiden Fotos.
„Ich habe die beiden erst vor einer Woche zusammen gesehen“, sagte er. „Willst du davon hören?“
Sie sah einen Moment lang überrascht und ein wenig ungläubig aus.
„Ja, erzähl weiter!“, sagte sie.
Er erzählte ihr die Geschichte. Sie hörte mit einem Interesse zu, das ihn überraschte. Ein- oder zweimal, als er aufblickte, hatte er den Eindruck, dass auch die Dame aus Wien sich bemühte, zuzuhören. Als er fertig war, wurde das Abendessen serviert.
„Ich finde“, sagte sie, während sie sich Vorspeisen nahm, „dass du großes Glück hattest, dass du entkommen bist.“
Er lachte unbekümmert.
„Das Lustige daran ist“, sagte er, „dass ich den ganzen Weg hierher verfolgt worden bin. Ein Typ, der vorgab, in Straßburg zugestiegen zu sein, versuchte die ganze Zeit, mit mir zu reden, aber ich sah, wie er sich in Wien einschlich, und ich wollte nichts davon wissen. Sag mal, kommst du jeden Abend hierher?“
„Sehr oft“, antwortete sie. „Ich tanze im Comique, und danach gehen wir normalerweise zum Abendessen ins Maxim's und anschließend hierher. Ich stelle dich später meinen Freunden vor, wenn du möchtest, und wir setzen uns alle zusammen. Wenn du brav bist, tanze ich für dich!“
„Sehr gerne“, antwortete er, „wenn sie Englisch sprechen. Ich habe es satt, den Leuten mein miserables Französisch verständlich zu machen.“
Sie nickte.
„Sie sprechen gut Englisch. Ich wünschte, dieses schreckliche Wiener Mädchen würde nicht versuchen, jedes Wort mitzuhören, das wir sagen.“
Er lächelte.
„Sie wollte, dass ich an ihrem Tisch sitze“, bemerkte er.
Mademoiselle Flossie sah ihn warnend an und senkte ihre Stimme.
„Sei lieber vorsichtig!“, flüsterte sie. „Man sagt, sie sei eine Spionin!“
„Wahrscheinlich ist sie mir auf der Spur“, meinte er mit einem Grinsen.
Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und lachte.
„Wie eingebildet! Warum sollte irgendjemand dir auf der Spur sein? Komm morgen Abend ins Comique und schau mir beim Tanzen zu.“
„Geht nicht“, meinte er. „Meine Schwester kommt aus England zu Besuch.“
„Dummkopf!“
„Oh, ich komme irgendwann mal“, meinte er. „Bestell doch einen Kaffee – und welche Liköre?“
„Ich hole meine Freunde“, sagte sie und stand auf. „Wir trinken alle zusammen Kaffee.“
„Wer sind sie?“, fragte er.
Sie zeigte auf eine kleine Gruppe am anderen Ende des Raums – zwei Männer und eine Frau. Die Männer waren Franzosen, einer mittleren Alters und einer jung, dunkelhäutig, makellos gekleidet und mit der leicht gelangweilten Miene, die junge französische Modebewusste an den Tag legen; die Frau war auffallend hübsch und prächtig gekleidet. Sie waren die vornehmsten Personen im Raum.
„Wenn du denkst, dass sie kommen“, meinte er zweifelnd. „Ist es nicht so, wie es ist, ziemlich gemütlich?“
Sie bahnte sich einen Weg zwischen den Tischen hindurch.
„Oh, sie werden kommen“, erklärte sie. „Sie sind Freunde!“
Sie schwebte mit einer Zigarette im Mund durch den Raum, sehr anmutig in ihrem luftigen Musselinrock und dem großen Hut. Guy folgte ihr bewundernd mit seinen Augen. Die Wiener Dame riss plötzlich eine Ecke ihrer Speisekarte ab und kritzelte schnell etwas darauf. Sie reichte sie Guy.
„Lies!“, sagte sie mit bestimmter Stimme.
Er nickte und öffnete es.
„Prenez garde!“ , sagte er langsam. Dann sah er sie an und schüttelte den Kopf. Sie bedeutete ihm, ihre Nachricht zu vernichten, und er tat es sofort.
„Ich verstehe nicht!“, sagte er. „Tut mir leid!“
Mademoiselle Flossie lachte und unterhielt sich mit ihren Freunden. Bald standen sie auf und kamen mit ihr durch den Raum. Guy stand auf und verbeugte sich. Die Vorstellungsrunde verlief ungezwungen, aber er spürte, wie seine Vorurteile durch die angenehme Gelassenheit, mit der diese beiden Franzosen die Situation akzeptierten, ein wenig erschüttert wurden. Ihre gute Erziehung war ebenso offensichtlich wie ihre Freundlichkeit. Der Tisch wurde schnell umgestellt, um Platz für alle zu schaffen.
„Ihre Freunde werden mit mir Kaffee trinken, Mademoiselle“, sagte Guy. „Seien Sie bitte die Gastgeberin. Meine Versuche, Französisch zu sprechen, werden nur alle amüsieren.“
Der Ältere der beiden Franzosen, den der Kellner mit Monsieur le Baron und alle anderen mit Louis ansprachen, hob die Hand.
„Mit Vergnügen!“, erklärte er, „aber später. Jetzt ist es noch zu früh. Wir feiern die Entente cordiale. Garçon, eine Magnumflasche Pommery, un neu frappé! Ich weiß, dass du mir diese Freiheit verzeihst“, sagte er und lächelte Guy an. „Diese Flasche ist geweiht. Flossie hat zum ersten Mal seit drei Abenden gelächelt.“
Sie warf ihm einen Papierfächer zu und setzte sich wieder neben Guy.
„Erzähl ihm doch die Geschichte, die du mir erzählt hast“, flüsterte sie ihm ins Ohr. „Louis, hör zu!“
Guy erzählte seine Geschichte noch mal. Monsieur le Baron hörte aufmerksam zu. Genauso wie die Dame, die ihn begleitet hatte. Guy fand, dass er sie echt gut erzählt hatte, aber zum zweiten Mal ließ er die Sache mit dem fehlenden Blatt Papier, das in seinen Besitz gekommen war, komplett weg. Monsieur le Baron war offensichtlich sehr interessiert.
„Bist du dir ganz sicher – was die beiden Männer angeht?“, fragte er leise.
„Ganz sicher!“, antwortete Guy selbstbewusst. „Der einewar ... “
Madame – Flossies Freundin – ließ ein Weinglas fallen. Monsieur le Baron hob die Hand.
„Keine Namen“, sagte er. „Das ist besser so. Wir verstehen. Ein äußerst interessantes Abenteuer, Monsieur Poynton, und – auf Ihre Gesundheit!“
Der Wein war gut, und die ausgelassene Stimmung des Ortes stieg fast zu Kopf. Ständig kamen neue Gäste herein, die unter einem Chor von Begrüßungen durch den Raum gingen, begleitet von fröhlicher Musik. Dann tanzten Flossie und eine andere Freundin, die sie von einem entfernten Tisch herübergerufen hatte, unter dem Jubel der Gäste einen Cake-Walk – sehr anmutig und mit einer wunderbaren Darstellung von Regenbogenröcken. Sie kam atemlos zurück und warf sich neben Guy auf den Boden.
„Gib mir noch mehr Wein!“, keuchte sie. „Wie eng es hier ist!“
Der jüngere Franzose, der kaum etwas gesagt hatte, beugte sich vor.
„Ich hab 'ne Idee!“, rief er. „Mein Auto steht draußen. Ich fahr euch durch die ganze Stadt. Monsieur Poynton soll Paris ohne Schnickschnack sehen. Danach gehen wir zu Louis' Zimmer und lassen uns von seinem Koch ein Déjeuner Anglais machen.“
Flossie stand auf und lachte.
„Wer leiht mir einen Mantel?“, rief sie. „Ich habe nichts außer einem Spitzenmantel.“
„Im Auto sind genug Franzosen“, rief der junge Franzose. „Sind wir uns alle einig? Gut! Garçon, l'addition! “
„Und meine“, bestellte Guy.
Die Frauen gingen, um ihre Mäntel zu holen. Guy und die beiden Franzosen stopften sich die Taschen mit Zigaretten voll. Als die Rechnungen kamen, stellte Guy fest, dass seine nur eine Kleinigkeit war, und Monsieur Louis winkte alle Proteste ab.
„Heute Abend sind wir Gastgeber, mein junger Freund“, erklärte er mit charmanter Beharrlichkeit. „Ein anderes Mal bist du an der Reihe. Du musst morgen in den Club kommen, dann organisieren wir etwas Unterhaltsames. Allons!“
Unter Abschiedsrufen drängten sie sich gemeinsam nach draußen. Guy nahm Flossie beim Treppensteigen den Arm.
„Ich bin dir echt dankbar, dass du mich deinen Freunden vorgestellt hast“, sagte er. „Ich hab echt Spaß!“
Sie lachte.
„Ach, die sind in Ordnung“, meinte sie. „Pass auf meine Röcke auf!“
„Sag mal, was bedeutet ‚prenez garde‘?“, fragte er.
„‚Sei vorsichtig.‘ Warum?“
Er lachte erneut.
„Nichts!“
KAPITEL III
EIN MYSTERIÖSES VERSCHWINDEN
„Mademoiselle“, sagte der junge Mann mit einer etwas müden Höflichkeit, „ich muss leider sagen, dass wir nichts mehr tun können!“
Er war betrübt und höflich, weil Mademoiselle schön war und in Schwierigkeiten steckte. Ansonsten war er ein wenig ihrer überdrüssig. Einundzwanzigjährige Brüder, die noch nie in Paris waren und die Sprache nicht sprechen, müssen sich gelegentlich verlaufen, und die britische Botschaft ist nicht gerade ein transportiertes Scotland Yard.
„Dann“, erklärte sie und stampfte energisch mit ihrem wohlgeformten Fuß auf, „verstehe ich nicht, wozu wir hier überhaupt einen Botschafter haben – oder irgendjemanden von euch. Das ist skandalös!“
Der ehrenwerte Nigel Fergusson ließ sein Monokel fallen und musterte die junge Dame aufmerksam.
„Meine liebe Miss Poynton“, sagte er, „ich maße mir nicht an, mit Ihnen zu diskutieren. Wir sind wohl aus dem einen oder anderen Grund hier. Ob wir diesen erfüllen oder nicht, mag Ansichtssache sein. Aber dieser Grund ist sicherlich nicht, uns um eine junge Idiotin zu kümmern – entschuldigen Sie meine Offenheit –, die in dieser faszinierenden Stadt Amok läuft. In deinem Fall hat sich der Chef besonders bemüht, dir zu helfen. Er hat selbst mit dem Polizeichef gesprochen, seinen Einfluss in verschiedenen Bereichen geltend gemacht, und ich kann dir ehrlich sagen, dass im Moment alles getan wird, was möglich ist. Wenn du meinen Rat hören möchtest, dann ist er dieser: Hol dir einen Freund, der dir hier Gesellschaft leistet, und versuch, geduldig zu sein. Du machst dich höchstwahrscheinlich unnötig unglücklich.“
Sie sah ihn etwas vorwurfsvoll an. Er bemerkte jedoch mit heimlicher Freude, dass sie ihre Handschuhe anzog.
„Geduldig! Er sollte mich vor zehn Tagen hier treffen. Er ist im Hotel angekommen. Seine Kleidung ist noch da, und seine Rechnung ist unbezahlt. Er ist am Abend seiner Ankunft ausgegangen und nie zurückgekommen. Geduldig! Nun, ich bin dir sehr dankbar, Mr. Fergusson. Ich habe keinen Zweifel, dass du alles getan hast, was deine Pflicht war. Guten Tag!“
„Guten Nachmittag, Fräulein Poynton, und seien Sie nicht allzu niedergeschlagen. Denken Sie daran, dass die französische Polizei die klügste der Welt ist – und sie arbeitet für Sie.“
Sie sah ihn verächtlich an.
„Polizei, ja!“ antwortete sie. „Weißt du, dass sie bisher nichts anderes getan haben, als mich immer wieder zu sich zu schicken, um mir Leichen in der Leichenhalle anzusehen? Ich glaube, ich werde einen englischen Detektiv hinzuschicken.“
„Sie könnten es schlechter treffen“, antwortete er, „aber in jedem Fall, Fräulein Poynton, hoffe ich sehr, dass Sie jemanden – einen Freund oder Verwandten – zu sich bitten, um Ihnen Gesellschaft zu leisten. Paris ist kaum ein geeigneter Ort für Sie, um allein und in Schwierigkeiten zu sein.“
„Danke“, sagte sie. „Ich werde mir Ihre Worte merken.“
Der junge Mann sah ihr mit einer seltsamen Mischung aus Erleichterung und Bedauern nach.
„Der junge Dummkopf hat wohl seine üblichen Runden gedreht und schämt sich entweder zu sehr oder ist zu betrunken, um aufzutauchen. Ich wünschte, sie wäre nicht so verdammt hübsch“, sagte er zu sich selbst. „Wenn sie alleine unterwegs ist, wird sie noch eine Menge Angst bekommen, bevor sie hier fertig ist.“
Phyllis Poynton fuhr direkt zurück zu ihrem Hotel und ging auf ihr Zimmer. Eine mitfühlende Zimmermädchen folgte ihr.
„Mademoiselle hat schon Neuigkeiten von ihrem Bruder?“, fragte sie.
Mademoiselle schüttelte den Kopf. Tatsächlich war ihr Gesichtsausdruck Antwort genug.
„Überhaupt keine, Marie.“
Das Zimmermädchen schloss die Tür.
„Vielleicht würde es Mademoiselle helfen, wenn sie wüsste, wo der junge Herr den Abend vor seinem Verschwinden verbracht hat?“, fragte sie geheimnisvoll.
„Natürlich! Genau das möchte ich herausfinden.“
Marie lächelte.
„Hier im Friseursalon ist ein junger Mann, Mademoiselle“, sagte sie. „Er erinnert sich gut an Monsieur Poynton. Er war dort, um sich rasieren zu lassen, und hat ein paar Fragen gestellt. Ich denke, Mademoiselle sollte ihn mal sehen!“
Das Mädchen sprang sofort auf.
„Weißt du, wie er heißt?“, fragte sie.
„Monsieur Alphonse, so nennen sie ihn. Er hat gerade Dienst.“
Phyllis Poynton ging sofort ins Erdgeschoss des Hotels und öffnete die Glastür, die zum Friseursalon führte. Monsieur Alphonse bediente gerade einen Kunden, und man bot ihr einen Stuhl an. Nach ein paar Minuten kam er die Wendeltreppe herunter und fragte, was Mademoiselle wünsche.
„Sprichst du Englisch?“, fragte sie.
„Aber natürlich, Mademoiselle.“
Sie seufzte erleichtert.
„Ich frage mich“, sagte sie, „ob Sie sich daran erinnern, meinen Bruder letzten Donnerstag bedient zu haben. Er war groß und blond und sah mir ähnlich. Er war gerade in Paris angekommen.“
Monsieur Alphonse lächelte. Er vergaß selten ein Gesicht, und das Trinkgeld des jungen Engländers war großzügig gewesen.
„Natürlich, Mademoiselle“, antwortete er. „Sie haben mich gerufen, weil Monsieur kein Französisch sprach.“
„Mein Zimmermädchen Marie meinte, du wüsstest vielleicht, wie er den Abend verbringen wollte“, fuhr sie fort. „Er war ganz neu in Paris und hat vielleicht nach Infos gefragt.“
Monsieur Alphonse lächelte und streckte seine Hände aus.
„Das stimmt“, antwortete er. „Er hat mich gefragt, wohin er gehen soll, und ich habe ihm die Folies Bergères empfohlen. Dann meinte er, er habe viel von den Supper-Cafés gehört und fragte mich, welches das unterhaltsamste sei. Ich habe ihm das Café Montmartre empfohlen. Er hat es sich aufgeschrieben.“
„Glaubst du, dass er vorhatte, dorthin zu gehen?“, fragte sie.
„Aber natürlich. Er hat versprochen, mir am nächsten Tag zu erzählen, wie es ihm gefallen hat.“
„Das Café Montmartre. Wo ist das?“, fragte sie.
„Auf der Place de Montmartre. Aber Mademoiselle wird mir verzeihen – sie wird verstehen, dass es ein Ort für Männer ist.“
„Sind Frauen nicht erlaubt?“, fragte sie.
Alphonse lächelte.
„Doch, schon. Aber Mademoiselle versteht sicher, dass eine Dame, die dorthin geht, eine gute Begleitung braucht.“
Sie stand auf und steckte ihm eine Münze in die Hand.
„Ich bin dir sehr dankbar“, sagte sie. „Übrigens, hat dich noch jemand nach meinem Bruder gefragt?“
„Niemand, Mademoiselle!“, antwortete der Mann.
Als sie hinausging, schlug sie die Tür fast zu.
„Und man sagt, die französische Polizei sei die klügste der Welt“, sagte sie empört.
Monsieur Alphonse beobachtete sie durch die Glasscheibe.
„ Ciel! Aber sie ist hübsch!“, murmelte er vor sich hin.
Sie ging ins Arbeitszimmer, zog ihre Handschuhe aus und schrieb einen Brief. Ihre hübschen Finger trugen keine Ringe, und ihre Handschrift war ein wenig zittrig. Trotzdem ist es sicher, dass kein Mann durch den Raum ging, ohne einen Grund zu finden, einen zweiten Blick auf sie zu werfen. Das schrieb sie:
Mein lieber Andrew, ich bin hier total verzweifelt und echt unglücklich. Ich hätte dir schon früher schreiben sollen, aber ich weiß, dass du gerade selbst Probleme hast, und wollte dich nicht belästigen. Ich bin pünktlich zu dem mit Guy vereinbarten Termin hier angekommen und habe festgestellt, dass er bereits am Vorabend eingetroffen war und ein Zimmer für mich gebucht hatte. Als ich ankam, war er nicht da. Ich habe mich umgezogen und mich hingesetzt, um auf ihn zu warten. Er kam nicht zurück. Ich habe mich erkundigt und erfahren, dass er das Hotel am Vorabend um acht Uhr verlassen hatte. Um es kurz zu machen: Jetzt sind schon zehn Tage vergangen, und er ist immer noch nicht zurückgekommen.
Ich war bei der Botschaft, bei der Polizei und in der Leichenhalle. Nirgendwo habe ich auch nur die geringste Spur von ihm gefunden. Niemand scheint sich auch nur im Geringsten für sein Verschwinden zu interessieren. Die Polizei zuckt mit den Schultern und sieht mich an, als müsste ich es verstehen – sie sind sich ganz sicher, dass er sehr bald zurückkehren wird. In der Botschaft fangen sie an, mich als lästig zu empfinden. Die Leichenhalle – möge der Himmel mir helfen, dass ich eines Tages den Schrecken meiner hastigen Besuche dort vergessen kann. Ich bin zu dem Schluss gekommen, Andrew, dass ich selbst nach ihm suchen muss. Wie, weiß ich nicht; wo, weiß ich nicht. Aber ich werde Paris nicht verlassen, bevor ich ihn gefunden habe.
Andrew, was ich hier brauche, ist ein Freund. Vor ein paar Monaten hätte ich keinen Moment gezögert, dich zu bitten, zu mir zu kommen. Heute ist das unmöglich. Deine Anwesenheit hier würde uns beiden nur peinlich sein. Kennst du jemanden, der kommen würde? Ich habe keinen einzigen Verwandten, den ich um Hilfe bitten könnte. Würdest du mir raten, Scotland Yard um einen Detektiv zu bitten oder mich an eine dieser Agenturen zu wenden? Wenn nicht, fällt dir jemand ein, der hierherkommen und mir helfen würde, entweder dir zuliebe als dein Freund oder, noch besser, ein Detektiv, der Französisch spricht und dem man vertrauen kann? Unser ganzes Leben lang haben Guy und ich uns darüber gefreut, dass wir keine Verwandten haben, die näher als Indien wohnen. Jetzt entdecke ich die Kehrseite davon.
Ich weiß, dass du alles tun wirst, was du kannst, um mir zu helfen, Andrew. Schreib mir bitte umgehend zurück.
Mit freundlichen Grüßen,
Phyllis Poynton.“
Sie versiegelte den Brief, adressierte ihn und schickte ihn ab. Danach ging sie über den Hof zum Restaurant und versuchte, etwas zu essen. Als sie fertig war, war es erst halb neun. Sie rief den Aufzug und fuhr in den vierten Stock. Auf dem Weg durch den Flur kam ihr plötzlich ein Gedanke. Sie nahm einen Schlüssel aus ihrer Tasche und ging in das Zimmer, das ihr Bruder bewohnt hatte.
Seine Sachen lagen immer noch unordentlich herum, und keiner seiner Koffer war verschlossen. Sie kniete sich hin und begann ruhig, seine Sachen zu durchsuchen. Es war eher eine vergebliche Hoffnung, aber sie hielt es für möglich, dass sich in einer seiner Taschen ein Brief befinden könnte, der Aufschluss über sein Verschwinden geben würde. Sie fand jedoch nichts dergleichen. Es gab Postkarten, ein paar Fotos und eine ganze Reihe von Restaurantrechnungen, aber alle stammten aus Orten in Deutschland und Österreich. Am Boden des zweiten Koffers fand sie jedoch etwas, das er offenbar für wertvoll genug gehalten hatte, um es sorgfältig aufzubewahren. Es war ein dickes Blatt Papier, das offiziell aussah, oben mit einer geprägten Krone versehen war und mit deutscher Schrift bedeckt war. Oben war es mit „siebzehn” nummeriert, und es handelte sich offensichtlich um ein einzelnes Blatt eines Dokuments. Sie faltete es sorgfältig zusammen und nahm es mit in ihr Zimmer. Dann fing sie an, es mit Hilfe eines deutschen Wörterbuchs zu studieren. Nach einer Stunde hatte sie eine grobe Übersetzung fertig, die sie sorgfältig durchlas. Als sie fertig war, war sie völlig verwirrt. Sie hatte das unangenehme Gefühl, auf etwas völlig Unerwartetes und Geheimnisvolles gestoßen zu sein.
„Was soll ich tun?“, fragte sie sich leise.
„Was kann das bedeuten? Wo um alles in der Welt hat Guy das gefunden?“
Es gab niemanden, der ihr antworten konnte, niemanden, der ihr einen Rat geben konnte. Ein überwältigendes Gefühl der Einsamkeit trieb ihr die Tränen in die Augen. Sie saß eine Weile da und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Dann stand sie auf, vernichtete ruhig und sorgfältig ihre Übersetzung und schloss das geheimnisvolle Blatt ganz unten in ihrer Kulturtasche ein. Je mehr sie darüber nachdachte, desto weniger neigte sie dazu, es mit seinem Verschwinden in Verbindung zu bringen.
KAPITEL IV
DER VERLUST DES TASCHENTUCHS
Monsieur Albert schaute über ihre Schulter, um den Mann zu suchen, der sicherlich anwesend sein musste – aber er suchte vergeblich.
„Mademoiselle wünscht einen Tisch – für sich allein!“, wiederholte er zweifelnd.
„Wenn es Ihnen recht ist“, antwortete sie.
Es war offensichtlich, dass Mademoiselle zu der Klasse gehörte, die nicht alleine Nachtcafés besucht, aber das ging Monsieur Albert schließlich nichts an. Sie kam vielleicht aus jenem seltsamen Land der Freien, dessen Töchter vor langer Zeit die Barrieren der Geschlechter mit derselben Unbekümmertheit überwunden hatten, mit der Mademoiselle Flossie wenige Stunden später in ihrem Nationaltanz ihre Fußsohlen zeigen würde. Hätte sie zufällig ihren Schleier gelüftet, hätte keine Überredungskunst der Welt ihr die Freiheit dieses kleinen Raumes gesichert, denn Monsieur Alberts Sinn für Ähnlichkeiten war ebenso ausgeprägt wie sein Gedächtnis für Gesichter. Aber erst als sie es sich an einem Ecktisch bequem gemacht hatte, von dem aus sie einen guten Überblick über den Raum hatte, tat sie dies, und Monsieur Albert erkannte mit einem philosophischen Achselzucken den Fehler, den er begangen hatte.
Phyllis sah sich neugierig um. Es war noch zu früh für die Stammgäste des Lokals, und die meisten Tische waren leer. Die Musiker in ihren scharlachroten Jacken rauchten Zigaretten und hatten ihre Instrumente noch nicht hervorgeholt. Der Dirigent zwirbelte seinen schwarzen Schnurrbart und starrte die schöne junge Engländerin an, ohne jedoch einen einzigen Blick von ihr zu ernten. Ein oder zwei Männer versuchten ebenfalls, ihr mit Lächeln und Blicken zu vermitteln, dass ihre Einsamkeit nicht länger andauern musste, als sie wollte. Die unverheirateten Damen steckten die Köpfe zusammen und diskutierten mit leisem Gelächter über sie. All dies ließ sie gleichgültig. Sie bestellte ein Abendessen, das sie mechanisch aß, und Wein, den sie kaum trank. Die ganze Zeit über dachte sie nach. Was konnte sie jetzt, da sie hier war, tun? Bei wem sollte sie sich erkundigen? Sie musterte die Gesichter der Neuankömmlinge mit einer gewissen ernsten Neugier, die diese verwirrte. Sie zog weder Aufmerksamkeit auf sich, noch stieß sie sie ab. Sie blieb völlig gelassen.
Monsieur Albert kam bei einem seiner Rundgänge durch den Raum an ihrem Tisch vorbei. Sie hielt ihn an.
„Ich hoffe, Mademoiselle ist gut bedient worden!“, sagte er mit einer kleinen Verbeugung.
„Ausgezeichnet, danke“, antwortete sie.
Er wollte weitergehen, aber sie hielt ihn zurück.
„Sie haben hier sehr viele Besucher“, bemerkte sie. „Ist das immer so?“
Er lächelte.
„Heute Abend“, meinte er, „ist das nichts Besonderes. Es gibt viele, die jeden Abend hierherkommen. Sie amüsieren sich hier.“
„Hast du auch viele Fremde hier?“, fragte sie.
„Aber natürlich“, sagte er. „Die ganze Zeit!“
„Ich hab einen Bruder“, sagte sie, „der vor elf Nächten hier war – mal überlegen – das war letzten Dienstag vor einer Woche. Er ist groß und blond, etwa 21 Jahre alt, und man sagt, er sieht mir ähnlich. Ich frage mich, ob du dich an ihn erinnerst.“
Monsieur Albert schüttelte langsam den Kopf.
„Das ist seltsam“, meinte er, „denn normalerweise vergesse ich niemanden. An den letzten Dienstag vor einer Woche erinnere ich mich sehr gut. Es war ein ruhiger Abend. La Scala war hier – aber sonst niemand. Wenn der Bruder von Mademoiselle hier war, ist das sehr seltsam.“
Ihre Lippen zitterten einen Moment lang. Sie war enttäuscht.
„Das tut mir leid“, sagte sie. „Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen. Er verließ das Grand Hotel an diesem Abend mit der Absicht, hierher zu kommen – und kehrte nie zurück. Seitdem mache ich mir große Sorgen.“
Sie war keine große Menschenkennerin, aber Monsieur Alberts Mitgefühl beeindruckte sie nicht mit seiner Aufrichtigkeit.
„Wenn Mademoiselle es wünscht“, sagte er, „werde ich mich bei den Kellnern erkundigen. Ich fürchte jedoch, dass sie hier keine Neuigkeiten erfahren wird.“