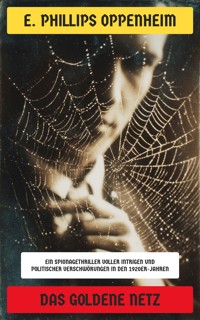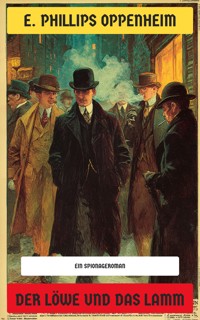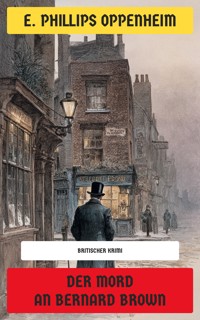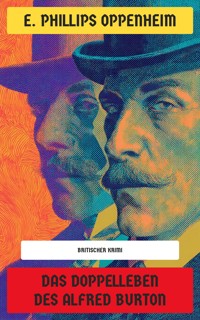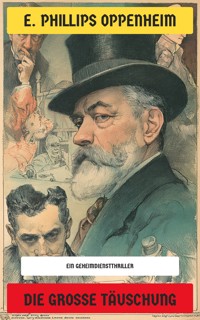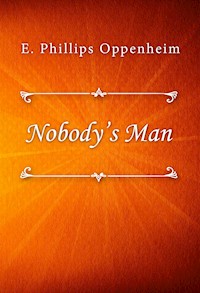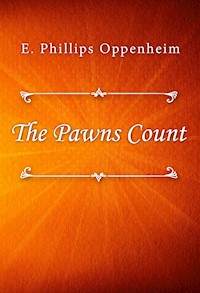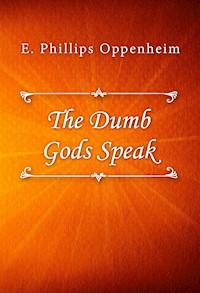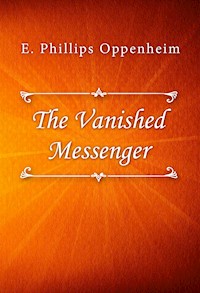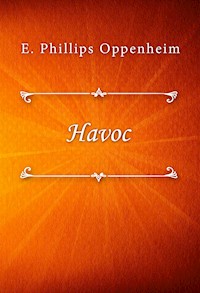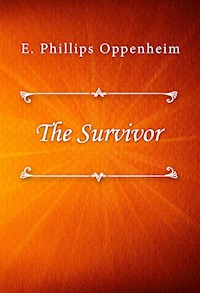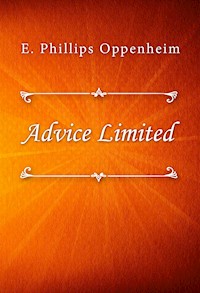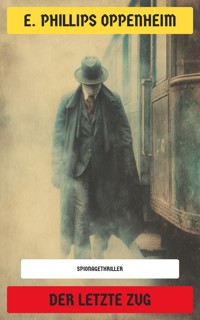
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der letzte Zug ist ein hochgespannter Flucht- und Spionageroman an der Schwelle des europäischen Zusammenbruchs. Ein Geflecht aus Diplomaten, Agenten und Grenzbeamten umstellt Reisende, die den letzten Zug aus einer bedrohten Hauptstadt erreichen wollen. Oppenheim mischt urbane Dialoge in Botschaften, Hotels und Speisewagen mit abrupten Wendungen an Kontrollpunkten. Clubland-Eleganz trifft die Unruhe der späten Dreißiger; Identitäten, chiffrierte Depeschen und Eisenbahnlogistik werden zu Hebeln von Loyalität und Opportunismus. E. Phillips Oppenheim (1866–1946), der produktive britische Meister des weltläufigen Thrillers, veröffentlichte über hundert Romane und wurde als "Prince of Storytellers" bekannt. Als Geschäftsmann und Vielreisender, zwischen London und der Riviera, schrieb er im Schatten zweier Kriege. Diese Erfahrung schärft hier den Blick für gesellschaftliche Rituale, diplomatische Manöver und verdeckte Macht an Bahnhöfen, in Salons und Kanzleien. Empfehlenswert für Leserinnen und Leser klassischer Spannungsliteratur: Wer Ambler, Buchan oder Greene schätzt, findet hier eine frühere, doch elegante Schule des Genres. Der letzte Zug vereint zügigen Rhythmus, urbane Atmosphäre und historische Resonanz zu einem Thriller von anhaltender Relevanz. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der letzte Zug
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL I
Herr Paul Schlesser, der Chefkassierer der Bank Leopold Benjamin & Co. in der Ludenstraße in Wien, unterbrach sein Gespräch mit dem vornehm aussehenden jungen Engländer, der sich über seinen Teil des Schalters beugte, und machte ihn leise auf den größeren der beiden Männer aufmerksam, die gerade aus dem privaten Büro auf der anderen Seite des Marmorbodens kamen.
„Das“, verkündete er mit angehaltenem Atem und einer Spur von tiefem Respekt in der Stimme, „ist der derzeitige Leiter unserer Firma – Herr Leopold Benjamin. Er kommt heutzutage nur noch sehr selten hierher. Es ist uns eine große Freude, ihn willkommen zu heißen.“
Herr Schlesser, der eine unscheinbare Person war, schien sich zu strecken und fast an Würde zu gewinnen, als er sich tief vor dem großen, schlanken Mann verbeugte, der an ihm vorbeiging. Herr Leopold Benjamin ähnelte seinem Kassierer nicht im Geringsten. Niemand hätte gedacht, dass sie derselben Rasse angehörten, einer Rasse, die damals stündlich um ihr Leben fürchten musste. Sein Lächeln war kaum fröhlich, aber auf seine Weise angenehm, als er kurz inne hielt, um den Gruß seines Angestellten zu erwidern. Seine Augen blickten den Fremden fragend an. Der Kassierer öffnete die Drahtabtrennung, die ihn von der Außenwelt trennte.
„Entschuldigen Sie bitte, Herr Benjamin“, sagte er, „dieser Herr, Herr Charles Mildenhall, hat hier einen Kreditbrief von Barclay's in London. Das ist der Chef unserer Firma, Herr Mildenhall – Herr Leopold Benjamin.“
Der Bankier nahm seine Hand von der Schulter seines Begleiters. Er streckte seine Hand aus. Seine Stimme war angenehm, fast musikalisch.
„Sind Sie vielleicht mit meinem alten Freund Sir Philip Mildenhall verwandt?“, fragte er.
„Sir Philip ist mein Onkel, Sir“, antwortete der junge Mann. „Er war in seinen jüngeren Jahren Erster Sekretär hier.“
Mr. Benjamin nickte nachdenklich.
„Er war ein angenehmer Begleiter. Er hat oft mit mir zu Abend gegessen. Außerdem war er ein Kenner von Gemälden – eigentlich von allen Kunstgegenständen. Ich habe ihn sehr vermisst, als er nach Bukarest ging.“
„Ich glaube, in gewisser Weise tat es ihm leid, wegzugehen“, bemerkte Mildenhall. „Er hatte hier viele Freunde. Unter ihnen habe ich ihn von Ihnen sprechen hören, Sir. Ich habe von ihm von Ihrer wunderbaren Sammlung alter Meister gehört.“
„Sind Sie selbst im diplomatischen Dienst?“, fragte der Bankier.
„In gewisser Weise ja“, antwortete der junge Mann. „Im Moment bin ich auf Langzeiturlaub.“
„Deinem Onkel geht es gut, hoffe ich?“
„Bei bester Gesundheit, danke der Nachfrage, Sir. Ich werde ihm von unserem Treffen erzählen.“
„Du musst mich besuchen kommen, bevor du die Stadt verlässt“, lud der Bankier ihn ein. „Wie lange bleibst du hier?“
„Nur noch ein paar Tage, fürchte ich.“
„Würdest du am Donnerstagabend mit mir essen gehen?“, schlug der andere vor. „Ich muss mich für einen frühen Termin entscheiden, weil meine Pläne noch ein bisschen ungewiss sind.“
„Das mache ich gerne“, stimmte der junge Mann zu. „Mein Onkel wird sich sehr über Neuigkeiten von dir freuen.“
Mr. Benjamin zuckte mit seinen hohen, gebeugten Schultern. Für einen Moment lag Traurigkeit in seinen eingefallenen Augen.
„Leider keine allzu guten Neuigkeiten“, sagte er. „Unsere Rasse wird in diesem Land mit jedem Tag weniger beliebt. Zu Zeiten deines Onkels war das noch anders. Derzeit blicken wir mit großer Sorge in die Zukunft. Aber zumindest eine Freude werde ich mir sichern“, schloss er mit einem Lächeln. „Ich werde mich freuen, dich am Donnerstag um acht Uhr zu sehen. Ich hoffe, du hast nichts gegen unsere frühen Termine.“
„Überhaupt nicht, Sir.“
„Unser Freund hier am Schalter“, sagte Leopold Benjamin mit einem freundlichen Lächeln in Richtung des Kassierers, „wird dir meine Adresse aufschreiben. Auf Wiedersehen, Mr. Mildenhall.“
Er ging weiter, sein Begleiter – ein kleiner, stämmiger Mann mit einem sehr intelligenten Gesicht – an seiner Seite. Der Kassierer sah seinen Kunden mit noch mehr Respekt an.
„Es ist uns eine große Ehre“, vertraute er ihm an, während er einige Scheine abzählte, „von Herrn Benjamin empfangen zu werden. Er empfängt nur noch sehr selten Gäste. Hier ist Ihr Geld, Sir – und auch Ihr Kreditbrief“, fuhr er fort und steckte Letzteren zurück in seinen Pergamentumschlag. „Es ist uns immer eine Freude, Ihnen hier zu Diensten zu sein, wenn Sie mehr Geld benötigen oder allgemeine Informationen über die Stadt wünschen. Ich schreibe hier die Adresse von Herrn Benjamin auf: Palais Franz Josef. Jedes Fahrzeug, das du mietest, wird dich ohne Umwege dorthin bringen.“
Der junge Mann sammelte seine Sachen ein, nickte freundlich und verabschiedete sich. Auf den breiten Stufen des sehr schönen Bankgebäudes zögerte er einen Moment, dann beschloss er, ein bisschen auf der Ringstraße spazieren zu gehen. Es war knapp fünf Uhr, und obwohl es stressige und angespannte Zeiten waren, sah man den meisten Passanten eine gewisse Unbeschwertheit an. Der Arbeitstag war vorbei. Der Abend und die Nacht standen vor der Tür. Der echte Wiener ist selten empfänglich für den Ruf der Häuslichkeit. Es sind die Musik der Cafés, das leichte Lachen der Frauen, der Geschmack seines Aperitifs, die ihn mit Einbruch der Dämmerung anziehen. Mildenhall gab sich der allgemeinen Stimmung hin. Nach einer Stunde Spaziergang betrat er eines der attraktivsten der berühmten Cafés, kaufte eine Abendzeitung und setzte sich an einen bequemen Tisch. Er bestellte ein Getränk und zündete sich eine Zigarette an. Sein Rendezvous am Donnerstagabend gefiel ihm. Es war toll, Leopold Benjamin ganz zufällig getroffen und eine so interessante Einladung bekommen zu haben. Die Wiener Cafés sind nicht für Isolation gemacht. Mildenhall saß in der Ecke der langen Couch, die sich an einer Seite des Raumes entlang erstreckte. Der Tisch vor ihm war groß genug, um mehrere Gäste aufzunehmen. Zwei Stühle waren frei. Mildenhall breitete seine Zeitung aus und drehte sie so, dass er den Leitartikel lesen konnte. Seine Aufmerksamkeit wurde jedoch plötzlich abgelenkt.
„Störe ich Sie, wenn ich diesen Stuhl nehme?“, fragte eine freundliche Stimme in ausgezeichnetem Englisch.
Mildenhall blickte auf und erkannte den Mann, der kurz zuvor noch mit Mr. Benjamin in der Bank gewesen war.
„Überhaupt nicht“, antwortete er höflich. „Warum nicht die Couch? Die ist bequemer, und schließlich nehme ich nicht viel Platz weg.“
Mit einer Verbeugung setzte sich der Neuankömmling, reichte seinen Mantel und Hut einem Kellner und gab eine Bestellung auf. Er warf einen Blick auf die Zeitung in Mildenhalls Händen.
„Heutzutage verschwendet man viel Zeit mit diesen flüchtigen Zeitschriften“, meinte er. „Mir scheint, dass vieles geschrieben wird, was die Tinte nicht wert ist.“
„Ich nehme an, Sie sind kein Journalist!“
„Das bin ich nicht“, war die leise Antwort. „Kluge Männer, ohne Zweifel, aber wofür sind sie verantwortlich! Die Hälfte der Kriege auf der Welt wird durch die Presse verursacht. Jede Ungerechtigkeit der Menschheit wird durch ihre Federn genährt. Nachrichten an sich sind gut, aber Nachrichten sind das Letzte, was man findet – jedenfalls in den Abendzeitungen. Die Zeitung, die du da hast, ist in einen unheiligen Kreuzzug verwickelt. Sie richtet großen Schaden in der Stadt an. Sie schürt schlechte Gefühle an diesem Ort der schönen Dinge und freundlichen Menschen.“
„Habe ich Sie nicht vor einer Stunde in Benjamins Bank gesehen?“, fragte Mildenhall.
„Das haben Sie in der Tat, Sir. Mr. Leopold Benjamin ist einer der Männer, die ich am meisten bewundere. Er ist ein großer Philanthrop, ein großer Künstler, ein Liebhaber der Menschheit, ein guter Mensch. Aber sein Leben wird derzeit durch die Kampagne einer bestimmten Sektion der Presse vergiftet.“
Mildenhall nickte mitfühlend.
„Dieser Kreuzzug gegen die Juden“, murmelte er.
„Es ist ein bösartiger und empörender Kreuzzug“, sagte sein Begleiter fast flüsternd und nach einem vorsichtigen Blick in die Runde. „Ich sollte vielleicht nicht an einem öffentlichen Ort so reden, aber ich weiß, wer du bist. Ich habe deine Vorstellung bei Leopold Benjamin gehört. Ich weiß auch, dass du Engländer bist, und die Engländer waren schon immer die Beschützer aller verfolgten Völker.“
„Ist ‚verfolgt‘ nicht ein ziemlich harter Ausdruck?“, fragte Mildenhall. „Der Österreicher ist so ein freundlicher Mensch – zumindest habe ich das aus dem Wenigen, das ich von ihm gesehen habe, geschlossen.“
„Der Österreicher selbst ist ganz in Ordnung“, gab der andere zu. „Es ist das, was hinter ihm steht und ihn antreibt, das gefährlich ist. Darf ich?“
Er zog ein kleines Etui aus seiner Tasche und reichte seinem Begleiter eine Visitenkarte.
„Ich selbst bin kein Jude“, fuhr er fort, „obwohl mein Name, den du dort siehst, eher darauf hindeutet. Ich habe einen Beruf, der mich dazu zwingt, um die ganze Welt zu reisen. Es gibt nur wenige Länder, bevölkerungsreiche Länder, die ich noch nicht besucht habe. Die leeren Orte interessieren mich nicht. Ich mag Arbeit, und meine Arbeit findet unter Menschen statt. Mein Name ist, wie du siehst, Marius Blute, und ich bin eingebürgerter Finne.“
„Nach Ihrer Sprache zu urteilen“, bemerkte Mildenhall, „hätte ich Sie für einen Engländer gehalten. Nach Ihrem Aussehen hätte ich Sie vielleicht für einen Skandinavier gehalten.“
„Ich bin eigentlich in Finnland geboren“, vertraute Blute ihm an. „Meine Mutter war Finnin und mein Vater Russe.“
„Und was machst du beruflich?“, fragte Mildenhall freundlich.
„Ah, das wirst du vielleicht bald erraten“, antwortete der andere. „Ich habe gehört, dass wir uns am Donnerstag beim Abendessen wiedersehen werden.“
„Das freut mich zu hören“, versicherte Mildenhall ihm. „Sag mal, glaubst du, unser Gastgeber wird uns einige seiner Schätze zeigen? Mir wurde immer gesagt, dass ich in seinen Räumen erlesenere Bilder finden würde als in jeder europäischen Galerie.“
„Das ist ganz sicher wahr“, stimmte Blute zu. „Ob er Ihnen die Galerien öffnen wird, bezweifle ich allerdings. Es sind gefährliche Zeiten für einen Mann, der solche Besitztümer hat.“
„Hat er gefährliche Nachbarn?“
„Darüber werden wir hier nicht sprechen. Wien hat sich leider sehr verändert. Wir haben hier eine regelrechte Plage der Gestapo unter uns. Die Wiener selbst, die Stadtbewohner, haben die Kontrolle über ihre Stadt verloren. Das ist traurig, aber wahr. Einer nach dem anderen mussten die Männer, die Wien zu einem großartigen und fröhlichen Ort gemacht haben, die Stadt verlassen. Diejenigen, die am meisten zu ihrem Reichtum und ihrer Schönheit beigetragen haben, sind jetzt am meisten verfolgt. Man fragt sich manchmal, wie die Welt von morgen aussehen wird! Ich könnte dich jetzt zum Haus eines großen österreichischen Aristokraten bringen, Mr. Mildenhall. Es ist nicht weit von hier. Du würdest ihn in einem kleinen Zimmer sitzen sehen. Am anderen Ende ist ein Vorhang, und hinter diesem Vorhang, der, wie ich dir sagen kann, aus unbezahlbarer chinesischer Seide ist, steht ein Bett, und auf diesem Bett schläft er. Am anderen Ende steht ein Tisch, umgeben von Paravents, deren Schönheit mit Worten nicht zu beschreiben ist, und dort isst er zu Abend. Es gibt ein großes Fenster mit Vorhängen, die einst den Palast eines Dogen schmückten. Wenn sie beiseite gezogen sind, hat er einen der schönsten Ausblicke in Wien. Dieses Zimmer und sein kleiner Vorraum, Mr. Mildenhall, hat er seit zwanzig Jahren nicht mehr verlassen, und in diesem Zimmer wird er sterben. Aber wenn einer der Experten aus irgendeinem Teil der Welt, der zu Benjamins Rasse gehörte und sowohl einen Sinn für finanzielle Werte als auch für Wertschätzung hatte, dieses Zimmer sehen würde, würde er Ihnen sagen, dass Millionen Ihrer englischen Pfund den Inhalt dieses einen Raumes nicht kaufen könnten. Dort sitzt er. Er ist zufrieden, solange er nicht gestört wird. Er hat sein Leben der Schönheit gewidmet und fürchtet, seine Schätze zu verlieren. Er fürchtet sich so sehr, dass er sie konzentriert, aussortiert und alles behalten hat, was ein bisschen schöner war als alles andere seiner Art. „Der Raum ist zu klein“, sagt er manchmal, „um ihn auszurauben.“ Aber in seinem Herzen ist Angst bei diesem Gedanken. Eines Tages wird er alles verlieren. Vor nicht einmal drei Tagen kam ich an seinem Haus vorbei. Ich sah einen dieser verhassten Spione, die es beobachteten. Sie beginnen zu wissen, wo sie das finden können, wonach ihre Herren verlangen – alles, was sie in Gold verwandeln können. An diesem Nachmittag kam ein weiterer auf die Liste.
Blutes Geschichte war so einfach erzählt worden und offensichtlich das Ergebnis seiner eigenen Beobachtungen, dass sein Begleiter plötzlich großes Interesse an dem fürstlichen Einsiedler entwickelte, der seine Schätze hütete.
„Kannst du ihn nicht warnen?“, fragte er. „Kann man ihm nicht sagen, dass sie ihn im Visier haben?“
Der andere schüttelte langsam den Kopf.
„Was würde das bringen? Er ist zu alt, um zu fliehen, er ist zu alt und zu müde, um seine Schätze zurückzulassen. Er wird dort sitzen, umgeben von seinen Schätzen, bis der Tag kommt, an dem die Gestapo seine Schwelle überschreitet und er ihre schicksalhafte Vorladung hört. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, wird er sich meiner Meinung nach umbringen.“
Mildenhall seufzte. Das Orchester spielte fröhliche Musik, der Ort war voller plaudernder und lachender Gruppen von Menschen, die für ein oder zwei Stunden alle Sorgen hinter sich lassen konnten.
„Was ist mit unserem Freund Benjamin?“, fragte er. „Glaubst du, er ist in Gefahr?“
„Leopold Benjamin“, sagte Blute ernst, „steht im Moment im Rampenlicht des Schicksals. Manchmal wundere ich mich, dass er so lange entkommen ist. Er ist der prominenteste Jude der Stadt, er wurde mit hohen Geldstrafen belegt, er spendet viel für wohltätige Zwecke, die alte Aristokratie des Landes, die selbst ihren hochgeborenen Nachbarn die Türen verschließt, hat ihn in ihre Mitte aufgenommen. Er nimmt einen großen Platz in den Herzen der Menschen hier ein, aber um ehrlich zu sein, ist er die Sorge meines Lebens. Selbst ich wage es nicht, ihm zu sagen, dass er verloren ist, wenn er in der Stadt bleibt. Er ist zu reich, zu mächtig, um zu entkommen. Er wird eines der ersten Opfer der Katastrophe sein, die Österreich bedroht. Ich bin seit zwei Jahren hier und habe nichts anderes getan, als mich um ihn zu kümmern. Ich werde alles tun, was ich kann, auch wenn es mich wahrscheinlich das Leben kosten wird. Ich werde es ohne zu zögern geben. Trotzdem ist Leopold Benjamin verloren. Ich saß heute Nachmittag mit ihm in seinem schönen Büro. Ich habe ihm einen Fluchtweg gezeigt. „Und meine Bilder?“, fragte er. „Meine Schätze?“ „Wir könnten einige Dinge herausschmuggeln“, sagte ich ihm. Er schüttelte den Kopf. „Ich bin ein gieriger Mann“, sagte er. „Ich kann mich von nichts trennen.“ Was soll man mit so jemandem machen? Ich halte ihm den Weg offen, aber ich fürchte, dass er bis zum Ende stur bleiben wird.
Mildenhall schaute auf seine Uhr und stand auf.
„Vielleicht kann ich dir in ein paar Tagen mehr sagen“, meinte er. „Ich esse dann dort zu Abend und hoffe, ein paar der alten Meister zu sehen.“
Marius Blute seufzte.
„Ein paar Tage“, murmelte er. „Ja, ich denke, ein paar Tage sind wohl das Maximum. Du kannst trotzdem im Palais Franz Josef zu Abend essen, Mr. Mildenhall. Du wirst die besten Weine Österreichs trinken und die Speisen unseres großartigen Küchenchefs genießen, aber es wird eher wie das Festmahl vor dem Einfall der Philister sein.“
Charles Mildenhall verabschiedete sich mit einem Nicken und verließ den Ort, während ihm die Worte seines Begleiters noch in den Ohren klangen. Aber noch eindringlicher als diese Worte blieb ihm der Schatten in Erinnerung, der in den traurigen Augen des Mannes zu liegen schien, mit dem er nur wenige Minuten in der Bank gesprochen hatte. Leopold Benjamin hatte tatsächlich die Ausstrahlung eines Mannes, der sich auf dem Weg zum Tod befand.
KAPITEL II
Mildenhall betrat die britische Botschaft mit der Gelassenheit eines Stammgastes. Er wechselte ein paar Worte mit dem Botschafter, Sir John Maxwell-Tremearne, den er abgelenkt und besorgt vorfand, und ging dann zu Freddie Lascelles, dem Ersten Sekretär und einem Mann von einiger Bedeutung im gesellschaftlichen und sportlichen Leben Wiens. Auch Lascelles sah etwas besorgt aus und führte seinen Besucher nach den ersten Worten in ein separates Zimmer.
„Du bist immer da, wenn es Probleme gibt, nicht wahr, Charles?“, bemerkte er grimmig. „Was machst du hier? Und woher kommst du?“
„Ach, ich hänge nur so rum“, antwortete Mildenhall und nahm sich eine Zigarette seines Freundes. „Zuletzt war ich in Budapest.“
„Da herrscht ja ziemliche Nervosität, oder?“
„Überall nervös! Europa ist wie eines dieser unbeleuchteten Lagerfeuer, die bereits unter der Oberfläche schwelen.“
„Stimmt es, dass Polen komplett mobilisiert ist?“, fragte Lascelles.
Das Gesicht seines Besuchers war völlig ausdruckslos.
„Es gibt Berichte dieser Art“, stellte er fest. „Hör mal, wann geht unsere nächste Sendung?“
„Heute Nacht.“
„Mit dem Flugzeug oder der Bahn?“
„Keine Ahnung“, sagte Lascelles und lehnte sich zurück, um zum Telefon zu greifen. „Warte mal kurz, bitte.“
Er unterhielt sich kurz in fließendem Deutsch mit jemandem, den man nicht sehen konnte.
„Mit dem Flugzeug“, sagte er, als er auflegte.
„Um wie viel Uhr?“
„Spät. Der Chef isst in der Kanzlei zu Abend und muss nach seiner Rückkehr einen kurzen Bericht abgeben. Wie viel Platz brauchst du?“
„Nur genug für mein wöchentliches Geschwätz ... Ich mache es hier, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Bin ich Ihnen ein paar Stunden lang im Weg?“
„Ich sperre dich gerne hier ein. Willst du ein Codebuch?“
„Ich kann es genauso gut haben. Ich sollte es aber nicht brauchen.“
In Lascelles' Augen blitzte Bewunderung auf, als er ein paar Vorbereitungen traf, um es seinem Freund bequem zu machen.
„Was würde ich für ein Gedächtnis wie deins geben!“, meinte er. „Zehn oder fünfzehn Seiten Foolscap, dein letzter Bericht, ich erinnere mich, direkt in Code.“
„Diesmal sind es leider etwas mehr“, seufzte Mildenhall. „Was das Gedächtnis angeht – das ist nur ein Trick.“
„Hätte ich das doch auch! Willst du damit sagen, dass du nicht einmal Notizen hast?“
„Nicht eine einzige“, antwortete Mildenhall.
„Und wann hast du deinen letzten Bericht nach Hause geschickt?“
„Nach Warschau, letzten Donnerstag.“
„Und jetzt setzen Sie sich hin und verschlüsseln, wahrscheinlich ohne Codebuch, einen Bericht über wie viele Besuche und Gespräche?“
Mildenhall lächelte.
„Geh du ruhig spielen, mein Freund“, riet er ihm. „Hast du genug Siegellack?“
„Eine ganze Schublade voll. Wirst du heute Abend Ihrer Ladyschaft deine Aufwartung machen?“
„Ich werde sehen, wie spät es ist, wenn ich fertig bin.“
„Auf deinem Schreibtisch stehen zwei Glocken“, wies Lascelles ihn hin. „Eine für die Sekretärin, die andere für den Hausdienst. Ich wohne gerade hier. Ruf mich an, und wenn du rechtzeitig fertig bist, trinken wir einen Cocktail.“
Er verschwand mit einem Abschiedsnicken. Ein paar Minuten später tauchte ein englischer Diener mit einem kleinen Aktenkoffer und einem versiegelten Umschlag auf. Mildenhall begrüßte ihn mit ein paar freundlichen Worten.
„Mr. Lascelles sagt, Sir, vergessen Sie nicht, vor Ihrer Abreise mit ihm zu sprechen. Er hat Zeit zum Abendessen, falls Sie ihm Gesellschaft leisten möchten.“
„Ich schaue mal, wann ich fertig bin, Butler. Trotzdem vielen Dank an ihn. Ist hier immer noch alles ziemlich fröhlich?“
Der Mann schüttelte traurig den Kopf.
„Es ist nicht mehr wie früher, Sir. Nichts ist mehr wie früher. Der Glanz ist verschwunden, wenn Sie verstehen, was ich meine, Sir.“
„Die Leute sind nervös geworden, was?“
„Sie haben Angst vor dem, was kommen könnte, Sir. Das ist es, was mit ihnen los ist. Es ist der Herr auf der anderen Seite, vor dem sie Angst haben.“
Mildenhalls Gesichtsausdruck war wieder völlig ausdruckslos. Er nickte leicht und winkte mit der Hand in Richtung Tür.
„Sag Mr. Lascelles, dass ich ihn so bald wie möglich besuchen werde“, wies er ihn an.
Der Diener verabschiedete sich. Mildenhall saß einige Minuten lang da, als wäre er in Gedanken versunken. Sein Blick wanderte durch den Raum. Alles war ihm vertraut. In den letzten sieben oder acht Jahren hatte er seine geheimen Europareisen, die ihm im Außenministerium so viel Ansehen eingebracht hatten, in Wien beendet und von diesem Raum aus seinen Abschlussbericht nach Hause geschrieben. Die Wohnung war unverändert, die beiden Türen waren geschlossen, die Vorhänge zugezogen, seine Einsamkeit war gesichert. Er brach das Siegel des Umschlags und holte einen kleinen Schlüssel heraus, dessen einziger Inhalt. Mit dem Schlüssel öffnete er den Aktenkoffer und holte das Codebuch heraus. Er schob den Koffer beiseite und legte das Codebuch an einer gut sichtbaren Stelle direkt vor sich ab. Dann nahm er einen Stapel schweres, blaues Foolscap-Papier mit Prägung aus dem Regal, überprüfte seinen Füllfederhalter und begann zu schreiben.
Nach zwei Stunden war seine Aufgabe erledigt. Die acht Blätter Foolscap-Papier, bedeckt mit klarer, kräftiger Handschrift, enthielten in sorgfältig gewähltem Code das Ergebnis eines geheimen Besuchs in Moskau und dreier kürzerer Aufenthalte in Warschau, Bukarest und Budapest. Mildenhall zündete sich eine Zigarette an und las alles durch, was er geschrieben hatte. Als er fertig war, huschte ein Hauch von Selbstzufriedenheit über sein Gesicht. Er nahm keine Korrekturen vor, nicht eine einzige Änderung, sondern fügte nur zwei Wörter in einem Code hinzu, der so geheim war, dass nur er und die Person, die seinen Bericht lesen würde, ihn kannten und der nur in der Erinnerung der beiden Männer existierte. Er faltete die acht Blätter zusammen, suchte den passenden Leinenumschlag heraus, versiegelte ihn großzügig mit braunem Siegellack und seinem eigenen Siegel. Dann legte er das Codebuch zurück in die Versandbox, schloss sie ab und steckte den Schlüssel in einen weiteren Umschlag, den er versiegelte und frankierte. Schließlich läutete er die Glocke. Ein junger Mann mit einer dicken Brille, blass und eindeutig ein Sekretär, erschien. Er begrüßte den einzigen Bewohner des Raumes ohne ein Lächeln.
„Guten Abend, Mr. Mildenhall.“
„Guten Abend, Paul. Da bist du ja.“
Er reichte ihm das Paket. Der junge Mann nahm es entgegen.
„Ich werde es im Safe aufbewahren, Sir, bis wir es um Mitternacht für die Tasche öffnen. Seine Exzellenz wird bis dahin zurückgekehrt sein.“
„Wer fliegt heute Nacht hinüber?“, fragte Mildenhall.
„Major Grimmet, Sir.“
„Ein netter, zuverlässiger Kerl“, lobte Mildenhall. „Ich hätte nichts dagegen, mit ihm mitzufliegen.“
„Sie verlassen uns doch noch nicht, Sir?“, fragte der Sekretär.
„Noch nicht“, war die etwas vage Antwort. „Weißt du, ob Mr. Lascelles noch in seinem Zimmer ist?“
„Ja, er ist da und hofft, Sie zu sehen.“
„Und Ihre Ladyschaft?“
„Ihre Ladyschaft isst zu Hause zu Abend. Sie hat mir gesagt, dass Sie, wenn Sie vor neun Uhr anrufen, zu ihr kommen und einen Cocktail mit ihr trinken können.“
Mildenhall schaute auf seine Uhr.
„Nur noch fünf Minuten“, meinte er. „Ein Cocktail klingt echt gut, Paul.“
„Du findest Ihre Ladyschaft im kleinen Salon. Mr. Lascelles meinte, dass er wahrscheinlich auch zu euch stoßen wird.“
Lady Maxwell-Tremearne war die typische Botschaftergattin. Sie wurde als Tochter amerikanischer Eltern in Washington geboren, hatte ihren zukünftigen Mann bei einem Wintersporturlaub im österreichischen Tirol kennengelernt und ihn innerhalb eines Monats nach seiner Ernennung zum Ersten Sekretär der britischen Botschaft in Washington geheiratet. Sie war noch keine vierzig Jahre alt und in der Wiener Gesellschaft äußerst beliebt. Sie begrüßte Charles Mildenhall herzlich, als er vom Haushofmeister angekündigt wurde. Sie lag auf einem Sofa vor einem Kaminfeuer und war von Zeitungen umgeben.
„Mein lieber Charles!“, rief sie aus. „Wie schön, dich zu sehen.“
Er küsste ihre Finger und zog einen Stuhl an ihre Seite.
„Es tut mir leid, dass du all diese halboffiziellen Zeitungen liest“, sagte er, nachdem sie ein paar Höflichkeiten ausgetauscht hatten. „Du wirst völlig verwirrt sein, wenn du versuchst, sie alle zu lesen. Da gibt es die offizielle Zeitung der Heimwehr, das Nazi-Blatt, die Regierungszeitung und den Schutzbund!“
„Ich weiß“, seufzte sie. „Es ist furchtbar schwierig. Ich dachte immer, unsere amerikanische Politik sei schon kompliziert genug, aber hier ist es noch viel schlimmer. Sag mir, was passieren wird, Charles.“
Er lachte – fast unbeschwert.
„Meine liebe Sarah“, rief er aus, „warum fragst du mich? Ich dachte, du wüsstest, dass Politik nicht mein Ding ist. Ich bin hierher gekommen, um ihr zu entkommen. Ich bin immer nervös, dass meine Familie eines Tages darauf bestehen wird, dass ich ins Parlament gehe.“
„Die Politik in England ist anders“, erklärte sie etwas gereizt. „Sie bedeutet nicht Blutvergießen wie hier. Weißt du, es gab ziemlich viele Straßenkämpfe, und die Art und Weise, wie sie diese armen Juden behandeln, ist schrecklich. Erinnerst du dich an Otto von Lenberg?“
„Aber natürlich“, antwortete er.
„Die Von Lenbergs sind eigentlich gar keine Juden“, erzählte sie ihm, „aber nur weil er die Herzfelds verteidigt hat, als ihr Eigentum beschlagnahmt wurde, wurde er aus dem Gericht ausgeschlossen und zu einer Millionenstrafe verurteilt. Er sitzt derzeit im Gefängnis und Olga ist fast außer sich. Unzählige unserer Freunde wurden als Verdächtige gebrandmarkt. Die österreichischen Nazis werden hier von Tag zu Tag stärker. Es ist wirklich alarmierend, Charles. Wir rechnen damit, dass die Deutschen jeden Moment die Grenze überqueren, und ich kann mir nicht vorstellen, was dann passieren wird. Ich mag Juden nicht besonders, Charles, aber einige von ihnen sind ganz reizende Menschen, und sie werden brutal behandelt.“
„Was denkt Sir John darüber?“, fragte Mildenhall.
„Er denkt natürlich gar nichts“, antwortete sie. „Das kann er auch nicht. Er ist Botschafter eines fremden Landes und darf seinen Mund nicht aufmachen. Bei dir ist das anders. Du hast den Dienst praktisch verlassen, sagt John. Du musst zugeben, dass diese Judenverfolgung für eine zivilisierte Nation eine schmutzige Angelegenheit ist.“
„Ich esse am Donnerstag mit einem Juden zu Abend“, meinte Mildenhall. „Einem jüdischen Bankier. Ich hoffe, er bekommt keinen Ärger.“
„Keiner von den Rothschilds?“
Er schüttelte den Kopf.
„Nein. Leopold Benjamin.“
Sie sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen und einem fast ängstlichen Blick in den Augen an.
„Aber er ist genau der Mann, vor dem ich am meisten Angst habe“, vertraute sie ihm an. „Ich finde ihn total liebenswert, aber man sagt, er musste schon zwei riesige Geldstrafen zahlen, und erst neulich Abend habe ich gehört, dass er ein gezeichneter Mann ist. Ich habe dich noch nie zuvor von ihm sprechen hören, oder?“
„Ich habe ihn erst heute Nachmittag kennengelernt“, antwortete Mildenhall. „Ich habe ihn in seiner Bank getroffen und er hat mich zum Essen eingeladen. Ich möchte unbedingt seine Bilder sehen.“
„Er hat die großartigste Sammlung aller erdenklichen Kunstwerke“, sagte Lady Tremearne beeindruckt. „Meine Liebe, er besitzt einen Murillo, für den ich meine Seele verkaufen würde, und einen Fra Filippo Lippi, der schöner ist als der im Palazzo Pitti. John sagt, seine Sammlung muss viele Millionen Dollar wert sein.“
„Das kostet ihn jetzt bestimmt einige schlaflose Nächte, denke ich.“
„Wir gewöhnen uns hier langsam daran“, seufzte sie. „Fast jede Nacht gibt es irgendwelche Auseinandersetzungen auf den Straßen. Wenn du hierher gekommen bist, um Spaß zu haben, Charles, wirst du leider enttäuscht sein. Das Café-Leben geht zwar noch weiter, aber es gibt keine Partys mehr, nicht einmal unter unseren eigenen Leuten. Alle hier scheinen mit angehaltenem Atem auf irgendetwas zu warten. Stell dir vor, wozu ich mich heutzutage in Sachen Vergnügen herablasse! Die Erzherzogin Katherine – du erinnerst dich, du hast sie irgendwo in Tirol getroffen –, die Prinzessin Madziwill und Molly Morton – die Frau unseres Botschaftsrats hier – essen zweimal pro Woche mit mir zu Abend und spielen Bridge! Sie kommen heute Abend. Was hältst du davon für das fröhliche Wien?“
„Sehr angenehm, würde ich sagen“, meinte er. „Ich habe schon ewig kein Bridge mehr gespielt. Wie ich höre, findet wie immer deine eine große Party des Jahres statt.“
„Die Von Liebenstrahls? Was für ein Mut! Sie sind sicher in ihrem Schloss, das angeblich eine richtige Festung und so groß wie eine kleine Stadt ist, und sie öffnen den Palast hier in Wien nur für diese eine Party. Seit Jahren ist ihre Party jedes Frühjahr das große gesellschaftliche Ereignis in Wien, und der Feldmarschall besteht darauf, dass sie wie immer stattfindet. Hundert Bedienstete sind gerade dabei, den Palast vorzubereiten.“
„Das ist echter Wiener Geist“, lobte er. „Man sagt, Prinz von Liebenstrahl sei der mutigste Mann in Österreich und seine Frau immer noch die schönste Frau. Ich habe sie seit Jahren nicht mehr gesehen.“
„Waren Sie schon einmal auf einem ihrer Bälle?“, fragte sie.
„Nie.“
„Sie sollten mit uns kommen. Sie werden immer noch die schönsten Frauen Europas und die wunderbarste Sammlung von Uniformen sehen.“
„Das ist sehr nett von dir“, sagte Mildenhall etwas zweifelnd.
„Wir haben zwar schon vierzig Gäste zum Abendessen“, vertraute Lady Tremearne ihm an, „aber wir werden schon irgendwo Platz für Sie finden. Die englische und die amerikanische Botschaft haben schon immer Dinnerpartys veranstaltet. Ich glaube, die Gräfin Otobini, die Frau des ungarischen Ministers, gibt dieses Jahr eine.“
„Ich fürchte, ich kann leider nicht zum Abendessen kommen“, bedauerte er. „An diesem Abend esse ich mit Benjamin zu Abend.“
„Dann werde ich kein Wort mehr über mein kleines Festmahl verlieren“, lachte sie. „Mr. Benjamin selbst isst kaum etwas, aber er ist ein großer Feinschmecker und bezahlt seinem Koch ein immenses Gehalt. Auch seine Weine sind die berühmtesten in Wien. Was du wahrscheinlich nicht bekommen wirst, und obwohl ich weiß, dass es ein brutaler Geschmack ist, mag ich sie trotzdem, ist ein Cocktail. Ich habe das einmal Herrn Benjamin gesagt, und da war dieser schmerzerfüllte Blick in seinen Augen, als hätte jemand eine falsche Note auf der Geige gespielt oder mitten in einer schönen Rede ein “h„ ausgelassen. Er hat kein Wort gesagt, aber ich konnte sehen, wie er litt.“
„Er hat natürlich vollkommen Recht. Spirituosen sind im Vergleich zu Weinen grobe Getränke, egal wie raffiniert sie gemischt sind.“
Lascelles kam ziemlich hastig herein und nahm Mildenhall am Arm.
„Wir müssen los“, sagte er. „Ihre Gäste kommen die große Treppe hoch, Lady Tremearne. Ich bringe Mildenhall durch den Hinterausgang nach unten.“
Lady Tremearne lächelte.
„Tweed ist in diesem Land bis zehn Uhr völlig in Ordnung“, sagte sie, „und ich bin sicher, dass er die Erzherzogin gerne wiedersehen würde.“
„Vielleicht später in der Woche“, sagte Mildenhall, als er den dringenden Griff seines Freundes spürte. „Entschuldigen Sie uns bitte, Lady Tremearne. Ich werde morgen meinen offiziellen Besuch machen.“
Sie entließ sie mit einer kleinen Handbewegung.
„Wünscht mir Glück“, rief sie. „Fünfzig Cent pro Hundert, und wir spielen die Forcing Two!“
KAPITEL III
Victors glattes Gesicht strahlte, als er eine Stunde später seine beiden angesehenen Gäste Lascelles und Mildenhall in einem der bekanntesten kleinen Restaurants Wiens zu ihren Plätzen führte. Er war dafür bekannt, dass er die Sprachen aller anerkannten Nationen Europas beherrschte, und sein Englisch war flüssig und fehlerfrei.
„Es ist mir eine große Freude“, sagte er, „Herrn Mildenhall wieder in Wien willkommen zu heißen. Herr Lascelles hat hier immer seinen Tisch, obwohl er öfter in seiner schönen Botschaft speist, als mir lieb ist. Heute Abend beehren mich viele meiner geschätzten Gäste. Manchmal sehe ich sie – manchmal auch nicht. Den Erzherzog sehe ich heute Abend zum Beispiel nicht, aber Herr Mildenhall wird mir sicher zustimmen, dass seine Begleiterin sehr, sehr schön ist.“
Er führte die beiden Männer zu ihrem Tisch. In der Mitte des kleinen runden Tisches, der für zwei Personen gedeckt war, stand eine Schale mit dunkelroten Rosen, und die Gläser hätten genauso gut in einem Museum stehen können. Sie nahmen Platz. Victor breitete seine Hände aus.
„Für Gäste, denen ich eine Ehre erweisen möchte“, vertraute er ihnen an, „habe ich kein Menü. Ich glaube, ich kenne den Geschmack von Monsieur Lascelles gut, und ich glaube, ich kann den von Monsieur Mildenhall erraten. Ich werde Sie nicht schockieren, wenn ich Ihnen den Kaviar der neuen Saison mit dem neunzigjährigen Wodka, den ersten jungen Lachs aus unserem eigenen edlen Fluss, ein Rehkalb mit Beilagen aus jungem Schweinefleisch, einen Salat, den ich hier zubereite, und ein unvergleichliches Soufflé serviere, das erst letzte Woche vom Neffen meines Küchenchefs, dem Cordon Bleu Maurice, erfunden wurde, der hier seine Lehre absolviert. Zum Lachs serviere ich einen Berncasteler Doktor von 1984, damit du die Schärfe des Wodkas vergisst. Zum Reh würde ich einen Château Mouton-Rothschild von 1870 anbieten. Über den Brandy reden wir später.“
„Victor hat Ideen!“, murmelte Mildenhall.
„So ein Essen sollte mit Poesie untermalt werden“, schlug Lascelles vor.
„Aber wo sonst könnte man Gedichte oder Musik genießen?“, fragte Victor. „Alle sagen mir, dass mein Restaurant ein Treffpunkt für schöne Frauen ist, und Sie sitzen genau in der richtigen Entfernung, um die wunderbarste Musik zu genießen, die Strauss je geschrieben hat, gespielt vom Maestro.“
„Wir geben uns geschlagen, Victor“, sagte Mildenhall mit einem Augenzwinkern. „Du bist der Kaiser der Gastronomie!“
Victor verbeugte sich tief und verließ sie.
Mildenhalls ganze Aufmerksamkeit galt in den nächsten Minuten, soweit es die Diskretion zuließ, dem Tisch genau gegenüber.
„Ich finde“, sagte er, „die Frau neben Karl Sebastian ist das schönste Wesen, das ich je in meinem Leben gesehen habe.“
Lascelles warf einen Blick durch den Raum.
„Die meisten Wiener denken genauso wie du, mein Freund“, gab er zu. „Eine Vorstellung wäre durchaus angebracht, aber – nicht heute Abend.“
„Sag mir ihren Namen“, bat Mildenhall. „Ich kann mich nicht erinnern, sie hier schon einmal gesehen zu haben.“
„Der Name, unter dem sie allgemein bekannt ist und den sie meiner Meinung nach absolut verdient, ist Baronin von Ballinstrode. Ich habe gehört, dass sie zuvor mit einem Mann verheiratet war, dessen Namen ich vergessen habe, und dass diese Ehe annulliert wurde, aber ich glaube nicht, dass die Scheidung ordnungsgemäß vollzogen wurde. Sehr kompliziert, diese religiösen Spitzfindigkeiten.“
„Überwältigend germanisch“, murmelte Mildenhall, „aber trotzdem exquisit. Ich habe noch nie einen so komplexen Teint gesehen – blauere Augen – ein faszinierenderes Lächeln. Sie ist fast zu lebhaft für ihren Typ.“
„Wenn du lange genug bleibst, muss ich mich auf jeden Fall um diese Vorstellung kümmern“, meinte Lascelles. „Der Erzherzog ist wegen des Tanzabends der Von Liebenstrahls am Donnerstag hier. Ein oder zwei Tage danach werden er und die Erzherzogin in ihr Schloss in den Bergen zurückkehren, es sei denn, er kann sich ein paar Wochen allein nach Monte Carlo verabschieden. Eine Woche ist ungefähr die maximale Zeit, die er sich derzeit in Wien leisten kann. Er kann von Glück sagen, wenn es während seines Aufenthalts in der Stadt nicht zu einem weiteren Putsch kommt. Er ist kein großer Politiker, aber eine ziemliche Galionsfigur.“
„Was ist mit dem Anschluss?“
„Keine Politik, mein Lieber“, bat Lascelles. „Ich weiß nicht, woher die Deutschen diese Idee haben“, fügte er hinzu und sah sich um, „aber sie denken immer, dass Engländer – vor allem, wenn sie in irgendeiner Weise mit der Diplomatie zu tun haben – nichts als “Schwätzer„ sind. Dieser Ort ist ein beliebter Treffpunkt der Royalisten – der wenigen, die noch übrig sind. Ich denke, wir werden sicher Besuch von der Gestapo bekommen, es sei denn, Victor schafft es, sie fernzuhalten. Ich wünschte, ich könnte mit dir zurückfahren, Charles. Mitteleuropa geht mir langsam auf die Nerven.“
Der Kaviar wurde serviert und lenkte mit seinen vielen Extras für eine Weile die Aufmerksamkeit der beiden Männer auf sich.
„Es gibt keinen Wodka auf der Welt, der so ist wie dieser“, meinte Lascelles, während er langsam daran nippte. „Weich wie Samt, nicht wahr?“
„Er ist wunderbar“, stimmte sein Freund zu. „Perfektes Essen, perfekter Wein und herrliche Frauen. Stell dir vor, was mit uns passieren würde, wenn in Wien etwas schiefgehen würde!“
Lascelles' Gesicht schien plötzlich jegliche Ausdruckskraft verloren zu haben. Seine Finger spielten mit der Wodkaflasche.
„Gestapo!“, murmelte er leise. „Das Einzige, was ich derzeit in Wien vermisse, ist Polo. Seit sich die ungarische Mannschaft aufgelöst hat, gab es kein anständiges Spiel mehr.“
„Ich vermisse das County Cricket, weil ich so viel unterwegs bin“, meinte Mildenhall genauso ernst. „Ich habe letztes Jahr zweimal Yorkshire spielen sehen, aber ich habe das Testspiel gegen die Westindischen Inseln verpasst. Freies Schlagen und davon jede Menge – das ist die Art von Cricket, die ich gerne sehe.“
Vier Mitglieder der Gestapo – kräftige, muskulöse junge Männer mit bösartigen Gesichtern – standen in der Mitte des Restaurants und unterhielten sich mit einem sehr ernsten Victor. Einer von ihnen löste sich von den anderen und schlenderte gemächlich durch den Raum, wobei er die Gäste unverschämt anstarrte. Vor einem der unauffälligsten Tische, an dem ein Mann allein aß, blieb er stehen. Der Mann aß weiter und schien nicht zu bemerken, was um ihn herum vor sich ging. Der Eindringling klopfte mit den Fingerknöcheln auf den Tisch. Der Gast blickte auf und stellte eine scheinbar einfache Frage. Der SS-Mann schrie ihn wütend an. Seine Stimme war im ganzen Raum zu hören.
„Wie heißt du?“, verlangte er zu wissen.
„Behrling – Antoine Behrling“, kam die deutlich ausgesprochene Antwort.
„Ihre Papiere!“
Der Mann schaute auf.
„Ich muss keine Papiere mit mir führen“, sagte er. „Ich bin Wiener.“
„Du bist Jude“, meinte der andere wütend.
Der Gast zuckte mit den Schultern.
„Ich bin nichts dergleichen“, antwortete er. „Ich bin Katholik.“
„Das werden wir noch sehen!“
Victor kam eilig durch den Raum. Es fiel ihm offensichtlich schwer, höflich zu sprechen.
„Dieser Herr“, sagte er, „ist ein bekannter Anwalt. Er heißt Behrling und ist überhaupt nicht die Art von Person, die du suchst.“
„Woher weißt du das?“
Victor wandte sich ab. Der Mann sah ihm mit finsterer Miene nach.
„Wenn du Anwalt bist, warum hast du das nicht gesagt?“, fragte er und drehte sich wieder zum Tisch um.
„Du hast mich nicht nach meinem Beruf gefragt.“
„Verlass deinen Platz nicht, bevor ich dir die Erlaubnis dazu gebe!“
Der Nazi stolzierte durch den Raum zu seinen Kumpels. Sie schauten sich noch mal um, redeten kurz über Behrling, aber der Anführer der kleinen Gruppe schüttelte den Kopf.
„Ein glücklicher Abend für dich, Victor“, meinte einer der jüngeren Männer.
„Nicht wirklich“, war die leise Antwort. „Das ist überhaupt kein Zufall. Ich habe keine Gäste, die euch interessieren könnten.“
„Keine Frechheit!“, schnauzte der Sergeant und zeigte auf einen Tisch. „Bring uns vier Gläser Bier dorthin.“