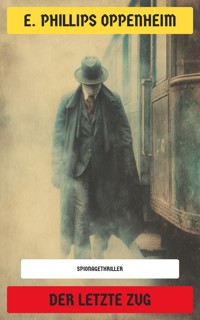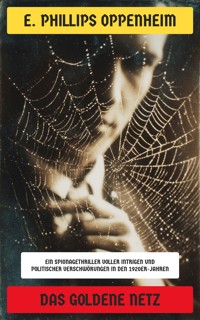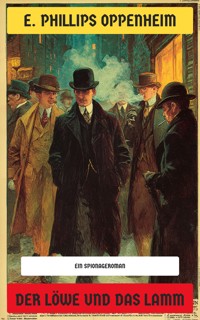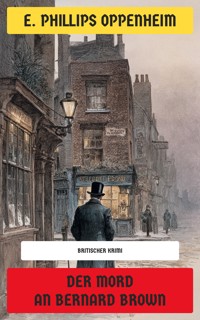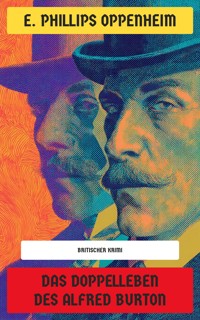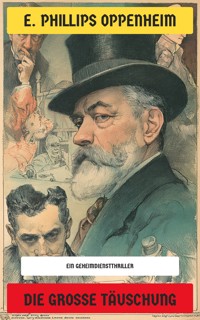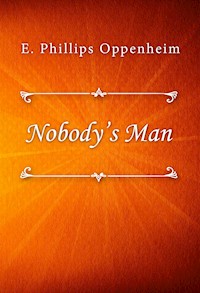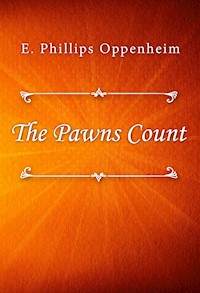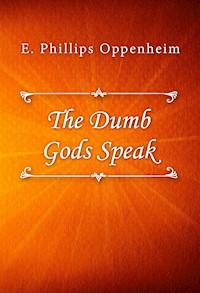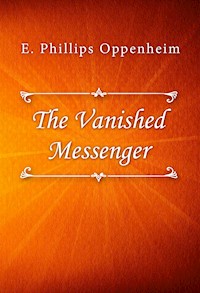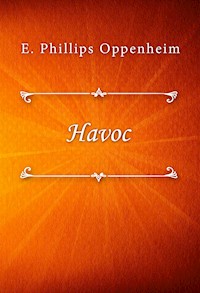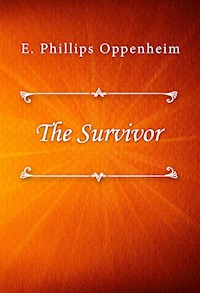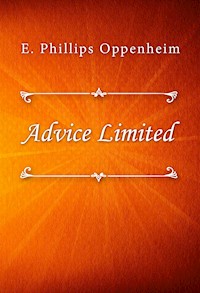1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
"Die goldene Bestie" von E. Phillips Oppenheim ist ein packender Spionage- und Intrigenroman, der seine Leser in eine Welt aus Geheimnissen, Machtspielen und gefährlicher Verführung führt. Hier treffen politische Spannung, mysteriöse Vorgänge und menschliche Abgründe aufeinander – in bester Oppenheim-Manier. Im Mittelpunkt steht Arnold Kellerman, ein kluger und ehrgeiziger junger Mann, der unvermittelt in die Schattenwelt internationaler Machenschaften gerät. Was mit einem scheinbar harmlosen Auftrag beginnt, entwickelt sich zu einem gefährlichen Spiel aus Verrat, Spionage und verdeckten Operationen. Hinter allem steht das Symbol der "goldenen Bestie" – Sinnbild für Gier, Macht und den zerstörerischen Einfluss des Geldes. Kellerman wird in ein Netz aus Täuschung und Geheimdiplomatie gezogen, in dem nichts ist, wie es scheint. Er begegnet Fenella von Heyst, einer faszinierenden Frau mit undurchsichtiger Vergangenheit, die ebenso Mitwisserin wie Gegenspielerin sein könnte. Zwischen beiden entsteht ein gefährliches Band aus Anziehung und Misstrauen, während sie in den Strudel internationaler Intrigen hineingeraten. Im Hintergrund lauern dunkle Kräfte: verschwundene Personen, geheime Papiere, verborgene Allianzen und eine Spur von Verrat, die sich von London über Paris bis in exotische Schauplätze zieht. Überall schimmern Reichtum und Glanz – doch unter der Oberfläche lauern Spione, Agenten und skrupellose Spieler, die bereit sind, für Macht und Profit jedes Risiko einzugehen. Oppenheim entfaltet hier eine Geschichte voller Spannung, List und Doppelspiel. "Die goldene Bestie" ist kein stilles Gesellschaftsdrama, sondern ein rasanter Thriller über Täuschung, Loyalität und die Gefahren geheimer Ambitionen. Mit scharfem Blick für Intrige und psychologischer Raffinesse schildert Oppenheim die verführerische Welt der Spione – und wie leicht ein Mensch darin selbst zur Beute der "goldenen Bestie" werden kann. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die goldene Bestie
Inhaltsverzeichnis
BUCH EINS
KAPITEL I
Israel, erster Baron Honerton, in Geschäftskreisen bekannt als Vorsitzender des Vorstands von Fernham & Company, Ltd., dem großen Chemiegroßhändler, und Lord des Anwesens Honerton Chase in Norfolk, saß am Kopfende des langen schwarzen Eichentisches im Festsaal des alten und historischen Herrenhauses, das er, wie der Auktionator es beschrieb, vor zwei Jahren „mit Haut und Haaren” gekauft hatte. Als einer der gewieftesten Finanziers Englands, Multimillionär und in allen alltäglichen Angelegenheiten ein grimmiger Materialist, neigte er zu seltsamen Anfällen von Abstraktion, zu geistigen Abschweifungen, die fast denen eines Visionärs glichen und während denen sich sein Aussehen zu verwandeln schien. Für seinen Typ war er eine Person von feiner Präsenz. Er war groß und schlank, fast schon hagere. Er hatte noch immer volles graues Haar, feine, wenn auch streng geschnittene Gesichtszüge, überhängende Augenbrauen, einen gnadenlosen Mund und Augen, die normalerweise scharf und hart waren, aber in Momenten wie diesen von einem seltsamen, überirdischen Licht erfüllt waren. Sogar seine Kleidung schien Teil seines Wesens zu sein. Er trug konventionelle Abendgarderobe, die jedoch nach einem alten, nicht mehr erkennbaren Schnitt gefertigt war, mit einer hohen Weste und einem lockeren, doppelreihigen Jackett, das an einen Smoking erinnerte. Sein Kragen war nach der Mode von vor hundert Jahren, seine schwarze Krawatte kaum mehr als ein Fetzen. Doch obwohl sein Vater ein kleiner Schneidermeister gewesen war und seine Mutter in einem Fischgeschäft gearbeitet hatte, war er der Einzige in dieser Gesellschaft, der den Eindruck machte, an den Ort gekommen zu sein, der ihm im Leben zustand.
Der Hintergrund und die Kulisse des Festes, das gerade stattfand, waren einfach perfekt. Honerton Chase war einer der schönsten Orte der Welt und sowohl innen als auch außen architektonisch einzigartig. Israel Fernham, Lord Honerton, hatte nichts von einem Vandalen an sich. Tatsächlich hatte er einen Geschmack für schöne Dinge, der dem des letzten hoffnungslos bankrotten Besitzers des großen Hauses, das er erworben hatte, mindestens ebenbürtig war. Die düsteren Wände mit ihren edlen Ölgemälden und vereinzelten ausgewählten Rüstungen waren unberührt geblieben. Die Wandteppiche, die die Nordseite des Raumes bedeckten, waren sogar unrenoviert geblieben, damit der Charme der alten Farben nicht verloren ging. Die Bediensteten, die bedienten, waren die bestausgebildeten ihrer Zunft; der Butler hatte königlichen Dienst geleistet. Glas, Silber und Blumen waren gleichermaßen perfekt. Die Gäste! – Es war seine Betrachtung der Gäste, von denen die meisten Mitglieder seiner eigenen Familie waren, die Israel, Lord Honerton, in einen dieser mysteriösen Anfälle von Abstraktion versetzt hatte. Da waren die drei Söhne des Hauses mit ihren Frauen. Da waren die beiden Töchter, beide verheiratet, mit ihren Ehemännern. Da waren zwei Engländer, deren Herkunft und Erziehung sie gut und passend in das Bild einfügten, deren Ruf jedoch getrübt war und die die besten Jahre ihres Lebens damit verbracht hatten, aus den Positionen, die sie in der Gesellschaft hätten einnehmen sollen, abzurutschen. Dann war da noch der jüngste Sohn des Hauses, auf den der Blick seines Vaters am längsten gerichtet war; ein junger Mann, der gerade aus Oxford gekommen war, dunkel, glatt rasiert, angeblich klug, der einzige Erbe des schmalen Gesichts und der tief liegenden Augen seines Vaters; in diesen langsam verstreichenden Momenten der Offenbarung schien er auch der einzige Erbe der Traditionen seines Geschlechts zu sein.
Das Stimmengewirr um ihn herum wurde immer lauter. Es war eine Familienfeier unter Leuten, für die Familie Intimität, grenzenlose Freundlichkeit und eine ausgeprägte Begabung für lockere, neckische Unterhaltungen bedeutete. Sowohl die Frauen als auch die Männer tranken reichlich Champagner – und machten mehr als nur reichlich Lärm. Einmal wanderte der Blick seines Vaters zu Cecils Glas. Leider war er wie die anderen, die Röte kroch bereits in seine Wangen, der Glanz in seinen Augen war nicht mehr der des Intellekts. Einige der Männer und auch einige der Frauen rauchten bereits Zigaretten, obwohl das Abendessen erst zur Hälfte serviert war. Das Gelächter war hin und wieder ohrenbetäubend.
Währenddessen saß Israel, der Gastgeber der Versammlung, still in seiner tranceartigen Stimmung da, seine Weingläser leer, ein Wasserglas neben ihm. Es war einer von vielen bitteren Momenten, in denen seine Augen die Wahrheit sahen und sein Verstand, unbeeinträchtigt von seinen Gefühlen, die Verurteilung seiner eigenen Nachkommen, der Kinder seines Blutes und seiner Knochen, aussprach. Sie waren seine Söhne, aber er wusste, dass die Hand des Luxus und des lasterhaften Lebens sie befleckt hatte. Sie waren alle zu dick, ihre Zungen waren locker geworden. Geld, Wein und Vergnügen forderten ihren Tribut. Und die Frauen – in der Natur dieses Mannes, der so traurig zusah, lag eine Ader von Idealismus, ein Hauch jener strengeren Freuden der Entsagung, die ihm von den großen Vorfahren seines Geschlechts, aus dem er stammte, überliefert worden waren – die Frauen erfüllten ihn mit einem Gefühl, das fast an Scham grenzte. Judiths Schultern waren unanständig entblößt, der Blick in Rebeccas Augen – „Becky“, wie alle sie nannten –, als sie mit dem jungen Fremden an ihrer Seite flirtete, schien von einer beiseite geworfenen Bescheidenheit zu zeugen. Leah, einst seine Favoritin, war nur deshalb ruhiger, weil sie sich mit größerer Hingabe den Köstlichkeiten des wunderbaren Kochs ihres Vaters widmete. Ihre unbedeckten Schultern waren fast kolossal, und ihr Lachen, wenn sie inne hielt, um sich an dem zu beteiligen, was weniger eine Unterhaltung als ein Strom von Spott war, war lauter denn je. Als Einzige in der ausgelassenen Gesellschaft zeigte Rachel, seine jüngste Schwiegertochter, gelegentlich Anzeichen von Schüchternheit und Verlegenheit.
Obwohl er es damals noch nicht wusste, war dies die letzte dieser bitteren Phasen der Klarsicht, denen Israel, Lord Honerton, jemals frönen würde. Er verfolgte seinen Gedankengang bis zu seinem unglücklichen Ende. Er blickte zurück auf seine arme Jugend, erinnerte sich an die Tage des reineren Fastens, an die Tage, als reine Familienfreuden ausreichten, als das Lesen in der Synagoge sowohl ihm als auch den anderen eine lebendige Botschaft brachte. Er spürte, wie alles, was im Leben mal schön und spirituell war, verging. Sie waren weg – seine vier Millionen blieben!
Ein Diener kam rein und flüsterte dem Butler etwas zu, der daraufhin auf die andere Seite des Tisches ging und sich über Cecil beugte.
„John Heggs, der Verwalter, ist hier, Sir. Er würde gerne kurz mit Ihnen sprechen.“
Der junge Mann nahm die Nachricht neugierig auf. Er drehte sich abrupt um, und in seinen Augen blitzte fast etwas wie Besorgnis auf.
„Heggs!“, wiederholte er. „Was zum Teufel will er?“
„Ich habe gehört, Sir“, erklärte der Butler, „dass er unbedingt mit Ihnen über die Reihenfolge sprechen möchte, in der morgen die Jagdreviere bejagt werden sollen.“
Cecils Miene hellte sich auf. Es war eine besondere Eitelkeit von ihm, die Jagd an den Tagen zu leiten, an denen neben den Hausgästen auch andere Gäste eingeladen waren. Er nickte zustimmend.
„Ich komme sofort raus“, sagte er. „Heggs hat ganz recht! Ich wollte mit ihm über die langen Hecken sprechen, bevor er morgen früh die Treiber losschickt.“
Er stand auf.
„Entschuldige mich, Dad“, sagte er schnell, als er an seinem Vater vorbeiging. „Morgen wird ein toller Tag. Die Vögel werden so zahm sein, dass sogar Rudolph sie treffen kann – vorausgesetzt, wir können sie überhaupt zum Fliegen bringen.“
Es gab lautes Gelächter und eine Flut von neckischen Erinnerungen. Die beiden Fremden tauschten Blicke aus. Unter dem Deckmantel all dessen verließ Cecil den Raum und schlenderte durch die große Halle hinaus in Richtung der hinteren Räume, gefolgt von einem der Diener.
„Heggs ist im hinteren Raum, Sir“, sagte der Mann zu ihm, „nicht im normalen Waffenraum.“
„Was macht er denn da?”, fragte Cecil genervt, und für einen Moment kam dieses erste Gefühl der Unruhe wieder hoch.
„Dort gibt es eine Karte des Anwesens, Sir“, erinnerte ihn der Diener. „Er hat sie studiert, als ich gegangen bin. Ich glaube, er plant drei Rebhuhnjagden nach dem Mittagessen.“
Cecil ging den mit Steinplatten ausgelegten Gang entlang. Der Raum, den er betrat, befand sich in einem Flügel, der fast vom Rest des Hauses abgeschnitten war – ein großes Zimmer mit Steinboden, einem Holztisch und verputzten Wänden, das vor vielen Jahren als Milchkammer genutzt worden war. Heggs, der Verwalter, studierte eine Karte, die an der Wand hing, und hielt eine Schwarzdornrute in der Hand. Als Cecil eintrat, drehte er sich um und berührte die Stelle, an der sein Hut, der auf dem Tisch lag, hätte sein sollen.
„Du wolltest mich sehen, Heggs?“, fragte der junge Mann.
„Ich wollte kurz mit dir reden, Sir.“
„Beeil dich dann. Ich bin gerade beim Abendessen. Ich möchte die Vögel ...“
„Darüber reden wir gleich“, unterbrach ihn Heggs.
Cecil, Sohn von Israel, Lord Honerton, starrte den Sprecher erstaunt an – ein Erstaunen, das sich fast augenblicklich in Angst verwandelte. Heggs war ein Mann von über sechzig Jahren ohne besonders kräftigen Körperbau, aber er hatte die harte, reine Haut und die strahlenden Augen eines Menschen, der auf sich achtet. Sein Haar war grau, sein Gesichtsausdruck in der Regel durchweg wohlwollend. Er war ein ganz gewöhnlicher Mann vom Land, der sein Glas Bier, seine Freunde und seinen Beruf liebte und der mehr über die Handaufzucht von Vögeln und die Gewohnheiten von Ungeziefer wusste als jeder andere Tierpfleger in Norfolk. In diesem Moment war jedoch klar, dass er an andere Dinge dachte. Was das war, wusste Cecil Fernham wahrscheinlich. Jedenfalls machte er eine schnelle Bewegung in Richtung Tür und als er feststellte, dass das nicht klappte, öffnete er den Mund. Mit überraschender Schnelligkeit wurde er von Heggs' schwieliger Hand bedeckt.
„Du weißt, warum ich hier bin“, sagte dieser. „Du kannst dir denken, was ich vorhabe. Wenn du heute Abend nicht gekommen wärst, hätte ich es morgen vor all deinen Freunden getan. Wenn ich einen Sohn hätte, hätte ich euch beide es ausfechten lassen. Aber er ist in Australien. Du kannst schreien, wenn du willst. Sie werden dich nicht hören, und wenn sie mich unterbrechen, bevor ich fertig bin, bekommst du den Rest an einem anderen Tag.“
Cecil Fernham wehrte sich und versuchte, um Hilfe zu rufen. Beides brachte ihm nicht viel. Mit dem ersten heftigen Stoß wurde sein schön gewaschenes weißes Hemd von den Knöpfen gerissen und sein Kragen zerrissen. Dann passierten noch schlimmere Sachen. Heggs war ein freundlicher Mann und menschlich, wenn es um seine Mitmenschen ging, aber er war grausam zu Ungeziefer. Die Angelegenheit hätte wahrscheinlich ihren natürlichen Lauf genommen – Cecil Fernham hätte aufgrund eines bedauerlichen Unfalls zwei Wochen in seinem Zimmer verbracht, und Heggs hätte einen der vielen anderen Plätze angenommen, die ihm immer offenstanden –, wäre da nicht ein kleiner, unglücklicher Zwischenfall gewesen. Eine Küchenmagd, die den Flur entlangging, hörte etwas von dem, was sich abspielte. Sie eilte atemlos in die Küche. Es gab eine Massenflucht der Bediensteten entlang des Flurs, und Heggs hörte sie kommen. Der Gedanke, dass ihm ein einziger Schlag geraubt werden sollte, dass ihm eine einzige Sekunde der Strafe, die er verhängte, vorenthalten werden sollte, machte ihn für einen Moment wahnsinnig. Als die Tür geöffnet wurde, hob er den halb bewusstlosen Körper des jungen Mannes, den er gezüchtigt hatte, ein grimmiger und unangenehmer Anblick, hielt ihn über seinen Kopf, wie er es mit dem Kadaver eines Fuchses getan hätte, schüttelte ihn und warf ihn auf den Boden, der leider aus Stein war. Dann wandte er sich zur Tür, ging durch die kleine Gruppe von Bediensteten, von denen keiner auch nur den geringsten Wunsch zeigte, ihn aufzuhalten, und verließ das Haus durch einen Hinterausgang in den Park.
John Heggs entsprach bis zu einem gewissen Punkt dem Typus, wich aber an einem bestimmten Punkt in der psychologischen Entwicklung davon ab. Als er nach Hause kam, sah er aus wie ein Mann, der eine unangenehme Angelegenheit hinter sich gebracht hatte und sie vergessen wollte. Er beendete eine Aufgabe, mit der er sich früher am Tag beschäftigt hatte – das Reinigen von zwei Gewehren, die zu diesem Zweck aus dem Haus geschickt worden waren. Danach schenkte er sich ein Glas Bier ein, schaute in die Küche, um zu sehen, ob die Frau, die seit seiner Witwerschaft für ihn sorgte, sein Frühstück vorbereitet hatte, stopfte schließlich seine Pfeife, holte die Lokalzeitung und setzte sich in seinen Sessel, um auf die Ereignisse zu warten. Er war gerade dabei, sich für die Nacht zurückzuziehen, als das lang erwartete Klopfen an der Tür kam. Auf seine Einladung hin, hereinzukommen, überschritt sein alter Freund und Begleiter, P. C. Choppin, der örtliche Polizist, die Schwelle. Choppin, der beim Zubettgehen gestört worden war, trug seine Diensthose, aber einen alten Tweedmantel und einen Hut. Die Ernsthaftigkeit seines Auftretens machte jedoch alle Unregelmäßigkeiten seiner Kleidung wett. Er schloss die Tür fest hinter sich und es gab ein unheilvolles Klirren in seiner Jackentasche, in der er herumfummelte.
„Das ist eine echt üble Sache, Mr. Heggs“, sagte er düster.
Heggs faltete seine Zeitung zusammen und stand auf.
„So schlimm ist es nicht, Choppin“, war die unbeeindruckte Antwort. „Ich habe nur einem dieser jungen Schlingel oben im Haus gegeben, was er verdient hat. Ich bin aber bereit, dafür ins Gefängnis zu gehen, wenn es ihr Wunsch ist.“
Es ist fraglich, ob dies nicht der entscheidende Moment im Leben von P. C. Choppin war. Ihm wurde klar, dass es ihm nun oblag, die schreckliche Nachricht zu überbringen. Er war kein bösartiger Mensch, aber die Ungeheuerlichkeit der Nachricht überwältigte ihn.
„Du hast ihm das Genick gebrochen, Heggs“, verkündete er feierlich. „Er ist tot! Er war mausetot, als sie ihn aufgehoben haben!“
Heggs sah ein wenig benommen aus.
„Das war nicht meine Absicht“, murmelte er, halb zu sich selbst.
Choppin schüttelte traurig den Kopf.
„Du musst dich bereit machen, John Heggs“, sagte er. „Ich bin schnell hierher geeilt, bevor der Sergeant aus Fakenham, der auf dem Weg ist, hier ankommt. Ich dachte, du würdest es vorziehen, wenn es ein Freund wäre.“
Die Handschellen klickten an Heggs' Handgelenken. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte P. C. Choppin einen Mörder verhaftet.
John Heggs wurde trotz einer starken Empfehlung zur Gnade gehängt, bis er tot war, und Israel, Baron Honerton, saß in seinem Auto vor dem Gefängnis von Norwich und lauschte dem Läuten der Glocke wie jemand, der Musik hört. Als er das Zeichen zum Losfahren gab, fand er sich von einer kleinen, aber feindseligen Menschenmenge umgeben. In der Stadt war allgemein bekannt, dass ohne seine unermüdlichen Bemühungen die Empfehlung der Jury, Gnade walten zu lassen, Wirkung gezeigt hätte. Diese Leute hatten von seinen häufigen Besuchen beim Innenminister gehört. Es gab Gerüchte, dass er gedroht hatte, aus der Partei, der er sich voll und ganz verschrieben hatte, auszutreten, wenn dem Verurteilten auch nur die geringste Milde entgegengebracht würde. Sie umringten ihn nun bedrohlich und die Worte, die sie riefen, waren nicht angenehm zu hören. Doch zum ersten Mal seit dem Tod seines Sohnes lächelte Israel. Er kurbelte das Fenster seines Autos herunter und schaute in den strömenden Regen hinaus.
„Gibt es jemanden, der mit mir sprechen möchte?“, fragte er.
Es gab eine Salve von Pfiffen und Beschimpfungen, die vor dem Hintergrund der langsam läutenden Glocke seltsam klangen, aber niemand nahm die Herausforderung an. Israel wollte gerade seinem Chauffeur befehlen, weiterzufahren, als ein Mädchen aus dem Rand der Menge herankam und sich dem Auto näherte. Sie war jung, sah auf eine etwas zurückhaltende Art gut aus und war ordentlich, sogar modisch gekleidet. Sie trat an die Seite des Autos und schaute zu seinem Insassen hinein.
„Bist du Cecils Vater?“, fragte sie.
„Ja“, sagte er.
Sie zeigte auf das Gefängnis.
„Er war mein Vater“, sagte sie.
Israel musterte sie unter seinen schweren grauen Augenbrauen, und in seinem Gesicht war weder Interesse noch Mitleid zu sehen.
„Ihr Frauen mit eurem lockeren Lebenswandel“, sagte er, „bringt den Tod unter uns. Ist euch klar, dass ich wegen eurer Lust meinen Sohn verloren habe und ihr euren Vater?“
Sie antwortete ihm ganz ruhig. Sie war offensichtlich eine gebildete Person. Außerdem verfügte sie zweifellos über die seltene Gabe der Zurückhaltung.
„Was ist mit deinem Sohn?“, fragte sie. „Er war mein erster Liebhaber.“
„Das mag sein oder auch nicht“, entgegnete er. „Eine Wüstlingin hat keine Ahnung von der Wahrheit. Bist du hier, um mich um etwas zu bitten?“
Zum ersten Mal zeigte sie ein Zeichen von Emotion. Ihre Augen blitzten vor Wut.
„Geld! Geld! Das ist alles, woran du und deine Sorte denkt!“, rief sie leidenschaftlich. „Ihr kauft euch eure Vergnügungen, eure Frauen, und ihr würdet euch den Weg in den Himmel erkaufen, wenn es so einen Ort gäbe. Vielleicht ist es gut, dass dein Sohn gestorben ist. Er wäre wie ihr alle geworden.“
„Er hat dich gekauft, nehme ich an“, bemerkte Israel.
Sie zog bedächtig ihren Handschuh aus, nahm einen kleinen Platinring von ihrem Finger und warf ihn auf den Boden des Autos.
„Das ist das einzige Geschenk, das ich je von deinem Sohn bekommen habe“, verkündete sie, „das einzige von Wert, das ich jemals von ihm annehmen wollte.“
„Was willst du von mir?“, fragte er unvermittelt.
Die Glocke hatte aufgehört zu läuten. Die Menschenmenge löste sich langsam auf. Ein oder zwei Polizisten waren beiläufig aufgetaucht. Dennoch gab es immer noch hin und wieder bedrohliche Rufe, und einmal traf ein Stein die Rückseite des Autos. Ein vorbeifahrender Brauereiwagen bespritzte sie mit Schlamm. Sie wartete, bis er vorbei war, bevor sie versuchte zu sprechen.
„Ich bin gekommen, um dich an etwas zu erinnern, das du bereits weißt“, sagte sie. „Von euch beiden Männern – dir und meinem Vater – bist du der Mörder, nicht er. Mein Vater ist durch deine Hand einen schändlichen Tod gestorben. Als ich mich von ihm verabschiedete, las er gerade im Alten Testament. Er las deinen Kodex – ‚Leben für Leben, Auge für Auge‘. So etwas in der Art, nicht wahr?“
„Und?“
„Ich bin nicht gekommen, um dir zu drohen“, fuhr sie fort, „aber ich bin hier, um dir Folgendes zu sagen: Für die Tat, die du heute Morgen zugelassen hast, werden du und deine Familie leiden. Mein Vater hat deinen Sohn aus Versehen getötet; du hast meinen Vater mit abscheulicher und bestialischer Vorsätzlichkeit ermordet. Du hast seinen Tod mit deinem Geld erkauft. Dieses Geld wird sich wie ein widerliches Spinnennetz aus Hass und Verfall über dich und deine Familie ausbreiten, auf die du so stolz bist.“
Er sah sie ungerührt, kalt und streng an, seine Augen waren stählern, sein Tonfall, als er sprach, bitter.
„Du bist also eine Prophetin“, spottete er.
Sie beugte sich ein wenig vor, sodass ihr Gesicht von dem Ort eingerahmt wurde, an dem sich das Fenster befunden hätte. Der Regen glitzerte auf ihren Wangen und ihrer Kleidung, ihre perfekte Selbstbeherrschung schien für einen Moment durch eine neue Emotion gestört zu sein.
„Warum nicht?“, fragte sie. „Du stammst aus einem Volk, das vor Generationen mit Wahrsagern und Magiern gehandelt hat. Hast du nie gehört, dass es einen einzigen Moment im Leben einer Frau gibt, in dem sie ein wenig über die Welt hinaussehen kann – ein wenig darüber? Dieser Moment ist jetzt bei mir. Es ist das Kind deines Sohnes, das sich dem Leben nähert. Du bist ein alter Mann und wirst die Dinge, von denen ich dir erzähle, nicht mehr erleben, aber trotzdem sind sie wahr. Die Millionen, für die du geschuftet hast, verwandeln sich bereits in das Gift, das dein Volk ins Nichts und noch schlimmer als ins Nichts führen wird. Die Angst davor ist bereits in deinem Herzen. Du wirst sie nie verlieren. Du wirst in deinem Bett sterben und nicht auf diesem schändlichen Schafott, aber dein Herz wird so schwer sein wie seines, denn wie alle anderen in diesen letzten Augenblicken wirst du die Wahrheit erkennen.
So leise und unauffällig, wie sie gekommen war, drehte sie sich um und ging davon. Der alte Mann saß an seinem Platz und sah ihr nach. Trotz ihres tropfnassen Zustands ging sie mit Würde und Selbstbeherrschung. Er öffnete das Fenster und murmelte dem Chauffeur einen kurzen Befehl zu. Irgendwie fühlte er sich seiner mürrischen Freude beraubt, mit der er in den Morgen gestartet war. Geister begleiteten ihn.
Am Nachmittag suchte Israel seine Frau in ihrem Wohnzimmer auf. Sie war eine korpulente Dame, die nach dem Mittagessen gerne eine Pause machte, und weder die Überredungskünste ihrer modebewussteren Kinder noch die strenge Missbilligung ihres Mannes hatten sie jemals davon abhalten können, sich tagsüber wie auch nachts mit einer Fülle kostbarer und glitzernder Juwelen zu schmücken. Ihr Mann stand da und beobachtete sie einige Augenblicke lang. Durch eine Ironie des Schicksals wanderten seine Gedanken zurück zu ihrem Hochzeitstag – sie, ein schlankes, halb verängstigtes Kind mit dunklen Augen, die noch immer einen Hauch von Träumerei hatten. Das war das Ergebnis seines Reichtums, das Ergebnis von vierzig Jahren Luxus! Sie öffnete langsam die Augen und erwiderte seinen Blick.
„Was ist los, Israel?“, fragte sie etwas gereizt.
„Mir ist eingefallen, dir eine Frage zu stellen“, sagte er. „Dieses Mädchen von Heggs, weißt du irgendwas über sie?“
„Ob ich etwas über sie weiß?“, keuchte Lady Honerton. „Wie sollte ich das, Israel? Sie hat nie hier gelebt. Sie war nur einmal in diesem Sommer zu Besuch hier.“
„Aber seitdem – hast du dich erkundigt?“
„Ich nicht!“, kam die empörte Antwort. „Was meinst du damit? Hat sie um Geld gebeten?“
Israel schüttelte den Kopf, ging weg, und seine Frau schloss wieder die Augen.
Israel ging in seine Bibliothek, einen Raum von feierlicher Pracht, der jedoch irgendwie von der Strenge seines neuen Besitzers geprägt war. Er ließ seinen Butler kommen.
„Groves“, sagte er, „Sie haben Ihr ganzes Leben lang in dieser Gegend gewohnt.“
„Mein ganzes Leben lang, Eure Lordschaft“, bestätigte der Mann.
„Ich möchte, dass du mir erzählst, was du über die junge Frau, die Tochter von Heggs, weißt“, fuhr Israel ruhig fort.
„Sehr gerne, Mylord“, antwortete Groves. „Gab es – Eure Lordschaft wird mir die Frage verzeihen – gab es keine Begnadigung?“, fügte er mit einem Anflug von Besorgnis in der Stimme hinzu.
„Es gab keine Begnadigung. Heggs wurde heute Morgen um acht Uhr gehängt.“
Der Mann stand einen Moment lang schweigend da. Sein Herr las seine Gedanken mit grimmiger Verbitterung.
„Die junge Dame, mein Herr“, fuhr der ehemalige fort, „war eine sehr vornehme Person. Heggs selbst stammte aus einer Familie von Yeomen – Gentlemen-Bauern, wie sie sich selbst nennen. Sie leben seit Generationen in dieser Gegend. Die junge Dame gewann Stipendien und besuchte das College und die Universität Oxford. Sie war sehr klug und sehr begabt. Sie war – wenn Eure Lordschaft mir diese Bemerkung gestattet – hier sehr geschätzt.“
„Weißt du, wo sie jetzt ist?“, fragte Israel nach einer kurzen Pause.
„Ich habe keine Ahnung, Mylord. Sie wurde seit einiger Zeit nicht mehr hier gesehen.“
Sein Herr entließ ihn mit einer kleinen Handbewegung und schrieb daraufhin einen Brief an seine Anwälte. Nach drei oder vier Tagen erhielt er eine Antwort.
17, Lincoln's Inn.
Lieber Lord Honerton,
wir haben deine Anweisungen befolgt und Kontakt zu der jungen Dame aufgenommen, die, wie unter den etwas beschämenden Umständen nur natürlich, ihren Namen geändert hat. Wir müssen dir jedoch leider mitteilen, dass sie es absolut und kompromisslos ablehnt, mit irgendeinem Mitglied deiner Familie zu kommunizieren. Wir können hinzufügen, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten steckt.
Mit freundlichen Grüßen,Fields, Marshall & Fields.
Israel hatte den Brief eines Abends nach dem Essen bekommen und ihn in seine Bibliothek mitgenommen, um ihn zu lesen. Langsam zerriss er ihn in Stücke und warf sie ins Feuer. Er stand da, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, in Gedanken versunken. Durch die halb geöffnete Tür drangen die klangvollen Töne von Jazzmusik aus dem neuesten und teuersten Grammophon. Einige Familienmitglieder waren in luxuriösen Autos aus London angereist, um „die alten Leute aufzuheitern”. Er konnte ihre schweren Schritte auf dem polierten Boden hören, fast sogar ihr Atmen, die hohen Stimmen, das schrille Lachen, das Knallen der Korken – denn die Familie von Israel, Baron Honerton, mochte Champagner lieber als alle anderen Weine und trank ihn zu jeder Tageszeit. Eine Welle von etwas, das fast wie Übelkeit war, überkam ihn. Ihm wurde plötzlich schwindelig, er taumelte zu seinem Sessel und läutete die Glocke.
In dieser Nacht starb Israel, Lord Honerton.
KAPITEL II
Joseph, der zweite Baron Honerton, war, anders als sein längst verstorbener Vater, kein Träumer oder Idealist. Er hatte ein super Abendessen hinter sich, eine Mahlzeit, die seinen Arzt total aufgeregt hätte, wenn er dabei gewesen wäre, bevor er überhaupt daran dachte, sich für einen Moment aus dem Gespräch mit dem Ehrengast zu seiner Rechten zu lösen und einen selbstgefälligen Blick über seinen prächtigen Esstisch zu werfen. Der Raum selbst war unverändert geblieben, seit Israel, der Gründer der Familie, vor dreißig Jahren an der Stelle seines Sohnes gesessen hatte; die Wandteppiche waren vielleicht einen Hauch weicher geworden, die Wände in ihrer dunklen Perfektion ein wenig geheimnisvoller, die Gesichter, die von den halb sichtbaren Leinwänden herabstrahlten, einen Tick blasser. Drei Jahrzehnte hatten jedoch wenig Veränderung in einem Raum bewirkt, dessen Atmosphäre über Jahrhunderte hinweg gewachsen war. Es waren die Gäste, die Männer und Frauen, die um den Tisch saßen, die den Fortschritt der Zeit markierten. Dies war keine Familienfeier, wie sie Israel am Herzen gelegen hätte. In dreißig Jahren hatten sich die neuen Herren des Anwesens in den Boden, den sie gekauft hatten, eingepflanzt. Es war eine tolerante Zeit, was soziale Qualifikationen anging, und schließlich war ein Sohn von Joseph in der Eton-Elf gewesen und machte sich heute gut in der Botschaft in Paris, abgesehen davon war Judith, die jüngere Tochter, ohne Konkurrenz die Schönheit der Saison. Große Maler baten sie demütig, für sie Modell zu sitzen. Sehr begehrte junge Männer hatten um sie und ihre Millionen geworben. Sie hatte nur einen Nachteil, wie viele in ihrem unmittelbaren Umfeld bereits entdeckt hatten. Sie war erstaunlich und unangenehm klug. Der Blick ihres Vaters ruhte einen Moment lang auf ihrem schönen Gesicht, mit derselben zufriedenen, selbstgefälligen Freude, mit der er ein Kunstobjekt betrachtet hätte, das er an diesem Nachmittag bei Christie's gekauft hatte. Dann wanderte sein Blick zu seinem einzigen noch lebenden Bruder Samuel – einem gereizten Dyspeptiker, der weder bei Gesundheit noch guter Laune war – dessen Anwesenheit eine schwache Zugeständnis an den Geist des verstorbenen Israel war. Sie wanderten mit selbstgefälliger Gleichgültigkeit über eine kleine Reihe gut gekleideter, vornehmer Menschen, ruhten einen Moment lang freundlich auf seiner Frau am anderen Ende des Tisches mit ihrem aufwendig frisierten weißen Haar, ihrer pergamentartigen Haut und ihren strahlenden Augen und verweilten schließlich mit etwas, das eher echter Zuneigung ähnelte, auf der gutaussehenden, aber etwas auffällig semitischen Gestalt von Ernest, seinem jüngeren Sohn, der gerade in das Geschäft eingestiegen war. Es war eine Gesellschaft, mit der jeder Gastgeber zufrieden sein konnte, ein Sohn und eine Tochter, auf die jeder Vater stolz sein konnte. Kein Wunder, dass Joseph, der zweite Baron Honerton, sein Weste über seinen runden Bauch zog und nichts von dem wilden, unglücklichen Impuls verspürte, der dreißig Jahre zuvor Israels erschöpftem Blick die düstere Botschaft an die Wand geschrieben hatte.
„Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr sich Frederick auf die morgige Jagd freut“, bemerkte die Marquise, die zu seiner Rechten saß. „Unsere eigenen Fasane waren dieses Jahr so enttäuschend. Tatsache ist, dass wir bei weitem nicht genug Vögel züchten und das schon seit Jahren nicht mehr können.“
Ihr Gastgeber nickte verständnisvoll. Es war keine angenehme Geste, da sein Doppelkinn dabei auf seinen Kragen fiel. Er hatte im Laufe der Jahre viele Lektionen gelernt und verzichtete bewusst darauf, seine Dauerbestellung von zehntausend der besten Eier zu erwähnen.
„Wir werden versuchen, dem Marquis etwas Unterhaltung zu bieten“, versprach er freundlich. „Ich gehe morgen selbst auf die Jagd. Die letzten zwei oder drei Male habe ich mich um alles gekümmert, aber jetzt übernimmt das mein Sohn – Ernest ist ein guter Jäger.“
„Wie selbstlos von Ihnen“, schnurrte sein Nachbar. „Ich habe viel Gutes über Ihren älteren Sohn, Lord Honerton, gehört. Man sagt mir, dass er in wenigen Jahren Erster Sekretär in Paris sein wird, wenn er dort bleibt.“
„Henry ist ein guter Junge“, gab sein Vater zu, „und er hat den Kopf auf den Schultern. Manchmal wünschte ich mir, wir hätten ihn in das Geschäft aufgenommen. Aber man kann nicht alles haben.“
„Das sollte man wohl meinen, in der Tat“, stimmte die Marquise zu. „Sie können sehr stolz auf Ihre Kinder sein, Lord Honerton. Es gab bei der letzten Audienz nicht einen Menschen, der nicht erklärte, Judith sei das schönste Mädchen, das man seit Jahren im Buckingham-Palast gesehen habe. Mein Sohn Frederick war im Thronsaal im Dienst. Er konnte von niemand anderem sprechen – er wusste überhaupt nicht mehr, was er eigentlich zu tun hatte.“
Lord Honerton schaute den Tisch entlang.
„Er scheint sich jetzt wieder gefasst zu haben“, bemerkte er.
„Frederick ist immer in Bestform, wenn er mit jemandem zusammen ist, den er wirklich mag“, vertraute seine Mutter ihm an. „Er ist ein lieber Kerl, auch wenn ältere Söhne ziemlich kostspielig sind“, seufzte sie. „Polo und all diese Dinge kosten heutzutage so viel Geld. Ich fürchte, für die jüngeren Jungs wird es nichts dergleichen geben. Wir haben darüber nachgedacht, Dick in ein gutes Geschäft zu bringen, wo er etwas Geld verdienen kann. Was denken Sie darüber, Lord Honerton?“
Ihr Gastgeber wurde ein wenig zurückhaltender. Es gab zwar Millionen zu verdienen im großen Fernham-Geschäft, doch diese waren ganz eindeutig den Mitgliedern der Familie Fernham vorbehalten. Angestellte, Verwalter und Reisende waren durchaus nützlich, aber er hatte eine scharfsinnige Vorstellung davon, wie es um die Aussichten einer Frau wie der Marquise stand, die eine kaufmännische Laufbahn für ihren Sohn anstrebte. Für etwas auch nur im Geringsten Zierliches war in den Fernham-Werken kein Platz.
„Es kommt darauf an, ob er das Zeug dazu hat“, meinte er ausweichend. „In der Regel ist der Mann, der im Handel Geld verdient, der Mann, der den Instinkt dafür geerbt hat. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Lord Frederick oder einer Ihrer Söhne sich heutzutage in der Geschäftswelt behaupten könnte.“
„Es sei denn, man hilft ihm“, murmelte die Marquise.
„Es gibt nur zwei Arten von Hilfe“, erklärte Lord Honerton. „Die eine ist, jemandem eine Chance zu geben. Das ist in Ordnung, aber es bringt nichts, wenn der Empfänger nicht das Zeug dazu hat, diese Chance zu nutzen. Die zweite Art bedeutet einfach, jemandem ein Einkommen zu verschaffen, das er nicht selbst verdient. Das nenne ich Wohltätigkeit.“
Die Marquise war ein wenig verärgert. Das Schlimmste an diesen Prinzen der Wirtschaft, entschied sie, war, dass sie keine Sensibilität hatten. Sie wollte gerade das Thema wechseln, als etwas passierte, das für nur drei Personen im Raum – Lord Honerton, seine Frau und Samuel, seinen Bruder – eine besondere, fast unheimliche Bedeutung hatte. Es war das erneute Anheben eines vergessenen Vorhangs der Tragödie. Ein Diener kam rein und flüsterte Martin, dem perfekten Butler, was ins Ohr. Dieser nickte kurz, ging hinter Ernest Honertons Stuhl und beugte sich mit einer kleinen Verbeugung vor.
„Entschuldigen Sie bitte, Sir“, sagte er. „Middleton, der Oberförster, steht draußen. Er hat gerade den Plan der Reviere zum Haus gebracht. Er wollte wissen, Sir, ob Sie noch weitere Anweisungen haben, bevor er geht.“
Der junge Mann stand auf. Vielleicht lag ein Hauch von Eitelkeit in dieser Situation, aber er war tatsächlich sehr an der morgigen Jagd interessiert. Er warf einen Blick auf seine Mutter.
„Darf ich mich kurz entschuldigen?“, fragte er. „Middleton hat den Plan für die Jagdgebiete von morgen mitgebracht, und ich würde gerne kurz mit ihm reden. Wir haben letzten Monat viele Vögel in den Parkdickichten verloren, und da wir dort fertig waren, haben wir sie nicht wiederbekommen.“
Die Männer der Gruppe lächelten zustimmend, erfreut über diese Erinnerung an das morgige Jagdvergnügen. Die Frauen zeigten sich angenehm gleichgültig, obwohl Ernests Nachbarin, eine kleine Freche, ihm eine Grimasse schnitt und ihm zuflüsterte, er solle sich nicht zu lange aufhalten. Aber drei Personen saßen da, als wären sie zu Stein geworden. Lady Honertons dunkle Augen, die in letzter Zeit aufgrund ihrer Hautverfärbung viel strahlender wirkten, zeigten für einen Moment einen fast unmenschlichen Ausdruck von Schrecken. Aus dem Gesicht ihres Mannes verschwand die Farbe, ein Erbe seiner jüngsten Ausschweifungen, und hinterließ einen streifigen Fleck. Seine dicken, pummeligen Finger krallten sich an beiden Seiten des Tisches fest, seine kleinen Augen schienen unter seinen Augenlidern hervorzukriechen, bis sie fast herauszufallen drohten. Weiter unten am Tisch hatte sich Samuel nach vorne gebeugt, die Hände auf seinem dicken Stock verschränkt, und sein Blick wanderte abwechselnd von seinem Bruder zu seiner Schwägerin. Ernest war schon ein paar Schritte zur Tür gegangen, bevor er merkte, dass etwas nicht stimmte. Er blieb sofort stehen, als er das Gesicht seines Vaters sah.
„Hallo, Dad!“, rief er. „Ist alles in Ordnung? Du wolltest, dass ich mich um das Schießen kümmere? Ich kann doch kurz mit Middleton reden, oder? Ich bin gleich wieder da.“
„Klar“, murmelte sein Vater.
„Bleib nicht zu lange weg“, bat seine Mutter.
„Ich fühle mich wie ein ungezogener Junge, der ohne Erlaubnis weggegangen ist“, lachte der junge Mann, während er weiter zur Tür ging. „Wenn Middleton mich länger als ein paar Minuten aufhält, komme ich zu euch in den Bridge-Raum.“
Er ging hinaus und die Tür wurde hinter ihm geschlossen. Nur wenige Leute hatten bemerkt, wie tief der Schock war, der für ihre Gastgeber für einen Moment eine Atmosphäre entsetzlicher Erinnerungen in den Raum gebracht hatte. Die Unterhaltung wurde fast sofort wieder aufgenommen. Erst als die Marquise die kleinen Schweißperlen auf der Stirn ihres Gastgebers bemerkte, überkam sie plötzlich eine Welle der Erinnerung.
„Mein lieber Lord Honerton!“, rief sie aus. „Verzeihen Sie uns, dass wir diesen schrecklichen Zufall nicht sofort erkannt haben. Ich war damals noch sehr jung – das muss vor dreißig Jahren gewesen sein, nicht wahr? –, aber ich erinnere mich noch genau an den Schock, den wir alle empfanden, den jeder in der Grafschaft empfand, als wir die schreckliche Nachricht hörten. Es war natürlich Ihr Bruder, der von diesem Verrückten ermordet wurde, nicht wahr? Und wenn ich mich recht erinnere, wurde er auf genau dieselbe Weise aus dem Zimmer geholt.“
„Die Nachricht war fast identisch“, stöhnte Lord Honerton und wischte sich die Stirn ab.
„Sehr beunruhigend“, erklärte die Marquise. „In diesem Fall besteht jedoch kein Grund zur Sorge. Middleton ist ein sehr angesehener Mann – Frederick schätzt ihn sehr – und er hat keine Familie. Es war natürlich die Assoziation, die so schmerzhaft war.“
Lady Honerton stand etwas abrupt auf, und die Männer rückten nach dem Weggang der Frauen näher zusammen, lobten lautstark den Portwein ihres Gastgebers und diskutierten eifrig über die möglichen Gewinne am nächsten Tag. Der Marquis hätte sich gerne links neben seinen Gastgeber gesetzt, aber Samuel Fernham kam ihm zuvor – Samuel, der sich schwer auf seinen Stock mit Elfenbeingriff stützte, humpelte herbei und ließ sich in den Stuhl neben seinem Bruder sinken. Er beugte sich vor und legte seine schrumpelige, gelbe Hand auf die kräftige Hand des anderen.
„Das war ein Schock, Bruder“, sagte er leise. „Es war, als würde man in die Vergangenheit zurückblicken – diese schreckliche Nacht! Aber egal. Das liegt alles dreißig Jahre zurück. Das ist vorbei.“
Joseph sah ihn dankbar an, aber in seinem Gesicht schwelte noch immer etwas von der alten Angst.
„Das ist vorbei, Samuel“, stimmte er zu. „Es ist die Erinnerung, die niemals verblasst!“
KAPITEL III
Lord Honerton ließ seinen Gästen an diesem Abend viel weniger Zeit als sonst, um über seinen tollen Portwein zu quatschen. Er stand ziemlich abrupt auf, gerade als sich alle gemütlich machten, und ging zur Tür.
„Sie warten darauf, dass einige von uns Bridge spielen“, erklärte er. „Kaffee und Zigarren gibt's im Kartenzimmer.“
Unter denjenigen, die gerade ihre Gläser gefüllt hatten, herrschte fast schon Bestürzung. Der Marquis ließ sich nicht drängen.
„Wir kommen gleich nach, wenn wir dürfen, Honerton“, sagte er. „Ihr Portwein ist zu gut, um so unhöflich behandelt zu werden.“
Joseph murmelte etwas und eilte weiter. Normalerweise war er kein nervöser Mensch, aber ein seltsamer kleiner Dämon der Unruhe saß in seinem Herzen. Er durchquerte die Halle mit einer Geschwindigkeit, die Samuel weit hinter sich ließ, und sah sich eifrig im Bridgezimmer um. Die meisten Frauen hatten sich dort versammelt, einige saßen bereits am Bridge-Tisch, ein oder zwei standen um den großen Kamin herum. Von Ernest war jedoch nichts zu sehen. Durch die halb geschlossene Portière konnte er das Geräusch von Billardkugeln aus dem Raum dahinter hören. Er schaute hinein und sah Judith, die mit einem anderen jungen Mitglied der Hausgesellschaft eine Partie Billard spielte.
„Hast du Ernest gesehen?“, fragte er.
Judith hielt inne, als sie gerade dabei war, ihren Queue zu kreiden.
„Er war nicht hier, Dad“, sagte sie. „Ich denke, er ist noch bei Middleton.“
Joseph ließ den Vorhang fallen, ging zurück in den Bridge-Raum und machte sich etwas bedächtiger auf den Weg zu den Bedienstetenquartieren. Er umging diese, ging durch eine grüne Filztür in einen mit Steinplatten ausgelegten Gang, der zur Rückseite des Hauses führte, und stieß die Tür zum Waffenraum auf. Ein wenig blauer Zigarettenrauch hing noch in der Luft, aber der Raum war leer. Robinson, einer der Unterjäger, kam aus einem Nebenraum mit dem Gewehr, das er gerade gereinigt hatte, in der Hand.
„Hast du Mr. Ernest gesehen?“, fragte Joseph schnell.
„In den letzten zehn Minuten nicht, Mylord“, antwortete der Mann. „Damals war er mit Middleton im Waffenraum.“
„Wo ist Middleton?“
„Er ist vor etwa zehn Minuten nach Hause gegangen, mein Herr.“
Joseph nickte und wandte sich ab, um zu seinen Gästen zurückzukehren, wobei er sich immer wieder sagte, dass er ein Idiot sei, und sich ständig über die Feuchtigkeit auf seiner Stirn und das seltsame Gefühl einer drohenden Katastrophe in seinem Herzen wunderte. Er gab sich jedoch alle Mühe, dagegen anzukämpfen, und tauschte beiläufige Grüße mit den wenigen Männern aus, denen er auf dem Weg durch die Halle begegnete. Im Speisesaal angekommen, rief er Martin zu sich.
„Martin“, sagte er, „ich möchte, dass du Mr. Ernest für mich suchst. Er ist vielleicht in sein Zimmer gegangen. Wenn er nicht da ist, such so lange, bis du ihn findest. Ich brauche ihn zum Bridge.“
„Sehr gerne, mein Herr“, antwortete der Mann.
Joseph ging zurück ins Bridgezimmer. Er schaute sich gespannt um, mit der leisen Hoffnung, Ernest auf dem Weg zu den hinteren Räumen verpasst zu haben. Er war jedoch nirgends zu sehen, auch nicht im Billardzimmer oder in der großen Lounge, wo es einen weiteren Billardtisch gab und ein oder zwei Männer Pool spielten. Joseph ging wieder ins Bridgezimmer, schenkte sich ein starkes Glas Brandy ein und trank es.
„Wer hat Lust auf Bridge?“, fragte er und schlenderte auf seine Gäste zu. „Wir haben genug für drei Tische, oder? Spielst du mit mir, Marquise, und du, Lady Levater, und du, Pownall? Gut! Dann könnt ihr vier so spielen, wie ihr seid“, fügte er mit einer Handbewegung hinzu, „und Ernest kann euch andere Partner suchen, wenn er kommt.“
„Wo ist Ernest?“, fragte Lady Honerton und schaute zu ihrem Mann hinüber. „Ich dachte, du wärst ihn suchen gegangen.“
„Er scheint auf sein Zimmer gegangen zu sein, meine Liebe“, antwortete dieser. „Ich habe Martin geschickt, um ihn zu holen. Würdest du an diesen Tisch kommen, Lady Levater?“
In den nächsten Minuten herrschte ein gewisses Durcheinander, während sich alle niederließen; dann kehrte relative Stille ein, die nur durch das leise Fallen der Karten, ein gedämpftes Ausruf und das gelegentliche Aufprallen der Billardkugeln im Nebenzimmer unterbrochen wurde. Rachel, Lady Honerton, die nicht mitspielte, saß in einem Sessel und tat so, als würde sie eine Abendzeitung lesen, aber ihre Augen waren fast die ganze Zeit auf die Tür gerichtet. Ihr Mann, der sich mit einem weiteren Likör-Brandy gestärkt hatte, war entschlossen, seine Nervosität zu überwinden, die sein vernünftiges Ich ihm als fast schon idiotisch bezeichnete. Er paffte an einer riesigen Zigarre und spielte sein gewohnt solides, wenn auch etwas aggressives Spiel. Sein geschicktes Spiel weckte die aufrichtige Bewunderung seiner Partnerin.
„Wenn ich nur so spielen könnte wie Sie, Lord Honerton!“, murmelte sie. „Was mir so schwer fällt, ist die Konzentration. Ich merke, dass meine Gedanken ständig abschweifen, gerade wenn ich besonders darauf achten möchte, welche Karten abgelegt werden oder wie viele Trümpfe es gibt.“
„Konzentration“, sagte Joseph und hielt seinen Blick eifrig von der Tür abgewandt, „ist eine der Disziplinen des Lebens.“
Die Marquise seufzte.
„Das klingt wie eine Maxime aus einem Lehrbuch“, erklärte sie, „aber die haben einem im wirklichen Leben noch nie geholfen, oder?“
Die Tür wurde geöffnet und Martin betrat den Raum, gefolgt von zwei Dienern, die gekommen waren, um das Kaffeegeschirr abzuräumen. Er ging sofort zum Stuhl seines Herrn und blieb dort einen Moment lang stehen, während eine Runde gespielt wurde, in respektvoller Stille. Sobald die letzte Karte gefallen war, erstattete er Bericht.
„Es tut mir leid, Mylord, aber ich habe Mr. Ernest nicht finden können“, sagte er. „Ich war in seiner Suite und habe es in der Gemäldegalerie, im Ballsaal und im Squashcourt versucht.“
„Warst du in der Bibliothek?“, fragte Joseph.
„Dort war ich als Erstes, mein Herr. Es gibt keinen Ort im Haus, den ich nicht überprüft habe.“
Samuel humpelte durch den Raum, mit einem seltsamen Ausdruck der Besorgnis in seinem hageren Gesicht.
„Was ist mit dem Jungen, Joseph?“, fragte er. „Was sagt Martin?“
„Anscheinend ist er nirgendwo im Haus“, war die angespannte Antwort.
Major Pownall, der nichts über die Familiengeschichte wusste, war ungeduldig und wollte mit dem Spiel weitermachen. Er schaute von den Karten auf, die er gerade sortiert hatte.