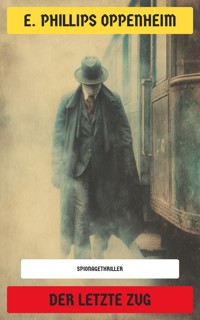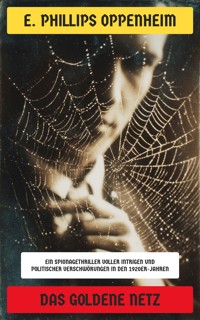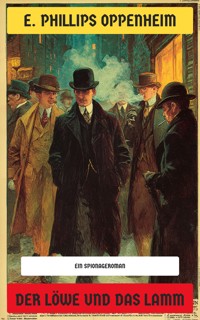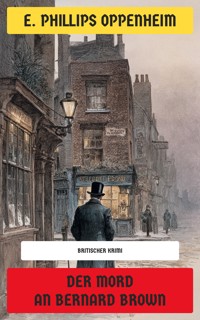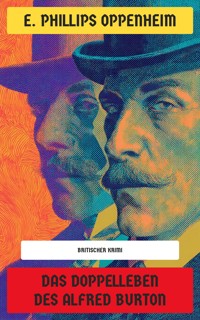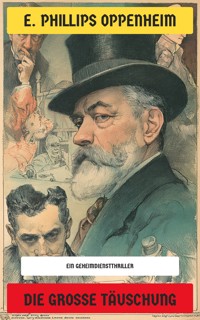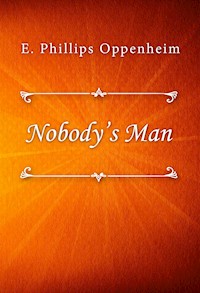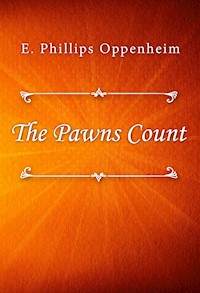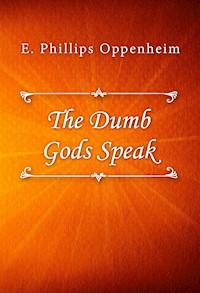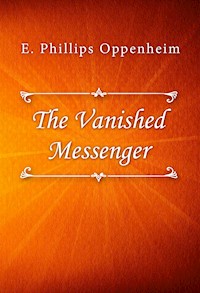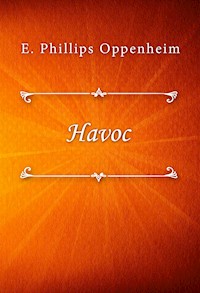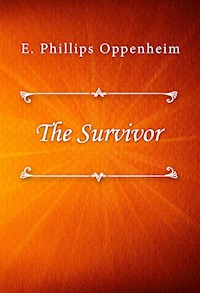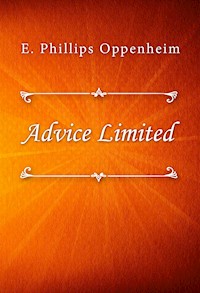1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Herr Grex aus Monte Carlo" von E. Phillips Oppenheim ist ein spannender Spionageroman voller Eleganz, Geheimnisse und Intrigen im glitzernden Umfeld der Riviera. Monte Carlo – das Symbol für Luxus, Glücksspiel und geheime Geschäfte – ist der Schauplatz, an dem sich internationale Diplomaten, Abenteurer und Spione in einem gefährlichen Spiel begegnen. Inmitten dieser schillernden Welt tritt Herr Grex auf, ein geheimnisvoller Mann, dessen Identität niemand genau kennt. Ist er ein reicher Aristokrat, ein brillanter Diplomat – oder ein gefährlicher Agent, der mit den Geschicken Europas spielt? Neben ihm steht die junge englische Adlige Grace Pellissier, die in Monte Carlo Erholung sucht, aber bald in ein Netz politischer Intrigen verwickelt wird. Sie trifft auf den charmanten und klugen Sir Hargrave, einen britischen Offizier, der ebenso wie sie zwischen Pflichtgefühl und persönlichen Gefühlen schwankt. Die Begegnungen zwischen ihnen sind von Spannung, Anziehung und Misstrauen geprägt – denn in dieser Welt scheint niemand ganz aufrichtig zu sein. Während auf den Boulevards und in den Spielsälen das mondäne Leben tobt, braut sich im Hintergrund ein gefährlicher Konflikt zusammen. Geheimdokumente wechseln die Besitzer, verschlüsselte Botschaften werden überbracht, und hinter jeder Maske könnte sich ein Feind verbergen. Herr Grex bewegt sich darin wie ein Schatten – stets einen Schritt voraus, ungreifbar und faszinierend zugleich. Oppenheim entfaltet in diesem Roman ein raffiniertes Spiel aus Politik, Leidenschaft und Täuschung. Mit präzisen Dialogen und filmreifer Atmosphäre fängt er die Spannung jener Epoche ein, in der ein einziger Fehler ein Land ins Chaos stürzen konnte. "Herr Grex aus Monte Carlo" ist eine elegante Mischung aus Liebesgeschichte, Spionage und mondäner Gesellschaftsdramatik – ein klassischer Oppenheim voller Stil und geheimnisvoller Spannung. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herr Grex aus Monte Carlo
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL I
EIN UNERWARTETES TREFFEN
Die Augen des Mannes, der eine überaus fantastische und brillante Szene beobachtet hatte, erfuhren nach diesen ersten Momenten relativer Gleichgültigkeit eine merkwürdige Veränderung. Er betrachtete eines der Weltwunder. Er sah eine Ansammlung von Menschen, die vielleicht alle Schichten der Gesellschaft und alle wichtigen Nationalitäten repräsentierten, aber aufgrund ihrer Vorliebe für Mode eine seltsame Gemeinsamkeit aufwiesen. Unbeeindruckt blickte er auf eine schöne Engländerin, die eine Herzogin war, aber nicht so aussah, und auf eine ebenso schöne Französin, die wie eine Herzogin aussah, aber keine war. Um ihn herum waren Frauen in Kleidern der großen Modeschöpfer der Zeit, Frauen wie Blumen, voller Duft, Weichheit und Farbe. Sein Blick wanderte fast achtlos über sie hinweg. Etwas müde von der mehrwöchigen Reise durch Länder, in denen es wenig Luxus gab, waren seine Sinne für die Pracht der Szene abgestumpft, sein Puls hatte noch nicht auf ihren Charme und ihre Wunder reagiert. Und dann kam die Veränderung. Er sah eine Frau, die fast genau ihm gegenüber am nächsten Roulette-Tisch stand, und zuckte merklich zusammen. Für einen Moment veränderte sich sein blasses, ausdrucksloses Gesicht, sein Geheimnis lag offen da. Das war jedoch nur eine Sache von Sekunden. Er war an Schocks gewöhnt und überstand auch diesen. Er trat ein wenig zur Seite von seinem prominenten Platz in der Mitte der weitläufigen Türöffnung. Er stellte sich neben eine der Liegen und beobachtete.
Sie war groß, blond und schlank. Sie trug ein hochgeschlossenes, schimmerndes graues Kleid, einen schwarzen Hut, unter dem ihr üppiges Haar wie Gold glänzte, und eine Perlenkette um den Hals, auf deren Perlen sein Blick mit neugierigem Ausdruck ruhte. Im Gegensatz zu vielen ihrer Nachbarn spielte sie zurückhaltend, aber mit Interesse, fast schon Begeisterung. Ihr glattes, schönes Gesicht zeigte keine Anzeichen von Anspannung, wie man sie bei Spielern oft sieht. Ihre zart geschwungenen Lippen waren frei von den grimmigen Linien konzentrierter Habgier. Sie war zweiunddreißig Jahre alt, sah aber viel jünger aus, als sie dort stand, die Lippen zu einem zufriedenen Lächeln der Vorfreude leicht geöffnet. Sie beugte sich ein wenig über den Tisch und ihre Augen waren mit humorvoller Intensität auf das sich drehende Rad gerichtet. Selbst inmitten dieser Schar schöner Frauen besaß sie eine gewisse individuelle Ausstrahlung. Sie sah nicht nur so aus, wie sie war – eine Engländerin von guter Herkunft –, sondern ihre Mimik und ihre Haltung strahlten eine gewisse zarte Zurückhaltung aus, die ihrer Persönlichkeit, die die beiden Extreme Provokation und Zurückhaltung zu vereinen schien, zusätzlichen Charme verlieh. Man hätte gezögert, sie auch nur mit den beiläufigen Bemerkungen anzusprechen, die unter Fremden an den Tischen so leicht fallen.
„Violet ist hier!“, flüsterte der Mann leise. „Violet!“
In diesem Flüstern lag Tragik, und auch in dem Blick, den sich der Mann und die Frau wenige Augenblicke später zuwarfen, lag etwas Tragisches. Mit den Händen voller Plaketten, die sie gerade gewonnen hatte, hob sie endlich den Blick vom Spielbrett. Das Lächeln auf ihren Lippen war das freudige Lächeln eines Mädchens. Und dann, als sie gerade dabei war, ihre Gewinne in ihre goldene Tasche zu stecken, sah sie den Mann gegenüber. Das Lächeln schien von ihren Lippen zu verschwinden; tatsächlich schien es zusammen mit jedem anderen Ausdruck aus ihrem Gesicht zu weichen. Die Plaketten fielen eine nach der anderen durch ihre Finger in die Tasche. Ihre Augen blieben auf ihn gerichtet, als würde sie einen Geist betrachten. Die Sekunden schienen sich zu einer grausamen Zeitpause zu dehnen. Die Stimme des Croupiers, das gemurmelte Fluchen eines Verlierers neben ihr, die Notwendigkeit, sich leicht zu bewegen, um jemandem, der nach Wechselgeld suchte, Platz zu machen – solche Kleinigkeiten holten sie schließlich aus ihrer Starre zurück. Ihr Gesichtsausdruck normalisierte sich sofort. Sie wandte ihren Blick nicht ab, sondern neigte nur leicht den Kopf in Richtung des Mannes. Dieser verbeugte sich daraufhin sehr ernst und ohne ein Lächeln.
Der Tisch vor ihr war jetzt leer. Die Leute fingen an, über ihren nächsten Einsatz nachzudenken. Die Stimme des Croupiers mit seinem papageienartigen Ruf hallte über den Tisch.
„Faites vos jeux, mesdames et messieurs.“
Die Frau machte keine Anstalten, einen Einsatz zu machen. Nach einem Moment des Zögerns gab sie ihren Platz auf, ging zurück und setzte sich auf einen leeren Diwan. Schnell formten sich Gedanken in ihrem Kopf. Ihre zarten Augenbrauen zogen sich zu einer deutlichen Stirnrunzel zusammen. Nach diesem ersten Schock, diesem seltsamen Gefühlswirrwarr, das sich nicht analysieren ließ, aber dennoch etwas völlig Unerwartetes in sich barg, verspürte sie den Drang, wütend zu werden. Dieses Gefühl hatte sich noch nicht gelegt, als sie einen Moment später bemerkte, dass der Mann, dessen Ankunft sie so verstört hatte, vor ihr stand.
„Guten Tag“, sagte er etwas steif.
Sie hob den Blick. Die Stirn war immer noch gerunzelt, obwohl ein leichtes Zittern ihrer Lippen dem etwas widersprach.
„Guten Tag, Henry!“
Aus irgendeinem Grund fiel es ihm schwer, weiter zu reden. Er ging auf den freien Platz zu.
„Wenn du nichts dagegen hast“, meinte er, als er sich setzte.
Sie öffnete ihren Fächer – eine uralte, aber wunderbare Verteidigungswaffe. Das verschaffte ihr eine kurze Atempause. Dann sah sie ihn ruhig an.
„Ausgerechnet hier“, flüsterte sie, „treffe ich dich!“
„Ist das so außergewöhnlich?“
„Für mich schon“, gab sie zu. „Du passt hier überhaupt nicht hin, weißt du. Eine Szene wie diese“, fügte sie hinzu und blickte sich um, „würde dich wohl kaum um ihrer selbst willen anziehen, oder?“
„Nicht wirklich“, gab er zu.
„Warum bist du dann gekommen?“
Er schwieg. Die Falten auf ihrer Stirn vertieften sich.
„Vielleicht“, fuhr sie kühl fort, „kann ich dir bei deiner Antwort helfen. Du bist gekommen, weil du mit den Berichten des Privatdetektivs, den du beauftragt hast, mich zu beobachten, nicht zufrieden bist. Du bist gekommen, um sie durch deine eigenen Ermittlungen zu ergänzen.“
Er runzelte die Stirn wie sie. Die Kälte in seiner Stimme wurde durch einen Anflug von Wut noch bitterer.
„Ich bin überrascht, dass du mich zu so einer Handlung fähig hältst“, erklärte er. „Ich kann nur sagen, dass das ganz zu deinen anderen Verdächtigungen mir gegenüber passt und dass ich es absolut unwürdig finde.“
Sie lachte ein wenig ungläubig, nicht ganz natürlich.
„Mein lieber Henry“, protestierte sie, „ich kann mir nicht einbilden, dass es noch jemanden auf der Welt gibt, der sich so sehr für meine Aktivitäten interessiert, dass er mich beobachten lässt.“
„Glaubst du wirklich, dass das der Fall ist?“, fragte er grimmig.
„Das ist überhaupt keine Frage des Eindrucks“, erwiderte sie. „Es ist die Wahrheit. Ich wurde von London aus verfolgt, ich wurde in Cannes beobachtet, ich werde hier Tag für Tag beobachtet – von einem kleinen Mann in einem braunen Anzug und einem Homburg-Hut, der die Angewohnheit hat, herumzulungern. Er lungert unter meinem Fenster herum, wahrscheinlich lungert er gerade jetzt gegenüber herum. Seit drei Wochen lungert er in einem Umkreis von fünfzig Metern um mich herum, und um ehrlich zu sein, habe ich ihn satt. Könnte ich nicht eine Woche Urlaub haben? Ich werde ein Tagebuch führen und dir alles erzählen, was du wissen willst.“
„Reicht es aus“, fragte er, „wenn ich dir auf mein Ehrenwort versichere, dass ich nichts davon weiß?“
Sie war etwas überrascht. Sie drehte sich um und sah ihn an. Sein Tonfall war überzeugend. Er hatte nicht das Gesicht eines Mannes, dessen Ehrenwort eine unbedeutende Sache war.
„Aber Henry“, protestierte sie, „ich sage dir, dass es keinen Zweifel gibt. Ich werde Tag und Nacht beobachtet – ich, eine unbedeutende Person, deren Taten nur für dich und nur für dich von Interesse sein können.“
Der Mann antwortete nicht sofort. Seine Gedanken schienen für einen Moment abgeschweift zu sein. Als er wieder sprach, hatte seine Stimme ihren vorwurfsvollen Ton verloren.
„Ich mache dir keinen Vorwurf wegen deines Misstrauens“, sagte er ruhig, „obwohl ich dir versichern kann, dass ich nie daran gedacht habe, dich beobachten zu lassen. Das wäre mir selbst in meinen unglücklichsten Momenten nie in den Sinn gekommen.“
Sie war verwirrt – gleichzeitig verwirrt und interessiert.
„Ich bin so froh, das zu hören“, sagte sie, „und natürlich glaube ich dir, aber die Tatsache bleibt bestehen. Ich denke, du wirst mir zustimmen, dass es seltsam ist.“
„Könnte es nicht sein“, wagte er zu fragen, „dass es Ihre Begleiter sind, die im Fokus der Wachsamkeit dieses Mannes stehen? Sie sind hier doch nicht allein, oder?“
Sie sah ihn ein wenig trotzig an.
„Ich bin hier“, verkündete sie, „mit Mr. und Mrs. Draconmeyer.“
Er hörte ihr ohne jede Regung zu, aber irgendwie war leicht zu erkennen, dass ihre Nachricht, obwohl mehr als halb erwartet, ihn getroffen hatte.
„Mr. und Mrs. Draconmeyer“, wiederholte er und betonte dabei leicht den letzten Teil des Satzes.
„Natürlich! Es tut mir leid“, fuhr sie einen Moment später fort, „dass meine Begleiter nicht deine Zustimmung finden. Das konnte ich jedoch kaum erwarten, wenn man bedenkt ...“
„In Anbetracht dessen, was?“, hakte er nach und sah sie fest an.
„In Anbetracht aller Umstände“, antwortete sie nach einer kurzen Pause.
„Frau Draconmeyer ist immer noch krank?“
„Sie ist immer noch krank.“
Der leicht sarkastische Unterton in seiner Frage schien eine gewisse Trotzhaltung in ihr hervorzurufen, als sie sich ein wenig seitlich zu ihm drehte. Sie bewegte ihren Fächer langsam hin und her, warf den Kopf zurück und wirkte fast schon kämpferisch. Er nahm die Herausforderung an. Er stellte ihr in klaren Worten die Frage, die seine Augen bereits gestellt hatten.
„Ich sehe mich gezwungen, dich zu fragen“, sagte er in einem bewusst gemessenen Tonfall, „wie du in den Besitz der Perlen gekommen bist, die du trägst? Ich kann mich nicht erinnern, dass sie dir gehören.“
Ihre Augen blitzten.
„Findest du nicht“, erwiderte sie, „dass du deine Privilegien ein wenig überschreitest?“
„Überhaupt nicht“, erklärte er. „Sie sind meine Frau, und obwohl Sie sich mir in einer bestimmten Angelegenheit widersetzt haben, unterliegen Sie dennoch meiner Autorität. Ich sehe, dass Sie in der Öffentlichkeit Juwelen tragen, die Sie vor einigen Monaten sicherlich noch nicht besaßen und die weder Ihr Vermögen noch meines ...“
„Lass mich dich beruhigen“, unterbrach sie ihn eiskalt. „Die Perlen gehören mir nicht. Sie gehören Mrs. Draconmeyer.“
„Mrs. Draconmeyer!“
„Ich trage sie“, fuhr sie fort, „auf Lindas besonderen Wunsch hin. Sie ist zu krank, um in der Öffentlichkeit aufzutreten, und kann nur sehr selten ihren wunderschönen Schmuck tragen. Es macht ihr Freude, ihn manchmal an anderen Menschen zu sehen.“
Er blieb einige Augenblicke lang ganz still. In Wirklichkeit war er leidenschaftlich wütend. Selbstbeherrschung war jedoch zu einer solchen Gewohnheit für ihn geworden, dass es keine Anzeichen für seinen Zustand gab, außer dem leichten Zucken seiner langen Finger und dem Zusammenziehen seiner Lippen. Sie jedoch erkannte die Symptome ohne Schwierigkeiten.
„Da du dich meiner Autorität widersetzt“, sagte er, „darf ich fragen, ob meine Wünsche für dich überhaupt eine Rolle spielen?“
„Das kommt drauf an“, antwortete sie.
„Es ist mein ernsthafter Wunsch“, fuhr er fort, „dass du weder in der Öffentlichkeit noch privat den Schmuck einer anderen Frau trägst.“
Sie schien einen Moment lang nachzudenken. Tatsächlich kämpfte sie gegen die Überzeugung, dass seine Bitte vernünftig war.
„Es tut mir leid“, sagte sie schließlich. „Ich sehe in diesem speziellen Fall nichts Schlimmes daran. Es bereitet der armen Mrs. Draconmeyer große Freude, ihre Juwelen zu sehen und zu bewundern, auch wenn sie sie selbst nicht tragen kann. Es bereitet mir eine intensive Freude, die selbst ein normaler Mann kaum verstehen kann, Sie schon gar nicht. Es tut mir leid, dass ich Ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen kann.“
Er beugte sich zu ihr hinüber.
„Nicht, wenn ich dich darum bitte?“
Sie sah ihn fest an, als würde sie etwas in seinem Gesicht suchen oder über etwas in seinem Tonfall nachdenken. Es war ein Moment, der viel hätte bedeuten können. Hätte sie in sein Herz sehen und die heftige Eifersucht verstehen können, die seine Worte ausgelöst hatte, hätte es sehr viel bedeuten können. So wie es war, schien ihre Betrachtung unbefriedigend zu sein.
„Es tut mir leid, dass du so viel Wert auf eine so kleine Sache legst“, sagte sie. „Du warst schon immer unvernünftig. Deine jetzige Bitte ist ein weiteres Beispiel dafür. Ich habe mich sehr amüsiert, bis du gekommen bist, und jetzt willst du mir eines meiner größten Vergnügen nehmen. Ich kann dir diesen Gefallen nicht tun.“
Er wandte sich ab. Selbst dann hätte noch ein Zufall eingreifen können. In dem Moment, als sie diese Worte ausgesprochen hatte, wurde ihr klar, dass sie etwas ungerecht waren, und sie verstand vielleicht ein wenig die Sichtweise dieses Mannes, der immer noch ihr Ehemann war. Sie beobachtete ihn fast eifrig und hoffte, in seinem Gesicht ein Zeichen zu finden, dass es nicht nur sein sturer Stolz war, der sprach. Das gelang ihr jedoch nicht. Er war einer dieser Männer, die nur zu gut wissen, wie man eine Maske trägt.
„Darf ich fragen, wo du hier wohnst?“, fragte er schließlich.
„Im Hotel de Paris.“
„Das ist bedauerlich“, meinte er. „Ich werde morgen mein Quartier wechseln.“
Sie zuckte mit den Schultern.
„Monte Carlo ist voller Hotels“, sagte sie, „aber es ist schade, dass Sie umziehen. Der Ort ist groß genug für uns beide.“
„Es ist noch nicht lange her“, erwiderte er, „dass du London selbst zu klein fandest. Es würde mir sehr leid tun, dir deinen Urlaub zu verderben.“
Ihr Blick schien einen Moment lang auf der spanischen Tänzerin zu verweilen, die ihnen gegenüber am Tisch saß, einer Frau, deren Name einst in aller Munde war, die nun entthront war, aber immer noch Aufmerksamkeit und Ehrerbietung verlangte und sie sogar mit den Überresten ihrer Schönheit und der Pracht ihrer Kleidung in ihren Bann zog.
„Dies scheint ein seltsamer Ort für häusliche Streitigkeiten zu sein“, bemerkte sie. „Versuchen wir, strittige Themen zu vermeiden. Bin ich zu neugierig, wenn ich Sie noch einmal frage, was Sie um alles in der Welt an einen Ort wie Monte Carlo verschlagen hat?“
Er wich ihrer Frage aus. Vielleicht störte ihn der leicht ironische Unterton in ihrer Stimme. Vielleicht gab es auch andere Gründe.
„Warum sollte ich nicht nach Monte Carlo kommen?“, fragte er. „Das Parlament ist nicht besonders unterhaltsam, wenn man in der Opposition ist, und ich jage nicht. Die ganze Welt amüsiert sich hier.“
„Aber nicht Sie“, erwiderte sie schnell. „Ich kenne Sie besser, mein lieber Henry. Hier und in dieser Atmosphäre gibt es nichts, was Sie auf Dauer anziehen könnte. Es gibt keine Arbeit für Sie – Arbeit, die Sie zum Atmen brauchen; Arbeit, das Einzige, wofür Sie leben und wofür Sie geschaffen sind; Arbeit, Sie Mann aus Sägemehl und Bürokratie.“
„Bin ich wirklich so schlimm?“, fragte er leise.
Sie fingerte einen Moment lang an ihrer Perlenkette herum.
„Vielleicht habe ich kein Recht, mich zu beschweren“, räumte sie ein. „Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen. Aber wenn man einen Moment lang in die Vergangenheit blicken darf, kannst du mir dann eine einzige Stunde nennen, in der die Arbeit nicht der wichtigste Gedanke in deinem Kopf war, das Idol, das du verehrt hast? Selbst unsere Flitterwochen haben wir mit Wahlwerbung verbracht!“
„Die Wahl kam unerwartet“, erinnerte er sie.
„Es wäre auf dasselbe hinausgelaufen“, erklärte sie. „Die einzige Literatur, die du wirklich verstehst, ist ein Regierungsbericht, und die einzige Musik, die du hörst, ist das Glockenspiel von Big Ben.“
„Du redest“, bemerkte er, „als ob du diese Dinge ablehnst. Dabei wusstest du schon vor unserer Heirat, dass ich Ambitionen habe und nicht vorhabe, ein müßiges Leben zu führen.“
„Oh ja, das wusste ich!“, stimmte sie trocken zu. „Aber wir kommen vom Thema ab. Ich frage mich immer noch, was dich hierher gebracht hat. Bist du direkt aus England gekommen?“
Er schüttelte den Kopf.
„Ich bin heute aus Bordighera gekommen.“
„Das wird ja immer mysteriöser“, murmelte sie. „Bordighera, wirklich? Ich dachte, du hättest mir mal gesagt, dass du die Riviera nicht magst.“
„Das tue ich auch“, stimmte er zu.
„Und trotzdem bist du hier?“
„Ja, ich bin hier.“
„Und du bist nicht gekommen, um nach mir zu sehen“, fuhr sie fort, „und das Rätsel um den kleinen braunen Mann, der mich beobachtet, ist immer noch ungelöst.“
„Ich weiß nichts über diese Person“, versicherte er, „und ich hatte keine Ahnung, dass du hier bist.“
„Oder wärst du nicht gekommen?“, fragte sie ihn herausfordernd.
„Deine Anwesenheit“, erwiderte er gereizt und vergaß für einen Moment seine Zurückhaltung, „hätte meine Pläne nicht im Geringsten geändert.“
„Dann hast du einen Grund, hier zu sein!“, rief sie schnell.
Er zeigte keine Anzeichen von Verärgerung, aber seine Lippen waren fest geschlossen. Sie beobachtete ihn unverwandt.
„Ich wundere mich nicht mehr über mich selbst“, fuhr sie fort. „Ich glaube nicht, dass irgendeine Frau auf der Welt jemals mit einem Mann leben könnte, für den Geheimhaltung so wichtig ist wie die Luft zum Atmen. Kein Wunder, mein lieber Henry, dass die Politiker so gut über dich sprechen und so zuversichtlich sind, was deine brillante Zukunft angeht!“
„Ich bin mir nicht bewusst“, bemerkte er ruhig, „dass ich dir gegenüber jemals übermäßig geheimnisvoll gewesen wäre. Du musst jedoch bedenken, dass du in den letzten Monaten unseres gemeinsamen Lebens beschlossen hast, eine Person, die ich als ... betrachte, als Freundin aufzunehmen.“
Ihre Augen warnten ihn plötzlich. Er senkte seine Stimme fast zu einem Flüstern. Ein Mann näherte sich ihnen.
„Als Feind“, schloss er leise.
KAPITEL II
ZUFALL ODER ABSICHT
Der Neuankömmling, der sich jetzt Hunterleys und seiner Frau vorgestellt hatte, war ein Mann mit etwas ungewöhnlichem Aussehen. Er war groß, kräftig gebaut, sein schwarzer Bart und sein kurzgeschnittenes Haar waren mit grauen Strähnen durchsetzt, er trug eine goldgerahmte Brille und hielt seinen Kopf ein wenig nach vorne geneigt, als wäre er trotz seiner Brille immer noch kurzsichtig. Er wirkte wie ein Ausländer, obwohl er ohne Akzent sprach. Er streckte etwas zögerlich seine Hand aus, was Hunterleys jedoch zu ignorieren schien.
„Mein lieber Sir Henry!“, rief er aus. „Das ist ja eine Überraschung! Monte Carlo ist wirklich der letzte Ort auf der Welt, an dem ich erwartet hätte, Ihnen zu begegnen. Und dann auch noch im Sporting Club! Na, na, na!“
Hunterleys, der locker mit den Händen hinter dem Rücken dastand, hob die Augenbrauen. Die beiden Männer waren seltsam gegensätzliche Typen. Hunterleys, schlank und vornehm, hatte trotz seiner fahlen Wangen und der müden Falten um die Augen immer noch die Statur eines Athleten. Er war äußerst schlicht gekleidet. Seine tief liegenden Augen und sein sensibler Mund standen in deutlichem Kontrast zu den gröberen Gesichtszügen und den eher vollen Lippen seines Gegenübers. Dennoch strahlten beide Männer eine gewisse Stärke aus, eine Stärke, die sich vielleicht auf unterschiedliche Weise entwickelt hatte, aber dennoch eine bemerkenswerte Eigenschaft war.
„Man sagt, die ganze Welt sei hier“, bemerkte Hunterleys. „Warum sollte ich nicht ein harmloser Teil davon sein?“
„Warum eigentlich nicht?“, stimmte Draconmeyer herzlich zu. „Selbst die Ernsthaftesten unter uns haben ihre frivolen Momente. Ich hoffe, Sie essen heute Abend mit uns? Wir werden ganz unter uns sein.“
Hunterleys schüttelte den Kopf.
„Danke“, sagte er, „ich habe schon was anderes vor.“
Mr. Draconmeyer bedauerte das höflich, wiederholte seine Einladung aber nicht.
„Wann bist du angekommen?“, fragte er.
„Vor ein paar Stunden“, antwortete Hunterleys.
„Mit der Luxe? Wie seltsam! Ich bin hinuntergegangen, um sie zu empfangen.“
„Ich bin von der anderen Seite gekommen.“
„Ah!“
Mr. Draconmeyers Ausruf war fragend, Hunterleys zögerte einen Moment. Dann fuhr er mit einem leichten Achselzucken fort.
„Ich war in San Remo und Bordighera.“
Herr Draconmeyer war sehr interessiert.
„Da haben Sie sich also versteckt“, meinte er. „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Sie einen Sechsmonatsvertrag angenommen haben. Aber finden Sie die italienische Riviera nicht etwas langweilig?“
„Ich bin im Ausland, um mich zu erholen“, antwortete Hunterleys.
Herr Draconmeyer lächelte neugierig.
„Ausruhen?“, wiederholte er. „Das passt irgendwie nicht zu deinem Ruf. Man sagt, du seist unermüdlich, selbst wenn du nicht im Amt bist.“
Hunterleys wandte sich von seinem Gesprächspartner ab und seiner Frau zu.
„Ich habe mein Glück noch nicht versucht“, meinte er. „Ich denke, ich werde mal in den Baccarat-Raum schauen. Hast du Lust, mitzukommen?“
Lady Hunterleys stand sofort auf. Herr Draconmeyer mischte sich jedoch ein. Er legte seine Hand auf Hunterleys' Arm.
„Sir Henry“, bat er, „unser Treffen kam ziemlich unerwartet, aber in gewisser Weise ist es günstig. Wären Sie so freundlich, mir fünf Minuten Ihrer Zeit zu schenken?“
„Gerne“, antwortete Hunterleys. „Ich stehe dir zur Verfügung, wenn du etwas zu sagen hast.“
Draconmeyer ging voran aus dem überfüllten Raum, den Flur entlang und in die kleine Bar. Sie fanden eine ruhige Ecke und zwei Sessel. Draconmeyer gab einem Kellner eine Bestellung auf. Für einige Momente war ihre Unterhaltung eher formell.
„Ich hoffe, du findest, dass deine Frau durch die Veränderung besser aussieht?“, begann Draconmeyer. „Ihre Gesellschaft ist eine Quelle großer Freude und Erleichterung für meine arme Frau.“
„Bezieht sich das Gespräch, das du mit mir führen möchtest, auf Lady Hunterleys?“, fragte ihr Mann leise. „Wenn ja, möchte ich vorab ein paar Worte sagen, die, wie ich hoffe, die Angelegenheit sofort aus jeder Möglichkeit eines Missverständnisses herausnehmen.“
Draconmeyer bewegte sich etwas unruhig auf seinem Platz.
„Ich habe noch andere Dinge zu sagen“, erklärte er, „aber ich würde gerne hören, was Sie im Moment denken. Ich fürchte, Sie billigen diese Freundschaft zwischen meiner Frau und Lady Hunterleys nicht.“
Hunterleys war unnachgiebig, fast schon schroff.
„Das tue ich nicht“, stimmte er zu. „Es ist Ihnen wahrscheinlich kein Geheimnis, dass meine Frau und ich uns vorübergehend entfremdet haben“, fuhr er fort. „Der Hauptgrund für diese Entfremdung ist, dass ich ihr verboten habe, Ihr Haus zu besuchen oder mit Ihnen Umgang zu haben.“
Draconmeyer war ein wenig überrascht. Mit solch einer extremen Direktheit im Gespräch war schwer umzugehen.
„Mein lieber Sir Henry“, protestierte er, „Sie machen mich traurig. Ich verstehe Ihre Haltung in dieser Angelegenheit überhaupt nicht.“
„Sie müssen das auch gar nicht verstehen“, erwiderte Hunterleys kühl. „Ich behaupte das Recht, die Besuchsliste meiner Frau zu regeln. Sie bestreitet dieses Recht.“
„Abgesehen von der Frage der ehelichen Kontrolle“, beharrte Mr. Draconmeyer, „würden Sie mir bitte sagen, warum Sie meine Frau und mich für ungeeignet halten, einen Platz unter Lady Hunterleys Bekannten einzunehmen?“
„Niemand ist verpflichtet, Gründe für seine Abneigung anzugeben“, antwortete Hunterleys. „Ich weiß nichts über Ihre Frau. Niemand weiß etwas über sie. Ich habe großes Mitgefühl für ihre unglückliche Lage, das ist alles. Sie persönlich missfallen Sie mir. Ich mag es nicht, wenn meine Frau mit Ihnen gesehen wird, ich mag es nicht, wenn ihr Name in irgendeiner Weise mit Ihrem in Verbindung gebracht wird. Ich mag es nicht, hier mit Ihnen zusammenzusitzen. Ich hoffe nur, dass das fünfminütige Gespräch, um das du gebeten hast, nicht länger dauert.“
Mr. Draconmeyer wirkte wie ein wohlwollender Mensch, der zutiefst betrübt ist.
„Sir Henry“, seufzte er, „ich kann solche deutlichen Worte nicht ignorieren. Verzeih mir, wenn ich davon ein wenig überrascht bin. Du bist als sehr geschickter Diplomat bekannt und hast viele Waffen in deinem Arsenal. Man hätte jedoch kaum erwartet – solche Offenheit verschlägt einem ein wenig den Atem.“
„Ich bin mir nicht bewusst“, sagte Hunterleys ruhig, „dass die Frage der Diplomatie ins Spiel kommen muss, wenn man nur die Absicht hat, seine persönlichen Bekanntschaften und die seiner Frau zu regeln.“
Mr. Draconmeyer saß einen Moment lang ganz still da und strich sich über seinen schwarzen Bart. Sein Blick war auf den Teppich gerichtet. Er schien mit einem Problem zu kämpfen.
„Sie haben mir den Boden unter den Füßen weggezogen“, erklärte er. „Ihre Meinung über mich ist so, dass ich zögere, überhaupt mit dem Thema fortzufahren, das ich mit Ihnen besprechen wollte.“
„Das“, antwortete Hunterleys, „müssen Sie ganz allein entscheiden. Ich bin durchaus bereit, mir alles anzuhören, was Sie zu sagen haben – umso mehr, als es nun keine Möglichkeit mehr für Missverständnisse zwischen uns geben kann.“
„Sehr gut“, stimmte Mr. Draconmeyer zu, „dann fahre ich fort. Schließlich bin ich mir nicht sicher, ob das Persönliche überhaupt eine Rolle bei dem spielt, was ich sagen wollte. Ich wollte nicht unbedingt eine Allianz vorschlagen – das wäre natürlich unmöglich –, aber ich wollte auf jeden Fall andeuten, dass wir uns gegenseitig helfen könnten.“
„In welcher Weise?“
„Ich bezeichne mich selbst als Engländer“, fuhr Herr Draconmeyer fort. „Ich habe in England viel Geld verdient und habe England und die englischen Gepflogenheiten lieben gelernt. Doch wie du weißt, komme ich ursprünglich aus Berlin. Die Position, die ich in deiner Stadt innehabe, ist immer noch die des Präsidenten der größten deutschen Bank der Welt. Ich habe die deutschen Finanzen geleitet und mit deutschem Geld mein Vermögen gemacht. Um ehrlich zu sein, fühle ich mich nach all den Jahren in London jedoch sehr als Engländer.“
Hunterleys saß vollkommen regungslos da. Sein Gesicht war starr, aber ausdruckslos. Er hörte aufmerksam zu.
„Andererseits“, fuhr Herr Draconmeyer langsam fort, „möchte ich ganz offen zu dir sein. Im Herzen werde ich immer Deutscher bleiben. Die Interessen meines Landes müssen immer an erster Stelle stehen. Aber hör zu. In Deutschland gibt es, wie du weißt, zwei Parteien, und von Jahr zu Jahr entfernen sie sich immer weiter voneinander. Ich werde nicht auf einzelne Fraktionen eingehen, sondern ganz allgemein sprechen. Es gibt die Kriegspartei und die Friedenspartei. Ich gehöre zur Friedenspartei. Ich gehöre ihr als Deutscher an, und ich gehöre ihr als treuer Freund Englands an, und sollte es zu dem drohenden Konflikt zwischen den beiden kommen, würde ich als friedliebender Deutsch-Engländer gegen die Kriegspartei sogar meines eigenen Landes Stellung beziehen.“
Hunterleys zeigte immer noch keine Regung. Doch wer ihn kannte, merkte sofort, dass er mit großem Interesse zuhörte und nachdachte.
„Bis jetzt“, sagte Draconmeyer, „habe ich meine Karten auf den Tisch gelegt. Ich habe dir die ehrliche Wahrheit gesagt. Ich bedaure, dass mir das vor vielen Monaten in London nicht eingefallen ist. Nun weiter. Ich bitte dich, meine Offenheit zu erwidern, und im Gegenzug werde ich dir Informationen geben, die es uns ermöglichen sollten, Hand in Hand für den Frieden zu arbeiten, den wir beide wollen.“
„Sie bitten mich“, sagte Hunterleys nachdenklich, „Ihnen gegenüber vollkommen offen zu sein. In welcher Hinsicht? Was erwarten Sie von mir?“
„Keine politischen Infos“, erklärte Mr. Draconmeyer und blinzelte hinter seiner Brille. „Dafür würde ich sicher nicht zu dir kommen. Ich möchte dir nur eine Frage stellen, und ich muss sie stellen, damit wir uns auf einer gemeinsamen Vertrauensbasis begegnen können. Bist du hier in Monte Carlo, um dich um deine Frau zu kümmern, oder auf der Suche nach einer Veränderung der Luft und der Umgebung? Ist das dein ehrliches Motiv, hier zu sein? Oder gibt es einen anderen Grund, der dich dazu veranlasst hat, gerade in diesem Monat – ich könnte fast sagen, gerade in dieser Woche – nach Monte Carlo zu kommen?“
Hunterleys Haltung war die eines Mannes, der ein Rätsel in der Hand hält und sich nicht sicher ist, wo er mit der Lösung beginnen soll.
„Sind Sie heute Nachmittag nicht ein wenig geheimnisvoll, Mr. Draconmeyer?“, fragte er kühl. „Oder versuchen Sie, eine vermeintliche Neugier zu wecken? Ich kann den Sinn Ihrer Frage wirklich nicht erkennen.“
„Beantworten Sie sie“, beharrte Mr. Draconmeyer.
Hunterleys nahm eine Zigarette aus seinem Etui, klopfte sie auf den Tisch und zündete sie gemächlich an.
„Wenn du denkst, dass ich hierhergekommen bin, um meine Frau zur Rede zu stellen oder mich in irgendeiner Weise in ihre Angelegenheiten einzumischen, kann ich dir versichern, dass du dich irrst. Ich hatte keine Ahnung, dass Lady Hunterleys in Monte Carlo ist. Ich bin hier, weil ich sechs Monate Urlaub habe, und ein Urlaub für den durchschnittlichen Engländer zwischen Januar und April bedeutet, wie du sicher weißt, in der Regel die Riviera. Ich habe Bordighera und San Remo ausprobiert. Ich fand sie, wie ich zweifellos auch diesen Ort finden werde, ermüdend. Am Ende werde ich wohl nach London zurückkehren.“
Mr. Draconmeyer runzelte die Stirn.
„Sie haben London“, bemerkte er knapp, „am ersten Dezember verlassen. Heute ist der zwanzigste Februar. Möchten Sie mir damit sagen, dass Sie die ganze Zeit in Bordighera und San Remo waren?“
„Woher wissen Sie, wann ich London verlassen habe?“, fragte Hunterleys.
Mr. Draconmeyer presste die Lippen zusammen.
„Ich habe ganz zufällig von deiner Abreise aus London erfahren“, sagte er. „Deine Frau hat sich aus irgendeinem Grund geweigert, über deine Reisen zu sprechen. Ich nehme an, dass sie damit deinen Wünschen entsprochen hat.“
„Ich verstehe“, sagte Hunterleys kühl. „Und jetzt willst du wissen, wo ich die Zeit verbracht habe und warum ich hier in Monte Carlo bin? Ehrlich gesagt, Mr. Draconmeyer, finde ich dieses große Interesse an meinen Plänen ziemlich unverschämt. Meine Reisen waren nicht wichtig, sondern nur meine Sache. Ich hab kein Vertrauen, um dir darüber zu erzählen. Und selbst wenn, würde ich mich nicht dir gegenüber öffnen.“
„Sie verdächtigen mich also? Sie zweifeln an meiner Integrität?“
„Überhaupt nicht“, versicherte Hunterleys seinem Fragesteller. „Soweit ich weiß, sind Sie außerhalb der Finanzwelt einer der langweiligsten und harmlosesten Menschen, die es gibt. Meine eigene Position ist einfach die, die ich Ihnen in den ersten Sätzen unseres Gesprächs erklärt habe. Ich mag Sie nicht, ich verabscheue es, dass der Name meiner Frau mit Ihrem in Verbindung gebracht wird, und aus diesem Grund bin ich umso glücklicher, je weniger ich von Ihnen sehe.“
Mr. Draconmeyer nickte nachdenklich. Er schien das Muster des Teppichs zu studieren. Zum ersten Mal in seinem Leben war er wirklich verwirrt. War der Mann neben ihm nur ein eifersüchtiger Ehemann oder hatte er eine Ahnung von dem größeren Spiel, das um sie herum gespielt wurde? War er vielleicht gekommen, um daran teilzunehmen? War es überhaupt klug, das Thema weiter zu verfolgen? Wenn er es jedoch an dieser Stelle aufgab, würde er das Gefühl haben, versagt zu haben, und Versagen war etwas, an das er nicht gewöhnt war.
„Ihre Offenheit“, gab er grimmig zu, „ist fast schon berauschend. Da unsere persönlichen Beziehungen nun so klar definiert sind, bin ich geneigt, noch weiter zu gehen, als ich ursprünglich vorhatte. Wir können uns jetzt unmöglich missverstehen. Angenommen, ich würde Ihnen sagen, dass Ihre Ankunft in Monte Carlo, auch wenn sie zufällig sein mag, in gewisser Weise günstig ist; dass Sie hier in kurzer Zeit ein oder zwei Politiker treffen könnten, Freunde von mir, mit denen ein Meinungsaustausch angenehm sein könnte? Angenommen, ich würde Ihnen meine Dienste als Vermittler anbieten? Sie möchten doch bessere Beziehungen zu meinem Land herstellen, nicht wahr, Sir Henry? Du bist zugegebenermaßen ein Staatsmann und ein einflussreicher Mann in deiner Partei. Ich bin zwar nur ein Bankier, aber ich genieße das Vertrauen derer, die das Schicksal meines Landes lenken.
Hunterleys Gesicht spiegelte nichts von der Ernsthaftigkeit seines Gegenübers wider. Er schien sogar ein wenig gelangweilt und antwortete fast gereizt.
„Ich bin dir sehr dankbar“, sagte er, „aber Monte Carlo scheint mir kaum der richtige Ort für politische Diskussionen zu sein, zumal ich kein offizielles Amt bekleide. Ich könnte keine Vertraulichkeiten entgegennehmen oder austauschen. Solange meine Partei nicht an der Macht ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Ich bin mir sicher, dass du es gut meinst, Herr Draconmeyer“, fügte er hinzu und stand auf, „aber ich bin hier, um die Politik ganz zu vergessen, wenn ich kann. Wenn du mich bitte entschuldigen würdest, ich werde mir die Baccarat-Räume ansehen.“
Er war gerade im Begriff zu gehen, als durch die offene Tür, die zu den Baccarat-Räumen führte, ein Mann mit einer auffallenden Persönlichkeit hereinkam, ein bemerkenswert dicker Mann mit kurzgeschnittenem grauen Haar, das wie Borsten auf seinem ganzen Kopf abstand; ein riesiges, glattrasiertes Gesicht, das in diesem Moment in einem überwältigenden Lächeln von überwältigender Gutmütigkeit zu konzentrieren schien. Er hielt eine kleine Französin an der Hand, dunkelhäutig, zierlich, die in ihrem schmalen, maßgeschneiderten Kostüm fast wie eine Marionette aussah. Er erkannte Draconmeyer mit Begeisterung.
„Mein Freund Draconmeyer“, rief er mit donnernder Stimme, „Baccarat ist das beste Spiel der Welt. Ich habe gewonnen – ich, der ich nichts davon verstehe, habe hundert Louis gewonnen. Es ist unglaublich! Es gibt keinen Ort auf der Welt, der diesem gleicht. Wir sind hier, um gemeinsam eine Flasche Wein zu trinken, Mademoiselle und ich, Mademoiselle, die gleichzeitig meine Lehrerin und mein Glücksbringer war. Danach gehen wir zum Juwelier. Warum nicht? Eine faire Aufteilung der Beute – fünfzig Louis für mich, fünfzig Louis für ein Armband für Mademoiselle. Und dann ...“
Er brach plötzlich ab. Seine Geste war fast dramatisch.
„Ich bin vergessen worden!“, rief er und streckte Hunterleys die Hand entgegen. „Schon vergessen! Sir Henry, es gibt viele, die mich als bescheidenen Diener meines Herrn vergessen, aber es gibt nur wenige, die mich physisch vergessen. Ich bin Selingman. Wir haben uns vor sechs Jahren in Berlin getroffen. Sie waren mit Ihrem großartigen Außenminister dort.“
„Ich erinnere mich sehr gut an Sie“, versicherte Hunterleys ihm, während er sich dem kräftigen Händedruck des Neuankömmlings unterwarf. „Wir werden uns sicher wieder sehen.“
Selingman legte seinen Arm um Hunterleys, als wolle er ihn am Gehen hindern.
„Sie werden nicht weglaufen!“, erklärte er. „Ich stelle euch beide einander vor – Herr Draconmeyer, der große anglo-deutsche Bankier; Sir Henry Hunterleys, der englische Politiker – Fräulein Estelle Nipon von der Oper. Nun kennen wir einander. Wir werden gute Freunde sein. Wir teilen uns diese Flasche Champagner.“
„Eine Flasche für vier Personen!“, lachte Mademoiselle mit einem Schmollmund. „Und ich bin total durstig! Ich habe Monsieur Baccarat beigebracht. Ich bin erschöpft.“
„Eine Magnumflasche!“, bestellte Selingman mit donnernder Stimme und schüttelte seine Faust in Richtung des erschrockenen Kellners. „Wir setzen uns hier an den runden Tisch. Mademoiselle, wir werden gemeinsam Champagner trinken, bis die Augen von uns allen so funkeln wie Ihre. Wir werden Champagner trinken, bis wir nicht mehr glauben, dass es so etwas wie Verlieren im Spiel oder im Leben gibt. Wir trinken Champagner, bis wir alle vier glauben, dass wir zusammen aufgewachsen sind, dass wir lebenslange Busenfreunde sind. Sehen Sie, so werden wir uns verhalten. Mademoiselle, wenn die anderen Ihnen Avancen machen, beachten Sie das nicht. Ich bin es, der fünfzig Louis in eine Tasche gesteckt hat, um dieses Armband zu kaufen. Vertrauen Sie Sir Henry dort nicht, er hat einen schlechten Ruf.“
Wie immer setzte sich der übermächtige Selingman durch. Weder Draconmeyer noch die Hunterleys versuchten zu fliehen. Sie nahmen ihre Plätze am Tisch ein. Sie tranken Champagner und hörten Selingman zu. Er redete die ganze Zeit, außer wenn Mademoiselle ihn unterbrach. Er saß auf einem Stuhl, der absurd unpassend wirkte, sein großer Bauch mit dem weiten weißen Weste war gut zu sehen, seine kurzen Beine waren unter ihm angezogen, und er strahlte sie alle mit einem Lächeln an, das nie nachließ.
„Es ist ein wunderbarer Ort“, erklärte er, als er zum fünften Mal sein Glas hob. „Lasst uns darauf anstoßen, auf dieses Monte Carlo. Hierher kommen Menschen aus allen Teilen der Welt – die Damen, die unsere Herzen verzaubern“, fügte er hinzu und verbeugte sich vor Mademoiselle, „die Finanziers, deren Wort die Geldmärkte der Welt erschüttern kann, und die Politiker, die sich hier in der Sonne vielleicht ein wenig entspannen, so kalt und unnachgiebig sie auch unter ihrem eigenen strengen Himmel sein mögen. Zum letzten Mal also – auf Monte Carlo! Auf Monte Carlo, liebe Mademoiselle! – Messieurs!“
Zum letzten Mal also – auf nach Monte Carlo!
Sie stießen an und ein paar Minuten später schlich sich Hunterleys davon. Die beiden Männer schauten ihm nach. Das Lächeln schien allmählich von Selingmans Lippen zu verschwinden, sein Gesicht war groß und beeindruckend.
„Hol schnell deinen Mantel, Schatz“, sagte er zu dem Mädchen.
Sie gehorchte sofort. Selingman beugte sich über den Tisch zu seinem Begleiter.
„Was macht Hunterleys hier?“, fragte er.
Draconmeyer schüttelte den Kopf.
„Wer weiß?“, antwortete er. „Vielleicht ist er gekommen, um nach seiner Frau zu sehen. Er war in Bordighera und San Remo.“
„Ist das alles, was er dir über seine Reisen erzählt hat?“
„Das ist alles“, gab Draconmeyer zu. „Er war misstrauisch. Ich bin nicht weitergekommen.“
„Bordighera und San Remo!“, murmelte Selingman leise. „Vielleicht für einen Tag oder zwei.“
„Was weißt du über ihn?“, fragte Draconmeyer, dessen Augen hinter seiner Brille plötzlich hell aufleuchteten. „Seit ich ihn vor einer Stunde getroffen habe, bin ich misstrauisch. Er hat England am 1. Dezember verlassen.“
„Das stimmt“, bestätigte Selingman. „Er reiste nach Paris und – man beachte die Gerissenheit – kehrte nach England zurück. In derselben Nacht reiste er nach Deutschland. Wir verloren ihn in Wien und fanden ihn wieder in Sofia. Was bedeutet das wohl? Was bedeutet das?“
„Ich habe mich hier zwanzig Minuten lang mit ihm unterhalten, bevor du gekommen bist“, sagte Draconmeyer. „Ich habe versucht, sein Vertrauen zu gewinnen. Er hat mir nichts erzählt. Er hat seine Reise nicht einmal erwähnt.“
Selingman saß da und trommelte mit seinen breiten Fingerspitzen auf den Tisch.
„Sofia!“, murmelte er. „Und jetzt – hier! Draconmeyer, wir haben Arbeit vor uns. Ich kenne die Menschen, das sage ich Ihnen. Ich kenne Hunterleys. Ich habe ihn vor sechs Jahren in Berlin beobachtet und ihm zugehört. Damals war er bei seinem Meister, aber er hatte nichts von ihm zu lernen. Er ist aus dem Stoff, aus dem Diplomaten gemacht sind. Er hat es im Blut. Wir haben Arbeit vor uns, Draconmeyer.“
„Wenn Monsieur bereit ist!“, warf Mademoiselle etwas gereizt ein und ließ die Spitze ihrer Boa einen Moment lang über seine Wange gleiten.
Selingman trank seinen Wein aus und stand auf. Wiederum umspielte ein Lächeln sein Gesicht. Was bedeuteten schon die Wanderungen dieses melancholischen Engländers! Es galt, das Armband der Mademoiselle zu kaufen und vielleicht ein paar Blumen. Selingman zog seine Weste herunter und nahm seinen grauen Homburg-Hut aus der Garderobe. Er hielt die Finger der Mademoiselle, als sie die Treppe hinabstiegen. Er sah aus wie ein Schuljunge von enormen Ausmaßen auf dem Weg zu einem Fest.
„Wir haben mit Champagner auf Monte Carlo getrunken“, sagte er, als sie auf die Terrasse traten und die Steinstufen hinuntergingen, „aber, liebe Estelle, wir trinken aus tiefstem Herzen darauf, mit jedem Atemzug dieser wunderbaren Luft, jedes Mal, wenn unsere Füße den federnden Boden berühren. Glaub mir, meine Kleine, alles andere ist unwichtig. Die wahre Philosophie des Lebens und des Lebens selbst liegt hier in Monte Carlo. Du und ich werden sie entschlüsseln.“
KAPITEL III
EINE WARNUNG
Die Hunterleys aßen allein an einem kleinen runden Tisch, der in einer abgelegenen Ecke des großen Restaurants des Hotel de Paris stand. Die Szene um ihn herum war farbenfroh und interessant. Eine Band in scharlachroten Uniformen spielte wunderbare Musik. Die Toiletten der Frauen, die auf ihrem Weg zu den verschiedenen Tischen hin und her gingen, waren umwerfend und auf ihre Weise einzigartig. Die Beleuchtung und die Blumen im Raum, die Einrichtung und die Dekoration – alles war der letzte Schrei in Sachen Luxus. Überall waren Farben, überall ein fast übertriebener Versuch, den Passanten zu vermitteln, dass dies kein gewöhnlicher Urlaubsort war, sondern ein riesiger Vergnügungspark für alle, die Geld zum Ausgeben und die Fähigkeit zum Genießen hatten. Nur einmal schien eine etwas düstere Note zu erklingen, als Mrs. Draconmeyer, sich auf den Arm ihres Mannes stützend und begleitet von einer Krankenschwester und Lady Hunterleys, an ihrem Tisch vorbeiging. Hunterleys Blick folgte der kleinen Gruppe, bis sie ihr Ziel erreicht und ihre Plätze eingenommen hatten. Seine Frau trug Schwarz und hatte die Perlen, die sie am Nachmittag um den Hals getragen hatte, abgelegt. Sie trug nur ein Diamantkollier, sein Geschenk. Ihre Frisur war weit weniger aufwendig und ihre Toilette weniger prunkvoll als die Toiletten der Frauen, von denen sie umgeben war. Doch als er sie von seiner Ecke aus quer durch den Raum betrachtete, wurde Hunterleys klar, wie schon vor zwölf Jahren, als er sie zum ersten Mal getroffen hatte, dass sie unvergleichlich war. Es gab keine andere Frau in diesem großen Restaurant, die eine so ruhige Eleganz ausstrahlte; keine andere Frau, die in den kleinen Details ihrer Toilette und ihrer Person so makellos war. Hunterleys beobachtete mit ausdruckslosem Gesicht, aber mit wachsender Wut in seinem Herzen, wie Draconmeyer sich zu ihr hinunterbeugte, ihre Vorschläge zum Abendessen annahm, lachte, wenn sie lachte, und fast demütig auf ihre Zufriedenheit oder Unzufriedenheit achtete. Es war ein verfluchtes Unglück, das ihn nach Monte Carlo gebracht hatte!
Hunterleys aß schnell zu Abend und ging, ohne auch nur in sein Zimmer zu gehen, um Hut und Mantel zu holen, über den Platz in der sanften Dämmerung eines ungewöhnlich warmen Februarabends und setzte sich an einen Tisch vor dem Café de Paris, wo er Kaffee bestellte. Um ihn herum war eine weitaus kosmopolitischere Menschenmenge, die von Minute zu Minute größer wurde. Es wurden alle möglichen Sprachen gesprochen, vor allem Deutsch. Normalerweise fand Hunterleys so eine Ansammlung von Menschen irgendwie interessant. Aber heute Abend waren seine Gedanken woanders. Er vergaß sein anstrengendes Leben der letzten drei Monate, die Gefahren und Unannehmlichkeiten, die er durchgemacht hatte, die seltsame Abfolge von Ereignissen, die ihn voller Vorfreude und bereit für eine Krise ausgerechnet nach Monte Carlo geführt hatte. Er vergaß, dass er sich mitten in großen Ereignissen befand, an denen er wahrscheinlich selbst beteiligt sein würde. Seine Gedanken nahmen, was für ihn eher selten war, eine rein persönliche und sentimentale Wendung. Er dachte an die ersten Tage seiner Ehe, als er und seine Frau an Frühlingsabenden wie diesen durch die Gärten seines alten Hauses in Wiltshire spazierten und manchmal leichtfertig, manchmal ernsthaft über die Zukunft sprachen. Fast so, als säße er dort inmitten dieser lärmenden Menschenmenge, konnte er den schwachen Duft von Hyazinthen aus den Rabatten, an denen sie vorbeigegangen waren, und den gepflegten Blumenbeeten, die den tiefgrünen Rasen säumten, wahrnehmen. Fast konnte er das Läuten der alten Stalluhr hören, den klaren Gesang einer Drossel. Eine Windböe brachte ihnen einen noch schwächeren Duft von den wilden Veilchen, die den Wald bedeckten. Dann umhüllte sie die Dunkelheit, und ein Stern kam zum Vorschein. Hand in Hand gingen sie zum Haus und in die Bibliothek, wo ein Holzfeuer im Kamin brannte. Seine Gedanken schweiften weiter. Eine Welle der Zärtlichkeit überkam ihn. Dann wurde er durch die Stimme des Kellners an seinem Ellbogen geweckt.
„Le café, Monsieur.“
Er setzte sich aufrecht in seinem Stuhl auf. Seine träumerischen Momente waren selten, und dieser war vorbei. Er unterdrückte die schwindenden Erinnerungen, nippte an seinem Kaffee und blickte auf die Menschenmenge. Drei- oder viermal schaute er ungeduldig auf seine Uhr. Punkt neun Uhr kam ein Mann aus der Menge hinter ihm und setzte sich auf den freien Stuhl neben ihm.
„Könnte ich Monsieur um ein Streichholz bitten?“
Hunterleys drehte sich zu dem Neuankömmling um, als er ihm seine Streichholzschachtel reichte. Es war ein junger Mann von mittlerer Größe, mit sandfarbener Haut, ein paar Sommersprossen und einem spärlichen blonden Schnurrbart. Er hatte scharfe graue Augen und einen ganz leichten schottischen Akzent. Er rückte seinen Stuhl ein wenig näher an Hunterleys heran.
„Vielen Dank“, sagte er. „Ein wunderbarer Abend, nicht wahr?“
Hunterleys nickte.
„Hast du mir was zu erzählen, David?“, fragte er.
„Wir stecken mittendrin“, antwortete der andere mit etwas leiserer Stimme. „Es gibt mehr zu erzählen, als mir lieb ist.“
„Sollen wir auf der Terrasse spazieren gehen?“, schlug Hunterleys vor.
„Bleib sitzen“, bat der junge Mann. „Du wirst hier beobachtet, und ich auch, in gewisser Weise, obwohl sie eher meine Nachrichten zensieren wollen als irgendetwas Persönliches. Diese Menge von Deutschen um uns herum, ohne einen einzigen freien Stuhl, ist die beste Barriere, die wir haben können. Hör mal. Selingman ist hier.“
„Ich habe ihn heute Nachmittag im Sporting Club gesehen“, flüsterte Hunterleys.
„Douaille wird übermorgen hier sein, wenn er nicht schon angekommen ist“, fuhr der Neuankömmling fort. „In Paris wurde bekannt gegeben, dass er nach Marseille und von dort nach Toulon fahren würde, um drei Tage mit der Flotte zu verbringen. Sie haben eine kurze Nachricht an unser Büro dort geschickt. Tatsächlich kommt er direkt hierher. Ich weiß nicht genau, wie, aber ich vermute mit dem Auto.“
„Bist du sicher, dass Douaille selbst kommt?“, fragte Hunterleys besorgt.
„Absolut! Seine Frau und seine Familie wurden nach Mentone gebracht, um einen Vorwand für seine Anwesenheit hier zu haben, falls die Zeitungen davon erfahren. Ich habe herausgefunden, dass sie sehr kurzfristig gekommen sind und überhaupt nicht damit gerechnet hatten, ihr Zuhause zu verlassen. Douaille wird die volle Macht haben, und die Konferenz wird in der Villa Mimosa stattfinden. Das wird das Hauptquartier für die ganze Sache sein ... Pass auf, Sir Henry. Sie haben uns im Blick. Der kleine Mann in Braun, der uns dicht folgt, arbeitet Hand in Hand mit der Polizei. Sie haben gestern Abend versucht, mich in einen Streit zu verwickeln. Sie verdächtigen mich nur wegen meiner journalistischen Tätigkeit, aber sie würden mich beim geringsten Vorwand über die Grenze schieben. Sie werden mit Sicherheit etwas Ähnliches mit dir versuchen, wenn sie den Eindruck gewinnen, dass wir ihnen auf der Spur sind. Bleib ruhig und beobachte die Lage. Ich gehe jetzt. Du weißt, wo du mich finden kannst.
Der junge Mann hob seinen Hut und verließ Hunterleys mit der höflichen Verabschiedung eines Fremden. Sein Platz wurde fast sofort von einem kleinen Mann in brauner Kleidung eingenommen, einem Mann mit schwarzem Kinnbart und nach oben gekräuseltem Schnurrbart. Als Hunterleys zu ihm hinüberblickte, hob er höflich seinen Hamburger Hut und lächelte.
„Ist der Freund von Monsieur schon weg?“, fragte er. „Ist dieser Platz frei?“
„Wie du siehst“, antwortete Hunterleys.