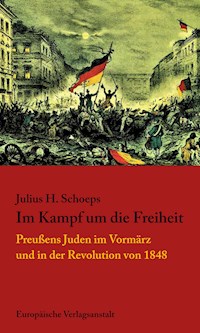9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Von dem bedeutenden jüdischen Philosophen der Aufklärung Moses Mendelssohn bis zu den großen Komponisten Felix und Fanny Mendelssohn-Bartholdy, von Dorothea Schlegel, geb. Mendelssohn, bis zu dem Wirtschaftsmagnaten Franz von Mendelssohn und dem bedeutenden Bankier und Sammler Paul von Mendelssohn-Bartholdy: Julius H. Schoeps schreibt eine so farbige wie lebendige Biographie dieser Familie und ihres Schicksals. Schoeps stellt erstmals systematisch die Familienzweige Mendelssohn dar, schildert ihre Geschichte als Bankiers und Unternehmer mit internationalem Wirkungskreis bis Russland und Estland, untersucht ihre einzigartige Rolle als Sammler und Mäzene und beschreibt den von den Nationalsozialisten erzwungenen Niedergang der Familie in bislang unbekannten Details. Dank des Zugangs zu zahlreichen bisher unveröffentlichten Dokumenten und Materialien aus Privatnachlässen und Archiven können bislang umstrittene Sachverhalte geklärt werden. Eine ausführliche Zeittafel und ein Stammbaum ergänzen dieses Standardwerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 749
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Prof. Dr. Julius H. Schoeps
Das Erbe der Mendelssohns
Biographie einer Familie
Über dieses Buch
Kaum eine deutsche Familie hat solch faszinierende Figuren - Bankiers, Denker, Kaufleute, Komponisten - hevorgebracht und unsere Kultur und Geschichte so bereichert und geprägt wie das Geschlecht der Mendelssohns: Eine große Biographie der Familie Mendelssohn, geschrieben auf der Grundlage neuen Quellenmaterials von Julius H. Schoeps, dem renommierten Historiker und Nachfahren der Mendelssohn-Bartholdys.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Die Abbildungen entstammen dem Mendelssohn-Archiv der Musikabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, mit folgenden Ausnahmen:
Abb. 3: »Moses Mendelssohns Examen …« (MMZ, Bildersammlung)
Abb. 4: Dorothea (von) Schlegel (Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz)
Abb. 20: Ernst (von) Mendelssohn-Bartholdy (Privatbesitz)
Abb. 21: Franz von Mendelssohn und Marie (Privatbesitz)
Abb. 23: Paul von Mendelssohn-Bartholdy (Privatbesitz)
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2009 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Coverabbildung: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400895-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Kapitel]
[Hauptteil]
Stammbaum
Einleitende Worte
Kapitel 1: Wie alles anfing
Mosche mi-Dessau
Die Anfänge in Berlin
Der Sokrates an der Spree
Lessing, Mendelssohn und »Nathan der Weise«
Der Philosoph und der König
»Allerliebste Fromet!«
Literaturkritik, Bibel- und Psalmenübersetzungen
Die Kontroverse mit Lavater
Im Bemühen um Toleranz und Gleichberechtigung
Mendelssohn und das deutsche Judentum
Kapitel 2: Söhne und Töchter
»Lieber Moses, Sie sehen so besorgt aus?«
Joseph Mendelssohn
Abraham Mendelssohn
Leipziger Straße Nr. 3
Nathan, der unauffälligste der Söhne
Das schwarze Schaf der Familie
Dorothea, Simon Veit, Friedrich Schlegel
Paris, Köln, Wien
Rom, die Frauenkommune und die Nazarener
Henriette »Jette« Mendelssohn
Kapitel 3: Fanny und Felix
»Meister, nicht Schüler«
Zelter und Goethe
Wilhelm Hensel und die Mendelssohns
Auf der Stufenleiter des Erfolgs
Der erste Englandaufenthalt
Im Schatten des Bruders
Auf Goethes Spuren in Italien
Rebecka, genannt »Beckchen«
Erste Anstellung in Düsseldorf
Die Heirat mit Cécile, geb. Jeanrenaud
Leipzig, Berlin und wieder Leipzig
Der Tod des Geschwisterpaares
Verdunkelter Nachruhm
Kapitel 4: Rund um Geschäft und Familie
Anfänge der Firma J & A Mendelssohn
Der »Berliner Cassen-Verein«
Prominente Privatkunden
Alexander Mendelssohn
Paul Mendelssohn-Bartholdy
Skepsis gegenüber dem Christentum, Sympathie für das Judentum
Geschäfte in Deutschland, Geschäfte mit Russland
Die Anfänge des Eisenbahnbaus
Der Geograph und der Historiker
Kapitel 5: Der Aufstieg im Kaiserreich
Kredite, Pfandbriefe und Anleihen
Franz (von) Mendelssohn
Orden und Adelsprädikate
Kaufmann, Bankier und Politiker
Testamentarische Verfügungen
Der Kirchenmusiker Arnold Mendelssohn
Von der Agfa zur IG Farben
Sebastian Hensel: Vom Landwirt zum Kaufmann
Der Familienchronist und Schriftsteller
Robert und Franz von Mendelssohn
Die gute alte Zeit
Kapitel 6: Bauherrn, Sammler und Mäzene
Die Häuser in der Jägerstraße
Stiftertätigkeit und Mäzenatentum
Die Villa Falconieri
Kunstförderung und Vereinsaktivitäten
Der Kreis um Hugo von Tschudi
Die Mendelssohns und der französische Impressionismus
Robert von Mendelssohn, Eduard Arnhold und ihre Unterstützung der Moderne
Das Rittergut Börnicke
Die Residenz im Spreebogen
Paul und Lotte von Mendelssohn-Bartholdy als Stifter und Sammler
Der Verlust der Sammlungen
Kapitel 7: Am Vorabend der Katastrophe
An der Spitze der deutschen Privatbanken
Der Fall Mannheimer
Franz von Mendelssohn
Wissenschaftspolitische Aktivitäten
Das Jubiläumsjahr 1929
Die Schauspielerin und der Bohemien
Unter dem Druck der Nazis
Paul von Mendelssohn-Bartholdy in Schwierigkeiten
Das Jahr 1935: Tod, Trauer und Vorsichtsmaßnahmen
Zwangsverkäufe von Grundstücken und Bildern
Das Ende von Mendelssohn & Co
Mehr Fragen als Antworten
Anhang
Bildteil
Abkürzungen
Zeittafel
Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Unveröffentlichte Quellen
2. Gedruckte Quellen/Kataloge/Nachschlagewerke/Bibliographien
3. Einzelstudien, Aufsatzsammlungen, Autobiographien
4. Aufsätze
Inhalt
Einleitende Worte
13
1. Kapitel
Wie alles anfing
Mosche mi-Dessau
27
Die Anfänge in Berlin
32
Der Sokrates an der Spree
39
Lessing, Mendelssohn und »Nathan der Weise«
43
Der Philosoph und der König
47
»Allerliebste Fromet!«
53
Literaturkritik, Bibel- und Psalmenübersetzungen
59
Die Kontroverse mit Lavater
63
Im Bemühen um Toleranz und Gleichberechtigung
66
Mendelssohn und das deutsche Judentum
70
2. Kapitel
Söhne und Töchter
»Lieber Moses, Sie sehen so besorgt aus?«
75
Joseph Mendelssohn
77
Abraham Mendelssohn
84
Leipziger Straße Nr. 3
91
Nathan, der unauffälligste der Söhne
95
Das schwarze Schaf der Familie
97
Dorothea, Simon Veit, Friedrich Schlegel
103
Paris, Köln, Wien
108
Rom, die Frauenkommune und die Nazarener
112
Henriette »Jette« Mendelssohn
117
Kapitel 3
Fanny und Felix
»Meister, nicht Schüler«
123
Zelter und Goethe
128
Wilhelm Hensel und die Mendelssohns
134
Auf der Stufenleiter des Erfolgs
138
Der erste Englandaufenthalt
140
Im Schatten des Bruders
143
Auf Goethes Spuren in Italien
148
Rebecka, genannt »Beckchen«
154
Erste Anstellung in Düsseldorf
156
Die Heirat mit Cécile, geb. Jeanrenaud
159
Leipzig, Berlin und wieder Leipzig
163
Der Tod des Geschwisterpaares
169
Verdunkelter Nachruhm
173
Kapitel 4
Rund um Geschäft und Familie
Anfänge der Firma J & A Mendelssohn
176
Der »Berliner Cassen-Verein«
179
Prominente Privatkunden
183
Alexander Mendelssohn
187
Paul Mendelssohn-Bartholdy
191
Skepsis gegenüber dem Christentum, Sympathie für das Judentum
195
Geschäfte in Deutschland, Geschäfte mit Russland
197
Die Anfänge des Eisenbahnbaus
199
Der Geograph und der Historiker
207
Kapitel 5
Der Aufstieg im Kaiserreich
Kredite, Pfandbriefe und Anleihen
215
Franz (von) Mendelssohn
218
Orden und Adelsprädikate
221
Kaufmann, Bankier und Politiker
225
Testamentarische Verfügungen
234
Der Kirchenmusiker Arnold Mendelssohn
236
Von der Agfa zur
IG
Farben
239
Sebastian Hensel: Vom Landwirt zum Kaufmann
242
Der Familienchronist und Schriftsteller
249
Robert und Franz von Mendelssohn
252
Die gute alte Zeit
258
Kapitel 6
Bauherrn, Sammler und Mäzene
Die Häuser in der Jägerstraße
262
Stiftertätigkeit und Mäzenatentum
266
Die Villa Falconieri
270
Kunstförderung und Vereinsaktivitäten
276
Der Kreis um Hugo von Tschudi
277
Die Mendelssohns und der französische Impressionismus
279
Robert von Mendelssohn, Eduard Arnhold und ihre Unterstützung der Moderne
283
Das Rittergut Börnicke
286
Die Residenz im Spreebogen
291
Paul und Lotte von Mendelssohn-Bartholdy als Stifter und Sammler
294
Der Verlust der Sammlungen
303
Kapitel 7
Am Vorabend der Katastrophe
An der Spitze der deutschen Privatbanken
314
Der Fall Mannheimer
317
Franz von Mendelssohn
322
Wissenschaftspolitische Aktivitäten
326
Das Jubiläumsjahr 1929
331
Die Schauspielerin und der Bohemien
335
Unter dem Druck der Nazis
342
Paul von Mendelssohn-Bartholdy in Schwierigkeiten
351
Das Jahr 1935: Tod, Trauer und Vorsichtsmaßnahmen
356
Zwangsverkäufe von Grundstücken und Bildern
365
Das Ende von Mendelssohn & Co
376
Mehr Fragen als Antworten
382
Anhang
Anmerkungen
391
Abkürzungen
435
Zeittafel
437
Quellen- und Literaturverzeichnis
449
Personenregister
476
[Hauptteil]
Eine größere Ansicht dieser Abbildung können Sie auf http://www.fischerverlage.de/sixcms/media.php/200/mendelssohnstammbaum.pdf herunterladen.
Einleitende Worte
Im Oktober 2007 lud Berlins Regierender Bürgermeister die Mendelssohn-Nachkommen ein, die Stadt ihrer Vorfahren zu besuchen. Mehr als erwartet folgten der Einladung. Rund 300 Personen reisten aus allen Teilen der Welt an; sie kamen aus den USA, aus Südamerika, Australien, der Schweiz und aus zahlreichen Städten Deutschlands. Die wenigsten kannten sich persönlich, wohl alle aber waren gespannt auf die Begegnung mit einer Verwandtschaft, von deren Existenz sie allenfalls über den gedruckt vorliegenden Stammbaum wussten.
Eine Zusammenkunft wie diese hatte es in der Familiengeschichte der Mendelssohns noch nicht gegeben. Bei einem Empfang im Roten Rathaus konnten erste Kontakte geknüpft werden, die sich im Laufe des Aufenthaltes vertieften, so auch auf dem »Weg in die Vergangenheit«, der zu den Lebens- und Arbeitsorten der Berliner Vorfahren führte.
Spuren, das war jedermann klar, würde man am ehesten auf den Friedhöfen rinden. Der Weg führte die Nachkommen deshalb zunächst in die Große Hamburger Straße, wo der Urahn Moses Mendelssohn 1786 seine Ruhestätte gefunden hatte. Der Friedhof, 1772 von Model Ries angelegt, existiert heute nicht mehr. Von den einstigen Grabsteinen steht nur noch der im Verlauf der Jahrzehnte viermal erneuerte Grabstein des großen Weltweisen Moses Mendelssohn, dem Verehrer ihre Reverenz erweisen, indem sie gemäß altem jüdischem Brauch kleine Steinchen auf der Grabsteinumrandung ablegen.
Die Reise in die Vergangenheit führte die Nachkommen weiter zum alten jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee, wo Joseph, der im Judentum verbliebene älteste Sohn Moses Mendelssohns, an der Rückmauer des 1827 eröffneten Friedhofs im Jahr 1848 begraben wurde. Bestattet sind dort auch seine Frau Henriette, geb. Meyer (1862), sein Sohn Alexander (1871) und seine Schwiegertochter Marianne, geb. Seeligmann. Im Beer'schen Familiengrab, an der Seitenmauer des Friedhofs gelegen, liegt seit 1850 Rebecka (Betty) Beer begraben. Die Enkelin Moses Mendelssohns war mit einem Bruder des Komponisten Giacomo Meyerbeer verheiratet.
Auf dem Friedhof sammelten sich die Gäste des Familientreffens vor vier schwarz verhüllten Steinen. Der Berliner Staatssekretär Andre Schmitz und eine Mendelssohn-Nachkommin enthüllten die Steine, und Andreas Nachama, der Berliner Rabbiner, rezitierte ein Gedicht, das Joseph zum 72. Geburtstag gewidmet worden war:
Steigt hinaus des Menschen Leben
Ist's vergleichbar dem Mittagstraum.
Nur des Weisen seelenvolles Streben
Dehnt zur Ewigkeit den engen Raum!
Wer stets hascht nach Tand und eitlen Dingen,
Nie bewegt und regt die Geistesschwingen
Bleibt vom wahren Lebensziele weit,
wirkt und schafft nur für die Spannezeit.[1]
Eine ganze Reihe getaufter Mendelssohns liegt auf dem Evangelischen Dreifaltigkeitsfriedhof am Halleschen Tor in Berlin. In Ehrengräbern ruhen hier nicht nur Abraham Mendelsohn Bartholdy (1835) samt seiner Ehefrau Lea, geb. Salomon (1842), sondern auch deren Kinder, die Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy (1847) und Fanny Hensel (1847), Letztere gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Maler Wilhelm Hensel (1861), und dem gemeinsamen Sohn, Sebastian Hensel (1898). Die Gräberreihen abschreitend, stellt der Besucher des Friedhofs fest, dass auch Felix' Bruder, der Bankier Paul Mendelssohn-Bartholdy (1874) sowie Franz (von) Mendelssohn (1889), der erste nobilitierte Mendelssohn, und einige seiner Nachkommen auf diesem Friedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.
Nicht weit außerhalb der Berliner Stadtgrenzen befinden sich die Gräber von Ernst (von) Mendelssohn-Bartholdy (1909), seiner Ehefrau Marie, geb. Warschauer (1906), sowie deren gemeinsamem Sohn Paul von Mendelssohn-Bartholdy (1935). Sie wurden auf dem Friedhof an der Dorfkirche in Börnicke bei Bernau bestattet. Die Grabsteine sind zwar kürzlich restauriert worden, aber der Eindruck drängt sich auf, dass sich niemand mehr wirklich um das Erbe der Mendelssohn-Bartholdys kümmert. Die Zeit scheint über alles hinweggegangen zu sein.
Das Schloss, auf dessen Gelände sich die Dorfkirche samt Friedhof befindet, macht einen unwirtlichen Eindruck. Es wird dem Besucher nicht leichtgemacht, Spuren zu erkennen, die etwas über die ehemaligen Besitzer und ihren Lebensstil aussagen. Das Haus ist verfallen, die prachtvolle einstige Innengestaltung nur noch in Ansätzen erkennbar, und von den kostbaren Möbeln, mit denen die Räume ausgestattet waren, sowie von den Bildern, die an den Wänden hingen, wissen wir nur noch durch Fotografien und versteckte Hinweise in der Literatur.
Die Ruine mit ihren vernagelten Fenstern erweckt den Eindruck trostloser Verlassenheit. Den Besucher, der bemüht ist, sich ein Bild von dem Einst und dem Jetzt zu machen, erfüllt das, was er zu sehen bekommt, mit einem Gefühl tiefer Traurigkeit. Die Trümmerreste und die heruntergekommene Parkanlage, vor denen er steht, lassen für ihn keinen anderen Schluss zu, als dass er Zeuge eines in diesen Tagen unwiderruflich zu Ende gegangenen Kapitels deutsch-jüdischer Kultur ist.
Auch in Berlin sind es nur noch wenige Gebäude und Orte, die an die einstige Präsenz der Mendelssohns in der Stadt erinnern. Das dreiflügelige Palais in der Alsenstraße wurde in der NS-Zeit abgerissen. Das Terrain – neben dem neuen Bundeskanzleramt und der Schweizer Botschaft – ist bis heute unbebaut und wird es wohl auch bleiben. Die Häuser in der Jägerstraße, in denen die Mendelssohns mehr als hundert Jahre residierten, stehen zwar noch, sind aber nicht mehr im Besitz der Familie.
In dem aufwendig restaurierten Gebäude Nummer 49/50, das 1939 mit der Liquidation der Bank zunächst an das Deutsche Reich gefallen war, hat heute die »Bundesvereinigung der deutschen Apothekerverbände« ihren Sitz. Die Häuser mit den Nummern 52 und 53 wurden 1913 beziehungsweise 1938 verkauft. Das Haus Nummer 53, in den Jahren 1882 bis 1884 errichtet, hatte Ernst (von) Mendelssohn-Bartholdy sich als sein Domizil gewählt. Heute stehen auf diesen Grundstücken Gebäude, in denen unter anderem die Belgische Botschaft untergebracht ist.
Dass in der Jägerstraße einst der Sitz des Mendelssohn'schen Bankhauses war, weiß heute kaum noch jemand. Die Tafeln auf der Straße informieren zwar über die Geschichte der Gebäude und seiner Bewohner, für den interessierten Passanten, der die Tafeln studiert, bleibt dennoch die Frage offen, warum die Familie Mendelssohn nichts mehr mit ihrem einstigen Besitz zu tun hat. In Berlin, der Stadt, deren Bild sie einst mitgeprägt und zu deren Prosperität sie maßgeblich beigetragen haben, sind die Mendelssohns nur noch Teil einer vergessenen Geschichte.
Eine Ausnahme ist das Hinterhaus des Jägerstraßen-Anwesens Nummer 51. Dort, in der sogenannten Remise, befindet sich heute die von ehrenamtlichen Mitarbeitern konzipierte Dauerausstellung »Die Mendelssohns in der Jägerstraße«. Der Besucher steht dort vor den Porträts von Familienmitgliedern, der Büste Moses Mendelssohns, aber auch derjenigen anderer Berühmtheiten, die in den Häusern der Mendelssohns verkehrten: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Christian Daniel Rauch, Alexander von Humboldt, Clara Schumann.
Die im Oktober 2007 nach Berlin angereisten Mendelssohn-Nachkommen standen vor den Vitrinen, studierten die ausgestellten Dokumente, stellten Fragen und fotografierten sich gegenseitig vor den Porträts ihrer Vorfahren. Der Höhepunkt des Besuchs in der Remise war die szenische Uraufführung eines Singspielfragments des dreizehnjährigen Felix Mendelssohn Bartholdy, ein Erlebnis, das wohl alle Familienmitglieder gleichermaßen begeistert hat.
In den Gesprächen, die am Rande der Aufführung in der Remise geführt wurden, gab es eine Reihe erheiternder Szenen. Ein angereister Achtzigjähriger beispielsweise beugte sich zu einem Zweiundachtzigjährigen herunter, der vor ihm auf einem Stuhl saß, und raunte diesem zu: »Jemand meint, wir würden uns ähnlich sehen.« Der Angesprochene wandte sich um, schaute den zwei Jahre Jüngeren freundlich-nachsichtig an und erwiderte: »Sind Sie von uns oder angeheiratet?«
Die Stadt Berlin und die Bundesrepublik Deutschland bemühen sich heute zwar, so gut sie können, um die Pflege des Mendelssohn'schen Erbes. Doch diesen Bemühungen sind enge Grenzen gesetzt, denn nur noch wenig erinnert an die einst so präsente Familie. In der NS-Zeit wurden nicht nur Sachwerte zerstört, sondern auch das ideelle Erbe einer Familie beschädigt, die so eng mit der Geschichte Berlins der letzten 250 Jahre verknüpft ist wie kaum eine andere.
Eine Ahnung von der einstigen glanzvollen Präsenz der Mendelssohns in Berlin vermittelt eine liebevoll zusammengestellte Ausstellung in der Berliner Staatsbibliothek, die Porträtgemälde von Moses bis Franz (von) Mendelssohn sowie Autographe und Graphiken aus den Sammlungen des Mendelssohn-Archivs präsentiert. Die Bestände des Archivs, das auf eine Stiftung Hugo von Mendelssohn Bartholdys (1894–1975) zurückgeht, werden durch regelmäßige Ankäufe der Staatsbibliothek und durch Leihgaben der von Cécile Lowenthal-Hensel, einer Mendelssohn-Nachkommin, gegründeten Mendelssohn-Gesellschaft ergänzt.
Abgesehen von der Ausstellung und dem Archiv in der Staatsbibliothek, in dem das Mendelssohn-Erbe heute gehütet wird, weist kaum noch etwas auf die einstige Gegenwart der Familie in Berlin und seinem Umland hin – allenfalls sind es Erinnerungszitate oder nachträgliche Verbeugungen wie das nach Moses Mendelssohn benannte Forschungszentrum in Potsdam, die Moses Mendelssohn Gesellschaft in Berlin, der U-Bahnhof Mendelssohn-Bartholdy-Park oder der von der Stadt seit 1980 alle zwei Jahre verliehene Moses-Mendelssohn-Preis.
Mit diesem Preis ehrt der Berliner Senat Personen, Gruppen und Institutionen, die sich besondere Verdienste auf geistig-literarischem oder religiös-philosophischem Gebiet zur Verwirklichung und Förderung der Toleranz gegenüber Andersdenkenden erworben oder durch ihre Aktivitäten zur Völkerverständigung beigetragen haben. Der Preis wurde 1979 anlässlich des 250. Geburtstags von Moses Mendelssohn gestiftet und wird alle zwei Jahre verliehen. Bisherige Preisträger sind unter anderem Eva G Reichmann (1982), Sir Yehudi Menuhin (1986) und Teddy Kollek (1990).
Aber es gibt nicht nur den Berliner Preis, sondern auch eine Medaille, die seit 1993 im Gedenken an Moses Mendelssohn verliehen wird, und zwar an Persönlichkeiten, die sich im Sinne und in der Tradition der Gedanken von Moses Mendelssohn für Toleranz und Völkerverständigung engagieren. Die Medaille, gestiftet vom Potsdamer Moses Mendelssohn Zentrum, wurde bisher an die folgenden Persönlichkeiten vergeben: Manfred Stolpe (1994), Ignatz Bubis (1994), Ernst Benda (1995), Kurt Biedenkopf (1998), Arno Lustiger (1999), Ari Rath (2002), Manfred Lahnstein (2006), Charlotte Knobloch (2008) und Daniel Barenboim (2009).
Auch die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) hat sich dem Gedenken an die Mendelssohns nicht entzogen. Im neu gebauten Ludwig Erhard Haus in der Fasanenstraße, in dem die IHK residiert, wurde 1999 ein Saal nach dem langjährigen Präsidenten der IHK Franz von Mendelssohn benannt. In einer öffentlichen Verlautbarung zur Einweihung des Saales bekannte sich die Berliner IHK zu ihrer historischen Verantwortung und erklärte, dass sie einen »unrühmlichen Anteil« an den Geschehnissen in den NS-Jahren gehabt habe.
Nicht gänzlich in Vergessenheit geraten ist Felix Mendelssohn Bartholdy. Seine Musik erfuhr eine Wiederentdeckung, auch wenn bis in die Nachkriegszeit hinein Richard Wagners antisemitische Hetze die Rezeptionsgeschichte beeinflusst und den Blick auf den Komponisten verstellt hat. Noch 1959 erklärte der Musikschriftsteller Heinrich Eduard Jacobs: »Die Musik Felix Mendelssohns ist keines natürlichen Todes gestorben. Sie wurde ermordet!« Inwieweit das heute noch zutrifft, darüber kann man streiten. Vorbehalte, wenn auch abnehmend, gegenüber Felix Mendelssohn Bartholdy und seiner Musik gibt es nach wie vor.
Allerdings, und das ist erfreulich, gibt es gegenwärtig sogar so etwas wie eine Mendelssohn-Renaissance in Deutschland. So wird nicht nur an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften seit 1992 die »Leipziger Ausgabe der Werke Felix Mendelssohn Bartholdys« erarbeitet, sondern seine Musik ist auch wieder in die Konzertsäle zurückgekehrt. Eines seiner Frühwerke, die Ouvertüre zum Sommernachtstraum beispielsweise, stößt wieder auf ein verstärktes Interesse ebenso wie das Oratorium Elias, das unbestritten zu den wichtigsten Kompositionen der traditionellen Kirchenmusik gehört; sein Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello (op. 49) ist heute eines der meistgespielten Werke der Kammermusik.
Doch abgesehen von diesen Gedenkaktivitäten muss eingestanden werden, dass es nach wie vor Probleme gibt. Einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt beispielsweise der Umstand, dass man es verabsäumt oder nicht für nötig erachtet, jenes Unrecht, das den Mendelssohn-Bartholdys in der Nazi-Zeit und unmittelbar nach 1945 widerfahren ist, zu korrigieren. Als die Mendelssohn-Bartholdy-Erben nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten in den neunziger Jahren auf die Rückgabe des einst Paul von Mendelssohn-Bartholdy und der Familie gehörenden Rittergutes Börnicke drängten, wurde ihnen das unter fadenscheinigen Vorwänden verweigert.
Die zuständigen Ämter nutzten dabei jedes Mittel, um die mögliche Rückgabe des Schlosses zu hintertreiben. Das Gebäude und das dazugehörige Gelände mit Wiesen, Äckern und Wäldern wurden als »junkerlicher« Großgrundbesitz eingestuft, womit das Anwesen der Mendelssohn-Bartholdys unter die Bodenreformmaßnahmen der SBZ in den Jahren 1945–48 fiel. Eine Rückgabe des Schlosses war damit ausgeschlossen. Auch der von den Erben angeführte Beleg, dass es sich nicht um »junkerlichen«, sondern um »jüdischen« und zudem auch noch um zu restituierenden ausländischen Besitz handele, hatte auf die Bewertung des Falles keinerlei Auswirkungen.[2]
Die angerufenen Gerichte folgten den politischen Vorgaben und waren nicht bereit, die Argumente der Mendelssohn-Bartholdy-Erben auch nur im Ansatz zu prüfen, geschweige denn eine Entscheidung zugunsten der Erbengemeinschaft zu fällen. Die am Prozesstag, dem 18. März 1999, in Frankfurt an der Oder anwesenden Familienangehörigen mussten sich anhören, wie ihr Antrag mit nicht nachvollziehbaren Begründungen abgewiesen wurde.
Zutiefst geschockt durch das Urteil, verließen sie den Gerichtssaal zwar erhobenen Hauptes, aber mit der bitteren Erkenntnis, dass das vereinte Deutschland nur bedingt bereit ist, in den Jahren der NS-Herrschaft begangenes Unrecht zu korrigieren. Auch die Medien, die den Prozess begleitet hatten, verzichteten darauf, das Urteil kritisch zu kommentieren.
Charlotte Busch, die Nichte Paul von Mendelssohn-Bartholdys und eine der Erbinnen des Schlosses Börnicke, die nach Versteck und Untergrund in Italien seit Ende der fünfziger Jahre unter sehr beschränkten Umständen als Staatenlose mit einem Nansen-Pass in Paris lebte und 1992 starb, lachte nur, als sie von den Bemühungen hörte, den Familienbesitz zurückerstattet zu bekommen. Dafür, so Charlotte Busch, kenne sie die Deutschen zu gut. Niemals würden diese eine einmal erbeutete Immobilie, ein Grundstück oder ein Kunstwerk, das sie in ihren Besitz gebracht hätten, freiwillig herausgeben.
Die Mendelssohn-Nachkommen sehen es trotz solcher Erfahrungen gewissermaßen als persönliche Verpflichtung an, ihre Ansprüche geltend zu machen. Das Rad der Geschichte können sie nicht zurückdrehen, aber sie können zur Klärung bestimmter Sachverhalte beitragen. Dazu gehören nicht nur historische Recherchen zur Frage, wie und warum es zum Niedergang der Familie in den dreißiger Jahren kam, sondern eben auch das Anmelden von Restitutionsansprüchen im vereinten Deutschland und in anderen Ländern.
Die Attacken, die solche Restitutionsansprüche häufig auslösen, werfen Fragen auf. So beispielsweise, wenn vorwurfsvoll geäußert wird: Warum melden sich die Erben erst jetzt? Ist es nicht reine Geldgier, die sie treibt? Die Kritiker sehen nicht ein oder unterschlagen bewusst, dass viele Verfolgte, so sie überhaupt mit dem Leben davonkamen, nach 1945 anderes zu tun hatten, als Immobilien, Bankkonten und Kunstwerken nachzuforschen. Sie waren mit dem alltäglichen Überleben beschäftigt. Viele wollten auch schlicht und einfach vergessen.
Dieses Buch führt auf eine Reise durch mehr als 250 Jahre und sechs Generationen Familiengeschichte, auf der wir immer wieder Paul von Mendelssohn-Bartholdy begegnen. Er war eine späte Schlüsselfigur des Clans und – typisch Mendelssohn – ein Traditionsbewahrer. In seinen künstlerischen Neigungen hingegen war er ein Aufbrechender, der Zukunft Zugewandter.
Wie wir heute wissen, war Paul von Mendelssohn-Bartholdy ein experimentierfreudiger Sammler Picassos, van Goghs, Rousseaus, Cézannes, Degas', Toulouse-Lautrecs, allesamt von der Mehrheit der Bevölkerung damals, wenn überhaupt, skeptisch wahrgenommene Künstler. Als er im Mai 1935 unter ungeklärten Umständen starb, war Paul von Mendelssohn-Bartholdy knapp sechzig Jahre alt. Im Spätherbst desselben Jahres erließen die Nationalsozialisten die Nürnberger Rassegesetze.
Das vom NS-Staat erzwungene Ende der Familie Mendelssohn als bedeutende bürgerliche Dynastie Deutschlands ist mein Ausgangspunkt, um über die klassische Familienbiographie hinaus die Rolle der Mendelssohns in der deutschen Geschichte zu beschreiben und zu deuten. Als preußische Patrioten, Eliten der Wirtschaft, Gelehrte, gefeierte Künstler, Mäzene und Sammler, Vermittler zwischen Deutsch- und Judentum. Als mit Talenten überdurchschnittlich gesegnete Großfamilie. Als Menschen mit Ecken und Kanten.
Wesentlich erschien es mir, in diesem Zusammenhang auch zu ergründen, warum der Familienzweig nach Joseph Mendelssohn sich so anders entwickelte als der nach seinem jüngeren Bruder Abraham Mendelssohn Bartholdy. Ich nahm mir vor, die Charakteristika der beiden Zweige herauszuarbeiten, die über die männlichen Nachkommen mit der gemeinsamen Bank verbunden waren und über die Generationenabfolge Kontakt zueinander hielten.
Zwischenzeitlich veröffentlichte, maßgeblich ergänzt um unpublizierte, von mir ausgewertete Korrespondenzen belegen, dass die Familienflügel sich zwar zusehends auseinanderentwickelten, sich jedoch stets zu ihrer Tradition bekannten. Das Andenken an ihren Ahnherrn Moses Mendelssohn war neben dem Bankhaus Mendelssohn & Co die Klammer, die die Familie über Generationen verband.
Familiensprecher waren in der Regel die jeweiligen Bankchefs. Jeweils ein Mendelssohn und ein Mendelssohn(-)Bartholdy teilten sich die Führung der Bank – das regelte ein verbindlicher, wenn auch niemals schriftlich festgehaltener Familienkodex, der auch besagte, dass die jeweiligen Familiensprecher in finanzielle Schwierigkeiten geratene Verwandte zu unterstützen hatten.
Die bisher vorliegenden Familienbiographien von Sebastian Hensel über Herbert Kupferberg und Eckhard Kiessmann bis hin zu Thomas Lackmann haben, schon aufgrund der Quellenlage, ihre Schwerpunkte auf die frühen Jahre der Familiengeschichte gesetzt. Erst in jüngster Zeit ist es durch neue Quellenfunde möglich geworden, bestimmte Entwicklungslinien von Moses Mendelssohn über dessen Söhne und Enkel – unter ihnen der natürlich hinreichend beleuchtete Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy – bis in unsere Gegenwart zu ziehen.
Dass es dazu kam, verdanken wir insbesondere dem Unternehmenshistoriker Wilhelm Treue, der in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Anstoß zu weiteren Studien gab, hauptsächlich zu solchen, die sich mit der Geschichte der Mendelssohns als Bankiers und Unternehmer befassen. In welchem Radius sie operierten, ist jedoch noch zu klären. Waren ihre Aktivitäten nur auf Berlin und Preußen beschränkt, oder beeinflussten sie die gesamteuropäische Wirtschaft?
Vergleichsweise wenig wussten wir trotz Thomas Lackmanns wichtiger Bemühungen bisher auch über die Mäzenaten- und Sammlertätigkeit der Mendelssohns. Wann und unter welchen Umständen begannen sie, ihre Kunstsammlungen zusammenzutragen, von wem ließen sie sich dabei beraten, wann wurde daraus eine Leidenschaft? Was oder wen haben sie vorzugsweise mäzenatisch unterstützt? Und inwiefern hängt dies mit ihrem spezifischen deutsch-jüdischen Erbe zusammen?
Wer heute den Spuren der Mendelssohns nachgeht und ihren Ort in der deutsch-jüdischen Geschichte zu bestimmen versucht, ist in hohem Maße auf die im Auftrag der Berliner Mendelssohn-Gesellschaft herausgegebenen Mendelssohn-Studien angewiesen. Die seit 1972 veröffentlichten, bisher 16 Sammelbände enthalten wichtige wissenschaftliche Aufsätze, Briefe und Miszellen zur Familiengeschichte. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dem Bild der Mendelssohns schärfere Konturen zu verleihen, auch wenn sie sich in aller Regel in Seitenaspekte der Familiengeschichte vertiefen und die großen, vergleichenden Linien erst noch zu ziehen sind.
Den roten Faden im Familiendickicht der Mendelssohns zu finden und unterwegs nicht zu verlieren, ist nach wie vor die große Herausforderung an den Biographen. Er ist mit Puzzlesteinen konfrontiert, die ein hübsches, bunt gefärbtes Mosaik aus Geschichten und Geschichtchen, aber kein zusammenhängendes Bild ergeben. Stets sind es dieselben Familienmitglieder, um die diese Geschichten kreisen, Moses Mendelssohns Söhne Joseph und Abraham und deren Nachkommen.
Andere, wie etwa Moses' jüngster Sohn Nathan, den die Forschung in den vergangen drei Jahrzehnten langsam zu beachten begonnen hat, tauchen in den Darstellungen nach wie vor nur als Randfiguren auf. Das Interesse an den Frauen der Familie wie etwa Dorothea Mendelssohn und ihrer Nichte Fanny Mendelssohn Bartholdy ist überhaupt erst mit dem Siegeszug der Gender Studies richtig erwacht. Zahlreiche Arbeiten haben die Familiengeschichte inzwischen um wertvolle Facetten bereichert.
Wer den Spuren der Mendelssohns nachgeht, muss zudem durch die Verwandten-Ehen zu blicken lernen, die in der Familie eher die Regel als die Ausnahme waren. Jüdische Familien wie die Mendelssohns, Itzigs, Warschauers oder Wachs, die sich im 19. Jahrhundert hatten taufen lassen und sich familienintern unterschiedlich vehement dem Christentum zuwandten, zogen es schon aufgrund der äußeren Umstände vor, ja sahen sich gezwungen, »unter sich« zu bleiben. Sie lebten in einer Art Zwischenwelt, einer Welt zwischen Judentum und Christentum, einer Welt des Weder-Noch, einer Welt, die es für einen getauften Juden schwierig machte, sich zurechtzufinden.
Hinzu kommt, als weitere Herausforderung an den Biographen und den interessierten Leser gleichermaßen, das Mendelssohn-spezifische Namensphänomen: Jene Familienmitglieder, die sich von Joseph (1770–1848) und dessen jüngerem Bruder Nathan (1781–1852) ableiteten, nannten sich Mendelssohn – ohne Beinamen. Nach der Nobilitierung stellten einige Nachkommen Josephs ihrem Nachnamen ein »von« voran.
Josephs Bruder Abraham (1776–1835) begründete hingegen die Linie Mendelssohn Bartholdy. Er nahm, um sich als getaufter Mendelssohn möglichst deutlich von den jüdischen Verwandten abzugrenzen, den Namen seines Schwagers an.
Abrahams beide Söhne verkomplizierten die Namensfrage zusätzlich. Während der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy und seine Nachfahren ihren Doppelnamen ohne Bindestrich führten, entschied Felix' Bruder, der Bankier Paul, sich, um Verwechslungen zu vermeiden, für die Variante mit Bindestrich.
Dass es trotzdem häufig zur Verwechslung einzelner Familienmitglieder kommt, hat mit der Vorliebe beider Familienflügel für einige wenige Vornamen zu tun, die von Generation zu Generation weitergereicht wurden, etwa Franz, Paul, Robert oder Arnold und für die weiblichen Nachkommen Marie, Margarete oder Cécilie. Als Orientierungshilfe für den Leser habe ich dem Buch deshalb einen Stammbaum beigefügt, der die Generationenfolge der Mendelssohns berücksichtigt und Verwandtschaftsverhältnisse veranschaulicht.
Paul von Mendelssohn-Bartholdy, der Enkel Pauls, Ur-Enkel Abrahams und Ur-Ur-Enkel Moses Mendelssohns, nicht nur Bankier, sondern heute zunehmend auch als Mäzen und Kunstsammler entdeckt, verstand sich zeit seines Lebens als Berliner, Preuße und Deutscher. Selbst in den Jahren der NS-Verfolgung sah er Deutschland als seine Heimat an. Der Gedanke, dass man ihn, einen Mendelssohn, ächten würde, war für ihn nicht nachvollziehbar. Denn der Name Mendelssohn schien ihm gleichbedeutend mit dem Deutschland der Vernunft, der Toleranz und Kultur. Mit dem Deutschland Hitlers konnte er nur wenig anfangen.
Es gibt nur wenige Bilder von Paul von Mendelssohn-Bartholdy. Sieht man sich diese an, erkennt man die Ähnlichkeit mit seinem großen Vorfahren. Augen und Nasenpartie, die Kopfform erinnern an diesen. Als Max Liebermann 1909 den Auftrag erhielt, ein Porträt Paul von Mendelssohn-Bartholdys anzufertigen, wird er bei den Sitzungen für das Bild Moses Mendelssohn vor seinem geistigen Auge gesehen haben. Ob er sich mit Paul von Mendelssohn-Bartholdy über seinen Vorfahren unterhalten hat? Wir wissen es nicht.
Das Liebermann-Porträt ist heute verschollen. Es hatte zuletzt in einem der Zimmer des Paul von Mendelssohn-Bartholdy gehörenden Rittergutes Börnicke gehangen. Höchstwahrscheinlich ging das Gemälde verloren, als Einheiten der Roten Armee sich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges in Börnicke einquartierten. Es könnte sein, dass das Bild damals zusammen mit Möbeln und anderen wertvollen Einrichtungsgegenständen in die Sowjetunion verbracht wurde. Möglich auch, dass es Plünderungen der Bevölkerung zum Opfer fiel. Noch heute könnte es in einem der Häuser in oder um Börnicke an der Wand hängen. Gerüchte dieser Art halten sich in der Gegend hartnäckig.
Schon als junger Mann fühlte ich mich von der Persönlichkeit und der Weisheit Moses Mendelssohns stark angezogen. Zu meiner Bar-Mizwa hatte mein Vater mir Sebastian Hensels berühmte »Geschichte der Mendelssohns« überreicht. Ich weiß noch, dass ich die beiden Bände, mit blauen Leineneinbänden versehen und mit Goldlettern bedruckt, geradezu verschlang. Sie haben mich durch mein bisheriges Leben begleitet. Ab und zu nehme ich sie zur Hand, um das eine oder andere in ihnen nachzuschlagen oder einfach darin zu blättern.
Mein Vater war es auch, der mich als Erster auf einen Stammbucheintrag des Berliner Weltweisen Moses Mendelssohn aufmerksam machte. »Wahrheit erkennen, / Schönheit lieben, / Gutes wollen, / das Beste tun« nannte der Ahnherr unserer Familie die »Bestimmung des Menschen«. Wenn die Mendelssohns eine gemeinsame Maxime hatten, dann war es diese im 18. Jahrhundert formulierte Lebensweisheit. Die Nachkommen des Berliner Philosophen haben sie verinnerlicht. Wer sein Tun und Handeln an dieser Einsicht orientiere, sagte man sich noch nach Generationen, könne nicht schlecht fahren.
Bei der Arbeit an diesem Buch konnte ich mich auf eine Reihe eigener Vorarbeiten stützen, etwa auf eine bewusst populär gehaltene Moses-Mendelssohn-Biographie, die ich vor etwa dreißig Jahren anlässlich des 250. Geburtstags des Ahnherrn schrieb, sowie eine Reihe von Einzelstudien, die sich mit bisher vernachlässigten Aspekten der Geschichte der Mendelssohns, vor allem mit dem Niedergang ihres Bankhauses in der Zeit des Nationalsozialismus, befassten.
Für die vorliegende Darstellung wurden Dokumente, Briefe sowie verschiedene Materialien aus zahlreichen Archiven (siehe Quellen- und Literaturverzeichnis) durchgesehen und ausgewertet. Es haben sich dabei manche neuen Erkenntnisse ergeben, die der Mendelssohn-Forschung bisher nicht bekannt gewesen sind. So konnten beispielsweise, was die Stiftungs- und Sammlungstätigkeit der Mendelssohns betrifft, umstrittene Sachverhalte geklärt und eine Reihe falscher Provenienzzuschreibungen korrigiert werden. Eine große Hilfe dabei war, dass Materialien aus Privatbesitz zur Verfügung gestellt wurden und eingesehen werden konnten.
An dieser Stelle bleibt mir nur noch übrig, mich bei all denen zu bedanken, die mich beim Schreiben des Buches mit Rat und Tat begleitet und unterstützt haben. Zuallererst gilt mein Dank Sebastian Panwitz, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Moses Mendelssohn Zentrum, der bereit war, seine Kenntnisse über die Mendelssohns mit mir zu teilen, und der mich an den Ergebnissen seiner Recherchen in den diversen Archiven teilhaben ließ. Ihm verdanke ich, dass ich bestimmte Sachverhalte verstehen konnte, die ich bis dahin missverstanden oder falsch interpretiert hatte.
Anna D Ludewig und Beatrix Borchardt, beide exzellente Kennerinnen der deutschen Musikgeschichte, diskutierten mit mir nicht nur Probleme der Rezeption Fanny und Felix Mendelssohn Bartholdys, sondern auch das Schicksal der Stradivari-Geigen. Diese Instrumente befanden sich einst im Besitz der Mendelssohns. Ihr weiteres Schicksal hat meine Phantasie beflügelt.
Christoph Kreutzmüller, Spezialist für die Frühjahre des NS-Regimes, gab wichtige Hinweise zur wirtschaftlichen Situation von Paul von Mendelssohn-Bartoldy in den Jahren 1933 bis 1935. Und von Thomas Blubacher erhielt ich weiterführende Hinweise zu dem Geschwisterpaar Eleonora und Francesco von Mendelssohn, die im Berliner Leben der Weimarer Republik feste Größen waren und um die sich bis heute manche seltsame Gerüchte ranken.
Michael Graf Strasoldo führte mich in zahlreichen Gesprächen in manches für den Laien unverständliche Geheimnis des Bankengeschäftes ein, was mich davor behütete, in dem einen oder anderen Fall falschen Fährten zu folgen. Mit Bogomila Welsh-Ocharov, der ich wegen manches Hinweises zu großem Dank verpflichtet bin, führte ich stundenlange Telefongespräche, in denen ich lernte, dass manche Zusammenhänge in der Familiengeschichte sehr viel komplizierter sind, als ich zunächst annahm.
Dank gilt neben den beiden Bibliothekarinnen des Potsdamer Moses Mendelssohn Zentrums, Karin Bürger und Ursula Wallmeier, die bei der Literaturrecherche halfen und manche Probleme mit bibliothekarischem Sachverstand zu lösen hatten, vor allem auch Kurt Blank-Markard, der die Bildstrecke zusammenstellte und den Stammbaum zeichnete.
Ganz zum Schluss möchte ich mich bei all denen bedanken, denen ich Teile des Manuskriptes zum Lesen gab und die mir hilfreich zur Seite standen. Dazu gehört vor allem meine Frau, deren Anregungen und Ratschläge mir bei der Arbeit sehr geholfen haben.
Eine letzte Bemerkung: Irrtümer im Urteil oder im Tatsächlichen, das sei hier ausdrücklich vermerkt, gehen nicht zu Lasten anderer, sondern nur zu meinen Lasten.
Julius H Schoeps
Berlin-Charlottenburg
Frühjahr 2009
Kapitel 1Wie alles anfing
Mosche mi-Dessau
Moses Mendelssohn kam nach dem hebräischen Kalender am 12. Ellul 5489, also am 6. September 1729 in Dessau als jüngstes von drei Kindern von Mendel (Menachem) Heymann (ca. 1682–1766) und seiner Frau Bela Rachel Sarah (gest. 1756) zur Welt.[1] Überliefert ist, dass er in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. Der Vater konnte die Familie durch die eher schlecht bezahlte Tätigkeit eines Synagogendieners nur mühsam ernähren. Als »Schulklopfer« hatte er die Aufgabe, jeden Morgen an die Türen der Gemeindemitglieder zu pochen, um sie zum Gottesdienst zusammenzurufen.
Zusätzliche Einkünfte verschaffte Mendel Heymann sich als Elementarschullehrer in der Gemeindeschule, vor allem aber durch seine Arbeit als »Sofer« (Schreiber) der Gemeinde. Er schrieb Thorarollen und kopierte Passagen aus der Bibel auf Pergamentstreifen, die als »Mesusot« an Türpfosten Verwendung fanden. Moses und sein Bruder Saul halfen dem Vater bei der Kopierarbeit.
Es heißt, der junge Moses habe sich durch diese Tätigkeit eine feine kalligraphische Handschrift angeeignet, die zu einem auffälligen Familiencharakteristikum werden sollte. In den akkurat ausgeführten Buchungseintragungen seines Sohnes Abraham lässt sich dieser Zug ebenso erkennen wie in der exakten Notenschrift seines Enkels, des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy.
Über die Beziehung des jungen Moses Mendelssohn zu seinem Vater ist kaum etwas bekannt. In den Briefen an seine Braut Fromet Gugenheim (1737–1812) erwähnt er mitunter den Vater, der damals schon nicht mehr der Jüngste war. Die Rede ist meist vom »alten Vater«, der »ein Mann aus der alten Welt« sei und »seine besonderen Grillen« (30. April 1762) habe. An Dankbarkeit für den Vater dürfte es Moses nicht gefehlt haben, doch sonderlich eng war das Verhältnis nicht. Die Biographen führen das auf den großen Altersunterschied zurück. Stichhaltiger ist ihr Argument, Mendel Heymann sei ein einfacher Mann gewesen, der den Sohn nach bestem Wissen gefördert und sein Bibel- und Talmudwissen an ihn weitergegeben, mit dessen Gelehrsamkeit jedoch nur wenig anzufangen gewusst habe.
Weniger noch ist über Moses Mendelssohns Mutter überliefert. Von ihr heißt es, sie sei eine »stille Frau« gewesen, die nicht viel Aufhebens von sich machte. Sie starb 1756, zehn Jahre vor ihrem Mann. Zu ihren Vorfahren zählen angeblich der berühmte Rabbiner und Verfasser zahlreicher Responsen Moses Isseries (vermutlich 1390–1460) und Saul Wahl (1541–1617), jene legendenumwobene Gestalt, die Ende des 16. Jahrhunderts einen Tag lang König von Polen gewesen sein soll.[2] Nach dem Tode Stefan Báthorys (1533–1586), als die polnischen Fürsten sich nicht einigen konnten, wer als dessen Nachfolger gewählt werden sollte, sollen sie den Unternehmer und Zollpächter Saul Wahl gebeten haben, sich für einen Tag die Krone aufzusetzen und als König von Polen zu amtieren. Inwieweit das tatsächlich geschah, ist unklar. Die Legende hat im Verlauf der Jahre jedenfalls ihre eigene Wirklichkeit entwickelt.
Das Judenviertel von Dessau, wo Moses Mendelssohn seine Kinderjahre verbrachte, galt als Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit. Nachdem 1672 die Ansiedlung jüdischer Familien in Dessau gestattet worden war, hatte man 1674 eine Synagoge eingeweiht, einen Friedhof eingerichtet sowie ein Krankenhaus gebaut. 1685, so besagen die Quellen, lebten 26 jüdische Familien in Dessau, die meist aus der Gegend von Halberstadt stammten oder – wie Moses Mendelssohns Vorfahren mütterlicherseits – aus Polen zugewandert waren.
Mendel Heymann lag die Ausbildung seines Sohnes sehr am Herzen. Er bemühte sich, so gut er konnte, sein Bibel- und Talmudwissen an den Jungen weiterzugeben. Kaum fünf Jahre alt, soll sich der junge Moses bereits erste Kenntnisse des Hebräischen und das Verständnis der alltäglichen Gebete angeeignet haben. Isaac Abraham Euchel, der seinem Lehrer Moses Mendelssohn in einer hebräisch geschriebenen Biographie ein ehrendes Denkmal gesetzt hat,[3] wusste zu berichten, dass der junge Moses schon mit sechs Jahren in der Lage war, »Halacha« und »Tosafot«, also talmudische Texte, mit ihren subtilen Auslegungen und Glossen zu studieren.
Als der Vater den Sohn dem häuslichen Unterricht entwachsen glaubte, brachte er ihn in das Dessauer »Beth Hamidrasch« (Lehrhaus), wo die Ausbildung, die damals üblicherweise einem jüdischen Knaben zuteil wurde, vervollständigt werden sollte. Sein Lehrer Hirsch, ein Sohn des gelehrten Rabbinatsassessors Aron Hirsch, bezeugte in späteren Jahren die Frömmigkeit, den Fleiß und den klaren Verstand seines Schülers. Belegt wird das auch durch den Verleger und Mendelssohn-Freund Friedrich Nicolai, der in den Anmerkungen zu Mendelssohns Briefwechsel mit Gotthold Ephraim Lessing notierte: »Er lernte in seiner frühen Jugend auf talmudisch-scholastische Art zu disputieren, und erlangte Fertigkeit darin.«[4]
Moses, vermutlich klüger und aufnahmefähiger als die meisten seiner Mitschüler, begann bald, die Lektionen, die ihm im Lehrhaus vermittelt wurden, durch eigene Studien zu ergänzen. Er beschloss, Hebräisch nach der Grammatik statt – wie es die Mehrzahl seiner Jugendfreunde und Studiengenossen tat – durch Memorieren zu erlernen. Mit zehn Jahren beherrschte er das Hebräische so gut, dass er Gedichte in hebräischer Sprache schreiben konnte, derer er sich allerdings später offenbar schämte, so dass er sie im reiferen Alter vernichtete. An den Dichter Ephraim Kuh schrieb er vier Jahre vor seinem Tod: »Die Musen, diese Schwestern, die oft den jungfräulichen Eigensinn haben, dem Jünglinge günstig zu sein und dem Manne den Rücken zuzuwenden, diese Mädchen sind mir nie recht gut gewesen, und wie ich glaube, aus Eifersucht gegen ihre Schwester Kritik, der ich manchmal die Aufwartung gemacht habe.«[5]
Für den jungen Moses, der sich in seinen jüdisch-deutschen und hebräischen Briefen stets Mosche (Mausche) Dessau oder Mosche mi-Dessau (Moses aus Dessau) nannte (nur in den deutsch geschriebenen Briefen benutzte er seit ungefähr 1760 das Patronym »Mendelssohn«), war es ein ausgesprochener Glücksfall, dass er Schüler von David Fränkel (1707–1762) wurde, dem anhaltischen Landesrabbiner, der 1731 auf Betreiben des Hoffaktors Elia Wulff von Berlin nach Dessau berufen worden war.
David Fränkel, ein scharfsinniger, strenggläubiger und dennoch keineswegs bildungsfeindlicher Gelehrter, hatte großen Einfluss auf die geistige Entwicklung des Knaben, der wiederum seinen Lehrer schwärmerisch verehrte. In einer kurzen autobiographischen Mitteilung, die Moses Mendelssohn am 1. März 1774 dem Ansbacher Bibliothekar Johann Jacob Spiess für dessen »Brandenburgische historische Münzbelustigungen« übersandte, heißt es: »Unter Rabbi Fränkel, der damals in Dessau Oberrabbiner war, studierte ich Talmud.«[6]
Ein besonders günstiger Umstand war es, dass Mendelssohn in Fränkel auf einen Lehrer gestoßen war, der sich als Gelehrter von der damals vorherrschenden spitzfindigen »pilpulistischen« Methode der deutschen und polnischen Talmudisten abgewandt hatte und eine nüchterne Erklärungsweise bevorzugte. Im Unterricht berücksichtigte Fränkel nicht nur Bibel und Talmud, sondern gab seinem lernbegierigen Schüler auch die Kommentare derselben zu lesen.
Es gibt Hinweise, dass Fränkel bestrebt war, das Interesse seiner Schüler besonders auf Maimonides (1135–1204) zu lenken. Insbesondere führte er sie an dessen Werk »More Newuchim« (Führer der Verirrten) heran, das, mit den Kommentaren von Schemtow, Efodi und Crescas versehen, 1742 in der Wulff'schen Druckerei in Jeßnitz in einer Neuherausgabe erschienen war.
Dieser 1190 geschriebene Versuch, die Vereinbarkeit von Religion und Vernunft zu beweisen, war ein epochemachender Schritt in den Bemühungen des Menschen, die Gültigkeit überkommener religiöser Gesetze in einer sich wandelnden Welt zu bewahren. Für Moses Mendelssohns geistigen Werdegang und spätere Denkweise hat Maimonides' Werk, das in eigentümlicher Weise die Aristotelische Philosophie mit der jüdischen Offenbarungslehre verband, eine außerordentliche Rolle gespielt.
»Diesem Maimuni«, scherzte Mendelssohn einmal im Kreis seiner Freunde, »habe ich es zuzuschreiben, dass ich einen so verwachsenen Körper bekommen; er allein ist die Ursache davon; aber deswegen liebe ich ihn doch, denn der Mann hat mir manche trübe Stunde meines Lebens versüßt, und so auf der einen Seite mich zehnfach für das entschädigt, um was er mich in Betracht meines Körpers gebracht hat.«[7]
Als David Fränkel 1743, drei Jahre nach der Thronbesteigung des Preußenkönigs Friedrich II., auf den Posten eines Oberrabbiners in Berlin berufen wurde, war Moses in einem Alter, in dem er daran denken musste, was aus ihm einmal werden sollte. Ihm schien bestimmt zu sein, wie die meisten jungen Juden in Dessau Hausierer zu werden und mit dem Packen auf dem Rücken über Land zu ziehen, um Waren anzubieten. Ein solches Los widerstrebte ihm. In wochenlangen Erörterungen gelang es ihm schließlich, seine Eltern zu überreden, ihn aus Dessau ziehen zu lassen, damit er seine Studien bei Rabbi Fränkel am neu gegründeten Berliner Beth Hamidrasch fortsetzen konnte.
Im Oktober 1743 machte sich der Vierzehnjährige zu Fuß auf den Weg, um seinem Lehrer in die Hauptstadt Preußens zu folgen, die damals bereits rund 100000 Einwohner zählte und auf dem Weg war, eine Metropole zu werden. Durch welches Tor Mendelssohn in die Stadt gelangte, ist nicht mit letzter Gewissheit zu ermitteln. Vertraut man den Berichten, oder sagen wir besser: glaubt man der Legende, dann war es das Rosenthaler Tor, durch das er in die Stadt gelangte. Von Dessau kommend, bedeutete dies einen erheblichen Umweg. Aber für Juden war das Rosenthaler Tor der einzige Zugang in die Stadt.[8]
Dort soll ein von der Jüdischen Gemeinde gestellter »Thor-Steher« (Torwächter) gestanden haben, von dem reisende Juden sich befragen lassen mussten, was sie in der Stadt wollten. Fielen die Auskünfte zufriedenstellend aus, wurden sie registriert und erhielten, wenn sie darüber hinaus noch den Nachweis führen konnten, dass sie nicht völlig mittellos waren, den für das Betreten der Stadt notwendigen Passierschein.
Apokryph ist allerdings die Geschichte, die in der deutsch-jüdischen Geschichtsschreibung vor 1933 von einer Generation zur nächsten tradiert wurde, der »Thor-Steher« sei vom bescheidenen Auftreten des jungen Mannes derart beeindruckt gewesen, dass er alle Bedenken zurückgestellt und ihn in die Stadt eingelassen habe. Zum positiven Eindruck beigetragen, so heißt es, habe unter anderem die Auskunft Mendelssohns, er folge seinem Lehrer David Fränkel, dem Berliner Oberrabbiner, um unter dessen Anleitung zu »lernen«, was zu jener Zeit noch als Ausweis von Gelehrsamkeit galt.
Die Anekdote, die den Eindruck vermittelt, der »Thor-Steher« sei in seinen Entscheidungen völlig frei gewesen und habe allein bestimmen können, wen er in die Stadt hineinlassen wollte und wen nicht, gehört vermutlich ebenso in den Bereich der Legende wie die Behauptung, es habe sich in den Journalen der Wache an diesem Oktobertag 1743 die Eintragung befunden: »Heute passierten das Rosenthaler Tor sechs Ochsen, sieben Schweine, ein Jude.«
Die Anfänge in Berlin
Als der junge Dessauer Talmudschüler 1743 nach Berlin kam, war er ein Rechtloser, der zur Gruppe derjenigen Juden gehörte, denen die Behörden in Brandenburg-Preußen Bürgerrechte und Rechtsschutz verweigerten und die jederzeit ohne Vorankündigung und Begründung aus der Stadt ausgewiesen werden konnten. In Berlin durfte Moses Mendelssohn anfänglich nur deshalb bleiben, weil die Gemeindeältesten sich bereiterklärt hatten, für ihn zu bürgen und, was vermutlich noch wichtiger war, für seine Unterkunft und Verpflegung aufzukommen.
Das jüdische Leben in Brandenburg-Preußen war zu jener Zeit weitgehend durch das vom Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I 1730 erlassene Edikt (»General-Privilegium und Reglement, wie es wegen der Juden in Sr. Königl. Maj. Landen zu halten«) reglementiert. Darin war festgelegt, was Juden tun durften und was sie zu lassen hatten. Als der vierzehnjährige Moses Berlin betrat, kam er in eine Stadt, die noch weitgehend unter dem Einfluss dieses Reglements stand, das Juden nur bedingt den Aufenthalt in Berlin gewährte.
Friedrich Wilhelm I. lebte zwar nicht mehr, aber nach wie vor waren die Regelungen des von ihm erlassenen Edikts in Kraft und bestimmten den Alltag der Juden. Der König, von dem die Zeitgenossen gemeint hatten, er sei von schlichtem Gemüt und besäße einen etwas beengten Gottesglauben, empfand eine tiefe Abneigung gegenüber seinen jüdischen Untertanen. Die Marginalien, die er an den Rand der Judenakten zu schreiben pflegte, sprechen eine unmissverständliche Sprache: »Soll man sie aus der Landes jagen …«[9], »Gottlob, dass sie weg seyn …«[10] oder »Mit den Juden will ich nits zu tuhn haben«.[11]
Moses Mendelssohn kam also in eine Stadt, von der er wusste, dass es für ihn äußerst schwer sein würde, hier Fuß zu fassen. Er durchlebte zunächst eine Zeit bittersten Elends. Der Hunger war, wie es heißt, sein ständiger Begleiter. Nur die Fürsorge seines Mentors David Fränkel, der sich, so gut er konnte, um ihn kümmerte, ließ ihn alle körperlichen Entbehrungen und Mühen überstehen. Fränkel verdankte er es, dass er eine Dachstube in der Probstgasse bei einem gewissen Heimann Bamberger beziehen konnte und bei verschiedenen Gemeindemitgliedern am Mittagstisch sitzen durfte.
In der Stadt lebten zu dieser Zeit etwa 330 jüdische Familien, die Gesamtzahl der Juden in Berlin wird auf zirka 1950 Seelen geschätzt. In den Listen der »Kurmärkischen Kriegs- und Domänenkammer« wurden 1743120 Schutzjuden nebst Familien und Domestiken aufgeführt. Für das Jahr 1750 liegt eine Liste der »Berlinischen Schutz-Juden-Familien« vor, die bereits eine ansteigende Zahl in der Stadt lebender Juden ausweist. In dieser Liste sind 266 Namen von Schutzjuden verzeichnet, beginnend mit dem Namen Moses Levi Gumpert und endend mit David Isaac Opticus.
Wie viele Juden tatsächlich Mitte des 18. Jahrhunderts in der Stadt lebten, ist allerdings nur bedingt festzustellen. Das für Schutzjuden festgelegte Limit wurde praktisch immer überschritten. Es gibt Schätzungen, nach denen um 1750 die Zahl der Berliner Juden doppelt so hoch war, als sie nach offizieller Regelung hätte sein dürfen.
Das hing zum einen damit zusammen, dass häufig mehrere Personen ein Aufenthaltsrecht von ein und demselben Schutzbrief ableiteten, zum anderen mit der Zuwanderung, die dazu geführt hatte, dass zahlreiche Juden sich illegal in Berlin-Brandenburg aufhielten. General-Fiscal Uhden bemängelte am 27. März 1743, »daß er nicht im Stande sei, eine ordentliche, zuverlässige und accurate Liste von den hiesigen Juden zu verfertigen und allerunterthänigst abzuliefern«.[12]
Moses Mendelssohn, der sich wie alle Juden, die nach Berlin kamen, zunächst um das Aufenthaltsrecht in der Stadt bemühte, wusste anfangs nicht, wie er seinen Lebensunterhalt verdienen sollte. Vielleicht aus diesem Grund kümmerte er sich verstärkt darum, sein Wissen zu vertiefen und sich eine umfassendere Bildung anzueignen. Einer der ersten Schritte, die er unternahm, war es, Deutsch lesen und schreiben zu lernen.
Das musste heimlich geschehen. Die Rabbiner jener Zeit, die sich zumeist nur des jüdisch-deutschen Jargons bedienten, betrachteten jeden als Abtrünnigen, der sich deutsche Bildung aneignen wollte. Sie fürchteten, mit der deutschen Sprache dringe auch weltliches Wissen und damit Unglauben und Ketzerei in die frommen Gemüter ihrer Gemeindemitglieder. Sie bestraften jeden, der sich derartiger »Verbrechen« schuldig machte, mit Bann und Stadtverweisung. Das Recht dazu hatten sie von der weltlichen Obrigkeit erhalten.
Schon der Besitz eines deutschen Buches konnte zur Ausweisung aus der Stadt führen. Das hinderte junge Juden allerdings nicht, sich deutsche Bücher zu besorgen und so die deutsche Sprache zu erlernen. Der Großvater des in der Bismarck-Zeit bekanntgewordenen Bankiers Bleichröder berichtete: »Ich kam im Jahre 1746 als armer vierzehnjähriger Knabe nach Berlin und fand Moses Mendelssohn in der jüdischen Lehranstalt. Dieser gewann mich lieb, unterrichtete mich im Lesen und Schreiben und teilte oft mit mir sein kümmerliches Brot.«
»Aus Dankbarkeit«, so Bleichröder, »zeigte ich mich ihm durch kleine Dienstleistungen erkenntlich, und so schickte er mich unter anderem irgendwohin, um ein deutsches Buch zu holen. Mit diesem Buch in der Hand begegnete mir ein jüdischer Armenvorsteher, der mich mit den Worten anfuhr: ›Was hast du da? Wohl gar ein deutsches Buch!‹ Sogleich riß er es mir aus der Hand und schleppte mich zum Vogt, dem er den Befehl erteilte, mich aus der Stadt zu weisen. Mendelssohn, der Kenntnis von meinem Schicksal erhielt, gab sich alle Mühe, meine Rückkehr zu bewirken, allein vergeblich.«[13]
Hilfreich bei den ersten Schritten, sich weiter fortzubilden, war die Bekanntschaft mit dem aus Galizien vertriebenen Talmudisten Israel Samoscz (um 1700–1772). Dieser kluge Kopf und begabte Autodidakt war es, der Mendelssohns Interesse an der mittelalterlichen jüdischen Religionsphilosophie weckte und ihn in die Grundlagen der Mathematik sowie in die Gesetze der Logik einführte. Mendelssohns späterer berühmter Kommentar von Maimonides' »Millot Ha-Higgayon« (Logik) wäre ohne diese Schulung wohl kaum denkbar gewesen.
Die Beschäftigung mit der Mathematik und den jüdischen Philosophen des Mittelalters ließ in Mendelssohn den Wunsch erwachen, auch die klassischen Sprachen zu erlernen. Hinderlich war nur der Mangel an Geld. Mendelssohn wusste nicht, wie er sich die für das Studium notwendigsten Bücher beschaffen, geschweige denn einen Lehrer bezahlen sollte. Um sich wenigstens einige Bücher kaufen zu können, begann er, Groschen, die er durch Schreibarbeiten verdiente, beiseitezulegen.
Bei einem Antiquar erwarb er eine alte lateinische Grammatik sowie ein deutsch-lateinisches Wörterbuch. Abraham Kisch, ein junger Medizinstudent aus Prag, der sich im Jesuiten-Collegium seiner Vaterstadt gute Kenntnisse der alten Sprachen erworben hatte, gab Mendelssohn kostenlos Lateinstunden, so dass dieser in kurzer Zeit in der Lage war, Lockes »Essay Concerning Human Understanding« (1690) in lateinischer Übersetzung zu lesen.
Mendelssohn verfuhr dabei nach einer äußerst mühevollen Methode: Er schlug Wort für Wort in seinem Lexikon nach, schrieb diese Wörter auf und versuchte schließlich, den Sinn des ganzen Satzes zu entziffern. Auf diese Weise gelang es ihm, sich nicht nur den Inhalt dieses Werkes, sondern auch Aristoteles und Platon in lateinischer Übersetzung anzueignen. »Übrigens bin ich nie«, berichtete Mendelssohn in späteren Jahren, »auf einer Universität gewesen, habe auch in meinem Leben kein Collegium gehört. Dieses war eine der größten Schwierigkeiten, die ich übernommen hatte, indem ich alles durch Anstrengung und eigenen Fleiß erzwingen mußte.«[14]
Bedeutsam wurde für Mendelssohn die Bekanntschaft mit Aaron Salomon Gumpertz (1723–1769), dem Enkel des berühmten Elias Gumpertz aus Emmerich, der einst als Lieferant und Agent dem Großen Kurfürsten wichtige Dienste geleistet hatte. In der autobiographischen Notiz, die Mendelssohn 1774 niederschrieb, werden drei Männer namentlich erwähnt, auf die er, aus unterschiedlichen Gründen, große Stücke hielt: sein Vater, Rabbi Fränkel und besagter Aaron Salomon Gumpertz.
Ohne Gumpertz wäre Mendelssohn wohl kein berühmter Gelehrter geworden. Er war es, der Mendelssohn an die moderne Wissenschaft heranführte.[15] »Durch den Umgang mit dem nachherigen Doctor der Arzneigelartheit [= -gelehrtheit], Herrn Aron Gumperz«, schrieb Mendelssohn nach dessen Tod, »habe ich Geschmack an den Wissenschaften [gewonnen], dazu ich auch von demselben einige Anleitung erhielt.«[16]
Gumpertz war es auch, der Mendelssohn dazu brachte, sich Kenntnisse der englischen und französischen Sprache anzueignen. Er war es, der nicht nur Mendelssohns Interesse für Leibniz und Wolff weckte, die damaligen Häupter der jüngeren Philosophie, sondern ihn auch in die gebildeten Kreise Berlins einführte. Durch Gumpertz' Beziehungen lernte Mendelssohn den Marquis d'Argens kennen, aber auch Pierre Louis Maupertuis (1698–1759), den Präsidenten der Berliner Akademie, zwei herausragende Köpfe des damaligen intellektuellen Berliner Lebens.
Mendelssohn war in den Häusern der Männer, die ihn einluden, ein gerngesehener Gast. Man empfand seine Gesellschaft als angenehm und war besonders davon angetan, dass er nicht nur geistreich parlieren konnte, sondern zudem ein glänzender Schachspieler war. Gumpertz und dem Schachspiel war es zu verdanken, dass Mendelssohn 1754 bei einer solchen Gelegenheit den Dichter Gotthold Ephraim Lessing traf – eine Begegnung, die Mendelssohns Leben von Grund auf verändern sollte.
Die Juden, denen es in jenen Jahren gelang, sich in Berlin Aufenthaltsrechte zu sichern, hatten es in doppelter Hinsicht schwer. Sie hatten unter den Reglements zu leiden, die genau vorschrieben, was Juden in der Stadt zu tun und zu lassen hatten, genauso aber unter den Abschottungsmaßnahmen, die die Gemeindeältesten verhängten, da sie den angeblich verderblichen Einfluss der Umgebungsgesellschaft fürchteten und Kontakte zwischen Gemeindemitgliedern und ihrer christlichen Umwelt vermeiden wollten.
Dazu kam, dass Juden nur eingeschränkt Berufen nachgehen konnten. Ihr Leben war durch die Auflagen der Zünfte und durch die Verordnungen der Behörden strikt geregelt. Erlaubte handwerkliche Tätigkeiten waren allein die des Schächters, Fleischhackers, Bäckers, des Glas- und Diamantschleifers, des Gold- und Silberstickers sowie des Petschierstechers (Stempelschneiders) und des Medailleurs – allesamt Tätigkeiten, die nicht zunftgebunden waren. Nur in seltenen Ausnahmefällen war es Juden gestattet, ein zünftiges Handwerk auszuüben.
Es gab einige wenige, die als Fabrikanten und Unternehmer in der Seiden- und Tuchindustrie und im Geld- und Pfandhandel Fuß fassten. Die meisten Juden in der Stadt verdienten kaum genug zum Überleben. In den von den Behörden geführten Berufsstatistiken werden sie überwiegend als ambulante Kleinhändler geführt, als Hausierer, Vermittler, Agenten oder Kommissionäre, die ihren Lebensunterhalt dadurch bestritten, dass sie Handelsgüter von der Stadt auf das Land transportierten und umgekehrt Waren vom Land in die Stadt brachten.
Diejenigen, die sich im Geldhandel betätigten, konnten das tun, weil sie auf diesem Sektor mit der Duldung der Behörden rechnen konnten. Die Akten belegen, dass im Jahre 1737 in Berlin 18 Geldwechsler tätig waren, darüber hinaus sieben Pfandleiher und ein Makler. Bezogen auf die 120 Familien, die in der Stadt zu jener Zeit Aufenthaltsrecht hatten, war die Zahl von 18 Geldwechslern vergleichsweise hoch – allerdings relativiert sie sich, wenn man bedenkt, dass damals tatsächlich deutlich mehr Juden in Berlin lebten.
Der junge Moses Mendelssohn hatte das Glück, von dem Seidenwarenfabrikanten Isaak Bernhard (Bermann Zültz) eine Stelle als Hauslehrer für seine vier Kinder angeboten zu bekommen. Für Mendelssohn brachte diese Anstellung nicht nur ein regelmäßiges Gehalt mit sich, er hatte auch die Zeit, in den Abendstunden weiter seinen Studien nachzugehen. Das Gehalt reichte darüber hinaus noch aus, Musikunterricht zu nehmen und gelegentlich Konzerte und Theateraufführungen zu besuchen.
Vier Jahre lang blieb Mendelssohn in Bernhards Haus und unterrichtete dessen Kinder in jüdischen und weltlichen Fächern. Als die Kinder dem Schulalter entwachsen waren und keinen Hauslehrer mehr benötigten, machte Bernhard Mendelssohn das verlockende Angebot, als Buchhalter in sein Unternehmen einzutreten.[17] Mendelssohn nahm an. Es handelte sich, wie es sich bald darauf zeigen sollte, um eine Aufgabe, bei der er seine rasche Auffassungsgabe, seine rechnerischen Fähigkeiten und seine schöne Handschrift gut einsetzen konnte.
Die Einarbeitung in die neue Stellung fiel Mendelssohn nicht leicht. Es saß von morgens um acht bis abends um neun am Schreibtisch. Seine Lage besserte sich nur allmählich. Im April 1756 teilte er Gotthold Ephraim Lessing mit, dass im nächsten Sommer sein Leben eine grundlegende Veränderung erfahren werde: Er habe vor, im Comptoir nicht mehr länger als sechs Stunden zu arbeiten, und zwar nur noch von acht Uhr morgens bis zwei Uhr nachmittags. Die übrigen Stunden des Tages wolle er sich bilden und die knapp bemessene freie Zeit für sich und eigene Studien verwenden.
Mendelssohn machte Karriere in der Firma, er erlangte den Posten eines Prokuristen und stieg 1761 sogar zum Teilhaber der Bernhard'schen Seidenwarenmanufaktur auf.[18] Er wurde das, was man einen erfolgreichen Geschäftsmann nennt. Seit 1779 handelte er mit italienischer Rohseide, die er gemeinsam mit den Hamburger Kaufleuten Bovara & Greppi in Italien einkaufen ließ, um sie dann den Seidenunternehmern auf Kredit oder bar zu verkaufen.
Bis zu seinem Lebensende hatte Mendelssohn durch seine beruflichen Aktivitäten ein vergleichsweise gutes Auskommen. Begeistert von dieser Tätigkeit war er allerdings nie. »Die Geschäfte! die lästigen Geschäfte!«, beklagte er sich beispielsweise im Mai 1763 in einem an Lessing gerichteten Brief, »sie drücken mich zu Boden, und verzehren die Kräfte meiner besten Jahre.«[19]
Trotz solcher Klagen ist Mendelssohn nicht aus Bernhards Seidenwarenmanufaktur ausgeschieden. Nach dessen Tod im April 1768 führte er gemeinsam mit Bernhards Witwe und dessen Kindern »zur Allerhöchsten Zufriedenheit« die Potsdamer und Berliner Unternehmen fort und erweiterte diese derart, dass zeitweilig 120 Webstühle in Betrieb waren. Diese positive Entwicklung war dem unternehmerischen Geschick Mendelssohns zu verdanken, dem nachgesagt wurde, er wisse mit Stoffen umzugehen. Er habe, so David Friedländer später, »einen ungemein feinen Geschmack« besessen.
Als 1781 die Witwe Isaak Bernhards starb, übernahmen die Söhne Moses und Abraham Bernhard die Leitung der Manufaktur in »Sozietät« mit Moses Mendelssohn, der zu dieser Zeit bereits kränkelte, aber nach wie vor die Arbeit eines Buchhalters wahrnahm, wie ein von ihm geführtes Geschäftsjournal aus den Jahren 1779 bis 1781 belegt.[20] In diesem Journal tauchen nicht nur Verwandte Mendelssohns als Geschäftspartner auf wie beispielsweise Moses Selig Bacher (1744–1824), der als Silberhändler und Lotterieeinnehmer in Potsdam arbeitete und Blümchen, die Schwester von Mendelssohns Frau, geheiratet hatte.
Das Journal belegt, dass Mendelssohn auch zu anderen bekannten Namen der damaligen Berliner Geschäftswelt in Beziehung stand: David Friedländer beispielsweise, aber auch der Kattunfabrikant Isaak Benjamin Wulff, Isaak Daniel Itzig und der spätere preußische Oberhofbankier, der Neustrelitzer Hofagent Nathan Meyer, gehörten dazu. Mit Meyer entstanden noch zu Lebzeiten Moses Mendelssohns verwandtschaftliche Beziehungen, als Mendelssohns Tochter Recha 1785 Nathan Meyers Sohn Mendel (gest. 1832) heiratete. Später ehelichte Joseph Mendelssohn Henriette (1776–1862), die Schwester von Mendel Meyer.
Nach dem Tod der Witwe Bernhard sollte das Unternehmen als »Gebrüder Bernhard & Co« beziehungsweise als »Gebrüder Bernhard & Moses Mendelssohn« weitergeführt werden. Zunächst sah es so aus, als ob diese Pläne auch umgesetzt werden würden, da die Firma durch die Erfindung und Produktion von Stoffen in ostindischer Manier (Pampelusen) und bunten seidenen Tüchern auf Expansionskurs zu sein schien. Die Absatzmöglichkeiten, bedingt durch die allgemein schwierige wirtschaftliche Lage, verschlechterten sich jedoch zusehends, so dass das Unternehmen gezwungen war, sich zu verkleinern. 1783 waren in Potsdam noch 39, in Berlin 38 bis 40 Webstühle in Betrieb. Die Schließung der Seidenmanufaktur war nur noch eine Frage der Zeit.
Der Sokrates an der Spree
Die 1755 anonym erschienenen »Philosophischen Gespräche« galten lange Zeit als die erste Veröffentlichung Moses Mendelssohns, was jedoch nicht zutrifft. Mendelssohns erste Publikation war der »Kohelet musar« (Prediger der Moral), eine Schrift, die angeblich bereits 1750 erschienen ist.[21] Dennoch sind die »Philosophischen Gespräche« das erste bedeutende Werk Mendelssohns, seine erste Bemühung, die zeitgenössische Philosophie mit eigenen Überlegungen zu bereichern.
Die »Gespräche« waren der Versuch, Leibniz' »prästabilisirte Harmonie« auf die Lehre Spinozas zurückzuführen – was zwar nicht neu war, aber den Beifall seines Freundes Lessing fand. Einige Jahre später, als die »Gespräche« 1761 in einer Überarbeitung erschienen, äußerte Lessing allerdings Zweifel, ob beide Lehren überhaupt miteinander vereinbar seien. »Ich muß Ihnen gestehen«, schrieb er Mendelssohn in einem Brief am 17. April 1763, »dass ich mit Ihrem ersten Gespräche seit einiger Zeit nicht mehr so recht zufrieden bin.«[22]
Was dem heutigen Leser der »Philosophischen Gespräche« auffällt, ist vor allem die Einstellung ihres Verfassers, sein Bekenntnis zur deutschen Sprache und Kultur. Entgegen der damals allgemein verbreiteten Schwärmerei für französischen Geschmack und Literatur spricht sich Mendelssohn gegen die »Gallomanie« aus, gegen die »sklavische Nachäffung« all dessen, was aus Frankreich stammt. Heftig attackiert Mendelssohn den Einfluss der französischen Literatur und artikuliert seinen Widerwillen gegen das, wie er es nennt, »witzelnde und tändelnde Treiben« der Franzosen.
Den Zeitgenossen nötigte es einigen Respekt ab, dass ein rechtloser Jude in seiner Gesinnung nationaler war als die meisten Deutschen seiner Zeit. Dies und sein Ruf als junger Philosoph, der die deutsche Sprache und die deutschen Sitten formvollendet beherrschte, öffneten Mendelssohn die Türen der Berliner Salons. Er wurde herumgereicht und bestaunt. Hochgestellte Persönlichkeiten wollten den mittlerweile zu einiger Bekanntheit gelangten Mendelssohn kennenlernen.
Als sich 1755 in der bis dahin intellektuell recht öden preußischen Hauptstadt ein »gelehrtes Kaffeehaus« bildete, in dem neben Friedrich Nicolai, Aaron Salomon Gumpertz und Johann Albrecht Euler noch viele andere berühmte Männer verkehrten, war es fast selbstverständlich, dass die Initiatoren auch Mendelssohn die Mitgliedschaft antrugen. Alle vier Wochen fanden in dieser gelehrten Kaffeehaus-Gesellschaft Veranstaltungen statt, bei denen sich Mendelssohn durch geistreiche und schlagfertige Äußerungen den Ruf erwarb, ein Schöngeist zu sein, ein Bel Esprit, wie man es damals in den Salons nannte.
Bei einer der Abendveranstaltungen soll im »heiteren Gespräch« der Vorschlag gemacht worden sein, jeder der Anwesenden möge doch etwas zu den Fehlern der eigenen Person sagen. Mendelssohn, der bekanntlich verwachsen war, einen starken Höcker hatte und zudem stotterte, soll, als die Reihe an ihm war, sich folgendermaßen geäußert haben:
Groß nennt ihr den Demosthen,
Den stotternden Redner von Athen,
Den höckrigen Aesop haltet ihr für weise –
Triumph! Ich werd' in Eurem Kreise
Doppelt groß und weise sein,