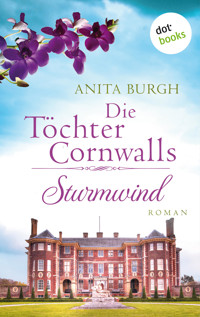Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Traum, beinahe zu schön, um wahr zu sein: Der gefühlvolle Liebesroman »Das Erbe von Respryn Hall« von Anita Burgh jetzt als eBook bei dotbooks. London, 1952: Die junge Krankenschwester Jane Reed begegnet auf einer Party dem charmanten Studenten Alistair Redland – und beide fühlen sich sofort wie magisch voneinander angezogen. Es beginnt eine zarte Liebesgeschichte, die so wundervoll und perfekt ist, dass Jane ihr Glück kaum fassen kann. Als Alistair ihr gesteht, dass er der zukünftige Earl of Upnor ist und sie auf den Landsitz seiner Familie einlädt, freut sich Jane zunächst auf ihren gemeinsamen Besuch in Respryn Hall. Schon glaubt sich Jane in einem Märchen – doch der frostige Empfang, den sie dort durch die besitzergreifende Mutter Alistairs erhält, lässt Jane verzweifeln: Kann sie in diesem Haus jemals glücklich werden? Doch ein Blick in Alistairs Augen und Jane weiß, dass sie gemeinsam für ihre Träume kämpfen werden, koste es, was es wolle … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Roman »Das Erbe von Respryn Hall« von Anita Burgh. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 899
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
London, 1952: Die junge Krankenschwester Jane Reed begegnet auf einer Party dem charmanten Studenten Alistair Redland – und beide fühlen sich sofort wie magisch voneinander angezogen. Es beginnt eine zarte Liebesgeschichte, die so wundervoll und perfekt ist, dass Jane ihr Glück kaum fassen kann. Als Alistair ihr gesteht, dass er der zukünftige Earl of Upnor ist und sie auf den Landsitz seiner Familie einlädt, freut sich Jane zunächst auf ihren gemeinsamen Besuch in Respryn Hall. Schon glaubt sich Jane in einem Märchen – doch der frostige Empfang, den sie dort durch die besitzergreifende Mutter Alistairs erhält, lässt Jane verzweifeln: Kann sie in diesem Haus jemals glücklich werden? Doch ein Blick in Alistairs Augen und Jane weiß, dass sie gemeinsam für ihre Träume kämpfen werden, koste es, was es wolle …
Über die Autorin:
Anita Burgh wurde 1937 in Gillingham, UK geboren und verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in Cornwall. Ihre 24 Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und feierten international Erfolge. Mittlerweile lebt Anita Burgh mit ihrem Mann und zwei Hunden in einem kleinen Dorf in den Cotswolds, Gloucestershire.
Bei dotbooks veröffentlichte Anita Burgh auch ihre Romane »St. Edith’s: Hospital der Herzen«, »Glückssucherinnen«, »Der Weg zum Herzen einer Frau«, »Wo deine Küsse mich finden«, »Das Lied von Glück und Sommer«, »Wo unsere Herzen wohnen«.
Außerdem veröffentlichte Anita Burgh bei dotbooks ihre Familiensaga »Die Töchter Cornwalls« mit den drei Einzelbänden: »Morgenröte«, »Sturmwind« und »Dämmerstunde«.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1987 unter dem Originaltitel »Distinctions of Class« bei Chatto & Windus, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Wenn du nur wagst zu träumen« bei Knaur.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1987 by Anita Burgh
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Ysbrand Cosijn, Evgeny Karandaev, Shutova Elena, Nicola Pelham
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-474-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Erbe von Respryn Hall« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anita Burgh
Das Erbe von Respryn Hall
Roman
Aus dem Englischen von Traudl Weiser
dotbooks.
Für Billy und Peteaus verschiedenen Gründenmit derselben Liebe
The rich man in his castle,The poor man at his gate,God made them, high or lowly,And ordered their estate.
Mrs. C. F. Alexander
Prolog
Jane Reed saß allein im Heck des Flugzeugs. Jane war immer allein, wenn die Turbinen mit schreiender Intensität aufheulten und die Maschine zu zittern begann. Sie mußte mit ihrer Angst allein sein; das Vertrauen, die Späße anderer vergrößerten ihre Angst nur. Allein fühlte sie sich besser.
Das große Flugzeug begann zu rollen. Das war der Zeitpunkt, an dem sie immer vorhatte aufzustehen und darauf zu bestehen, auszusteigen. Sie tat es jedoch nie. Die Kraft, die die Maschine über die Startbahn katapultierte, drückte sie in ihren Sitz zurück. Sie schloß die Augen, um die erschreckende Geschwindigkeit, die sie spürte, nicht auch noch zu sehen. Die Knöchel ihrer Finger traten weiß hervor, so fest verkrampfte sie ihre Hände ineinander.
Wir sind genau wie selbstmörderische Lemminge, sitzen hier, dachte sie, als das Flugzeug auf den Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt, zuraste.
Jane hatte alles probiert – Hypnose, Valium, Gin, sogar Pot –, aber es gab keine Droge, keine Therapie, die dieser sonst so selbstsicheren Frau die Angst vorm Fliegen nehmen konnte.
Der große, mit Chintz bezogene Sessel, in dem sie saß, betonte ihre zierliche Figur. Sie war für die Reise leger gekleidet und trug einen gutgeschnittenen Sportanzug aus feinster Seide, der jedoch nicht für den Sport bestimmt war. Das Grau des Stoffs paßte genau zu dem Grau ihrer großen Augen, die jetzt von geschlossenen Lidern bedeckt waren. Die handgefertigten Schuhe, der um ihre Schultern drapierte Schal von Hermès, die Kaskade goldener Ketten um ihren Hals kündeten von ihrem Reichtum, ehe man überhaupt die großen Diamantringe bemerkte, die an ihren manikürten Händen funkelten.
Wäre sie nicht so berühmt, es wäre unmöglich gewesen, ihr Alter zu schätzen. Ihre Haut war makellos und besaß noch immer den rosigen Schimmer einer viel jüngeren Frau. Die wenigen feinen Linien um ihre Augen schienen nur deren Größe und Schönheit zu unterstreichen, als wären sie von einer geschickten Kosmetikerin aufgetragen worden. Ihre Lippen waren voll. Die hohen Wangenknochen und das feste Kinn waren nie mit dem Skalpell eines Schönheitschirurgen in Berührung gekommen. Ihr kleiner, leichter Körper vermittelte den Eindruck von Zerbrechlichkeit, der die Zähigkeit verschleierte, zu der Jane fähig war. Die Menschen wollten ihr immer helfen und sie beschützen, und Jane hatte gelernt, diese Tatsache zu ihrem Vorteil zu nutzen. Aber sie war berühmt, und wo immer ihr Name gedruckt wurde, stand in Klammern – damit es die ganze Welt sah – ihr Alter daneben. Nicht, daß es Jane etwas ausmachte, denn bei ihrem Aussehen war es irrelevant, in den Vierzigern zu sein.
»Du kannst die Augen öffnen, den Sicherheitsgurt aufmachen und dir eine Zigarette anzünden. Wir sind in der Luft!« Jane entging der geduldige Humor in Frans Stimme nicht. Vorsichtig öffnete sie die Augen und grinste die Frau an, die vor ihr stand. »Ich bin albern, nicht wahr?«
»Verdammt albern, wenn man in Betracht zieht, wie oft du fliegst.«
»Ist es ungefährlicher, als die Straße zu überqueren?«
»Aber ja. Fliegen ist die sicherste Art zu reisen.«
»Aber ich habe immer das Gefühl, in meinen Sarg zu steigen, wenn ich an Bord gehe.«
»Ich weiß.«
»Du weißt es?«
»Das sollte ich wohl.« Fran lachte. »Nach jedem Start führen wir die gleiche alberne Unterhaltung.«
»Wirklich?«
»Ja, liebe Jane. Wort für Wort!« Fran plumpste in den gegenüberliegenden Sessel. »Möchtest du einen Drink?«
Jane nickte, und Fran drückte den Klingelknopf, um die Stewardeß zu rufen. Mit einem festgefrorenen Lächeln stellte sie bereits eingegossene Drinks vor sie hin.
Jane beobachtete das Mädchen, das sich durch den Mittelgang nach vorn schlängelte. Die Uniform im Schottenmuster sah lächerlich aus. Sie paßte einfach nicht zum Dekor. Jane wußte, daß das ihr Fehler war. Die mit Chintz bezogenen Sessel, die Seidentapeten mit den dazu passenden Vorhängen hatten bewirken sollen, daß der Innenraum der Maschine wie ein Salon aussah, damit Jane die Illusion hatte, sich nicht in der Luft zu befinden. Die Idee hatte ihren Zweck verfehlt. Mit Chintz ausgestattete Flugzeuge sahen nicht gut aus. Der zwitterhafte junge Designer, der bei ihrem Vorschlag wütend mit seinen Gucci-Schuhen aufgestampft hatte, hatte von Anfang an recht gehabt. Sie mußte das Interieur ändern lassen.
»Kaschmir! Grüner Kaschmir, das ist die Lösung.«
»Wofür?« Fran blickte von den Unterlagen auf, die sie durchsah. »Für dieses Flugzeug. Sieh es dir doch an! Es sieht wie ein fliegendes Bordell aus. Es ist scheußlich. Ich möchte, daß das Dekor sofort nach meiner Rückkehr geändert wird. Auch die Uniform der Stewardeß. Irgendwas Schottisches, aber kein verdammtes Schottenmuster, und laß diesen ganzen Chintz verschwinden.«
»Mit dem Chintz bin ich einverstanden – nur schade um das Schottenmuster.«
»Aber es wirkt außerhalb von Schottland immer so fehl am Platz.«
»Hell oder dunkel?«
»Hell.«
»Ich setze mich mit Campbells von Beauly in Verbindung.« Fran notierte es in ihrem riesigen Notizblock, den sie immer bei sich hatte.
»Weißt du, Fran, ich sehe keinen Grund, warum wir den Kaschmir nicht selbst herstellen könnten. Wir produzieren Tweed, Wolle, Seide – warum nicht auch Kaschmir? Wir müssen nur herausfinden, ob dafür spezielle Webstühle erforderlich sind.« Sie betrachtete den jetzt anstößigen Chintz. »Glaubst du, man kann damit Möbel beziehen?«
»Ich bezweifle es. Er würde meinem riesigen Hintern nicht lange standhalten.« Fran schnaubte verächtlich.
Jane runzelte mißbilligend die Stirn. »Setz dich nicht so herab, Fran.«
»Es stimmt, ich habe einen großen Hintern.«
»Es ist nicht nötig, dauernd davon zu reden«, entgegnete Jane scharf. Sie haßte die Art, wie sich Fran selbst erniedrigte. Frans Figur war gewiß einzigartig – ihr breites Gesicht schien kinnlos mit dem kräftigen Hals auf ihrem untersetzten Rumpf zu verschmelzen, der in zwei stämmigen Beinen endete. Nach all diesen Jahren wurde sich Jane Frans Figur nur bewußt, wenn Fran darüber sprach. Doch bei jeder Begegnung mit Fremden machte Fran innerhalb von Sekunden eine Bemerkung über ihre Figur. Sie behauptete, sie spräche davon, um den anderen zuvorzukommen, aber Jane spürte, daß es aus Verlegenheit über ihre Unförmigkeit geschah. Während der Vorstellung, welcher Kummer und welche Unsicherheit Fran beherrschten, wurden in Jane gleichzeitig Erinnerungen an die Qualen und Selbstzweifel geweckt, unter denen sie früher gelitten hatte und von denen sie gern glaubte, sie begraben zu haben.
»Mein Verhalten irritiert dich, nicht wahr?«
»Etwas.« Jane lächelte entschuldigend und bereute es schon, ihre Freundin angeschnauzt zu haben.
»Ihr Haut-und-Knochen-Modepuppen habt es gut.«
»Haut und Knochen! Ich? Du machst Witze. Mein Busen ist viel zu groß.«
»Du darfst also sagen, daß dein Busen zu groß ist, aber mir erlaubst du keine Bemerkung über den denkwürdigen Umfang meines Hinterns?«
»Gewonnen!« Jane bot Fran aus ihrem goldenen Etui, das mit Saphiren in Form der Initialen, die einmal ihre gewesen waren, verziert war, eine Zigarette an.
»Auf Max Shielbergs Party, vor ein paar Tagen, hast du hübsch ausgesehen«, sagte Jane lächelnd.
»Pah! Der Vergleich mit einem Beduinenzelt wäre wohl angebrachter.«
»Ich habe nicht immer so wie jetzt ausgesehen. Ich habe Jahre daran gearbeitet. Und Geld ist auch hilfreich dabei.«
»Alles Geld dieser Welt würde mein Aussehen nicht verändern.«
»Ich liebe dich so, wie du bist.«
»Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment sein soll«, entgegnete Fran lächelnd.
»Mein Gott, bin ich müde«, seufzte Jane und streckte die Arme über ihren Kopf.
»Man sieht es dir nicht an – wie üblich.« Fran betrachtete ihre Freundin. »Warum bist du gestern abend nicht noch auf einen Sprung zu mir gekommen?«
»Ich hatte es vor, aber es war schon spät. Ich wollte dich nicht wecken.«
»Offizielle Empfänge dauern gewöhnlich nicht so lange.« In Frans Stimme lag ein neckender Unterton.
»Hat er auch nicht. Um zehn Uhr war er zu Ende, dann bin ich ...«
»Irgendwohin gegangen. War es interessant?«
»War er interessant, meinst du wohl.« Jane lachte ihre Freundin an. »Nein ... nicht, was du denkst. Aber er ist ein sehr interessanter Mann. Ein brasilianischer Diplomat, der über den Trust und die Möglichkeit einer Unternehmensgründung in Brasilien mit mir sprechen wollte. So, jetzt weißt du's.«
»Affären müssen irgendwo anfangen.«
»Fran, du bist unmöglich. Schlimmer als eine Mutter! Ein paar Drinks, und du glaubst, ich hätte eine Affäre.«
»Ich wünschte, du hättest eine, Jane«, sagte Fran plötzlich ernst. »Für eine Frau deines Aussehens gönnst du dir viel zu wenig.«
»Meine liebe Freundin, allein die Vorstellung, in meinem Alter eine Affäre anzufangen, ist erschreckend. Einen Fremden kennenzulernen, dieses quälende Warten auf das Läuten des Telefons – ruft er an, ruft er nicht an? – Nein, wirklich, das kann ich mir nicht antun.«
»Dann fang keine Affäre mit einem Fremden an, sondern mit einem alten Freund.«
Jane warf ihr einen scharfen Blick zu. »Und was willst du damit sagen?«
»Ich meine nur ...«
»Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Das funktioniert nie, Fran.«
»Weißt du was? Ich glaube, du hast nur Angst davor. Ich hätte nie gedacht, daß du ein Feigling bist.«
»Nun, man lernt jeden Tag etwas Neues dazu, nicht wahr?« sagte Jane leichthin.
Jane sah, daß sich Fran auf ein längeres Gespräch einstellte, aber sie schleuderte ihre Schuhe von den Füßen und machte es sich in dem geräumigen Lehnsessel bequem.
»Willst du schlafen?« Die Enttäuschung in Frans Stimme war nicht zu überhören.
»Ich mache nur ein Nickerchen. Weck mich zum Dinner.« Sie lehnte sich mit geschlossenen Augen zurück. Es gibt Zeiten, dachte sie, da kann Fran meine Gedanken lesen. Es schien fast, als wüßte sie über den Brief Bescheid.
Ihre Hand ruhte beschützend auf ihrer Handtasche. Hin und wieder tätschelte sie die Tasche wie ein Schoßhündchen, wobei ein sanftes Lächeln ihre Lippen umspielte. In der Tasche lag ein Brief, vom dauernden Lesen zerknittert; ein Brief, den sie vor Jahren ohne Probleme beantwortet hätte. Doch jetzt? Sie war dankbar für diese Stunden, hoch über dem Atlantik, weil sie ihr Zeit zum Nachdenken ließen. Jane Reed mußte eine Entscheidung treffen: eine Entscheidung, die ihr außergewöhnliches Leben verändern konnte. Wieder einmal.
Teil I1951–55
Kapitel 1
Ihre Kindheit war voller Lärm gewesen. Der Verkehr dröhnte an ihrer Haustür vorbei; Züge rangierten unablässig auf den Gleisen zwei Straßen weiter; durchdringendes Geschrei spielender Kinder war von morgens bis abends zu hören; Nachbarn stritten endlos hinter dünnen Wanden. In regelmäßigen Abständen rief das klagende Heulen der Fabriksirene die Schichtarbeiter zum Dienst.
Jane lag in ihrem schmalen Bett. Das Zimmer war so klein, daß nur noch ein Nachttisch, ein niedriges Bücherregal, ein Kinderschreibtisch und ein Stuhl darin Platz hatten. Ein schäbiger, schwarzbrauner Flickenteppich lag auf dem Linoleumboden, der früher blaurosa gemustert gewesen war, doch durch das ständige Polieren zu einem dumpfen Beige verblaßt war. Der unbenutzte Gasometer hing bedrohlich über ihrem Kopf, und das darin verschlossene Gas verursachte Jane ständig Alpträume. Die Wände waren mit Temperafarbe gestrichen und die Pinselstriche deutlich zu sehen. Weil die Farbe ständig abblätterte, wurde der Anstrich jedes Jahr erneuert und dunkler. Jetzt hatte die ursprünglich hellrosa Farbe einen düsteren lachsfarbenen Ton. Die grünen Vorhänge vor dem kleinen Schiebefenster paßten weder zu den rosa Wänden noch zu dem blaugeblümten Stoff, der vor der Nische hing, die als Schrank diente.
Als die Fabriksirene zur Frühschicht rief, wachte Jane auf und wartete auf das nächste, sich jeden Morgen wiederholende Geräusch. Durch die dünne Wand hörte sie das schrille Läuten des Weckers ihres Nachbarn. Er fluchte, als er den Wecker abstellte und ihn dabei polternd zu Boden stieß. Die Sprungfedern quietschten, als er sich aus seinem Bett hievte. Sie konnte sich vorstellen, wie er sein fettiges, schwarzes Haar aus der Stirn schob, während er nach seinen schweren Stiefeln tastete. Zwei laute Schritte, und das Schiebefenster wurde geöffnet. Sie schloß die Augen, als könnte sie damit das Geräusch unhörbar machen, vor dem ihr graute und das sie jeden Morgen, außer sonntags, hörte. Am Sonntag, wenn er länger schlief, blieb ihr das Räuspern und Spucken erspart, mit dem er seine Lungen vom Schleim befreite und die Klumpen auf das Wellblechdach des Schuppens unterhalb seines Fensters spuckte. Später würde seine Mutter mit einem Eimer Wasser und Desinfektionsmittel den Schleim wegspülen, so daß in Janes Zimmer ständig der Geruch nach Desinfektionsmitteln hing. Allein sein Anblick erfüllte sie mit Abscheu. Sie wußte, daß ihre Nachbarn sie für hochnäsig hielten, aber sie brachte es nicht fertig, mit dem Mann zu reden.
Unter ihrem Zimmer, in der Küche, hörte sie ihren Vater Zucker in die Teetassen rühren. Außer dem Scheuern des Hofes, was er einmal in der Woche tat, war das die einzige Tätigkeit, die er im Haushalt verrichtete. Sie war erstaunt, daß er sich nach dem Streit gestern abend die Mühe machte. Eine Tür wurde zugeknallt, und dann hörte sie schwere Schritte auf der Treppe. Er öffnete die Tür zu ihrem Zimmer – wie nett wäre es, dachte sie, wenn er nur einmal anklopfen würde. Er stellte die Tasse auf den grüngestrichenen Teewagen, der ihr als Nachttisch diente. Er grunzte. Er grunzte immer morgens, sprach selten. Sie sah ihn nicht an. Schweigend drehte er sich um und schlurfte den Gang entlang zum Zimmer ihrer Mutter.
Sie trank den süßen, orangefarbenen Tee schlückchenweise und wünschte sich, nicht an den gestrigen Abend denken zu müssen, aber die Erinnerung stahl sich wieder in ihr Bewußtsein. Es hatte kein warnendes Vorzeichen gegeben, doch das war nicht ungewöhnlich. In diesem Haus flammten Streit und Gewalt mit deprimierender Regelmäßigkeit aus den nichtigsten Angelegenheiten auf.
Die drei hatten bei der Teestunde am Küchentisch gesessen – es hatte Fischplätzchen dazu gegeben, weil Freitag war.
»Ich habe mit dem Vorarbeiter gesprochen, Jane. Du kannst nächsten Monat anfangen zu arbeiten«, verkündete ihr Vater.
»Wie bitte?«
»Du hast mich gehört.«
»Ich habe es gehört, aber nicht verstanden.«
»Ach nein? Dann will ich es dir erklären«, sagte er sarkastisch. »Du bist über vierzehn. Es ist höchste Zeit, daß du die Schule aufgibst, dir einen Job suchst und deinen Lebensunterhalt verdienst, wie alle es tun.«
»Charlie! Red keinen Quatsch!« warf ihre Mutter ein.
»Ich rede keinen Quatsch. Vierzehn ist Schulabgangsalter, warum geht sie noch weiter zum Unterricht?«
»Vierzehn betrifft die Schüler, die kein Stipendium haben, das weißt du genau. Ich möchte, daß Jane bis zur sechsten Klasse in der Schule bleibt. Dann bekommt sie einen anständigen Job, und die Ausgaben machen sich bezahlt.«
»Sechste Klasse!« schnaubte er. »Wer redet jetzt Blödsinn?« Er starrte seine Frau wütend an.
»Dad, das Schulabgangsalter wird auf fünfzehn Jahre heraufgesetzt.«
»Stimmt! Deshalb sollst du jetzt mit der Schule aufhören, ehe das Gesetz in Kraft tritt.«
»Aber ich habe die Klasse nicht beendet und müßte ohne Abschluß abgehen. Dann wäre alles umsonst.«
»Ich habe immer gesagt, daß es umsonst ist. Und abgesehen davon, junge Frau, habe ich es, ehrlich gesagt, satt, dich zu ernähren. Ich arbeite mir die Finger wund, während du dich auf deinem fetten Arsch rekelst und nichts tust. Ich zahle keinen Penny mehr für dich.«
»Du Bastard!« schrie ihre Mutter. »Du arbeitest dir die Finger wund, den Tag möchte ich erleben! Nein, du hast was vor, du gemeiner Kerl! Du willst mir eins auswischen, nicht wahr?«
»Red keinen so verdammten Blödsinn. Ich sagte, warum ich will, daß sie von der Schule abgeht..«
»Nein, dahinter steckt mehr.« Ihre Mutter starrte ihren Vater wütend an. »Du hast nie gewollt, daß sie aufs Gymnasium geht. Und jetzt, wo Jane es geschafft hat, willst du alles zerstören. Bist du denn nicht stolz auf deine Tochter?«
»Stolz? Auf wen?« Ihr Vater grinste sie höhnisch an. »Eine hochnäsige kleine Kuh ist sie mit ihrer vornehmen Bildung geworden. Und fühlt sich mir die ganze Zeit überlegen.«
»Dad, das ist nicht fair ...«
»Eifersucht!« warf ihre Mutter triumphierend ein. »Du erbärmliche Kreatur bist auf deine eigene Tochter eifersüchtig. Eifersüchtig, weil sie eine Chance hat, die du nie hattest.«
Jane sah ihren Vater scharf an. Sie hatte die Geschichte so oft gehört – daß ihr Vater ein Stipendium fürs Gymnasium bekommen, sein Vater ihm aber das Studium verboten hatte. Konnte das wirklich der Grund für sein Verhalten sein? Sie betrachtete das einst gutaussehende Gesicht, das jetzt von Bitterkeit gezeichnet war, und ihr Zorn schwand. Er tat ihr leid. Zaghaft streckte sie die Hand nach ihm aus.
»Dad, es tut mir leid. Ich habe nicht gedacht ...«
»Red nicht so dumm daher, Mädchen! Ich weiß nicht, welchen Blödsinn deine Mutter von sich gibt. Eifersucht? Warum sollte ich auf dich eifersüchtig sein? Ich arbeite hart für mein Geld und habe beschlossen, keinen Penny mehr für dich auszugeben. So einfach ist das, verstehst du ...« Er lächelte sie an, doch sein Lächeln war voller Bosheit.
»Saufen!« Ihre Mutter war noch nicht mit ihm fertig. »Damit du mehr Geld für deine verdammte Kneipe hast, das ist der Grund, du selbstsüchtiger Scheißkerl!«
»Ich gebe mein Geld aus, wie ich es, verdammt noch mal, will! Und wenn du nicht die Klappe hältst, Maeve, kriegst du auch keinen Penny mehr.« Ihre Eltern zündeten sich Zigaretten an, inhalierten tief und schoben gleichzeitig ihre Teller beiseite, als wollten sie Platz für einen Kampf schaffen. Wie Boxer, die ihre Muskeln spielen lassen, saßen sie sich am Tisch gegenüber. Das Anfauchen und Schimpfen ging weiter, und mit jeder Bemerkung verletzten sich die beiden tiefer. In diesem Streit war für Jane kein Platz mehr. Ihre Eltern konzentrierten sich mit geübter Ungeniertheit völlig darauf, sich gegenseitig zu zerstören.
Das war eine allzu vertraute Szene, und Jane wußte, daß es keinen Sinn hatte, zu bleiben. Sie sammelte die Teller ein, spülte das Geschirr, stellte es weg und floh in ihr Zimmer.
Außerdem ist Freitag, dachte sie traurig. In ihrem ganzen Leben hatte sich der Freitag von anderen Tagen unterschieden. In ihrer Kindheit war es der Badeabend gewesen. Der mit Wasser gefüllte Waschkessel war erhitzt worden, und zwei riesige Kochtöpfe brodelten auf dem Gasherd. Die Zinkwanne wurde von ihrem rostigen Haken im Hof genommen und vor das Feuer gestellt. Da hatte sie im Wasser gesessen und die Wärme und die hübschen Farben, die der Schein des Feuers auf ihre Haut warf, genossen. Ihre Mutter hatte ihr das Haar eingeschäumt und Krüge voll Wasser über den Kopf gegossen, als würde sie unter einem Wasserfall sitzen. Dann war sie aus der Wanne gehoben und in ein vorgewärmtes Tuch gehüllt worden und durfte den ganzen Abend in ihrem Pyjama bleiben und Radio hören. Als sie älter wurde und sich ihr Körper entwickelte, durfte sie nicht mehr vor dem Feuer baden, sondern mußte die Kälte in der Küche ertragen.
Und einmal im Monat bedeutete der Freitag einen Ausflug quer durch die Stadt zu ihrer Tante. Ihr Onkel besaß ein Geschäft, und die beiden lebten auf einem Hügel in einem Haus, das Erkerfenster, bunte Glastüren und einen kleinen Vorgarten hatte. Es war der Traum ihrer Mutter, in einer solchen Straße zu wohnen, wo das Haus durch den Garten vom Verkehr abgeschirmt war.
Der Hauptgrund für diese Besuche war der Fernsehapparat, den ihre Tante besaß. Ganz bestimmt gingen sie nicht wegen der Unterhaltung dorthin. Gleich nach ihrer Ankunft setzten sie sich vor das Zaubergerät und blieben bis Sendeschluß. Wenn Jane sehr viel Glück hatte, wurde sie von ihrer Tante eingeladen, über Nacht zu bleiben. Dann nahm sie ein luxuriöses Bad in einem richtigen Badezimmer mit glänzenden Fliesen und unerschöpflich heißem Wasser aus dem gigantischen Durchlauferhitzer, der über der Wanne summte und zischte.
Jane lag in ihrem Bett und sehnte sich nach Schlaf, aber der Streit unten ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Sie fragte sich, woher ihre Eltern die Energie für diese Auseinandersetzungen nahmen. Das Klirren zerbrechenden Glases ließ sie auffahren. Sie sprang aus dem Bett und hastete nach unten. Im Wohnzimmer standen beide wie erstarrt da und betrachteten die zerschmetterte Glasschale, deren Scherben im Kamin und auf dem Teppich davor lagen.
»Mum! Dad! Um Gottes willen, hört damit auf!«
Langsam drehte sich ihre Mutter um. Jane war schockiert, als sie das verwüstete, tränenüberströmte Gesicht, die vor Zorn funkelnden Augen und den vor Bitterkeit verzerrten Mund sah.
»Sieh dir das an! Sie es dir an! Das einzige hübsche Stück, das ich besaß. Das einzige Stück ...« Und ihre Mutter brach in ein schrilles Geheul aus, das eher tierisch als menschlich klang.
»Dad, wie konntest du das nur tun? Mum hat diese Schale geliebt!«
»Ganz recht, gib mir die Schuld. Ich habe das verdammte Ding nicht kaputtgemacht. Die blöde Kuh hat's selbst getan!« schrie er zurück.
Jane begann, vorsichtig die Glasscherben aufzuheben.
»Vielleicht können wir die Schale reparieren«, sagte sie hoffnungsvoll.
»Sei nicht so blöd. Sie ist kaputt.« Plötzlich gab ihre Mutter ihr einen Stoß. Jane sah sie erstaunt an. Ihre Mutter stieß sie wieder, härter. Ihre Finger stachen schmerzhaft in Janes Fleisch. »Siehst du, was du getan hast? Siehst du meine Glasschale?«
»Aber, Mum, ich war nicht mal hier. Ich habe die Schale nicht angefaßt.«
»Es ist deine Schuld! Deinetwegen ist sie zerbrochen! Deinetwegen haben wir angefangen zu streiten. Verdammt noch mal! Warum wurdest du nur geboren ...?«
Jane stand schockiert und sprachlos da. Dieser Satz schien zwischen ihnen in der Luft zu hängen. Ihre Eltern sahen genauso bestürzt wie sie aus. Ihr erster Impuls war zu weinen, aber ein plötzlicher Anflug von Zorn erstickte jedes Gefühl von Selbstmitleid.
»Ich habe nie darum gebeten, geboren zu werden! Gewiß nicht in dieses Loch, das wie eine Hölle ist!« schrie Jane, drehte sich um und hastete blindlings zur Tür hinaus und die Treppe hinauf, in ihr Zimmer. Erst dort, hinter der geschlossenen Tür, ließ sie ihren Tränen der Wut und des Kummers freien Lauf.
Kapitel 2
Jetzt war Tag. Es hatte Tage nach anderen Auseinandersetzungen gegeben, als das Leben einfach wie gewohnt weiterging, doch dieses Mal konnte sich Jane das nicht mehr vorstellen.
Zu den familiären Gewohnheiten zählte auch, daß Janes Mutter nach einem Streit mit ihrem Mann zu ihrer Tochter sagte: »Wäre es nicht deinetwegen, wäre ich längst gegangen ...« Aber sie war nie gegangen. Jane hatte immer angenommen, daß ihre Mutter aus Liebe zu ihr geblieben war. Deshalb konnte sich Jane an keine Zeit erinnern, in der sie nicht Schuldgefühle wegen des Elends ihrer Mutter gehabt hatte und sich als Hindernis betrachtete, das diese Frau davon abgehalten hatte, ein besseres und glücklicheres Leben zu führen. Aber jetzt ... »Warum wurdest du nur geboren?« Wie konnte man jemanden lieben, von dem man wünschte, er wäre nie geboren worden, und wie groß war der Schritt, sich zu wünschen, dieser Mensch wäre tot?
Jane wußte, daß ihr Vater sie nicht mochte – diese Tatsache mußte sie akzeptieren, denn er sagte es ihr häufig. Aber sie war überzeugt, daß es nicht immer so gewesen war. Sie konnte sich an eine Zeit während des Krieges erinnern, als sie auf seinem Schoß gesessen und den Geruch seines Tabaks genossen hatte, während ihr Kopf an seiner Brust lag, der rauhe Serge seiner Uniform ihre Wange kratzte und seine tiefe Stimme in ihrem Ohr dröhnte, als er ihr die Geschichte von Jane Squirrel aus dem einzigen Buch, das er ihr je gekauft und mit »Mit Liebe« signiert hatte, vorlas. Das Buch besaß sie noch immer, aber sie begriff nicht, was seine Einstellung ihr gegenüber verändert hatte. Das war vor langer Zeit gewesen. Natürlich hatte es da diesen Zwischenfall mit dem Vogel gegeben. Vielleicht lag es daran.
Ein Nachbar hatte ihr ein Kätzchen geschenkt, und sie war außer sich vor Freude gewesen, als ihre Mutter ihr erlaubte, es zu behalten. Sie überhäufte das kleine Tier mit Liebe und ergötzte sich an seiner schnurrenden Zufriedenheit. Zwei Wochen, nachdem die Katze in ihr Leben getreten war, streunte sie in einem Garten am Ende der Gasse umher. Die alte Frau, die dort lebte, schleuderte einen Ziegelstein nach der Katze, der das Rückgrat der kleinen Kreatur zerschmetterte. Jane hatte das Tier, aus dessen Mäulchen Blut lief und das sich im Todeskampf wand, gefunden. Es starb in ihren Armen. Ihr Kummer war so groß gewesen, daß ihre Mutter sagte, sie dürfe nie wieder ein Tier haben. Deshalb hatte es sie überrascht, als ihr Vater ihr zum Geburtstag einen Wellensittich in einem Käfig schenkte. Er hatte sich über ihren Mangel an Begeisterung über das Geschenk geärgert. Sie hatte versucht, ihm zu erklären, daß sie Angst habe, noch ein Tier zu verlieren. Auch wollte sie kein armes Geschöpf besitzen, das in einem Käfig eingesperrt war. Vielleicht hatte sie sich ungeschickt ausgedrückt, denn er hatte ihr einen heftigen Schlag versetzt, sie ein undankbares Miststück geschimpft und war in den Pub gestürmt. Er kümmerte sich selbst um den Vogel, und sie konnte heimlich beobachten, wie er seine grünen und gelben Federn streichelte und ihn zärtlich betrachtete. Sie wünschte sich, dieser kleine Vogel zu sein, und ihr Vater würde sie auf diese Weise ansehen und berühren. Vielleicht hatte es an ihrer Einstellung dem Vogel gegenüber gelegen, daß ihr Vater sie nicht mehr liebte.
Jane schlüpfte aus dem Bett. Ihr Vater saß in der Küche vor einer Tasse Tee und las aufmerksam den Daily Mirror. Er ignorierte sie. Sie wusch sich Gesicht und Hände und wünschte wie immer, es gäbe ein Bad, wo sie sich allein waschen könnte. Sie goß sich Tee ein, setzte sich an den Tisch und sah voller Ekel den Nachttopf neben der Hintertür stehen.
»Dad, können wir miteinander reden?« fragte sie nervös.
»Es gibt nichts zu bereden.«
»Aber die Schule bedeutet mir so viel.«
»Ich nehme es an, aber es gibt eine wichtige Lektion im Leben, die du lernen mußt: Man bekommt nicht immer, was man haben möchte. Je früher du das lernst, um so besser.«
»Aber ...«
»Das Thema ist abgeschlossen. Ich gehe in meinen Schrebergarten.« Er zog seine Jacke an und ging zur Tür. »Leer den Pißpott für mich aus«, sagte er und stapfte mit seinen schweren Stiefeln in den Hof hinaus. Sie hörte das Quietschen des Fahrrads, als er es aus dem Schuppen zerrte. Er wollte sie demütigen. Er wußte, wie sie diesen Nachttopf verabscheute, wie sie sich jahrelang geweigert hatte, selbst einen zu benützen und es tapfer vorgezogen hatte, in Kälte und Dunkelheit, mit einer Taschenlampe bewaffnet, aufs Klo im Hof zu gehen. Angeekelt griff sie nach dem Topf und trug ihn vorsichtig in den Hof. Stechender Uringestank stieg ihr in die Nase, als sie den Inhalt hastig ins Klo leerte und die Kette des Spülkastens zog. Zurück in der Küche, erhitzte sie Wasser im Kessel, spülte den Nachttopf aus und schrubbte sich hinterher die Hände mit Lifeboy-Seife.
Dann ging sie ins Wohnzimmer, säuberte den Feuerrost, las sorgfältig die restlichen Glasscherben auf und legte sie in der vergeblichen Hoffnung beiseite, daß damit noch etwas anzufangen sei. Sie schaute sich in dem kleinen Zimmer um, sah das mit Plüsch bezogene Sofa, den abgenutzten Kunstledersessel ihres Vaters, den Eßtisch mit seinen häßlichen, wulstigen Beinen, der den Staub anzuziehen schien, den die Fabrik jeden Tag ausspuckte. Sie rückte das Bild mit den Kamelen in der Sahara zurecht und fragte sich, warum es sie deprimierte. Sie betrachtete sich im Spiegel – mit abgeschrägter Kante, pflegte ihre Mutter stets voller Stolz zu sagen. Sie haßte dieses kleine Haus und diesen häßlichen Raum, dessen untere Wandverkleidung abzublättern begann. Sie haßte dieses Leben, wo Nachbarn aus den Fenstern spuckten, Nachttöpfe geleert werden mußten, und sie wußte mit entmutigender Gewißheit, daß es für sie – sollte sie die Schule nicht weiter besuchen dürfen – kein Entrinnen aus diesem Elend geben würde.
Ihr Leben hatte sich an dem Tag, als sie die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium bestand, auf dramatische Weise geändert. Sie war mit dieser freudigen Nachricht nach Hause geeilt und hatte in atemloser Aufregung und voller Stolz die Neuigkeit verkündet.
»Ach, du lieber Himmel, denk an die Kosten für die Uniform!« war die einzige Reaktion ihrer Mutter.
»Richtig!« stimmte ihr Vater zu. »Das können wir uns nicht leisten. Außerdem ist es eine lächerliche Geldverschwendung. Was für einen Sinn hat die Ausbildung eines Mädchens? Es landet sowieso in der Küche am Spülbecken.«
Für Jane war die Reaktion ihres Vaters das Beste, das hatte passieren können. Wäre er glücklich darüber gewesen, daß sie weiterhin die Schule besuchte, hätte ihre Mutter unweigerlich Einspruch erhoben, so tief war ihr Mißtrauen ihm gegenüber. Da er jedoch erklärte, die Unterschrift für die notwendigen Papiere zu verweigern, sorgte er, ohne es zu wollen, für Janes Zukunft.
Der Besuch der neuen Schule entfremdete Jane ihren Freundinnen in ihrer Straße, die alle zur Realschule gingen und Gymnasiasten haßten, einschließlich Jane. Sie machte mit dem Fahrrad meilenweite Umwege, um jede Begegnung, die oft mit Beschimpfungen und manchmal auch mit Steinwürfen endeten, zu vermeiden. Der Abgrund, der sich zwischen ihr und den Mädchen auftat, betrübte und verwirrte sie. Sie war noch immer derselbe Mensch, eine Uniform konnte das nicht ändern. Sie alle hatten die gleiche Chance gehabt – es war nicht ihre Schuld, daß sie die Prüfung bestanden hatte und die anderen durchgefallen waren. Jetzt hatte sie keine Spielkameradinnen mehr, denn das Vorurteil galt auch für die Freizeit.
Das Gymnasium bot ihr jedoch wundervolle Kompensationen. Sie entdeckte, daß es Menschen gab, die einen zum Lesen ermutigten und Lektüre nicht für reine Zeitverschwendung hielten, wie es ihre Mutter tat. Ihr war nicht erlaubt worden, Mitglied in der Bücherei zu werden, weil ihre Mutter glaubte, Bücher seien schmutzig und voller Bakterien, also mußte sie sich mit den paar Büchern begnügen, die es im Haus gab. Mit zehn hatte sie alle Romane von Dickens gelesen, eine Gesamtausgabe, die ihr Vater bei einer Tombola gewonnen hatte, und das Buch Der Arzt zu Hause. Sie sparte ihr ganzes Taschengeld für Bücher, was ihre Mutter beunruhigte, da sie Tante Vi anvertraute, sie glaube, Jane sei sonderbar im Kopf.
Zum erstenmal lernte sie Musik kennen, die beim Zuhören ihr Gehirn durchflutete und sie traurig machte, wenn sie glücklich war und glücklich, wenn sie traurig war: Musik, die ihr das Gefühl gab, in ihrem jungen Leben sei alles möglich.
Sie entdeckte Bilder, als Drucke an den Wanden und als Abbildungen in großen Bänden in der Bücherei, die sie beflügelten, wie es die Musik getan hatte. Sie las Gedichte, die Gefühle beschrieben, die sie nicht hatte zum Ausdruck bringen können. Anfangs hatte sie den anderen Mädchen in ihrer Klasse gegenüber Hemmungen. Sie sprachen nicht nur mit einem anderen Akzent, sondern besaßen eine Ungezwungenheit und ein Selbstvertrauen im Umgang, die ihr fehlten. Sie fragte sich, woher diese Eigenschaften stammten. Da sie bisher nur in ihrer Gesellschaftsschicht gelebt hatte, war ihr nie der Gedanke gekommen, es könnten andere Kreise existieren. Jetzt, da sie damit konfrontiert wurde, fühlte sie sich nicht wohl und zog sich hinter einen Schutzschild aus Schüchternheit zurück.
Dort wäre sie wohl geblieben, hätte nicht eines der Mädchen, Sylvia, sie eines Tages zum Tee zu sich nach Hause eingeladen. In ihr fand Jane nicht nur eine Freundin, sondern durch Sylvia änderte sich ihre ganze Lebensanschauung auf subtile Weise. Sie war sprachlos vor Überraschung, als sie gefragt wurde, wie sie in der Schule vorankam und wie ihre Pläne für die Zukunft aussähen. Sie hörte dieser Familie zu, die miteinander sprach, und merkte zum erstenmal, wie allein sie zu Hause war. Bisher hatte sie die einsamen Stunden akzeptiert, das Schweigen der Eltern, die kaum miteinander sprachen. Wie hätte sie wissen können, daß sie einsam war, wenn es keine Vergleichsmöglichkeiten gab? Jetzt wurde ihr ihre Situation bewußt, und sie wünschte sich, ihre Eltern wären anders. So sehr sie sich auch den Kopf darüber zerbrach, sie sah keine Möglichkeit, die Dinge zu ändern.
Statt dessen verbrachte sie soviel Zeit wie möglich mit ihrer neuen Freundin. Jane beobachtete aufmerksam das Benehmen, die Gewohnheiten und die Sprechweise ihrer Freunde. Ermahnte die Mutter ihre Tochter, gerade zu sitzen, die Ellbogen vom Tisch zu nehmen, die Sahne weiterzureichen und sich selbst zuletzt zu bedienen, so war es Jane, die diese Ermahnungen befolgte. Die Feinheiten des Umgangs mit dem Besteck, der Unterschied zwischen dem Schneiden und Brechen eines Brötchens waren in Janes Familie unwichtig. Bei ihr zu Hause gab es nur zwei Regeln. Die erste und wohl die wichtigste lautete, den Nachbarn keinen Anlaß zum Gerede zu geben. Die zweite war, »nicht mit Männern rumzumachen«. Jane war sich nicht ganz sicher, was das bedeutete, fühlte jedoch instinktiv, daß diese beiden Regeln irgendwie miteinander im Zusammenhang standen.
Jetzt, nach dem Ultimatum ihres Vaters, drohten alle ihre Träume zu zerplatzen. Und es waren so bescheidene Träume gewesen. Sie hätte gern die Universität besucht, hatte den Gedanken jedoch als zu kostspielig verworfen. Was sie sich am meisten wünschte, war ein Zuhause wie Sylvias und einen Ehemann. Die einzige Möglichkeit, sich diesen Traum zu erfüllen, sah sie in der Fortsetzung ihrer Ausbildung. Sollte sie in der Fabrik zu arbeiten anfangen, würde sie wie ihre Mutter enden und einen Mann wie ihren Vater heiraten. Dann konnte sie ihre Träume von einem Ehemann, der jeden Tag einen Anzug trug, von Porzellangeschirr, das zusammenpaßte, von Regalen voller Büchern und von Schallplatten von Bach und Beethoven vergessen.
Es entsprach nicht der Wahrheit, was ihr Vater gesagt hatte: Sie blickte nicht auf ihre Eltern herab, sie fühlte sich ihnen nicht überlegen, obwohl sie mit jedem Tag mehr wußte als diese. War es nicht natürlich, die angenehme und erfreuliche Lebensweise, die sie kennengelernt hatte, für sich selbst anzustreben? Es gab so vieles, was sie gern mit ihren Eltern geteilt hätte, aber was hatte es für einen Zweck, mit ihnen über Poesie und Kunst zu sprechen? Je mehr sie lernte, um so fremder wurden ihr ihre Eltern.
Kapitel 3
Jane hatte recht gehabt. An diesem Morgen hatte sich alles geändert. Sie hatte sich verändert. Ihr war bewußt geworden, daß sie für sich und die Verwirklichung ihrer Träume kämpfen mußte.
Die Erinnerung an die Bemerkung ihrer Mutter kehrte zurück. Aber sie durfte sich keinen Groll darüber anmerken lassen: Eine Entfremdung zwischen ihr und ihrer Mutter konnte sie sich nicht leisten. Ihre beste Waffe war der Haß ihrer Mutter auf ihren Vater. Er würde seine Meinung nicht ändern. Hatte er einmal einen Entschluß gefaßt, hielt er stur daran fest.
Sie fühlte, daß mit ihrer Trauer eine gewisse Erleichterung verbunden war, als hätte sie das Wissen, daß ihre Mutter wünschte, sie wäre nie geboren worden, von den Schuldgefühlen befreit, die sie ihr Leben lang gequält hatten.
Aber die Erkenntnis, daß ihre Mutter sie nicht liebte, hinterließ eine große Leere in ihr.
Als sie ihre Mutter aufstehen hörte, setzte sie schnell den Wasserkessel auf und räumte das restliche Geschirr weg – wenigstens das würde ihr Freude machen. Ihre Mutter betrat die Küche und warf ihr einen finsteren Blick zu, denn sie war auf irgendeinen Angriff ihrer Tochter gefaßt.
»Ich habe den Kessel aufgesetzt, Mum. Möchtest du etwas essen?«
»Nur Tee«, antwortete ihre Mutter und entspannte sich sichtlich. »Wo ist dein Vater?«
»Im Schrebergarten.«
»Gut. Vielleicht fällt er in ein verdammt großes Loch und kommt nicht mehr heraus! Blöder Kerl!« Sie schlürfte ihren Tee. »Du hast keine Ahnung, was ich mir von diesem Bastard habe gefallen lassen müssen, Jane. Ich hasse ihn, weil er mich um mein Glück betrogen hat.«
»Ich weiß, Mum.« Jane versuchte ein Mitgefühl auszudrücken, das sie nicht empfand.
»Mein Gott, ich wünschte, ich könnte ihn verlassen!«
»Warum tust du es nicht?«
»Sei nicht so verdammt dämlich! Wie kämen wir denn zurecht?«
»Ich könnte den Job in der Fabrik annehmen – schließlich hat er ihn mir schon besorgt – und dich mit dem Geld unterstützen«, entgegnete sie mit einer Mischung von Schuldbewußtsein und Befriedigung über ihre Verschlagenheit.
»Nie im Leben!« wetterte ihre Mutter erregt. »Damit dieser Bastard gewinnt? Du beendest die Schule, und wenn es das letzte ist, wofür ich mich noch in meinem Leben einsetze!«
»Wie willst du das schaffen? Ich könnte eine Studienbeihilfe beantragen, aber die wäre nicht hoch – man muß schon Kriegswaise sein, um Unterstützung zu bekommen.«
»Der Scheißkerl hat es nicht einmal geschafft, im Krieg zu fallen, was eine Hilfe gewesen wäre.«
»Mutter!«
»Nun, wenn ich so denke, ist er schuld daran. Er hat mich dazu gemacht«, verteidigte sie sich und schlürfte geräuschvoll ihren Tee. »Ich weiß noch nicht, wie wir es schaffen, aber mir wird schon etwas einfallen«, fügte sie schließlich hinzu. »Der Bastard braucht nicht zu glauben, er hätte dieses Mal gewonnen.«
Jane fühlte eine leichte Entspannung bei der Gewißheit, daß ihre Mutter das Problem lösen würde und war jetzt überzeugt, daß dies nicht aus Liebe zu Jane, sondern aus Haß auf ihren Mann geschah.
»Wollen wir heute abend ins Kino gehen? Im Plaza läuft ein neuer Film mit Bette Davis.«
»Warum nicht? Wir erledigen die Einkäufe, gehen zum Tee zu Lever's und dann ins Kino. Soll er doch sehen, wie er zurechtkommt!«
»Erinnerst du dich, was beim letzten Bette-Davis-Film passiert ist, den wir uns dort angesehen haben?«
»Nein. Was denn?«
»Zwei Reihen vor uns fiel ein Mann in Ohnmacht. Mitten in der Szene, als Bette Davis ihrem sterbenden Mann seine Pillen nicht geben wollte. Der Lärm und das Getue haben die ganze Spannung verdorben.«
»Du lieber Himmel, jetzt fällt es mir wieder ein. Und du warst so enttäuscht, weil er kein Messer im Rücken stecken hatte, und wir nicht Zeugen eines Mordes waren.« Bei der Erinnerung daran mußte ihre Mutter lachen und erzählte, wie sie Jane wegen ihrer übersteigerten Phantasie gescholten hatte.
Der Tod im Kino hätte einen gewissen Anflug von Romantik gehabt, was man von Janes Erfahrungen mit dem wirklichen Tod nicht behaupten konnte – dem Tod in ihrer Nähe, dem Tod in der Straße, dem Tod in der Familie. Schreckliche Erfahrungen – denn es war üblich und wurde erwartet, daß die Nachbarn den Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen. Dieser Brauch schloß die Kinder sowie alle Anwohner der Straße ein. Man zerrte sie unter heftigem Protest in verdunkelte Vorderzimmer und zwang sie, im flackernden Kerzenlicht die wächserne Leiche anzustarren und dem Wehklagen der Hinterbliebenen zuzuhören. Jane hatte seit dem Tag, als man sie über die Leiche ihres Großvaters im Sarg hielt und sie zwang, sein eiskaltes, starres Gesicht zum Abschied zu küssen, keine Freude mehr beim Anblick von Veilchen. Der süße Duft der Veilchen, die man an sein Spitzenkissen geheftet hatte, erfüllte das Zimmer und würde in ihr immer die Erinnerung an den Tod wecken.
Also gingen sie ins Kino, saßen auf den billigsten Plätzen und aßen Konfekt. Zwischen ihnen herrschte ein beklemmender Waffenstillstand.
Und ihre Mutter löste das Problem, indem sie selbst die Stelle in der Fabrik annahm, die für Jane vorgesehen war. Und Jane, die sich zwar einredete, es mache ihr nichts aus, hatte wieder Schuldgefühle, die sich beim Anblick ihrer erschöpften Mutter noch steigerten.
Ihr Vater sprach jetzt nur noch selten mit ihnen beiden. In mancher Hinsicht war das eine Erleichterung, denn es gab weniger Auseinandersetzungen. Er verbrachte mehr Zeit im Pub, genau wie ihre Mutter es vorhergesagt hatte, und er hielt sein Wort, keinen Penny mehr für Jane auszugeben. Ihr Leben verfiel wieder in die starre Routine des Alltags – gab es Eintopf, mußte Mittwoch sein.
Weil ihre Mutter zur Arbeit ging, gab es ein übel in Janes Leben
den rituellen Waschtag am Montag – nicht mehr. Früher hatte sie den Montag am wenigsten gemocht, wenn der große Waschkessel auf dem Küchenherd erhitzt und die Wäsche hineingestopft wurde. Der widerwärtig süßliche Gestank von kochender Wäsche vermengte sich mit den Küchengerüchen. An besonders windigen Tagen wusch ihre Mutter die Bettdecken. Als Jane klein war, wurde sie in die Zinkwanne gehoben und mußte auf den eingeweichten Decken herumtrampeln. Ihre Mutter schien zu denken, das mache ihr Spaß, aber sie haßte es, haßte das schleimige Sodawasser, das ihre kleinen rosa Füße bleichte und aufschwemmte, bis die Haut ganz schrumpelig war. Sie hatte jedesmal schreckliche Angst, daß ihre Füße nie wieder normal aussehen würden. Montage bedeuteten, daß ihre Mutter von morgens bis abends schlechter Laune war. Auch bei Regenwetter wurde gewaschen, als hielte ihre Mutter das Waschen für ein religiöses Ritual, dessen Nichteinhaltung unweigerlich eine Katastrophe heraufbeschwören könnte. An Regentagen hing das Wohnzimmer voller nasser Wäsche, und der feuchte Geruch breitete sich im ganzen Haus aus. Aber jetzt hatte ihre Mutter eine Waschmaschine gemietet, die jeden Samstagmorgen gebracht wurde. Die Wäsche wurde in einem Viertel der Zeit erledigt, und ihre Mutter war an Waschtagen weniger schlechtgelaunt.
Die Besuche bei ihrer Tante fanden weiterhin statt und boten jetzt ein zusätzliches Vergnügen. Ihr Onkel hatte einen Caravan gekauft, und sie verbrachten manches vergnügliche Wochenende am Meer. Er bezahlte eine zusätzliche Gebühr für seinen Stellplatz, der direkt am Strand des mit Wohnwagen vollgestellten Platzes lag. Jane liebte es, nachts in ihrer Koje zu liegen und dem leisen Zischen der Gaslampe und dem endlosen Plätschern der Wellen auf dem Kiesstrand zuzuhören.
Tante Vi, die stets unförmige schwarze oder kastanienbraune Kleider in dem vergeblichen Versuch trug, ihren Umfang zu kaschieren, war der freundlichste und lustigste Mensch, den Jane je kennengelernt hatte. Bei ihrer Fettleibigkeit hätte ihr Gesicht eigentlich eine konturlose Fläche sein müssen, aber es wurde von dunkelbraunen Augen beherrscht, die stets vor Fröhlichkeit glitzerten. Ihre Herzenswärme und Charakterstärke stellten ihr Aussehen in den Schatten. Jane war vor allem vom Mund ihrer Tante fasziniert. Die Lippen waren voll und weich, und wenn ihre Tante Konfekt aß, umschlossen sie jede Praline mit einem Genuß, der an Sinnlichkeit grenzte und Neid auf diese Zärtlichkeit weckte. Im Caravan gab es keinen Fernseher, der jede Unterhaltung unmöglich machte. So lernte Jane erstmals die geistreiche und schlagfertige Art ihrer Tante kennen, die besondere Freude an Lächerlichkeiten hatte. über irgendwelche körperliche Funktionen konnte sie Tränen lachen. Ganz gleich, welches Gebrechen angesprochen wurde, Tante Vi wußte etwas Lustiges darüber zu sagen. Jane wünschte sich oft, Tante Vi wäre ihre Mutter, was natürlich wieder Gewissensbisse hervorrief.
Ihre Tante hatte einen neuen Zeitvertreib entdeckt. An den Wochenenden, die sie nicht am Meer verbrachten, lud sie Jane und ihr Mutter zu Busfahrten zu den für die Öffentlichkeit zugänglichen Herrenhäuser ein. Keine der beiden Frauen interessierte sich für die ausgestellten Kostbarkeiten, sondern beide richteten ihre kritischen Blicke ausschließlich auf zerschlissene Vorhänge, schäbige Teppiche und Staub auf den Chippendale-Möbeln. Jane hatte den Eindruck, daß der Erfolg eines Ausflugs für die beiden von der Qualität des Tees und der Sauberkeit der Toiletten abhing. Aber Jane liebte diese Besichtigungen und stellte sich während der Führung vor, wie die Räume vor hundert Jahren ausgesehen haben mochten, von Kerzen erhellt, in deren Schein Frauen in langen Kleidern Stickereien anfertigten.
Die Wochenenden und die Ausflüge erwiesen sich als der glücklichste Teil ihrer Kindheit, und Jane würde ihrer Tante immer dafür dankbar sein. In der Gesellschaft ihrer Schwägerin wirkte sogar ihre Mutter gelöster, denn der Unbeschwertheit und Lebensfreude von Tante Vi konnte man sich nicht entziehen. Jane sah ihre Mutter lachen und bekam einen flüchtigen Eindruck von der sorglosen Frau, die sie früher gewesen sein mußte. An diesen Wochenenden wich die Verbitterung aus ihrem Gesicht, und ihre Lippen, gewöhnlich eine schmale, strenge Linie, entspannten sich und lächelten. Aber am Sonntagabend, bei der Rückkehr nach Hause, war ihre gute Lauen wie weggewischt. Ihre Augen waren wieder zusammengekniffen und voller Mißtrauen, und um ihren Mund lag ein gemeiner Zug.
Jane hatte das Gefühl, daß sich im Verlauf ihrer Kindheit zwei Wesen in ihr entwickelten: Das Mädchen in der Schule, das lachen und scherzen konnte und voller Ideen steckte; und das Mädchen zu Hause, die Launische, wie ihre Mutter sie nannte. Ihre Mutter verzweifelte an Janes Aussehen. Mrs. Reeds Schönheitsideal war eine Cousine von Jane, die blondes Haar, eine kecke kleine Nase und den nichtssagenden Gesichtsausdruck einer Puppe hatte. Da Janes Eltern braune Augen hatten, betrachteten sie Janes graue Augen mit Argwohn, als hielten sie ihre Tochter für einen Wechselbalg. Als Jane noch ein kleines Kind gewesen war, hatte ihre Mutter ihr jeden Abend das Haar über Stoffstreifen gewickelt. Die neckischen Löckchen standen in krassem Gegensatz zu ihrem markanten Gesicht. Schließlich hatte sie die vergeblichen Versuche, aus Janes glattem Haar einen Lockenkopf zu machen, aufgegeben und ihr einen Pony schneiden lassen, der ihr nicht stand. Mit vierzehn beschloß Jane, ihr glattes Haar wachsen zu lassen.
Es war daher eine Überraschung für sie, als sie mit sechzehn feststellte, daß Jungen nicht die Ansicht ihrer Mutter bezüglich ihres Aussehens teilten.
Jetzt gehörte sie zu einer Gruppe von Jugendlichen, die vom Tennisclub zum Jugendclubball wirbelte, die zur Küste radelte und das Hügelland an der Süd- und Südostküste Englands durchwanderte, unzählige Tassen Kaffee trank, die Welt in Ordnung brachte und miteinander flirtete. Ein paarmal, wenn sie einen Jungen attraktiv fand, da er ein merkwürdiges Kribbeln in ihrem Bauch verursachte, war sie allein mit ihm ausgegangen. Voller Aufregung und Erwartung war sie zur Verabredung gegangen und voller Bestürzung und Verärgerung über die plumpen Küsse und zudringlichen Berührungen heimgekehrt. Schweißfeuchte Hände und unbeholfene Pettingversuche vernichteten dieses merkwürdige Gefühl in ihr und erhob sie gewiß nicht zu jenen Höhen der Leidenschaft, von denen die Dichter sprachen.
Ihre Schulzeit näherte sich dem Ende. Sie lehnte das Angebot ihrer Mutter, ein Studium an der Universität zu beginnen, ab. Sie konnte die Schuldgefühle, daß ihre Mutter arbeitete, um ihre Ausbildung zu finanzieren, nicht länger ertragen. Mit knapp achtzehn wußte sie nicht, was sie mit sich anfangen sollte. Die einzige Entscheidung, die feststand, war, keine Arbeit in einem Büro anzunehmen. Eine ihrer Lehrerinnen schlug vor, Krankenschwester zu werden. Darüber hatte sie nie nachgedacht, aber dieser Beruf bot gewisse Vorteile – sie würde während der Ausbildung bezahlt werden, interessante Menschen kennenlernen, in London sein und von zu Hause wegkommen. So begann sie, ohne ein Gefühl der Berufung, nur aus dem Bedürfnis heraus, eine Fluchtmöglichkeit zu finden, ihre Zukunft als Krankenschwester zu planen.
Kapitel 4
Da Jane die Krankenhäuser in London nicht kannte, bewarb sie sich bei dem einzigen, von dem sie gehört hatte St. Thomas. Als das Bewerbungsformular ankam, in dem die Referenz eines Geistlichen verlangt wurde, zerriß Jane es. Ihre Kirchenbesuche hatten sich auf ihre Taufe und eine kurze Periode in der örtlichen Methodistenkapelle beschränkt, deren Sonntagsschule sie nicht aus Glaubenseifer besucht hatte, sondern weil die Gemeinde die schönsten Ausflüge veranstaltete. Es machte ihr Sorgen, daß vielleicht alle Krankenhäuser den Segen der Kirche verlangten.
»Da, schau dir das an.« Ihre Mutter reichte ihr die Tageszeitung. »Wenn es gut genug für sie ist, dürfte es auch deinen Ansprüchen genügen!«
Jane überflog den Artikel, der von einem Gerücht berichtete, daß eine ausländische Prinzessin in einem Londoner Lehrkrankenhaus eine Ausbildung zur Krankenschwester absolvieren wolle.
»Wahrscheinlich verlangen sie wie die anderen die Referenz eines Vikars.«
»Ach komm! Versuch's einfach. Stell dir vor, du könntest mit Adeligen plaudern!« Ihre Mutter schien dieser Gedanke zu amüsieren.
»Es ist nur ein Gerücht, Mum. Immerhin steht hier der Name eines anderen Krankenhauses, und wenn die Prinzessin ihm die Ehre gibt, muß es gut sein.«
»Ich verstehe nicht, warum es ein Krankenhaus in London sein muß. Ein übler Ort, diese Stadt – dort könntest du in allerhand Schwierigkeiten geraten. Was hast du am hiesigen Krankenhaus auszusetzen? Hier könnte ich dich im Auge behalten.«
»Ich möchte die beste Ausbildung haben, Mum.« Das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Natürlich war es logisch, sich um die beste Ausbildung zu bewerben, aber der Hauptgrund für ihre Entscheidung war ihr Wunsch, von zu Hause fortzukommen. Und das konnte sie ihrer Mutter nicht sagen. Es war ermutigend, daß sich dieses Krankenhaus nicht dafür interessierte, was die Kirche von ihr hielt, konnte sie dem neuen Formular entnehmen. Sie schickte die Bewerbung ab, und zwei Monate später kaufte sich Jane von dem Geld, das sie als Teilzeitserviererin verdient hatte, eine Fahrkarte und fuhr mit dem Zug zum Vorstellungsgespräch nach London.
Da der Gedanke, Krankenschwester zu werden, eigentlich eine Notlösung war, war sie überhaupt nicht nervös, als sie das viktorianische Gebäude betrat und zum erstenmal diese Krankenhäusern eigene Geruchskombination aus gekochtem Kohl, Desinfektionsmitteln und Bohnerwachs wahrnahm.
Das Wartezimmer, in das sie geführt wurde, war bereits voller Mädchen. Da es keinen Sitzplatz gab, lehnte sie sich gegen die Wand. Es herrschte eine bedrückende Atmosphäre, und Jane fiel auf, daß keines der Mädchen stillsitzen konnte. Sie rutschten auf ihren Stühlen hin und her, entfernten imaginäre Fussel von ihren Kleidern, betasteten ihr Haar und zerrten an ihren Taschentüchern herum. Dauernd klickten Handtaschenverschlüsse, wurden Spiegel herausgenommen und ängstliche Gesichter kritisch betrachtet. Die Spannung war ansteckend, und bald ertappte sich Jane dabei, wie sie ihren Rock glättete und an ihrem Haar herumzupfte.
Die Tür wurde geöffnet, und ein Mädchen, das Gesicht starr vor Anspannung, trat heraus. Die anderen sprangen auf.
»Wie war's?« fragten mehrere.
»Es war fürchterlich«. Das Mädchen plumpste auf einen Stuhl, der ihr fürsorglich von einer Leidensgefährtin angeboten wurde. »Was hat sie dich gefragt?«
»Ich weiß es nicht mehr! Es tut mir leid, aber ich kann mich an nichts erinnern.« Sie schlug die Hände vors Gesicht.
Ein Name wurde aufgerufen und Rufe, wie »Viel Glück«, folgten dem nächsten Mädchen, als es hinter der Tür mit der Aufschrift »Oberin« verschwand.
Stimmengewirr erhob sich und steigerte die Spannung, als ein paar gutunterrichtete Mädchen mit Statistiken von Bewerberinnen und Mangel an Ausbildungsplätzen aufwarteten. Jane begann zu bereuen, Fahrgeld für ein offensichtlich vergebliches Unterfangen vergeudet zu haben.
Als ihr Name aufgerufen wurde, war sie völlig von der Nervosität der anderen angesteckt. Ihre Hände waren feucht, und ihr Magen verkrampfte sich vor Angst.
Sie nahm nichts von dem Zimmer wahr, das sie betrat, denn die Gegenwart einer Person, die eine Aura absoluter Autorität ausstrahlte, ließ ihren Hals plötzlich so trocken werden, daß sie fürchtete, kein Wort herauszubringen. Sie sah nur, wie das Weiß des Kragens und der Manschetten von der marineblauen Uniform der hageren Frau abstach, deren aufrechte Haltung Jane unwillkürlich die Schultern straffen ließ.
»Nehmen Sie Platz«, sagte die Oberin mit fester und erstaunlich tiefer Stimme. Jane setzte sich und fand sich dem kritischen Blick aus blauen Augen ohne einen Anflug von Wärme ausgeliefert, der ihre Kleidung zu durchdringen und zu prüfen schien, ob ihre Unterwäsche sauber war. Dieser starre Blick brachte Jane in Verlegenheit, und sie musterte eingehend ihre Hände.
»Warum wollen Sie Krankenschwester werden?« herrschte die Oberin sie an.
»Ich ...« Jane räusperte sich. »Ich kann es mir nicht leisten, auf die Universität zu gehen, Miss.«
»Welchen Beruf hat Ihr Vater?«
»Er ist Lagerarbeiter in einer Fabrik. Meine Mutter arbeitet in derselben Fabrik am Fließband. Sie stellen Schrauben und Bolzen und solche Sachen her ...« Ihre Stimme verlor sich, als die Frau hinter dem Schreibtisch Notizen auf einen Block kritzelte. Sie hörte auf zu schreiben und starrte Jane wieder mit ihren ausdruckslosen Augen an. Jane merkte, daß mehr von ihr erwartet wurde. »Sehen Sie, Miss, ich möchte nicht, daß meine Mutter weiterarbeitet, es ist zu anstrengend für sie. Es wird Zeit, daß ich mir meinen Lebensunterhalt selbst verdiene.« Da ihr keine weiteren Erklärungen einfielen, musterte sie wieder ihre Hände.
»Zur Krankenpflege gehört etwas mehr als die Lohntüte am Ende des Monats.«
»Oh, das weiß ich, Miss.«
»Glauben Sie, dafür berufen zu sein?«
Das war eine Frage, über die Jane hätte nachdenken müssen, was sie aber nicht getan hatte. Jetzt bereute sie, sich nicht besser auf dieses Vorstellungsgespräch vorbereitet zu haben.
»Was? Wie eine Nonne ...« Jane kicherte nervös und suchte verzweifelt nach der richtigen Antwort. Die Oberin ließ sie nicht aus den Augen. »Es tut mir leid, Miss. Das ist eine sehr ernste Frage, nicht wahr?«
»Alle meine Fragen sind ernst, Miss Reed.«
»Nun, wenn ich ehrlich bin, nein. Ich habe mich beworben, weil mir kein anderer Beruf einfiel und ich in keinem Büro arbeiten möchte.«
»Das ist wohl kaum ein Grund, den Beruf einer Krankenschwester erlernen zu wollen.«
»Nein, Miss. Aber ich habe darüber nachgedacht und glaube, daß die Krankenpflege eine interessante Arbeit und Training für meinen Geist ist. Und ich lerne gern Menschen kennen. Ich glaube, es wäre für mich ein zufriedenstellender Beruf ... Miss.« Sie beobachtete deprimiert, wie sich die Oberin weitere Notizen machte. Zweifelsohne war es eine dumme Antwort gewesen, aber die einzig mögliche. Sie hätte nicht lügen können. Diese eiskalten Augen, die sie durchbohrten, machten jede Lüge unmöglich.
»Sagen Sie mir, Miss Reed, wie würden Sie bei einer postoperativen Kolostomie reagieren? Eine Kolostomie ist die chirurgische Öffnung des Unterleibs, durch die übelriechende Fäkalien entleert werden«, erklärte die Oberin. Es lag wohl am sachlichen Ton, daß Jane überhaupt über diese grauenvolle Vorstellung nachdenken konnte.
»Ich halte es für das Wichtigste, dem Patienten kein Gefühl von Abscheu zu zeigen, das man bei dem Anblick und dem Geruch wahrscheinlich hat. Er befindet sich sicherlich in einem sehr sensitiven Zustand.«
»Ich verstehe.« Weitere Notizen wurden gemacht. »Welche Qualitäten sollte Ihrer Meinung nach eine Krankenschwester haben?«
Zufrieden mit ihrer Antwort entspannte sich Jane für einen Augenblick. »Sie sollte gut zu Fuß sein.« Jane hüstelte nervös. »Ich meine, sie sollte stark sein«, fügte sie hastig hinzu. »Und vernünftig. Sie muß Menschen mögen und Humor haben«, beendete Jane den Satz hastig, weil sie mittlerweile das Gefühl hatte, alles wäre sinnlos. Sie wollte nur noch aus diesem Zimmer fliehen.
»Glauben Sie, diese Qualitäten zu besitzen?«
»Ja«, antwortete Jane prompt.
»Stehen Sie bitte auf und kommen Sie hierher, Miss Reed. Würden Sie bitte Ihren Rock anheben?«
Jane tat, worum sie gebeten wurde und kam sich sehr albern vor, als die Oberin gründlich ihre Beine musterte.
»Es ist ein bißchen wie das Vorspielen bei einer Revuetanzgruppe, nicht wahr, Miss?« witzelte sie, um ihre Verlegenheit zu überwinden.
»Ihre Beine sind sehr wichtig. Sie müssen kräftig sein, um stundenlange Belastungen auszuhaken. Nebenbei bemerkt: Reden Sie mich mit Frau Oberin an, nicht Miss. Ich bin keine Lehrerin.«
»Entschuldigen Sie bitte, Frau Oberin.«
»Danke, Miss Reed. Nach Beendigung unseres Gesprächs findet eine Führung durchs Krankenhaus statt. Innerhalb einer Woche bekommen Sie von mir Bescheid.« Die Oberin wandte ihre Aufmerksamkeit wieder ihren Notizen zu. Jane hob deprimiert ihre Handtasche vom Boden auf, drehte sich um, öffnete eine Tür und marschierte direkt in einen Wandschrank. Einen irren, hysterischen Augenblick lang dachte sie daran, die Tür zu schließen und sich zu verstecken, in der Hoffnung, die Oberin hätte sie nicht gesehen.
»Die Tür ist links von Ihnen, Miss Reed«, verkündete die humorlose Stimme.
Im Wartezimmer wurde Jane von den anderen umringt und mit Fragen überhäuft.
»Fragt mich nichts! Es war schrecklich. Ich sagte, ich fühle mich nicht berufen und marschierte in einen verdammten Schrank.« Ohne den Kommentar der anderen über ihre verpfuschte Unterredung abzuwarten, zog sie ihren Mantel an, verzichtete auf die Führung durchs Krankenhaus und ging zum Bahnhof zurück.
Eine Woche später kam der Brief vom Krankenhaus. Jane konnte den Inhalt des Schreibens nicht glauben. Sie war akzeptiert worden. Auf irgendeine mysteriöse Weise waren ihre Antworten richtig gewesen. Sie mußte noch lernen, daß eine Krankenschwester am wenigsten von einem brennenden Gefühl der Berufung getrieben werden durfte, da solche Menschen für diesen Beruf untauglich waren. Weder wußte sie, daß ihre hilflosen kleinen Witze trotz ihrer Nervosität von Humor gezeugt hatten, noch daß starke Beine und ein kräftiges Rückgrat ihre größten Verbündeten sein würden. Sie mußte auch noch lernen, daß die Oberin kein Dummkopf war und den Charakter eines Menschen mit einem Blick aus ihren kalten, blauen Augen einschätzen konnte.
Jane war außer sich vor Begeisterung. Plötzlich war die Krankenpflege der schönste Beruf auf der Welt.
Sechs Monate später stand Jane mit ihrer Mutter auf dem Bahnsteig und wartete auf die Ankunft des Zugs nach London.
»Schreibst du mir?«
»Natürlich schreibe ich. Bestimmt antwortest du nicht!«
»Mach keine Dummheiten!«
»Nein, Mum.«
»Du weißt schon, laß keine dreckigen Kerle mit dir rummachen.«
»Nein, Mum.«
»Und zieh immer saubere Unterwäsche an.«
»Ja, Mum, ›im Falle eines Unfalls‹, ich weiß, Mum.« Sie grinste.
Jetzt standen beide in peinlichem Schweigen da, sie hatten sich nichts mehr zu sagen und wünschten, der Zug würde endlich kommen.
Als der Zug einfuhr, eilte Jane zu einem leeren Abteil.
»Nein, Jane. Steig in der Mitte ein.«
»Warum? Was stimmt mit den vorderen Abteilen nicht?«
»Im Falle eines Unfalls besteht in der Mitte die geringste Gefahr.«
»Mum, deine Welt ist voll von möglichen Unfällen.«
»Man muß immer vorsichtig sein. Denn man kann nie wissen, wann dieser Bastard da oben etwas auf einen runterwirft.« Jane lachte über die respektlose Bemerkung ihrer Mutter und ließ sich ergeben in ein Abteil in der Mitte des Zuges schieben. »Und«, fügte ihre Mutter hinzu, »reise immer in einem Abteil mit anderen Frauen.«
»Ich weiß, ich weiß, damit ich nicht vergewaltigt werde! O Mum, hör bitte auf, dir Sorgen zu machen. Ich fahre doch nur nach London.«
Ihre Mutter wirkte nicht überzeugt, daß ihre Mahnungen befolgt werden würden. Sie kletterte zurück auf den Bahnsteig und schaute zu Jane hoch, die sich aus dem Fenster lehnte und mit Bestürzung feststellte, wie klein und verletzlich ihre Mutter aussah und wie einsam sie plötzlich zu sein schien.
»Mach dir keine Sorgen, Mum. Mir wird nichts passieren.«
»Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen um einen großen Klotz wie dich.« Aber sie lachte nicht, und ihre Stimme klang gezwungen, als bereite ihr das Sprechen Schwierigkeiten. Sie sah niedergeschlagen aus.
»Mum, sei bitte nicht traurig.«
»Ich bin nicht traurig. Wohl eher froh, dich endlich vom Hals zu haben«, antwortete ihre Mutter lächelnd, aber das Lächeln zerfiel und wich aus ihrem Gesicht wie schmelzendes Wachs. »Mum ...!« Eine Dampfwolke zischte aus der Lokomotive und hüllte ihre Mutter ein. »Mum ...« Der Zug rollte an, und der Lärm verschluckte alle Worte. Sie lehnte sich aus dem Fenster und warf ihrer Mutter eine Kußhand zu, zweifelte jedoch, ob sie diese Geste wegen des Dampfes gesehen hatte.