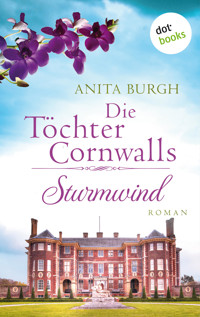Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Untrennbar verbunden in Liebe und Schmerz: Der berührende Schicksalsroman »Wo deine Küsse mich finden« von Anita Burgh jetzt als eBook bei dotbooks. Wie lange kannst du vor deiner Vergangenheit davonlaufen? Kitty Lawrence scheint alles zu haben, was sie sich wünschen kann: eine Karriere als umjubelte Opernsängerin, ein Leben im Luxus und einen Mann, um den sie viele Frauen beneiden würden. Und doch gibt es da diese Wunde in Kittys Seele, die niemals verheilen kann: Warum hat ihre Mutter immer nur ihre Schwester Lana gefördert, die an diesen großen Erwartungen zu zerbrechen drohte … und warum hat auch der charmante Slim immer nur Lana gesehen, statt Kittys zarte Gefühle zu erwidern? Als Kitty nach vielen Jahren des Schweigens die Nachricht erhält, dass ihre Mutter schwer erkrankt ist, eilt sie an ihr Krankenbett – und begreift, dass es Zeit ist, sich den Schatten der Vergangenheit zu stellen. Aber wird es ihr gelingen, Lana zu finden, die spurlos verschwunden ist … und ihr eigenes Glück? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der gefühlvolle Schicksalsroman »Wo deine Küsse mich finden« von Anita Burgh. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 814
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wie lange kannst du vor deiner Vergangenheit davonlaufen? Kitty Lawrence scheint alles zu haben, was sie sich wünschen kann: eine Karriere als umjubelte Opernsängerin, ein Leben im Luxus und einen Mann, um den sie viele Frauen beneiden würden. Und doch gibt es da diese Wunde in Kittys Seele, die niemals verheilen kann: Warum hat ihre Mutter immer nur ihre Schwester Lana gefördert, die an diesen großen Erwartungen zu zerbrechen drohte … und warum hat auch der charmante Slim immer nur Lana gesehen, statt Kittys zarte Gefühle zu erwidern? Als Kitty nach vielen Jahren des Schweigens die Nachricht erhält, dass ihre Mutter schwer erkrankt ist, eilt sie an ihr Krankenbett – und begreift, dass es Zeit ist, sich den Schatten der Vergangenheit zu stellen. Aber wird es ihr gelingen, Lana zu finden, die spurlos verschwunden ist … und ihr eigenes Glück?
Über die Autorin:
Anita Burgh wurde 1937 in Gillingham, UK geboren und verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in Cornwall. Ihre 24 Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und feierten international Erfolge. Mittlerweile lebt Anita Burgh mit ihrem Mann und zwei Hunden in einem kleinen Dorf in den Cotswolds, Gloucestershire.
Bei dotbooks veröffentlichte Anita Burgh ihrer Romane »Das Erbe von Respryn Hall«, »St. Edith’s: Hospital der Herzen«, »Glückssucherinnen«, »Der Weg zum Herzen einer Frau«, »Das Lied von Glück und Sommer«, »Wo unsere Herzen wohnen« und »Die Liebe eines Fremden«.
Außerdem veröffentlichte Anita Burgh bei dotbooks ihre Familiensaga »Die Töchter Cornwalls« mit den drei Einzelbänden: »Morgenröte«, »Sturmwind« und »Dämmerstunde«
***
eBook-Neuausgabe November 2020
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »Ouvertures« bei Macmillan, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1996 unter dem Titel »Ouvertüren der Liebe« bei Knaur.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1993 by Anita Burgh
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1996 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Shutova Elena, ventdusud
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-262-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Wo deine Küsse mich finden« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anita Burgh
Wo deine Küsse mich finden
Roman
Aus dem Englischen von Traudl Weiser
dotbooks.
Für meine Tochter Kate mit Liebe
We – are we not formed, as notes of music are, For one another, though dissimilar?
R B. SHELLEY (1792–1822)
Präludium1982
Vorn Fußende des Krankenhausbetts aus beobachtete Kitty die Patientin gespannt, dann sah sie auf ihre Uhr. Sollte die Frau sterben, so hoffte Kitty, daß es schnell geschehen möge.
Sie zog ihren Mantel enger um sich. Fror sie, weil die Zimmertemperatur nachts auf der Station niedriger war oder wegen dieser besonderen Umstände, oder weil ihre Gedanken sie erschaudern ließen? Sie konnte sich nicht erinnern, jemals derart gefroren zu haben, nicht einmal in Schweden. Denn dieses eisige Gefühl hatte sie ganz und gar durchdrungen, es ging bis ins Mark.
Sie war müde, geistig erschöpft. Um den halben Globus war sie geflogen, um hier zu sein, und nun, da sie hier war, wußte sie, daß ihre erste Reaktion – nicht zu kommen – richtig gewesen war.
»Möchten Sie eine Tasse Tee, Miss Lawrence?«
Kitty wandte sich um.
»Das wäre nett von Ihnen«, sagte sie zu der drallen, reizlosen Schwester. »Ohne Zucker«, fügte sie hinzu und lächelte diesmal, ein strahlendes, perfektes Lächeln, das ihre Augen nicht erreichte.
Den eisernen Rahmen des Betts umklammernd, wandte sie sich wieder der Patientin zu, die sich unter ihren Laken kaum rührte; ihr Atem ging so flach, daß man sie fast für tot halten konnte. Kitty betrachtete eine Fremde. Es mußte diese Krankheit sein und diese Umgebung, die die Frau all dessen beraubt hatte, was einmal ihr Selbst gewesen war. Oder war sogar sie daran schuld? Sie hatte nur das Wort der Schwester dafür. Wie lange war es her, seit Kitty die ihr jetzt so Fremde zum letztenmal gesehen hatte? Wie viele Jahre waren verstrichen? Und Menschen ändern sich ...
»Hoffentlich habe ich nicht zuviel Milch hineingegeben«, sagte die Schwester in einem so lauten Flüstern, daß sie nicht hätte zu flüstern brauchen.
»Es ist gut so«, erwiderte Kitty, ohne den Tee auch nur anzuschauen.
»Ich stelle die Tasse auf die Kommode. Sie können sich hier hinsetzen.« Die Schwester schob bereits einen Stuhl ans Kopfende des Betts. »Wenn sie aufwacht, wird sie Sie dann sofort sehen«, sagte sie freundlich.
»Ich trinke meinen Tee hier, Schwester.«
»Oberschwester«, korrigierte sie und lächelte mit der geduldigen Resignation eines Menschen, der das oft tat.
»Entschuldigen Sie, Oberschwester. Ich stehe lieber«, sagte Kitty schnell. »Das Flugzeug – ich habe stundenlang gesessen«, fügte sie erklärend hinzu, denn ihr wurde mit aufsteigender Panik bewußt, daß von ihr erwartet wurde, neben der Patientin zu sitzen und sie sogar zu berühren.
»Natürlich. Häßliche, unbequeme Dinger, diese Flugzeuge«, entgegnete die Oberschwester tröstend und gab Kitty die Tasse mit der Untertasse. Kitty nahm einen Schluck und unterdrückte gerade noch eine Grimasse wegen des viel zu starken Milchgeschmacks. »Fühlen Sie sich wohl? Sicher wäre es besser, Sie würden sitzen«, meinte die Oberschwester, als sie sah, daß die Tasse in Kittys Hand zitterte.
»Ja. Es geht mir gut. Ich friere bloß entsetzlich. Wie können Ihre Patienten nur bei diesen Temperaturen überleben?«
»Ich bringe Ihnen den Stuhl«, sagte die Oberschwester, die plötzlich begriff. Sie hatte täglich mit dem Tod Umgang, doch die meisten Menschen fürchteten sich vor ihm und wollten nicht mit ihm in Berührung kommen.
Kitty sank auf den Stuhl, der jetzt am Fußende des Betts stand. Sie hielt die Tasse in die Höhe. »Es tut mir leid, daß ich Ihnen Umstände mache, aber ich möchte den Tee jetzt nicht trinken.« Die Oberschwester nahm Tasse und Untertasse. »Ist sie ...« Kitty deutete mit dem Kopf auf die Gestalt im Bett. Sie konnte nicht formulieren, was sie sagen wollte.
»Sie ist eine richtige Kämpferin. Letzte Nacht ...« Die Oberschwester zuckte mit den Schultern, beugte sich nieder, und diesmal flüsterte sie wirklich. »Letzte Nacht stand es auf des Messers Schneide. Aber der menschliche Körper ist etwas Wundervolles, Miss Lawrence. Sehen Sie, ich wäre nicht überrascht, wenn sie es noch einmal schaffte.«
»Oh, ich verstehe«, erwiderte Kitty und war leicht verärgert, weil sie die lange Reise umsonst gemacht hatte.
»Aber schließlich ...« Die Oberschwester straffte ihre runden Schultern. »Wer kann schon was Definitives wissen?«
Plötzlich bewegte sich etwas im Bett. Die Oberschwester eilte zu ihrer Patientin, fühlte ihr den Puls, strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht und beugte sich über sie. »Wer hat denn da Besuch bekommen? Ist das nicht eine schöne Überraschung?« Sie richtete sich wieder auf. »Nur ein paar Minuten, denn wir wollen sie nicht ermüden. Nein, das wollen wir nicht, oder?« sagte sie fröhlich und machte Kitty Platz.
Langsam und angespannt stand Kitty auf und stellte sich neben den Kopf der Patientin. Die Lampe strahlte ein unheimliches blaues Licht aus, das die scharfen Linien in dem ausgezehrten Gesicht betonte.
»Ist das Lana!« Die Frau sprach mit dem heiseren Krächzen eines Menschen, der längere Zeit nicht geredet hatte. Müde winkte sie mit der Hand, die so dünn war, daß sie wie eine Vogelklaue wirkte. Kitty wich vor dieser nach Berührung tastenden Hand zurück, die ihr wie suchende Tentakel eines Geschöpfs aus dem Meer vorkam. »Lana? Endlich. Warum hast du so lange gebraucht, mein Liebling?«
Zögernd streckte Kitty ihre Hand nach der suchenden aus; Mitleid siegte über Ekel.
»Nicht Lana ist hier. Ich bin's, Kitty ...«
Völlig überraschend öffnete die Frau die Lider und starrte Kitty aus blauen Augen an.
»Was hast du hier zu schaffen?« Ihre Stimme war anklagend, ihre Hand fiel enttäuscht auf die Bettdecke zurück. »Ich will dich nicht. Wer hat dich kommen lassen? Ich will Lana.« Jetzt war die Stimme schmeichlerisch. Kitty steckte ihre Hand in die Manteltasche. In Sicherheit.
»Ich weiß nicht, wo Lana ist«, sagte sie.
»Dann finde sie. Das kannst du doch für mich tun, nicht wahr?« Das Sprechen strengte sie an; sie rang nach Atem.
»Ich will sehen, was sich machen läßt.«
»Und beeil dich.«
»Es könnte eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.«
»Ich habe keine Zeit mehr.« Die Patientin seufzte wütend.
»So darfst du nicht reden. Natürlich hast du Zeit ...« Kitty versuchte ermutigend zu klingen.
»Verdammt noch mal, rede nicht mit mir wie diese blöden Krankenschwestern. Ich bin kein Kind mehr!« Wegen der Anstrengung beim Sprechen fing sie an zu husten, der ausgemergelte Körper wurde krampfhaft geschüttelt. Von Panik ergriffen, hielt Kitty nach einer Schwester Ausschau. »Wasser ...« Die dünne Hand wedelte kraftlos in der Luft. »Wasser ...«
Kitty beugte sich vor, legte ungeschickt ihren Arm um die Kranke und richtete sie ohne Anstrengung in eine sitzende Position auf, denn sie wog so wenig. Kitty ließ sich auf dem Bettrand nieder und stützte sie mit ihrem Körper. Mit der anderen Hand hielt sie die Schnabeltasse an den Mund der Patientin. Diese trank gierig und fiel dann erschöpft in die Kissen zurück, wobei sie Kittys Arm einklemmte. Ein dünner Schweißfilm bedeckte das Gesicht der Frau. Kitty wußte, daß sie ihr den Schweiß abwischen sollte, aber sie wußte auch, daß sie es nicht konnte. Behutsam zog sie ihren Arm unter dem Körper der Kranken hervor.
Sie blickte hinab und sah, daß die blauen Augen sie flehend anschauten.
»Hol mich hier raus, Kitty. Laß mich auf die Privatstation verlegen.«
»Ja. Ich verspreche es dir.«
»Und finde Lana.«
»Ja.«
»Wenn du sie gefunden hast, kommst du wieder.« Und die Augen schlossen sich, als ob sie schliefe. Aber Kitty wußte, daß sie entlassen war.
Kitty nahm ihre Handtasche vom Boden und ging, ohne einen Blick zurückzuwerfen, schnell auf das helle Büro zu, wo die Oberschwester und zwei Schwestern saßen. Die beiden Schwestern strickten emsig.
»Sie gehen schon, Miss Lawrence?« Die Oberschwester stand auf, als Kitty in der offenen Tür erschien.
»Ja. Sie möchte ein Privatzimmer haben. Wie kann ich das bekommen?« Kitty redete schnell.
»Ich habe nicht bemerkt, daß sie hier bei uns unglücklich gewesen ist«, erwiderte die Oberschwester sichtbar verärgert. »Das hat nichts mit Ihnen oder Ihren Kolleginnen zu tun. Ich bezweifle, daß man es ihr irgendwo recht machen kann.«
»Ich informiere die Tagesschwester«, sagte die Oberschwester widerstrebend. »Sie wird veranlassen, daß die Patientin in den Privatflügel verlegt wird. Möchten Sie, daß derselbe Arzt sie behandelt, oder soll ein Arzt Ihrer Wahl die Behandlung fortsetzen?« Noch immer besaß ihre Stimme einen eisigen Unterton.
»Nein. Der jetzige ist sicher der beste.« Kittys Antwort schien die Schwester zu besänftigen, denn sie lächelte unerwartet.
»Ich habe Ihre private Telefonnummer nicht, Miss Lawrence – nur für den Fall ... Sie wissen schon. Wir haben zwar die Nummer Ihres Agenten, aber der ist bloß während der Bürostunden erreichbar.«
»Ich gebe Ihnen seine Privatnummer, denn ich werde nicht dasein.«
»Sie bleiben nicht hier?«
»Nein. Ich denke, das ist nicht nötig. Schicken Sie die Rechnungen an meinen Agenten. Er wird sich darum kümmern.«
Kitty warf einen Blick in den schwach beleuchteten Gang. »Ich glaube, das ist dann alles«, sagte sie wie jemand, der, gern gehen möchte, aber nicht weiß, wie man es geschickt anstellt. »Ich danke Ihnen, Ihnen allen.« Sie schenkte den dreien eines ihrer glatten, professionellen Lächeln und wollte sich zum Gehen wenden.
»Miss Lawrence.« Die Oberschwester streckte die Hand aus, um Kitty zurückzuhalten. »Es wäre mir lieber, Sie hinterließen uns eine Telefonnummer, unter der Sie direkt zu erreichen sind. Die Patientin könnte sterben, sogar heute nacht. In Fällen wie diesem ist man niemals sicher.«
»O nein, Oberschwester, das wird sie nicht tun. Sie werden meine Mutter noch für eine ganze Weile haben«, erwiderte Kitty und ging. Die drei hörten ihre hohen Absätze auf dem Fußboden klicken und warteten auf das Geräusch der Schwingtür. »Na, das ist aber eine – kalt wie Hundeschnauze«, sagte die Stationsschwester.
»Macht ihr das denn überhaupt nichts aus?« fragte die Lernschwester. »Ihre Mutter ist doch so eine nette Dame, die sich nie beklagt.«
»Es ist schon seltsam, daß sie ihre schwerkranke Mutter allein läßt«, meinte die Stationsschwester und gab im Rhythmus ihrer klappernden Nadeln mißbilligende Geräusche von sich. »Wie ich diese arme Frau bedaure!«
»Ich weiß nicht recht, Schwester. Während meiner Berufsjahre habe ich eine Menge gesehen. Miss Lawrence war nervös, sie zitterte und beklagte sich über die Kälte im Zimmer – sie steht unter einem leichten Schock, würde ich sagen. Wir kennen doch nie die ganze Geschichte, oder? Was in der Vergangenheit zwischen zwei Menschen geschehen ist, damit sie so sind, wie sie sind. Was wissen wir schon davon? Wenn sich Menschen auf eine gewisse Art und Weise benehmen, haben sie immer Gründe dafür. Jedenfalls habe ich diese Erfahrung gemacht.« Die Oberschwester nickte bekräftigend zu ihren weisen Worten. »Na ja«, sagte sie jetzt in forscherem Ton, »da nun unser VIP fort ist, werde ich meine Runde machen.« Sie nahm ihre große schwarze Taschenlampe, warf sich ihr Cape über die Schultern und ging aus dem Büro.
»Für mich ist sie trotzdem ein kaltes Aas«, meinte die Stationsschwester und klopfte mit der Stricknadel gegen ihre Zähne.
»Und haben Sie den Mantel gesehen? Ich habe noch nie Frauen leiden können, die mit einem Pelzmantel protzen. Das zeigt doch, wie gefühllos sie ist«, sagte die Lernschwester schaudernd.
Die von einem Chauffeur gelenkte Limousine hielt vor dem luxuriösen Apartmenthaus. Kitty hatte bereits halb die Straße überquert, ehe der Fahrer ihr die Tür hatte öffnen können. Und sie hatte ihm auch nicht gedankt oder eine gute Nacht gewünscht. Das ist ungewöhnlich für sie, dachte er, als er sich wieder hinter das Lenkrad setzte.
Kitty nahm den Lift – elegant und vergoldet, aber altmodisch und schrecklich langsam – zur obersten Etage. Sie schloß die Tür zu ihrer Wohnung auf; im Flur brannte Licht. Sie hoffte, es bedeutete, daß Jenny noch auf war und auf sie wartete. Aber der Salon war dunkel. Sie knipste die Lampen an, schleuderte ihre Schuhe von den Füßen und ging zu dem Tablett mit den gut sortierten alkoholischen Getränken, wo sie sich einen großen Scotch eingoß, den sie in einem Zug hinunterschüttete. Dann eilte sie in den Flur zurück und zog beim Gehen ihren Mantel aus. In der großen blendendweißen Küche suchte sie unter der Spüle und kramte einen schwarzen Müllsack hervor. Sie legte ihren Nerzmantel zusammen und steckte ihn in den Sack. Dann zog sie ihr elegantes schwarzes Kleid aus und tat es ebenfalls hinein. Sie verknotete den Sack, öffnete die Hintertür, die auf die Feuertreppe hinausging, und stellte den Müllsack zu den sich dort bereits befindenden.
In ihrem Schlafzimmer entkleidete sie sich völlig und ging ins Bad. Zehn Minuten stand sie unter der Dusche und schrubbte sich. Erst dann wurde ihr wieder warm. Erst dann fühlte sie sich wieder sauber.
Erster Akt1959–1963
Kapitel 1
Mike Lawrence lief in seinen festen Schuhen mit Kreppsohlen die Straße entlang. Sein Gang war leise, auch in normalen Schuhen, denn er war leichtfüßig. Das ärgerte Amy, seine Frau, über alle Maßen. »Schleicher« nannte sie ihn, wenn er plötzlich hinter ihr stand und sie zusammenschrak. Er könne gar nichts dagegen tun, denn er sei einfach so geboren, erklärte er ihr, und seine Erklärung ärgerte sie ebenfalls.
In der Kurve blieb er wie so oft stehen, nur um den Anblick seines Hauses zu genießen und das Wissen, daß es ihm gehörte. Für ihn war es etwas Besonderes, doch jeder andere hätte es als ein ganz gewöhnliches Haus betrachtet, eines von Tausenden, das in den zwanziger Jahren erbaut worden war, ehe die Depression weitere Investitionen unmöglich gemacht hatte. Es stand an einer Hauptstraße mit etwa zweihundert ähnlichen Häusern, die alle von ihren Besitzern geliebt und gepflegt wurden. Aber für Mike sah das Haus Nummer vierzehn immer etwas sauberer und gepflegter aus.
Eine kleine grüne Pforte mit einem Schnappschloß führte auf einen gepflasterten Weg zwischen zwei kleinen Rasenflächen, die von Rosenbüschen umgeben waren. Vor den Erkerfenstern im Parterre und im ersten Stock hingen weiße Geranien. Alle vier Jahre strich er die Fensterbretter und Rahmen neu an, wobei er die alte Farbe vorher vollständig entfernte – er hatte es sich noch nie im Leben leichtgemacht oder geknausert. Diesmal wollte er sie grün streichen – Nilgrün stand auf der Dose – und cremefarben, nicht schwarz und weiß wie das letzte Mal. Das Schwarz war ein Fehler gewesen, denn man konnte jedes Staubkorn darauf sehen und den Unrat der Vögel. Grün war besser.
Über der Haustür war ein kleines ovales, buntes Glasfenster, das einen Sonnenaufgang oder -untergang darstellte. Er war sich nicht sicher, was von beidem. Amy mochte das Fenster nicht; sie hielt es für altmodisch und hätte es am liebsten durch eine Milchglasscheibe ersetzt. Doch bisher hatte Mike ihrer Bitte widerstanden.
Wenn auf die Klingel gedrückt wurde, was nicht oft geschah, ertönte ein Glockenspiel, die Glocken von Westminster.
Das Haus war mit Rauhputz versehen. Mike bedauerte das, denn er löste sich an manchen Stellen und mußte dann erneuert werden. Außerdem war er davon überzeugt, daß er der Grund für eine ständig feuchte Stelle im Schlafzimmer war, die er nicht beseitigen konnte. Aber er mußte sich nun einmal mit dem Rauhputz abfinden, Klagen änderten nichts.
Auf einer Seite gab es eine gemeinsame Einfahrt mit Haus Nummer zwölf, die Ränder aus Beton, die Mitte aus Rasen, damit man genau sehen konnte, wo das Grundstück von Nummer zwölf aufhörte und das von Nummer vierzehn begann. Mike kannte Häuser gleichen Zuschnitts, wo der eine Nachbar seinen Rasen mähte und der andere nicht. Und da Frankie in Nummer zwölf noch nie einen Rasenmäher zur Hand genommen hatte, tat Mike es eben für sie beide. Amy sagte, er solle das lassen, daß er dem faulen Kerl einen Gefallen tue und nicht einmal Dank dafür ernte. Aber das war Mike egal. Er mochte es, wenn alles ordentlich aussah.
Er marschierte zu der Stelle, wo die Doppelgarage stand. In Mikes Garage war kein Wagen, aber eines Tages? Mike war ein unverbesserlicher Optimist. Dieser Seiteneingang machte aus Haus Nummer vierzehn eine Doppelhaushälfte und somit in Mikes und auch Amys Augen wertvoller, denn die meisten Häuser in dieser Straße waren Reihenhäuser.
Er kam zur Pforte, mannshoch und aus Holzbrettern gefertigt, die so sorgfältig wie die Fassade des Hauses gestrichen war. Oben waren die Nummer und ein Schild mit der Aufschrift Betteln und hausieren verboten angeschraubt. Er schob den Riegel zurück und drückte fest gegen die Pforte. Sie ließ sich nur schwer bewegen und blieb manchmal stehen, obwohl er die Scharniere ausgewechselt und gut geölt hatte. Jetzt hatte er sich an das mangelhafte Funktionieren gewöhnt, ja, es gefiel ihm sogar. Und Amy merkte wenigstens jedesmal, wenn er kam, denn seine Schritte verrieten ihn ja nicht.
Er durchquerte den Hof – den Amy Terrasse nannte – und ging unter der selbstgebauten Pergola hindurch, die schwer von den emporrankenden Rosen war. Als erstes inspizierte er den kleinen Rasenflecken, wo das Gras so zart und ohne Unkraut war, daß es wie feinstes grünes Wildleder aussah. Seine Dahlien waren sein Stolz und seine Freude. Er suchte jede einzelne nach Pilzen und Parasiten ab. Dann wandte er sich dem Gemüsebeet zu. Doch beim Heimkommen überprüfte er nur alles, denn er wollte seinen Arbeitsanzug nicht schmutzig machen. Er würde seinen Tee trinken, sich dann umziehen und in seinem geliebten Garten arbeiten. Nicht ein Quadratzentimeter war verschwendet, sogar den alten Luftschutzraum hatte er mit Erde bedeckt. Und im Frühling wuchsen dort Krokusse und Schneeglöckchen. Zufrieden, weil alles in Ordnung war, ging er zur Hintertür, putzte sich gründlich die Schuhe auf der Fußmatte draußen ab, wiederholte die Prozedur auf der Matte drinnen und rieft »Ich bin da.«
Es kam keine Antwort, oft kam keine. Er warf einen Blick neben den Kessel, wo gewöhnlich der Zettel mit der Nachricht lag, wo Amy und seine Töchter waren. Heute abend waren sie bei der Schneiderin, las er.
Noch mehr Ausgaben, dachte er traurig, nicht verärgert. Er war traurig, weil er geschworen hatte, seiner Frau alles zu geben, was sie glücklich machen würde. Und das hatte er getan, selbst um den Preis zahlloser Überstunden, die er lieber in seinem Garten verbracht hätte. Aber ganz egal, was sich Amy auch wünschte und er ihr schenkte, glücklich machte es sie nicht.
Zuerst war es das Ziel ihres Ehrgeizes gewesen, das schönste Haus in der Straße zu besitzen, am elegantesten gekleidet zu sein und die hübschesten und klügsten Kinder zu haben. Doch in den vergangenen fünf Jahren hatte sie ihre Energie vollständig auf ihre Töchter konzentriert. Amy hatte beschlossen, daß die Mädchen Tänzerinnen – und Stars auf diesem Gebiet – werden sollten, ganz gleich, um welchen Preis und zu welchen Kosten. Ach, die Kosten! Seltsamerweise ging es ihm als Angestellter früher finanziell besser. Jetzt, als Filialleiter, konnte er nicht mehr mit Überstunden dazuverdienen, die Mehrarbeit wurde von einem Mann in seiner Position einfach unentgeltlich erwartet. Auf dem Herd stand auf kleiner Flamme eine Kasserolle. Mike nahm einen Topflappen, ergriff damit den Teller, der auf der Kasserolle war und stellte ihn auf den mit Wachstuch bedeckten Küchentisch. Sorgfältig wusch er sich die Hände, ehe er den Deckel von der Kasserolle nahm. Hm, ein Auflauf aus Hackfleisch und Kartoffelbrei, mit weichen Erbsen, seine Lieblingsspeise. Der Tisch war schon für ihn gedeckt, Messer und Gabel und OK-Sauce, die er großzügig über das Gericht goß.
Während des Essens dachte er an Amy. Ihre Art, mit scheinbar unerschöpflicher Energie hin und her zu eilen, ständig in Bewegung zu sein, erinnerte ihn an einen Kolibri, an einen dieser exotischen Vögel in den Tropen, über die er gelesen hatte: buntschillernd, klein und immer aktiv.
Er hatte sie kurz vor Kriegsbeginn bei einer Tanzveranstaltung kennengelernt. Sie war damals Friseurlehrling, er Verkäufer bei Co-op. Sie hatte nicht Friseuse werden wollen, sondern Tänzerin, aber ihre einfachen, frommen Eltern hatten dem einen Riegel vorgeschoben, da sie glaubten, daß ihre Tochter auf der Bühne alle Sünden Sodom und Gomorrhas kennenlernen würde. Über Amys Beruf als Friseuse waren sie auch nicht allzu glücklich, da sie die künstliche Verschönerung des Menschen als Sünde betrachteten – doch es war das geringere von zwei Übeln. Mike hatte sich in Amy vom ersten Augenblick an verliebt, wie viele andere Männer auch, denn sie hatte eine gute Figur und ein hübsches, von goldenen Locken eingerahmtes Gesicht. Er hatte lange um sie werben müssen. Von seinem ersten Arbeitstag an hatte er immer einen guten Teil seines Gehalts gespart, weil er wußte, daß er sich eines Tages verlieben würde und dann seiner Braut etwas bieten wollte, das Beste. Und für Mike war das Beste ein Haus mit einem Badezimmer. In Amy hatte er eine Gleichgesinnte gefunden, denn auch sie sparte und wußte genau, was sie wollte: ein Haus in der Mulberry Avenue. Der Krieg hätte sie ihrem Ziel nicht näher bringen können, denn ein Soldat bekam nur wenig Sold, doch Amy arbeitete härter als je zuvor und trug fortwährend Geld zur Bank. Im Juli 1941 heirateten sie, eher als geplant, aber Amy schrieb, sie sei schwanger, und Mike erhielt einen zweitägigen Urlaub. In der Hochzeitsnacht bekam sie ihre Periode.
Mike nahm das gleichmütig hin, denn jetzt hatte er sie. Nur machte er sich manchmal, wenn er nicht bei ihr war, Sorgen, daß ein anderer Mann mit mehr Ersparnissen oder sogar einem Auto käme und sie ihm wegnehmen könnte.
Die vier ersten Jahre ihrer Ehe verbrachten sie als Untermieter in schäbigen Zimmern, dann in einer Mietwohnung. Für beide war das keine glückliche Zeit. Er wollte Kinder, sie nicht. Doch schließlich ermöglichten ihre Ersparnisse und ein höheres Gehalt Mike, Amys Traum zu verwirklichen: Er kaufte das Haus Nummer vierzehn in der Mulberry Avenue.
An einem Maimorgen gehörte ihnen der Hausschlüssel, und sie standen in ihrer Doppelhaushälfte, mit dem gekachelten Bad, dem separaten WC und der Einbauküche.
»Und wie gefällt's dir?« fragte Mike sie und lächelte stolz.
»Ich bin überglücklich. Jetzt wohnen wir endlich in der Mulberry Avenue.«
»Ich kaufe Tapeten und tapeziere das Wohnzimmer.«
»Nein. Zuerst den Eingang.«
»Aber warum? Das Wohnzimmer braucht eine neue Tapete.«
»Weil mehr Leute den Flur sehen, darum. Dann tapezierst du unten – zuerst das Zimmer, das nach vorne rausgeht.«
»Wenn du das so willst, Mum«, sagte Mike verwundert, aber er wunderte sich oft über seine Frau.
»Nenn mich nicht ›Mum‹. Das ist gewöhnlich.« Mit der Grazie einer Tänzerin, die sie nie sein würde, ging sie in die Küche, öffnete die Hintertür und schaute in den Garten.
»Blumen. Ich will Blumen, Hunderte, damit das ganze Haus davon voll ist. Große Vasen, die von Blumen überquellen.«
»Was immer du haben willst, bekommst du, mein Mädchen.« Er ging zu ihr und wollte sie in die Arme nehmen und küssen. »Du weißt doch, wie es heißt? Neues Haus, neues Baby«, sagte er grinsend.
»O Mike! Und was sonst noch? Kannst du nicht an etwas anderes denken? Wir müssen auspacken.« Und leichtfüßig war sie an ihm vorbeigetrippelt, und er war ihr gefolgt und hatte sich groß und plump gefühlt – ein Gefühl, das sie ihm oft vermittelte. Aber er hatte recht gehabt. Nach einer schwierigen Schwangerschaft und Geburt. kam ihr erstes Kind zur Welt und zwei Jahre später noch eins, dessen Geburt viel leichter gewesen war. Beide wurden in dem Schlafzimmer geboren, in dem sie empfangen worden waren.
Ach ja, das sind glückliche Tage gewesen, dachte Mike, als er seinen Teller nahm, ihn im Spülbecken wusch und dann abtrocknete und zurück in den Geschirrschrank stellte. Er ging über den Flur und die mit einem Teppich belegte Treppe hinauf. Als er die große Vase voller Dahlien auf dem Fenstersims sah, lächelte er. Sie durfte so viele Blumen pflücken, wie sie wollte. Im Schlafzimmer zog er seinen Geschäftsanzug aus und hing ihn sorgfältig in den Schrank aus Walnußholz. Er streichelte das schöne Holz und fragte sich, warum Amy diesen Schrank wegwerfen und einen neuen Einbauschrank haben wollte.
Als er seine Gartenkleidung anhatte, ging er zu seinem Gemüsebeet. Er entfernte die wilden Triebe von den Bohnen, und ihm wurde bewußt, daß es nichts nützte, sich immer nur an die schönen Zeiten in seinem Leben zu erinnern. Dadurch konnte er die nagende Angst nicht vertreiben, die ihn nachts wach hielt, während Amy unbekümmert neben ihm schlief. Er hatte eine solche Angst und machte sich solche Sorgen, daß ihm manchmal richtig schlecht wurde und er sich fragte, wie lange es noch so weiterginge.
Er hatte nicht genug Geld – das war sein Problem. Er mußte die Schulgebühren zahlen, denn Amy hatte darauf bestanden, daß die Mädchen eine Privatschule besuchten, womit er voll und ganz einverstanden gewesen war. Dann war da die erstaunliche Menge aller möglichen Uniformen, die ein solches Etablissement verlangte, und so Extras wie Klavierunterricht und Reitstunden. Und schließlich mußte er auch noch die Tanzstunden für beide bezahlen, die viermal wöchentlich stattfanden – zweimal in der Schule und zweimal als Privatunterricht. Dazu kamen die Rechnungen der Schneiderin für Kostüme für Schulaufführungen zweimal im Jahr. Und Stepschuhe, Ballettschuhe und zahllose Trikots und Ballettröckchen.
Mike war wegen all dieser Ausgaben nicht böse. Er hatte zwei schöne und talentierte Töchter, und es war seine Pflicht, ihnen jede mögliche Chance im Leben zu bieten.
Wenn nur Amy nicht Einbauschränke im Schlafzimmer, eine neue Einbauküche und einen neuen Teppich fürs Wohnzimmer haben wollte. Er wußte immer, welche Wünsche Amy hatte und daß sie von ihm erwartete, es herbeizuschaffen, denn plötzlich lagen wie zufällig aufgeschlagene Zeitschriften herum, auf deren Seiten hübsche Küchen, Badezimmer oder Schlafzimmer abgebildet waren. Außerdem erschienen dann wie aus dem Nichts Stoffproben oder Teppichmuster.
Doch diesmal wußte er einfach nicht mehr, wie er diese Dinge bezahlen sollte. Er hatte bereits eine zweite Hypothek auf das Haus aufgenommen und das ganze Geld für eine neue Zimmereinrichtung und ein neues Service – das nur zu Weihnachten benutzt wurde –, eine Menge Kleider für seine drei Ladys und eine neue Radiogrammophonkombination ausgegeben. Der Kredit war weg, und die Abzahlungen wurden zu einer immer größer werdenden Last.
Er hätte Amy seine finanzielle Situation erklären sollen, konnte es aber aus verschiedenen Gründen nicht. Wenn er ihr seine Lage gestehen würde, hätte er das Gefühl, sie im Stich gelassen zu haben. Und wenn er sie im Stich gelassen hatte, hatte er versagt. Und wenn er versagte, wußte er, wie ihre Reaktion aussähe. Eine der Eigenschaften, die er an Amy so liebte, war ihr bezauberndes kindliches Benehmen, weil er sich dann immer wie ihr starker Beschützer fühlte. Doch diese Eigenschaft hatte auch einen Nachteil. Wenn Amy ihre Pläne bedroht sah, konnte sie Wutanfälle wie ein Kind bekommen.
»Dad, wo bist du?«
Er schaute von seinen Spinatpflanzen auf und strahlte. Auf ihn zu kamen die beiden Menschen, für die sich alle seine Mühen und Sorgen lohnten. Zuerst Lana – im Laufen flatterte ihr blondes Haar hinter ihr her, ihre blauen Augen, die Augen ihrer Mutter, strahlten vor Aufregung, ihr hübsches Gesicht glühte vor Lebensfreude. Und dann kam Kitty – sie lief nicht, sondern ging und war viel größer als die zwei Jahre Altersunterschied vermuten ließen. Ihr Haar war dunkelbraun, ihre Augen haselnußbraun wie die ihres Vaters, ihr Gesichtsausdruck ernst. Als Erwachsene würde man sie eher als gutaussehend denn schön bezeichnen. Kitty war nachdenklicher, ruhiger, weniger ausgelassen und überschwenglich als ihre Schwester, doch Mike wußte, daß sie diejenige war, die er beschützen mußte.
Kapitel 2
Kitty ärgerte sich ständig über Lana. Sie liebte sie, denn wenn jemand nicht nett zu ihrer Schwester war, führte sich Kitty wie ein Racheengel auf. Aber Lana zu mögen, war ein Problem.
Das war von Anfang an so gewesen. Man hatte ihr erzählt, daß sie, als ihre Schwester geboren wurde, damals im Alter von zwei Jahren wie eine Mutter zu Lana gewesen sei. Sie hatte sie getragen, gewiegt, gefüttert. Das stimmte, denn ihr Vater hatte es ihr erzählt, und sie hatte ihn nie bei einer Lüge ertappt. Aber es war eine Wahrheit, die sie erstaunte.
In Kittys Leben gab es nur eine Gewißheit: Sie liebte ihren Vater. Sie liebte alles an ihm, sein Gesicht, seine Haltung, seine Intelligenz und seine Freundlichkeit, seine Ehrlichkeit und seine Toleranz. Doch am wichtigsten war, daß sie sich bei ihm sicher fühlte, und sie hatte die Gewißheit, daß er immer jedes Problem lösen könnte. Sie vertraute ihm.
Man konnte nicht behaupten, daß sie dieselben Gefühle ihrer Mutter entgegenbrachte. Kitty liebte ihre Mutter, selbst wenn sie Angst vor ihr hatte, aber sie vertraute ihr nicht. Kittys Vertrauen in ihre Mutter war unwiederbringlich zerstört worden, als sie erst drei Jahre alt gewesen war. Das geschah am Weihnachtsabend, und draußen schneite es. Amy hatte Kitty auf den Arm genommen, damit sie durchs Fenster die fallenden Schneeflocken betrachten konnte.
»Wenn du ganz angestrengt lauschst, kannst du die Glocken vom Schlitten des Weihnachtsmanns hören«, hatte Amy gesagt
Kitty hatte die Ohren gespitzt, den kleinen Mund vor lauter Konzentration geöffnet.
»Ich höre sie! Ich höre sie! Ich höre die Glocken.« Sie wandte ihr vor Aufregung leuchtendes Gesicht ihrer Mutter zu.
Patsch! Ihre Mutter hatte ihr mitten ins Gesicht geschlagen. »Lüg mich verdammt noch mal nicht an!« hatte sie geschrien und Kitty grob auf den Boden fallen lassen. Kitty hatte geweint – nicht so sehr, weil die Ohrfeige weh getan hatte, sondern weil sie nicht verstanden hatte, was sie verkehrt gemacht hatte. Sie hatte die Glocken gehört. Den Zwischenfall hatte sie bald vergessen, doch nicht die Konsequenz – ihre Mutter hatte für immer Kittys Vertrauen eingebüßt.
Lana war der Liebling ihrer Mutter. Nicht daß Kitty irgend etwas entbehrte, jedes Kind bekam die gleichen Sachen. Amys Bevorzugung drückte sich in ihrem Gesicht aus, wenn sie ihre jüngere Tochter anschaute, im Ton ihrer Stimme, wenn sie mit ihr sprach, in ihrer Unfähigkeit, Lana zu strafen. Mike hatte dagegen protestiert, aber ohne Erfolg.
»Sie ist ich, das mußt du verstehen«, hatte Amy erklärt. »Lana sieht nicht nur wie ich aus, sie denkt auch wie ich. Sie will all die Dinge im Leben haben, die ich mir gewünscht habe.«
»Aber Kitty ist doch auch ein Teil von dir, selbst wenn sie mir ähnlich sieht«, hatte Mike eines Tages eingewandt, als Amy besonders streng zu Kitty gewesen war Er wollte das Problem aus der Welt schaffen.
»Welcher Teil denn?« hatte Amy verächtlich gefragt.
»Mir kommt es fast so vor, als könntest du sie nicht leiden.«
»Das ist doch Unsinn«, hatte Amy entgegnet und begonnen, mit wütenden Bewegungen eine Kartoffel zu schälen.
»Wirklich? Du hast sie nie wie Lana behandelt, nicht einmal, als sie klein war. Ich weiß, daß die Schwangerschaft und Geburt schwer waren und daß du nach ihrer Geburt Depressionen hattest. Aber du bist doch jetzt nicht mehr deprimiert, oder?«
»Nein.« Sie warf die Kartoffel in einen Topf mit kaltem Wasser.
»Woran liegt es dann? Sag es mir, Amy. Ich möchte euch beiden doch nur helfen.«
»Ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Ich weiß es wirklich nicht«, sagte sie und preßte die Lippen verärgert zusammen. Dann nahm sie eine neue Kartoffel und schälte wütend weiter.
»Sie ist ein nettes Kind, und ich habe Angst, daß sie sich zurückzieht oder auf Lana eifersüchtig werden könnte.«
»Ich bezweifle, daß sie überhaupt merkt, wie ich über sie denke. Sie ist ganz wie du, das ist sie immer schon gewesen.«
»Weil du sie nicht liebst, deshalb.«
»Rede keinen Unsinn, Mike. Ehrlich, manchmal gehst du mir auf den Wecker.«
»Ich muß mit dir darüber sprechen. Mir kommt es jedenfalls hin und wieder so vor, als wärst du das Kind und nicht Kitty .... manchmal bist du einfach grob ... und ... kleinlich.«
Amy drehte sich abrupt um und sah ihren Mann an. »Kleinlich? Ich? Das mußt gerade du mir sagen! Diese ganze Diskussion ist kleinlich. Du willst also die Wahrheit wissen? In Ordnung. Ich verrate sie dir.« Wütend wischte sie sich die Hände an ihrer Schürze ab. »Ich kann sie nicht leiden, weil sie mich nicht leiden kann. Sie ist eine hochnäsige kleine Kuh, das ist sie schon immer gewesen. Was verstehst du denn davon? Du bist ein Mann. Hast du etwa gelitten, wie ich gelitten habe, als ich mit ihr schwanger war?«
»Nein. Aber dafür kannst du sie doch nicht verantwortlich machen ...«
»So ist es nun einmal. Noch vor ihrer Geburt hat sie mich leiden lassen, und seit sie auf der Welt ist, verachtet sie mich.«
»Amy, Liebste, das stimmt doch nicht.«
»Verdammt noch mal, halt mir keine Vorträge. Ich weiß, wer mich liebt und respektiert. Meine Lana. Du kannst dich ja um Madame Kitty kümmern.«
»Amy ...«
»Hätte ich sie in einem Krankenhaus geboren statt zu Hause, hätte ich sicher geglaubt, daß man mein Baby vertauscht hat. Ich fühle nicht, daß sie ein Teil von mir ist, und damit basta.«
»Aber Amy ...«
»Ach, Mike, tu mir einen Gefallen und grab dein Gemüsebeet um. Laß mich in Ruhe«, sagte Amy und wandte ihm den Rücken zu. Sie schälte ihre Kartoffeln, und Mike ging zu seinem Gemüsebeet. Das Thema wurde nie wieder von ihnen erwähnt.
Zu diesem Zeitpunkt merkte Kitty nichts von der Zurückhaltung ihrer Mutter ihr gegenüber. Da sie nie etwas anderes kennengelernt hatte, schien ihr dieses Verhalten normal zu sein.
Kitty war in ihrem Zimmer. Erst an ihrem zwölften Geburtstag hatte sie ein eigenes Zimmer bekommen, und mußte nicht mehr eins mit Lana teilen. Ursprünglich war es die Abstellkammer gewesen und deshalb so klein, daß sie sich kaum darin bewegen konnte. Doch ihr Vater hatte erfindungsreich Platz für alle ihre Besitztümer geschaffen. Unter die Fensternische hatte er einen kleinen Schreibtisch eingebaut, außerdem einen Schrank mit Schiebetüren, und unter dem Bett gab es zwei große Schubladen. Das Zimmer war nach Kittys Wunsch in den Farben Dunkelblau und Weiß gehalten.
Für ein Kind ihres Alters war das Zimmer nüchtern und immer aufgeräumt. Ihre Bücher standen nach Sachgebieten geordnet auf einem Regal über ihrem Bett. Auch auf ihrem Schreibtisch herrschte größte Ordnung. Ihre Kleider hing sie immer sofort in den Schrank. Nur zwei Dinge schmückten ihr Refugium: ein modernes Cottage aus Staffordshire, das ihr Vater ihr geschenkt, und ein Toulouse-Lautrec-Poster, das sie sich von ihrem Taschengeld gekauft hatte.
Weder Spielzeug noch Puppen aus Kittys Kindheit waren in ihrem Zimmer zu finden. Als sie das alles Lana geschenkt hatte, war sie deswegen gelobt worden, doch Kitty hatte es nur verschenkt, weil sie es nicht mehr brauchen konnte.
Kitty hütete ihr Zimmer wie einen Schatz. Sie putzte es selbst, damit ihre Mutter es nicht betrat, und sogar ihrem Vater gewährte sie nur ungern Zutritt.
Nachdem Kitty aus dem Zimmer, das sie mit Lana geteilt hatte, ausgezogen war, wurde es völlig neu gestaltet. Es war eine einzige Orgie aus rosa und weißen Rüschen und Girlanden. Auf dem Bett lag eine Satindecke, die mit Rosen bestickt war. Darauf waren spitzengesäumte Kissen in Herzform verteilt. Der Toilettentisch war mit rosafarbener Organza verkleidet, und darauf stand ein dreiteiliger Spiegel mit weißgoldenem Rahmen, damit Lana ihre Schönheit von allen drei Seiten bewundern konnte. Ihr Schrank quoll von Kleidern über, die alle mit Rüschen besetzt waren und dem Firlefanz in ihrem Zimmer glichen. Überall waren Puppen, auf Regalen, auf Stühlen. Sie waren nicht zum Spielen gedacht, sondern in kunstvollen Gruppen arrangiert, damit man sie bestaunen konnte. An der Wand hingen aus Illustrierten ausgeschnittene Fotos von Elvis Presley. Es war ein seltsames Zimmer für eine Zehnjährige. Es schien, als könnte sie mit dem Erwachsenwerden nicht warten, wobei ihre Mutter sie nach Kräften unterstützte.
Lana hatte es gern, wenn man sie in ihrem Zimmer besuchte. Kitty hätte jederzeit kommen können – aber sie kam nie.
Kittys Benehmen verwirrte Lana, denn sie war sich keines Fehlers bewußt. Und diese Verwirrung wurde noch größer, als sie merkte, daß sie von allen Menschen gemocht wurde.
»Warum magst du mich nicht, Kitty?« fragte sie manchmal. Gewöhnlich beantwortete Kitty diese Frage nicht, doch eines Tages sagte sie: »Ich würde dich mögen, wenn du zu atmen aufhören würdest.«
Um ihrer Schwester einen Gefallen zu tun, hielt Lana den Atem an. Sie wurde rot und dann blau. Kitty starrte Lana mit gespannter Verwunderung an. Doch dann merkte sie, daß sie zu weit gegangen war, klopfte Lana fest auf den Rücken und rieft »Atme, du Idiot!«
Erleichtert sog Lana gierig Luft ein. Als sie sich wieder erholt hatte, sagte sie: »Ich wünschte, du wüßtest, was du willst.«
Daß Kitty sie nicht leiden konnte, machte Lana unglücklich, und so beschloß sie, lieber nicht darüber nachzudenken und so zu tun, als wäre sie der Mensch, den Kitty am liebsten hatte. Schließlich, so folgerte sie allein in ihrem rosa-weißen Schlafzimmer, brauche ich Kittys Liebe nicht. Es gab so viele andere Menschen, die sie mit Liebe überschütteten. Doch Kittys Gefühle ihr gegenüber waren wie ein häßlicher Tintenfleck auf ihrem sonst so ordentlichen Schulheft.
»Mum, ich habe beschlossen, nicht mehr zum Tanzunterricht zu gehen«, sagte Kitty eines Sonntags beim Mittagessen.
»Was um alles in der Welt soll das heißen?« fragte Amy überrascht.
»Ich hasse es.«
»So ein Unsinn. Du liebst es.«
»Nein. Ich habe es nie gemocht. Ich hasse Steptanzen, das Geräusch. Es ist wie Trommeln in meinem Kopf.«
»Da kann ich dir nur zustimmen«, sagte ihr Vater, Kitty zulächelnd. Er mußte an die endlosen Vorstellungen denken, wo die Kinder sich vor ihren hingerissenen Eltern auf der Bühne produziert hatten.
»Du liebst das Ballett.«
»Ich mag die Musik, aber nicht den Tanz. Und außerdem werde ich zu groß. Ich kann genausogut jetzt damit aufhören.«
»Ja, wahrscheinlich wirst du zu groß. Aber das macht nichts, du kannst dann eins von den Bluebell Girls werden, weil du so lange Beine hast«, sagte Amy fröhlich, denn Mitglied dieser Truppe zu sein, war für sie mit ihrer Größe von einssechzig immer ein hoffnungsloser Traum gewesen.
»Ich will kein Bluebell Girl werden. Was Langweiligeres kann ich mir nicht vorstellen.«
»Dir paßt nie etwas. Über alles mußt du schimpfen. Kein Wunder, daß du immer so mürrisch aussiehst. Noch etwas von dem Nachtisch, Lana?«
»Wenn Kitty nicht mehr tanzen will, warum sie dazu zwingen, Amy?« sagte Mike erleichtert. Fieberhaft rechnete er bereits aus, wieviel Geld er sparen könnte.
»Statt dessen hätte ich lieber Klavierunterricht«, erklärte Kitty.
Sofort fiel Mikes Hoffnung in sich zusammen.
»Na, das wäre wirklich Geldverschwendung. Du weißt doch, was Miss Coleridge von deinem Klavierspiel hält. Nur mit Müh und Not hast du die Prüfung bestanden. Damit könntest du nie deinen Lebensunterhalt verdienen, das ist sicher.« Amy tupfte sich die Lippen mit einem Papiertuch ab, das sie beharrlich Serviette nannte.
»Ich möchte mein Klavierspiel verbessern, und ich mag Musik. Ich weiß, ich bin noch nicht gut, aber ...«
»Unsinn. Dein Vater und ich haben nicht so viel Geld in deine und Lanas Karrieren gesteckt, damit du jetzt aufgibst.«
»Verstehst du mich denn nicht, Mum? Ich will nicht Tänzerin werden. Das ist dein Traum, nicht meiner.«
Schneller als der Blitz holte Amy aus und schlug Kitty fest ins Gesicht.
»Ich verbitte mir deine Unverschämtheiten! Du tust, was ich sage!« Kitty stand auf und kämpfte gegen ihre Tränen, denn sie wollte ihrer Mutter nicht die Genugtuung geben, sie weinen zu sehen. »Wenn du aufhörst, schenkst du mir dann deine Schuhe?« fragte Lana.
»Das ist doch völliger Unsinn. Deine zierlichen Füße werden niemals in diese Kähne passen, die deine Schwester trägt«, antwortete Amy anstelle ihrer Tochter und räumte lärmend den Tisch ab.
»Ich gehe auf mein Zimmer«, sagte Kitty.
»Kann ich dir beim Spülen helfen, Mummy?«
»Was bist du doch für ein kleiner Engel. Nein. Lauf und mach deine Hausaufgaben. Kitty kann mir helfen.« Amy lächelte Kitty triumphierend an.
Mrs. Flynn saß vor dem Klavier, ihr breiter Hintern quoll durch die hölzernen Querstäbe des Schemels, ihre Füße, die in Slippern steckten, traten mit pumpenden Bewegungen auf die Pedale. Das Klavier stand in einer Ecke des Tanzstudios, und sie spielte, wie sie es seit fünfzehn Jahren an jedem Arbeitstag und jeden Samstagmorgen tat. Sie spielte, ohne zu denken, sie spielte, ohne zu hören, ihre Finger fanden die Tasten wie heimkehrende Tauben, die in ihren Schlag zurückkehren. Sie hämmerte den Rhythmus so laut wie möglich, damit sie von den sechzehn jungen Mädchen, die unter der Anleitung von Camilla de Souza steppten, auch gehört wurde.
Der Lärm war ohrenbetäubend, als sich die Mädchen – ein paar von ihnen waren für den Tanz zu dick – auf ihre Füße konzentrierten. Die Hitze in dem Raum wurde durch die schwitzenden Körper noch gesteigert. Im Takt der klackenden Schuhe wirbelten Staubwölkchen vom Boden auf. Und es roch nach Schweiß und Staub.
»Eins ... zwei ... drei«, rief Camilla und schritt vor ihrer Truppe wie ein inspizierender General hin und her. »Eins ... zwei ... drei ...« Sie klatschte im Rhythmus von Mrs. Flynns »California Here I Come« in die Hände.
Vor den anderen, da sie die beste Schülerin war, tanzte Lana. Ihr langes blondes Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden und ihr hübsches Gesicht von einem strahlenden Lächeln erleuchtet, das blendendweiße Zähne enthüllte. Hinter ihr steppten die drei nächstbesten Tänzerinnen, dann kam eine Reihe von fünf Mädchen, danach sieben, so daß alle ein Dreieck bildeten, mit Lana an der Spitze. Kitty tanzte mit den Älteren in der hintersten Reihe, denn ihre Größe hätte an einem anderen Platz die Harmonie gestört.
Die Schülerinnen waren gleich gekleidet. Alle trugen rote Röckchen, schwarze Strumpfhosen und rote Schuhe mit roten Schuhbändern, die ihre Füße größer aussehen ließen, als sie waren. Auf den Röcken war das Schullogo, eine Sechzehntelnote, und darunter in Kursivschrift gestickt: De Souza Dance Academy Kein Mädchen durfte am Unterricht teilnehmen, wenn es nicht korrekt gekleidet war, darin war Camilla sehr streng.
Camilla de Souza war schlank und trug ein schwarzes Trikot, und um ihre Schultern hatte sie einen Schal geschlungen. Bei jeder Bewegung klingelten lange Ohrringe – nicht, daß man das bei dem Lärm hätte hören können. Sie war fünfzig, doch mit viel Make-up und schmeichelhaftem Licht konnte sie für Anfang Vierzig durchgehen. Ihre Brauen waren dick und schwarz und so gewölbt, als ob sie freudig erregt wäre. Ihr Mund war voll und ebenso scharlachrot angemalt wie ihre Fingernägel. Ihr gefärbtes schwarzes Haar war zu einem strengen Knoten zurückgekämmt und glänzte wie Lack, da sie es mit Pomade behandelte. Sie sah wie eine Spanierin aus, was sie auch beabsichtigte, vor allem, da Flamenco ihre Spezialität war. Sie mochte es, wenn man sie als Exotin betrachtete. Doch in Wahrheit war Camilla als eine ganz gewöhnliche Gwen Roberts in Swindon auf die Welt gekommen, nicht in Sevilla.
Camilla redete immer von ihren »Studios«, aber der Gebrauch des Plurals war irreführend. Es gab nur ein Studio – diesen Raum. Ursprünglich hatte er das Geschäft eines Gemüsehändlers beherbergt, und sie hatte aus dem Laden und dem Lagerraum einen einzigen Raum gemacht. Die kleine Küche hinten war in ein Umkleidezimmer verwandelt worden, mit einem Waschbecken in einer Ecke und einer Sprossenleiter an der Wand. Die Toilette war draußen.
Das Studio war cremefarben gestrichen und indirekt beleuchtet. Eine Wand war mit einem Spiegel verkleidet, davor war in ganzer Breite eine Stange angebracht. Auf der gegenüberliegenden Seite standen Mrs. Flynns Klavier und eine Stuhlreihe für Eltern, die den Proben zuschauen wollten.
»Kitty, wie oft muß ich dir das noch sagen? Eins, zwei, gleiten. Eins, zwei, drei. Sieh her!« Camilla drehte sich um, so daß sie ihren Schülerinnen den Rücken zuwandte, und tanzte die Schritte vor. »Und könnt ihr denn nicht alle lächeln? Tanzen soll Spaß machen. Wenn Lana lächeln kann, warum könnt ihr es nicht?«
Amy saß auf einem der Stühle und lächelte selbstzufrieden.
Als der Unterricht zu Ende war, liefen die Mädchen lärmend ins Umkleidezimmer. Amy bat Camilla um eine Unterredung, woraufhin die Tanzlehrerin Mrs. Flynn diplomatisch vorschlug, eine Tasse Tee zu trinken, ehe die Ballettschülerinnen kämen. Mrs. Flynn gehorchte.
»Was kann ich für Sie tun, Mrs. Lawrence?« fragte Camilla und setzte sich graziös neben Amy.
»Ich habe zwei Anliegen. Das erste betrifft Kitty. Sie sagt, sie habe das Tanzen satt und wolle keinen Unterricht mehr.«
»Das habe ich erwartet«, erwiderte Camilla und verschränkte elegant ihre Hände im Schoß, wobei sie ihre schlanken Finger mit den perfekten Nägeln bewunderte. Doch gleichzeitig dachte sie betrübt, daß sie eine Schülerin und somit das dringend benötigte Geld verlieren würde.
»Sie haben es erwartet?«
»Ja. Mit zwölf haben die Mädchen gewöhnlich die Nase vom Tanzen voll, es sei denn, sie möchten einen Beruf daraus machen. Sie werden dann allmählich flügge und fangen an, sich für andere Dinge zu interessieren.«
»Ihre Weigerung ist nur eine vorübergehende Erscheinung«, sagte Amy selbstsicher. »Es wird ihr schon wieder Spaß machen. Ich frage mich nur, ob wir nicht eine Disziplin zugunsten einer anderen weglassen – entweder Ballett oder Steppen. Welche, wäre egal.«
»Aber nein, Mrs. Lawrence. Es ist offensichtlich, daß Kitty schon seit einem Jahr nicht mehr mit dem Herzen bei der Sache ist. Man kann jemanden nicht zum Tanzen zwingen, man muß mit Leib und Seele dabeisein, ja, sogar bereit sein, dafür zu leiden«, entgegnete Camilla fast atemlos vor innerer Bewegung.
»Ich kann sie dazu zwingen«, sagte Amy verbissen.
»Doch was würden sie damit gewinnen? Sie ist eine passable Tänzerin, würde aber keine Fortschritte machen, ganz gleich, wie viele Stunden Unterricht sie noch bekommt. Sie wird nie eine professionelle Tänzerin werden. Nein, Mrs. Lawrence, es ist besser, wenn sie aufhört.«
»Aber mein ganzes Herz hängt ...«, erwiderte Amy in dem weinerlich quengelnden Ton, den sie immer anschlug, wenn sie etwas von Mike wollte.
»Und Kittys Herz hängt offensichtlich nicht daran, nicht wahr?« unterbrach Camilla sie mit einem, wie sie hoffte, charmanten Lächeln zu dieser hübschen, aber penetranten Frau, die sie nicht leiden konnte. Camilla betrachtete Frauen, die eine derartige zuckersüße Lieblichkeit ausstrahlten, mit Argwohn, denn nur zu oft hatte sich herausgestellt, daß sich unter dieser glatten Oberfläche ein zänkisches Naturell verbarg.
»Kann Kitty singen? Bisher habe ich noch keine diesbezügliche Neigung bemerkt. Doch ich habe eine Freundin, die glücklich wäre ...«
»Ermutigen Sie sie bloß nicht dazu«, sagte Amy und hob in gespieltem Entsetzen die Hände. »Wenn sie singt, platzt Ihnen das Trommelfell. Sie wurde aus dem Schulchor ausgeschlossen, weil sie zu laut singt. Die anderen waren kaum noch zu hören, und das gefiel ihnen natürlich nicht. Ich habe ihr geraten, ihre Lautstärke zu drosseln, aber hat sie auf mich gehört? Sie hört ja nie auf mich.«
»Ich habe sie immer als ein sehr ernsthaftes Kind empfunden. Vielleicht hat sie keine künstlerischen Neigungen, aber das ist ja nichts Schlimmes, Mrs. Lawrence.«
»Bücher, Bücher, Bücher ... Sie interessiert sich nur für Bücher und schließt sich allein in ihr Zimmer ein. Sie mag es nicht, wenn jemand ihr Reich betritt«, fügte Amy finster hinzu.
»Was wollten Sie noch mit mir besprechen? Es seien zwei Dinge, sagten Sie«, wechselte Camilla das Thema, denn sie mochte Kitty, die ihr schon oft leid getan hatte. Sie wußte, daß es richtig wäre, es den Eltern frühzeitig mitzuteilen, wenn sie für den Unterricht ihrer Töchter Geld verschwendeten. Aber solche ethischen Standards konnte sie sich aus finanziellen Gründen nicht leisten. Als sie jetzt erfuhr, daß sich Kitty in ihrem Zimmer versteckte, tat sie ihr noch mehr leid. Denn jedes sensible und intelligente Kind wie Kitty würde sich vor einer solchen hohlköpfigen Mutter verstecken.
»Über meine Lana wollte ich mit Ihnen reden.« Sofort änderte sich Amys Gesichtsausdruck. Wenn sie nur den Namen ihrer jüngeren Tochter aussprach, bekam ihre Stimme einen anderen Klang, weich und vor Stolz nahezu berstend.
»Da brauchen Sie sich überhaupt keine Sorgen zu machen, Mrs. Lawrence. Ich bin sicher, daß Lana Erfolg haben wird. Es sei denn, sie verliert wie ihre Schwester die Lust.«
»Das wird sie nicht. Da passe ich schon auf.«
»Sie ist eine gute Tänzerin und macht Fortschritte. Nur etwas klein ist sie geraten.«
»Sie wächst noch, sie ist ja noch jung. Ich überwache ihre Diät aufs genaueste«, entgegnete Amy verteidigend, denn Lanas geringe Körpergröße bereitete ihr ebenfalls Sorgen. »Aber macht sie auch schnell genug Fortschritte? Das wollte ich von Ihnen wissen.«
»Sie ist erst zehn, Mrs. Lawrence. Sie können die Dinge nicht überstürzen.«
»Ich frage mich nur, ob ich sie nicht lieber in ein Internat schicke, wo sie alles lernt, was zur Bühne gehört, Sprechtechnik, Vortragskunst, Singen, Tanzen. Wäre das nicht besser? Dann würde sie zu einer Allroundkünstlerin ausgebildet.«
»Das stimmt. Aber dafür ist es noch zu früh. Ich meine ...« Camilla wußte nicht, was sie sagen sollte, denn zwei Schülerinnen auf einmal zu verlieren, wäre eine Katastrophe für sie. »Wenn Sie Lana zusätzlich in Sprechtechnik und Schauspiel unterrichten lassen wollen, kann ich das leicht für Sie arrangieren.« Sie würde ihre Freundin, Sarah Selling, eine arbeitslose Schauspielerin, anrufen. Sarah würde begeistert sein. Dumm, daß sie nicht bereits früher daran gedacht hatte. Schon konzipierte sie einen neuen Prospekt, in dem diese zusätzlichen Aktivitäten angepriesen wurden. Vielleicht konnte sie auch Miriam, ihre Freundin, die eine verkrachte Opernsängerin war, für eine Zusammenarbeit gewinnen. Dann würde sie größere Räumlichkeiten brauchen. Beim Gedanken an dieses neue Projekt röteten sich ihre Wangen vor Aufregung.
»Aber ich dachte an eine richtige Schule, die ihre Schüler auf eine richtige Bühnenlaufbahn vorbereitet.«
Jetzt wurde Camilla wütend. Wahrscheinlich waren ihre Qualifikationen suspekt – sie besaß keine Diplome, die sie an die Wand hätte hängen können. Doch sie erachtete die Show, die sie zweimal im Jahr im Empire inszenierte, als Empfehlung, die ebenso gut wie jede andere war.
»Ich habe meine Schule immer als eine richtige Schule betrachtet und bin auf meine Shows ziemlich stolz.«
»Ach, bleiben Sie doch auf dem Teppich, Miss de Souza. Mich überrascht nur, daß Sie so lange damit durchgekommen sind. Sie sind keine diplomierte Lehrerin, das sind Sie nie gewesen. Bisher haben Sie jeden hinters Licht geführt, sogar die Behörden. Deshalb sind Sie auch so billig.«
In diesem Moment vergaß Camilla völlig ihre anmutige Pose, die sie wie eine Ballerina auf einer Zeichnung von Degas aussehen ließ. Niedergeschlagen sackte sie auf ihrem Stuhl in sich zusammen und wußte nicht, was sie entgegnen sollte.
»Ich wollte das nur einmal sagen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, von mir erfährt niemand etwas. Sie sind eine gute Lehrerin, und allein das zählt. Aber bei einem Mädchen wie Lana, mit ihrem Talent ... jedenfalls muß ich an die Zukunft denken. Ich muß tun, was am besten für sie ist. Auf einer Schauspielschule bekäme sie automatisch später Gelegenheit zum Vorsprechen oder Tanzen und wäre immer auf dem laufenden, Was in Londoner Bühnenkreisen los ist. Das wissen wir doch hier gar nicht, oder?«
»Ich weiß es«, sagte Camilla scharf. Sie riß sich zusammen. »Ich lese The Stage und ich bin immer informiert.« Zwar las sie die Zeitschrift, doch um ehrlich zu sein, mehr aus eigenem Interesse als in dem Bestreben, für ihre Schülerinnen eventuell ein Engagement zu bekommen.
»Bisher haben Sie aber nicht viel Erfolg gehabt, wie?« sagte Amy hochnäsig.
»Das ist nicht so einfach, Mrs. Lawrence. Man muß eine ganze Menge Dinge in Betracht ziehen. Ich bin absolut dagegen, Kinder zu früh zu einer Karriere zu zwingen. Das kann zu gravierenden Schäden führen. Und ein kleines Mädchen kann leicht jedes Interesse verlieren, wenn man es zu sehr drängt.« Absichtlich betonte sie diese Worte. »Noch schlimmer ist es, wenn man durch zuviel Training die kleinen Körper zerstört.« Camilla besaß zwar nicht die nötigen Diplome, aber vom Tanzen verstand sie etwas, und sie wußte, was das Lächeln kostete und wie viele Tränen damit verbunden waren.
Amy hörte überhaupt nicht zu. Sie kramte verbissen in ihrer Handtasche. »Hier ist es. Sehen Sie mal. ›The Philbert School of Drama and Dance‹. Sie akzeptieren dort Internatsschülerinnen vom achten Lebensjahr an.«
Camilla konnte den Zeitungsausschnitt nur mühsam lesen. Sie brauchte eine Brille, doch da das nicht zu ihrem Image paßte, setzte sie sie nur auf, wenn sie allein war.
»Aber was wird aus dem übrigen Unterricht?«
»Der findet dort natürlich ebenfalls statt. Wie in einer richtigen Schule.«
»Und die Kosten?« fragte Camilla, fügte dann jedoch schnell hinzu: »Sie ist ja noch so klein und so jung.«
»Das haben Sie bereits bemerkt«, sagte Amy giftig.
»Und die Schule ist in Cambridgeshire, meilenweit entfernt, wo es so kalt im Winter ist.«
»Wenn es Lanas Karriere dient, ist kein Opfer zu groß.«
»Ich habe noch nie von diesem Institut gehört, Mrs. Lawrence. Eine dieser berühmten Londoner Schulen ... das wäre ein anderes Paar Stiefel.«
»Diese Schule ist neu. Das ist einer ihrer Vorzüge. Sie muß sich noch beweisen.«
»Sie klingen, als hätten Sie bereits eine Entscheidung getroffen, Mrs. Lawrence.«
»O ja, das habe ich. Ich wollte Sie nur informieren.«
Kapitel 3
»Verdammt noch mal, Amy! Glaubst du denn, ich bin aus Geld gemacht?« Mike stand vor dem Kamin und betrachtete seine Frau in dem Spiegel darüber.
»Mir ist durchaus bewußt, daß du es nicht bist. Wie außerordentlich schade.«
»Ich habe mein Bestes getan. Wir haben ein schönes Heim.«
»Von diesem Haus rede ich nicht. Ich rede von anderen Dingen – Kleidern, einer besseren Ausbildung für die Kinder, einem Auto«, entgegnete Amy. Ihr Stimme hatte einen Unterton aufgesetzter Vernünftigkeit.
»Nie werden wir uns ein Auto leisten können, solange ich diese horrenden Summen für Schulgeld und Tanzunterricht ausgebe. Und jetzt das.«
»Haargenau. Du verdienst eben nicht genug.« Trotz ihrer Blasiertheit sieht Amy gleichzeitig gut aus, dachte Mike.
Er drehte sich abrupt um, den Blick voller Qual und Zorn – jedenfalls glaubte er das. »Und was soll ich tun? Etwa zu meinem Chef gehen und sagen, daß ich mehr als jeder andere Filialleiter verdienen muß, weil ich eine Frau habe, die ewig nörgelt und nie zufrieden ist?«
»Ich nörgle nicht. Das kann mir niemand vorwerfen. Ich konfrontiere dich nur mit den Tatsachen, selbst wenn du das nicht hören willst.«
»Was erwartest du also von mir?«
»Du könntest dir noch einen Job für abends suchen.«
»Herrgott noch mal, Frau! Wenn ich nach Hause komme, bin ich erschöpft. Ich habe keine Kraft für einen zweiten Job. Außerdem würde es meinem Arbeitgeber nicht gefallen. Es sieht nicht gut aus, wenn ein Geschäftsführer Schwarzarbeit macht.«
»Ach ja? Wir dürfen den Co-op wohl nicht verärgern?« sagte Amy in einem ironischen Tonfall, daß er sie am liebsten geschlagen hätte. Er wandte sich ab, entsetzt über sich. Er sah sein Gesicht im Spiegel – einen Mann mittleren Alters, traurig, mit ergrauendem Haar an den Schläfen, und er fühlte sich besiegt.
»Ich weiß nicht, was mit dir los ist, Amy. Was dich so macht, wie du bist. Wir waren früher so glücklich.«
»Früher! Darauf läuft es doch hinaus! Früher!«
»Aber begreifst du denn nicht, Liebes?« Er dämpfte seine Stimme, denn er wollte sie besänftigen. »Du hast doch alles bekommen, was du dir gewünscht hast. Sogar den Einbauschrank im Schlafzimmer. Nächstes Jahr können wir uns dann ein Auto leisten. Aber nicht mit diesen Ausgaben.«
»Dir ist doch alles völlig egal, oder? Nun hast du eine Tochter mit einem außerordentlichen Talent – was jeder sagt –, und du willst kein Geld ausgeben, damit sie weiterkommt.«
»So einfach ist das nicht. Ich habe kein Geld mehr zum Ausgeben. Nichts. Ich bin genauso stolz wie du auf sie, ja, vielleicht noch stolzer, weil ich stolz auf das bin, was sie tut, aber nicht auf das, was ich will, daß sie tun soll.«
»Was soll das denn heißen?«
»Ich bin ganz ehrlich, Amy. Ich glaube nicht, daß es dir um Lanas Glück geht oder darum, was sie möchte. Es geht darum, was du willst. Du willst ihren Erfolg für dich.«
»Und was ist daran falsch?«
»Alles, wenn du es wissen willst. Hast du mit ihr darüber geredet? Möchte sie in diese Schule gehen? Möchte sie ihr Zuhause verlassen, ein so kleines Mädchen? Das ist nicht normal.«
»Nein, ich habe nicht mit ihr darüber gesprochen. Ich wollte keine Hoffnungen in ihr wecken.«
»Du redest Quatsch, Amy. Du fragst sie doch nie, ob sie etwas möchte oder nicht.«
»Sie wird es sich schon wünschen.«
»Ja, wahrscheinlich. Sie tut es, um dir zu gefallen. Sie tut alles, um zu gefallen. Und das weißt du und benutzt es als Druckmittel.«
»Ich hatte nie gedacht, daß du so gehässig sein könntest, Mike.«
»Es ist die Wahrheit.«
»Nein. Dahinter steckt etwas ganz anderes. Du willst sie allein für dich haben. Du willst nicht, daß sie in die Welt hinausgeht und von anderen bewundert wird. Du bist eifersüchtig, Mike. Du bist auf deine eigene Tochter eifersüchtig.«
»Es ist ekelhaft, was du da sagst, Amy. Du würdest doch alles tun, um deinen Willen durchzusetzen, nicht wahr?«
»Für Lana, ja. Weil sie nicht da landen soll, wo ich gelandet bin, in einem Friseursalon voller dummer Frauen, die man vorgibt zu mögen, wenn man sie in Wirklichkeit verachtet.«
»Und was hast du geleistet, um dich diesen Frauen überlegen zu fühlen?« Er lachte kurz,. denn er spürte, daß er ihren wunden Punkt getroffen hatte.
»Ich habe Lana auf die Welt gebracht. Das habe ich getan. Sie ist etwas Seltenes, eine wahre Kostbarkeit.«
»Sie ist ein kleines Mädchen, das gern tanzt, Amy. Wie tausend andere kleine Mädchen. Du setzt ihr nichts als Flausen in den Kopf. Aber hat sie denn überhaupt eine Chance?«
»Mit dir als Vater hat sie eine Riesenchance. Aber ich kämpfe für sie ... Sie wird nicht so wie ich enden, mit einem Versager wie dir verheiratet ...«
»Du Miststück! Du undankbares Miststück!« Er spie die Worte aus. Dann rieb er sich die Augen, als wollte er den Gedanken verscheuchen, daß sie alles, was er für sie getan hatte, genommen, aber ihm nie etwas gegeben hatte, am wenigsten Liebe.
»Ich suche mir einen Job. Jederzeit finde ich mit meinen Fähigkeiten bei einem Friseur eine Stellung. Vielleicht arbeite ich auch selbständig hier im Haus, oder ich gehe zu den Leuten ... Wahrscheinlich verdiene ich dann noch mehr.«