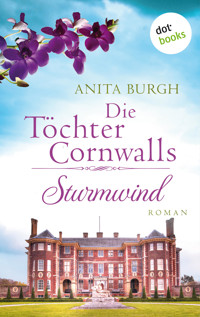Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Glück kommt manchmal auf vier Pfoten: Der herzerwärmende Feelgood-Roman »Der Weg zum Herzen einer Frau« von Anita Burgh als eBook bei dotbooks. Fast zwanzig Jahre war die Kinderbuchillustratorin Thomasine Lambert die perfekte und treusorgende Ehefrau – bis der angebliche Göttergatte sie von heute auf morgen sitzen lässt. Kurz entschlossen kehrt sie dem chaotischen London den Rücken und zieht nach Middle Shilling, um in der idyllischen Ruhe des englischen Landlebens noch einmal von vorn anzufangen. Doch an einen entspannten Neubeginn ist gar nicht zu denken, als sie einen kleinen hilflosen Hund von der Straße aufsammelt – und Thomasine ihr Herz für Vierbeiner entdeckt. Aber nicht nur der kleine Hund wirbelt ihr Leben durcheinander … denn als sie den geheimnisvollen Oliver Hawksmoor kennenlernt, gerät ihr neuer Vorsatz, keinem Mann mehr über den Weg zu trauen, gefährlich ins Wanken … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der berührende Wohlfühl-Roman »Der Weg zum Herzen einer Frau« von Anita Burgh. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 747
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Fast zwanzig Jahre war die Kinderbuchillustratorin Thomasine Lambert die perfekte und treusorgende Ehefrau – bis der angebliche Göttergatte sie von heute auf morgen sitzen lässt. Kurz entschlossen kehrt sie dem chaotischen London den Rücken und zieht nach Middle Shilling, um in der idyllischen Ruhe des englischen Landlebens noch einmal von vorn anzufangen. Doch an einen entspannten Neubeginn ist gar nicht zu denken, als sie einen kleinen hilflosen Hund von der Straße aufsammelt – und Thomasine ihr Herz für Vierbeiner entdeckt. Aber nicht nur der kleine Hund wirbelt ihr Leben durcheinander … denn als sie den geheimnisvollen Oliver Hawksmoor kennenlernt, gerät ihr neuer Vorsatz, keinem Mann mehr über den Weg zu trauen, gefährlich ins Wanken …
Über die Autorin:
Anita Burgh wurde 1937 in Gillingham, UK geboren und verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in Cornwall. Ihre 24 Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und feierten international Erfolge. Mittlerweile lebt Anita Burgh mit ihrem Mann und zwei Hunden in einem kleinen Dorf in den Cotswolds, Gloucestershire.
Bei dotbooks veröffentlichte Anita Burgh ihrer Romane »Das Erbe von Respryn Hall«, »St. Edith’s: Hospital der Herzen«, »Glückssucherinnen«, »Wo deine Küsse mich finden«, »Das Lied von Glück und Sommer«, »Wo unsere Herzen wohnen«.
Außerdem veröffentlichte Anita Burgh bei dotbooks ihre Familiensaga »Die Töchter Cornwalls« mit den drei Einzelbänden: »Morgenröte«, »Sturmwind« und »Dämmerstunde«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2020
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »Breeders« bei Orion Books, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1996 by Anita Burgh
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Martina Osmy, SScott514
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-452-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Weg zum Herzen einer Frau« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anita Burgh
Der Weg zum Herzen einer Frau
Roman
Aus dem Englischen von Traudl Weiser
dotbooks.
Dieses Buch ist Gertie und Gussiein Liebe gewidmet.
Und in liebevollem Andenken an:Paddy, Brutus, Fanny, Sammy, Sappho, Rita,Emma Dane, Kefti und Shin;besonders Buttercup.
Il y a aura toujours un chien perdu quelque part qui m'empêchera d'être heureux.
Immer wird es irgendwo einen ausgestoßenen Hund geben, der mich daran hindert, glücklich zu sein.
JEAN ANOUILH
We are alone, absolutely alone on this chance planet; and amid all the forms of life that surround us, not one, excepting the dog, has made an alliance with us.
Wir sind allein, absolut allein auf diesem Zufallsplaneten; und unter allen diesen mit uns lebenden Kreaturen gibt es nicht eine, ausgenommen den Hund, die sich mit uns verbündet hätte.
MAURICE MAETERLINCK
MÄRZ
Kapitel 1
Furcht war das alles beherrschende Gefühl in dem schnell fahrenden Wagen. Sie saß zusammengekauert auf dem Beifahrersitz und atmete schwer vor Angst. Er fuhr schnell, viel zu schnell für die scheußlichen Witterungsverhältnisse. Er war wütend. Sie wußte nicht warum, oder was seinen letzten heftigen Wutanfall ausgelöst hatte. In der kurzen Zeit, die sie bei ihm gewesen war, hatte sie gelernt, sich vor seinem Zorn zu fürchten, der jederzeit und ohne Anlaß ausbrechen konnte.
Der schwere schwarze Mercedes fuhr langsamer. Er hielt nicht, sondern zerrte sie – mit einer Hand am Lenkrad – über sich, stieß die Tür auf und schleuderte sie auf die regennasse Straße hinaus. Sie prallte schwer auf den Asphalt, schrammte sich das Kinn auf. Der Wagen brauste in die Nacht davon.
Sie versuchte aufzustehen, aber ein Bein knickte unter ihr weg. Sie versuchte, sich an den Straßenrand zu schleppen, aber der Schmerz war zu groß. Sie brach auf der Straße zusammen, Blut sickerte aus ihrem verletzten Kinn, die großen Augen feucht vor Entsetzen. Hilflos und verzweifelt lag sie da und wartete ergeben auf ihr Schicksal.
Thomasine fuhr wegen der schlechten Sichtverhältnisse langsam. Sie fand, daß dieses Wetter ein passender Abschluß für einen absolut gräßlichen Tag war. Sie hatte verschlafen und in der Hast, nicht zu spät zu kommen, zwei Strumpfhosen zerrissen, dann waren ihr die Kreditkarten gestohlen worden, sie war geschieden worden, hatte das Abendessen mit ihrer mißbilligenden Mutter ertragen und war jetzt diesem Sturm ausgesetzt. Heute kann nicht mehr viel schiefgehen, sagte sie sich.
Die Scheibenwischer klackten laut, sie huschten in einem hysterischen Rhythmus hin und her und schafften es trotzdem nicht, die Windschutzscheibe freizuhalten. Thomasine kauerte über dem Lenkrad, sie hielt es mit beiden Händen fest umklammert und wünschte sich, sie wäre sonstwo, nur nicht auf dieser Landstraße in dieser kalten und stürmischen Nacht – die mehr einer Winternacht glich, als einer Nacht zu Anfang des Frühlings.
Sie wünschte sich, sie wäre sicher zu Hause in London – nicht in der Gegenwart zu leben, sondern vor drei Jahren, als ihr Mann sie noch nicht betrogen hatte und ehe Zorn und Kummer anfingen. Sie wollte nicht in ein leeres, fremdes Haus zurückkehren und sich mit einer ungewissen und einsamen Zukunft auseinandersetzen. Es war schwer zu akzeptieren, daß sie jetzt geschieden war, wo es doch das letzte war, was sie sein wollte. Trotz allem, was geschehen war, liebte sie ihren Mann noch immer mit einer schmerzlichen Sehnsucht. Während des Abendessens mit ihrer Mutter, Di, hatte sie versucht, diese Gefühle zu verbergen. Und obwohl ihre Mutter gesagt hatte, es sei gut, daß sie diesen betrügerischen Bastard los sei, und je eher sie jemand anderen fände und aufhöre, sich gehenzulassen, um so besser. Thomasine war überzeugt, daß ihre Mutter sie durchschaut hatte und sie wegen ihrer Schwäche und Unentschlossenheit verachtete.
Thomasine seufzte. Für ihre Mutter war es leicht; sie war eine jener dogmatischen Individuen, die nie daran zweifelten, im Recht zu sein, und die gegen Schmerzen immun zu sein schienen, so als hätten sie eine zusätzliche Hautschicht. Di war verwirrt und irritiert über den Mangel an Ideen und Plänen ihrer Tochter, für die Zukunft, die neue Freiheit. Wäre das ihrer älteren Schwester, Abigail, passiert, hätte diese keine Angst vor einer leeren Zukunft gehabt. Zweifelsohne hätte sie sich schon längst für einen Fortbildungskurs eingeschrieben, würde per Fernstudium einen Abschluß anstreben und gleichzeitig einen Beruf ausüben. Abigail würde nie auch nur einen Augenblick an Träume verschwenden, was hätte sein können. Allerdings wäre Abigail mit ihrem geordneten, ausgefüllten Leben, einem vorbildlichen Ehemann, der nie fremdgehen würde, und ihren drei vollkommenen Kindern so etwas nie passiert.
Geschieden, Abendessen mit Mutter und die Brieftasche mit den Kreditkarten gestohlen. »Verdammt noch mal, das ist nicht fair«, sagte sie laut, als ein großer schwarzer Wagen sie in rasantem Tempo überholte, viel zu knapp vor ihr wieder einscherte und ihre Windschutzscheibe mit Regen und Dreck bespritzte.
»Rücksichtsloser Bastard!« schrie sie in ohnmächtiger Wut, spähte durch die Schlieren auf der Scheibe und versuchte, das Kennzeichen zu sehen, erkannte aber nur ein A. Das seifige Wasser aus ihrer Scheibenwaschanlage vermengte sich mit dem Dreck auf der Windschutzscheibe zu einem Brei. Die Scheibenwischer ruckten quietschend über das Glas und blieben schließlich stehen.
»O nein! Ich kann's nicht fassen!« Thomasine konnte nichts mehr sehen. Sie bremste den Wagen vorsichtig ab, um auf der regennassen Fahrbahn nicht ins Schleudern zu geraten, und hielt. Sie schaltete die Warnblinkanlage ein, band sich einen Schal um den Kopf, holte den Lappen aus dem Handschuhfach und tat, leise vor sich hin fluchend, das, was alleinreisende Frauen nicht tun sollten – sie öffnete die Autotür und stieg aus. Der Wind peitschte ihr den Regen ins Gesicht und zerrte an ihrer Kleidung. Etwa zwanzig Meter weiter sah sie die Umrisse und die rot aufleuchtenden Bremslichter des jetzt langsamer fahrenden Wagens, der sie gerade so rücksichtslos überholt hatte.
Innerhalb von Sekunden war sie bis auf die Haut durchnäßt, und das Haar hing ihr trotz des schützenden Schals klatschnaß ins Gesicht. Sie wischte mit dem Lappen über die Windschutzscheibe, was das Geschmier nur verschlimmerte. Der Wind brauste durch die Bäume am Straßenrand, und die Zweige wippten wie zuckende Schatten in einem wilden Tanz. Da drin können sich jede Menge Wahnsinniger verstecken, dachte sie und war sich des Risikos bewußt, das sie einging. Schnell stieg sie wieder in ihren Wagen. Sie hoffte, daß der Regen nachlassen würde, und betete, daß kein anderes Auto auf ihres auffuhr. Nervös verriegelte sie die Türen. Ihr war kalt, sie hatte Angst, und sie wünschte, sie wäre zu Hause.
Der Regen wusch schließlich den Schmutz von der Windschutzscheibe. Sie startete den Motor, und die Scheibenwischer glitten wieder über die jetzt saubere Scheibe. Mit eingeschalteten Scheinwerfern legte sie den ersten Gang ein und fuhr vorsichtig weiter.
Plötzlich trat sie so heftig auf die Bremse, daß das Heck des Wagens ausscherte. Die Lichtkegel ihrer Scheinwerfer hatten ein auf der Fahrbahn liegendes Tier erfaßt. »Fahr daran vorbei«, sagte ihr die Vernunft. »Und wenn es verletzt ist?« wandte ihr Mitgefühl ein.
»Nenn mich Franz von Assisi«, sagte sie laut und stieg mit einem kräftigen Seufzer wieder aus. Vorsichtig näherte sie sich dem Tier, das zitternd auf der Straße lag; zwei große, dunkle, gefühlvolle Augen sahen sie an und senkten dann unterwürfig den Blick. Es war ein Hund.
Thomasine wußte wenig über Hunde, nur, daß es unklug wäre, einen fremden Hund zu berühren, vor allem, wenn er verletzt war. Sie stand da und blickte auf das Tier hinunter, während sie überlegte, was zu tun sei. Wenn sie den Hund auf der Straße liegenließ, könnte es passieren, daß der nächste Wagen nicht rechtzeitig bremsen und das Tier überfahren würde. Sie merkte, daß der Hund sie mit seinen ausdrucksvollen Augen ansah, als könnte er ihre Gedanken lesen. Kopfschüttelnd tat sie diese idiotische Vorstellung ab – sie mußte etwas tun, sonst lief sie Gefahr, selbst überfahren zu werden.
Sie bückte sich, aber der Hund duckte sich. Wenn er soviel Angst hat, beißt er mich vielleicht nicht, dachte sie. Andererseits griff vielleicht ein verängstigtes Tier eher an. »Da, riech mal«, sagte sie und streckte die Hand aus. Bei der abrupten Geste zuckte der Kopf des Hundes zurück, um der Berührung durch ihre Hand zu entgehen. Sie wartete geduldig. Schließlich schnupperte der Hund die Luft etwa dreißig Zentimeter vor ihrer Hand, prüfte den Duft und kroch dann langsam auf den Vorderpfoten zu ihr. Thomasine war sich nicht sicher, ob sie mit dem Hund reden sollte oder nicht, und beschloß dann, ihn mit leisen, gurrenden Tönen zu beruhigen, wie sie es früher immer mit ihrer Tochter Nadine getan hatte.
Der Hund schien diese Töne ermutigend zu finden, denn er wagte es, ihre Hand eingehend zu beschnuppern. Thomasine tätschelte sanft seinen Kopf. Den kräftigen Hals des Hundes umspannte ein schwarzes Lederhalsband mit großen, gemein aussehenden Metallstiften. Sie suchte nach einer Erkennungsmarke, fand jedoch keine.
Sie betrachtete den Hund, der sie mit zur Seite geneigtem Kopf ansah. Seine wunderschönen Augen hielten ihrem Blick eine Weile stand, doch dann senkte er wieder sittsam die Lider wie ein schüchternes Mädchen. Ganz offensichtlich wartete das Tier ergeben ihre Entscheidung ab. Sie ging zum Auto zurück und öffnete die Beifahrertür. »Komm, Junge oder Mädchen oder was immer du bist.« Sie tätschelte ermutigend ihren Oberschenkel. Der Hund scharrte verzweifelt mit den Vorderpfoten, seine langen schwarzen Krallen kratzten über den Asphalt, und er stemmte sich mit den kräftigen Vorderbeinen und den muskulösen Schultern hoch. Aber seine Hinterbeine konnten ihn nicht tragen. Der Hund sackte wieder zusammen. »Warte, Freundchen, eines nach dem anderen. Zuerst lege ich Zeitungspapier auf den Sitz, damit du mir mein Auto nicht dreckig machst.« Sie war ein bißchen befangen, weil sie mit dem Tier redete, aber da sie das Vertrauen des Hundes gewonnen zu haben schien, würde ihre Stimme vielleicht weiter beruhigend wirken. »Na, komm schon.« Sie bückte sich, umfaßte mit beiden Händen den Bauch des Hundes und hob ihn mühsam ins Auto. »Wow! Du wiegst ja eine Tonne. Du solltest auf Diät gesetzt werden.«
Der Hund war offensichtlich ans Autofahren gewöhnt, denn er blieb ruhig auf dem Sitz liegen. Zwischen seinen schwarzen Lefzen schaute seine rosa Zungenspitze hervor, und die Töne, die er von sich gab, klangen freundlich.
Thomasine schaltete die Innenbeleuchtung ein. »Was bist du denn für ein Hund?« Sie registrierte die kräftigen Muskeln, die tiefen Hautfalten, die verkürzte Schnauze und den massiven Kiefer. »Hoffentlich bist du kein Pitbull. Mit dem würde ich nämlich nicht gern in einem Auto sitzen.« Der Hund machte ein schniefendes, schnaubendes Geräusch und blickte erwartungsvoll nach vorn, als würde er darauf warten, daß sie losfuhr. Da raste ein Auto hupend und wütend blinkend vorbei.
»Rowdy!« schrie sie und legte den ersten Gang ein.
Während der Fahrt hörte Thomasine das keuchende Atmen neben sich und fand die Anwesenheit des Hundes ziemlich tröstlich – er war zwar nicht groß, aber muskulös und offensichtlich kräftig. Jeder würde es sich zweimal überlegen, dir dumm zu kommen, dachte sie. Es war angenehm, sich endlich einmal nachts allein im Auto sicher zu fühlen.
Thomasine war auf der Umgehungsstraße von Morristown. Trotz des schlechten Wetters beschleunigte sie, denn Jugendliche vom Forest Glade Estate benutzten diese Strecke gern für Spritztouren mit gestohlenen Autos. In Morristown gab es zwar ein großes Polizeirevier, wo sie den Hund hätte abgeben können, aber sie fand die Stadt mit ihren öden Hochhäusern, schlecht beleuchteten Bürgersteigen und höhlenartigen, mehrstöckigen Parkhäusern erschreckend. In Morristown gab es zuviel Gewalt, und es war vor allem für eine Frau zu gefährlich, nachts durch die Stadt zu fahren. Deshalb gab sie Gas, um so schnell wie möglich auf die Straße zu kommen, die zu dem hübschen Marktflecken Shillingham führte. Dort gab es ein Polizeirevier, das zwar kleiner war, aber das Städtchen verbreitete eine Atmosphäre der Sicherheit und des Wohlbehagens.
Sie parkte vor dem Polizeirevier und schleppte mit Mühe den schweren Hund hinein.
»Was haben wir denn da?« fragte ein Constable, hob die Klappe am Tresen hoch und beugte sich vor, um die beiden neugierig zu betrachten.
Thomasine setzte den Hund vorsichtig ab. Der stand dann, bemitleidenswert anzusehen, auf drei Beinen da. »Ich habe diesen Hund auf der Schnellstraße zehn Meilen vor Morristown gefunden. Er könnte ein Mops sein, die haben doch diese plattgedrückten Gesichter, nicht wahr?«
»Das ist eine Bulldogge«, stellte der Constable fest.
»Sind Sie sicher? Die sind doch normalerweise viel größer. Der im White Hart ist riesig – Butch heißt er.«
»Das ist eine Hündin«, sagte der Constable nachsichtig und deutete auf die Tafel der Zuchthunde an der Wand. »Und deshalb viel kleiner. Ich habe noch nie erlebt, daß eine Bulldogge ausgesetzt wurde. Die sind doch viel zu wertvoll.«
»Ausgesetzt? Soll das heißen, daß es Leute gibt, die ihre Hunde einfach auf Autobahnen aussetzen? Dort könnten sie doch überfahren werden.«
»Oh, dieses Risiko gehen diese Leute absichtlich ein, Miss. Die armen Viecher haben bei dem starken Lkw-Verkehr doch kaum eine Chance.«
»Und warum tut jemand so etwas?«
»Das spart die Tierarztkosten – auf diese Weise muß nichts fürs Einschläfern bezahlt werden. Platsch!« Der Constable knallte seine Faust in die Handfläche.
»Das ist ja schrecklich! Ich bin zwar keine Hundenärrin, aber wie kann jemand ...«
»Tja, Menschen sind eben verschieden«, sagte der Constable mit der ganzen Gelassenheit seines Berufs und saugte geräuschvoll Luft durch seine Zähne. »Ich habe mit allen möglichen Typen zu tun«, redete er weiter, als freue er sich, eine Zuhörerin gefunden zu haben. »Als die gefährlichen Kampfhunde verboten wurden, hatten wir es mit einer Menge ausgesetzter Pitbulls und Rottweiler zu tun. Ich mußte mich auch schon mal um einen Bernhardiner, kümmern – ein Hund von dieser Größe könnte einen schlimmen Unfall verursachen.«
»Aber warum kauft sich jemand einen teuren Hund und setzt ihn dann einfach aus?« fragte Thomasine verwirrt.
»Dafür gibt es viele Gründe – Dad verliert seinen Job oder haut ab. Hunde müssen geflittert werden. Oder der Hund ist zu groß geworden, oder die Leute sind seiner überdrüssig geworden. Ist doch ganz einfach, wirf ihn auf die Straße, gib Gas und laß einen Lastwagen die Dreckarbeit für dich erledigen.«
»Mir wird übel«, sagte Thomasine und setzte sich auf die Bank an der hellgrünen Wand.
»Sind wir nicht eine großartige Nation von Tierliebhabern?« fragte der Constable sarkastisch, während er nach einem Schreibblock griff. »Nun zum Bericht.«
Nachdem die Formalitäten erledigt waren, trat der Constable mit einer Hundeleine in der Hand vor den Tresen. Der Hund kroch zu Thomasine und versteckte sich hinter ihr.
»Na, meine Süße«, säuselte der Constable, streckte die Hand aus, um das Halsband zu packen, aber die Bulldogge humpelte, so schnell sie konnte, auf drei Beinen davon.
»Dann glauben Sie also nicht, daß dieser Hund verlorengegangen ist? Der Besitzer wird nicht hierherkommen und sagen: ›Fido, Liebling!‹«
»Möglich, aber unwahrscheinlich. Hatten Sie Probleme mit der Hündin? Ich meine, wurde sie böse?«
»Nein, überhaupt nicht. Geben Sie mir die Leine.« Die Hündin ließ es zu, daß Thomasine die Leine am Halsband befestigte. Dieses Vertrauen rührte Thomasine und weckte gleichzeitig Schuldgefühle in ihr, weil sie dieses Vertrauen mißbraucht hatte.
»Danke«, sagte der Constable und zerrte den Hund hinter sich her.
»Das Bein. Sie hat ein verletztes Bein«, rief Thomasine, aber der Constable ignorierte sie. Die Hündin riß an der Leine und sah sie mit ihren großen braunen Augen an. Thomasine machte auf dem Absatz kehrt und floh aus dem Revier, fort von diesem Blick.
Die Zeitung, auf der die Hündin gelegen hatte, war zerknautscht und schmutzig. Thomasine knüllte sie zusammen und warf sie auf den Boden. Das Auto roch nach feuchtem Fell. »Scheußlich«, murmelte sie, startete den Motor und fuhr vom Parkplatz.
Während der Fahrt mußte sie ständig an die Hündin denken. Sie versuchte, sich mit anderen Gedanken abzulenken, die immer wiederkehrende Erinnerung zu verdrängen, aber die Hündin gewann. Oder vielmehr die Augen der Hündin gewannen. Viel zu leicht, dachte sie und sah den flehenden, um Hilfe bittenden Blick, als der Constable sie hinter sich her gezerrt hatte.
»Um Himmels willen, Weib, hör auf damit!« sagte sie laut, als sie vor einer Ampel auf grünes Licht wartete. Ein Mann ging auf ihren Wagen zu, und sie drückte schnell den Knopf für die Zentralverriegelung, weil sie wieder die vertraute Anspannung ihres Körpers fühlte, die ihre Reaktion auf eine mögliche Gefahr war. Nervös trommelte sie mit den Fingern aufs Lenkrad, bis die Ampel endlich umschaltete. Mit der Hündin im Auto würde sie sich sicher fühlen und nicht so ängstlich reagieren.
Als sie bei Grün erleichtert losfuhr, hing sie weiter ihren Gedanken nach. Natürlich war es nicht damit getan, daß Hunde einem ein Gefühl von Sicherheit vermittelten. Oft genug hatte sie Freunde, die Hunde besaßen, über Unannehmlichkeiten klagen hören, obwohl sie ihre Haustiere liebten. Sie schleppten Dreck ins Haus, zerkauten und zerfetzten alle möglichen Dinge, pinkelten überall hin, hatten Flöhe und ruinierten den Garten. Man konnte sie nicht allein lassen, und sie rochen nicht gut – vor allem, wenn es regnete. Nein, es wäre klüger, sich kein Haustier zuzulegen – man war freier.
Fünf Meilen hinter Shillingham und zwei Meilen von ihrem neuen Haus in dem Dorf Middle Shilling entfernt, hielt sie abrupt am Straßenrand, wendete auf einem Feldweg und raste zurück. »Was geschieht mit ihr?« fragte Thomasine, als sie ins Polizeirevier stürzte und Wind und Regen mitbrachte.
Der Constable blickte erstaunt auf. »Wir behalten sie sieben Tage hier im Hundezwinger, und wenn sie bis dahin niemand abgeholt hat ...« Er fuhr sich mit der Hand quer über die Kehle. Thomasine griff sich unwillkürlich an den Hals. »Nein, das haben wir früher gemacht.« Sie konnte in sein Lachen nicht einstimmen. »Vielleicht hat sie Glück«, sagte er ernst, als er merkte, daß sie kein Verständnis für seinen Sinn von Humor aufbrachte. »Einer meiner Kollegen könnte Gefallen an ihr finden. Und es gibt viele Leute, die ihre entlaufenen Hunde suchen. Vielleicht will jemand sie haben. Wenn nicht, kommt sie ins Tierheim, bis sie eventuell einen neuen Besitzer findet. Sollte im Tierheim allerdings kein Platz mehr sein, dann ...« Er beendete den Satz nicht.
»Kann ich sie mitnehmen?« unterbrach Thomasine ihn hastig, als hätte sie Angst vor dem, was er sagen könnte, und vor ihrer eigenen Entscheidung. »Ich könnte mich um sie kümmern, bis jemand sie haben will. Nur vorübergehend, verstehen Sie. Ist das möglich?«
»Damit würden Sie mir einen großen Gefallen tun, Mrs. Lambert. Unsere Hundezwinger sind zum Bersten voll. Sollte jemand Interesse an einer Bulldogge haben, schicke ich die Person zu Ihnen. Sind Sie damit einverstanden?«
»Ja, schön.« Während er den Hund holte, stellte sie die Klugheit ihrer Entscheidung in Zweifel und fragte sich, ob sie sich einfach davonstehlen sollte. Ihre Hand lag schon auf dem Türgriff, als der Constable mit der Hündin im Schlepptau zurückkam.
»Vorsicht! Sie ist doch verletzt«, fuhr Thomasine wütend den Constable an. Dann nahm sie die Hündin auf die Arme. Die leckte ihr sofort die Wange. »Nein«, protestierte sie und wandte das Gesicht ab. »Nur vorübergehend«, sagte sie noch einmal zu dem Polizisten, der ihr die Tür aufhielt.
Jim Varley war so erschöpft, daß seine Glieder schmerzten. Er kam sich wie ein Tiefseetaucher vor, als er in seinen Stiefeln über den gepflasterten Hof hinter seiner Praxis in Middle Shilling stapfte. Außerdem fror er. Es war ungewöhnlich kalt für März, was, glaubte man den Dorfbewohnern, einen schlechten Sommer bedeutete. Er fluchte leise vor sich hin, als er in mehreren Taschen seiner verschiedenen Kleidungsschichten vor der Hintertür nach dem Schlüssel suchte. Er konnte sich noch gut an eine Zeit erinnern – es war noch gar nicht so lange her –, da hatte er sich nie die Mühe gemacht, abzuschließen, und schon gar nicht die Hintertür. Aber jetzt kam ihm sein Haus wie Fort Knox vor – zweimal waren irgendwelche Idioten auf der Suche nach Drogen in seine Praxis eingebrochen. Wo sollte das noch hinführen, wenn jetzt sogar schon Medikamente für Tiere gestohlen wurden? Beim letzten Einbruch hatten die Diebe einen so großen Vorrat an Pentobarbital gestohlen, daß man damit eine ganze Armee hätte einschläfern können.
Er hängte seinen tropfnassen Trenchcoat in der hinteren Diele mit dem gekachelten Fußboden auf, stülpte seine Mütze über einen Haken und zog seine verdreckten Stiefel aus. Auf dicken grünen Socken tappte er in die warme Küche. Seine alte Hündin, Castille – eine Promenadenmischung –, lag in ihrem Korb, hob den Kopf und klopfte freudig mit dem Schwanz. Er bückte sich, tätschelte ihren Kopf und sagte ihr, was für ein prächtiges Mädchen sie sei. Castille sah ihn mit ihren tränenden Augen an – die Zeit wurde für das alte Mädchen knapp, das wußte er nur zu gut. Doch daran dachte er nicht gern und verdrängte den Gedanken schnell. Er ging zum Küchentisch aus Kiefernholz. Dort wartete wie immer eine Nachricht auf ihn. Der Zettel lehnte an einer Vase mit hübsch arrangierten Trockenblumen – Beths Hobby. Von den Deckenbalken hingen Sträuße getrockneter Blumen und Kräuter, die sie selbst gepflückt hatte. Abendessen steht im Herd. Pastete im Kühlschrank. Essen Sie! Beth. Er lächelte; arme, geduldige Beth. Wie viele Abendessen hatte sie schon zubereitet und im Aga-Herd warm gestellt, um sie morgens unberührt wieder herauszunehmen? Heute abend würde er sie nicht enttäuschen.
Er nahm den entenförmigen Topfhandschuh von der Herdstange und holte sein Essen aus dem Ofen. Als er jedoch sah, wie vertrocknet die Koteletts waren, beschloß er, nur die Pastete zu essen. Er holte sie aus dem Kühlschrank und setzte sich damit an den Küchentisch. Beth hatte ihm ein Glas und eine angebrochene Flasche Rotwein hingestellt. Er schob sie beiseite, holte sich eine Flasche Glenfiddich von der Arbeitsplatte und goß sich ein ordentliches Quantum ein. Er trank einen großen Schluck, ehe er zum Tisch zurückkehrte.
»Sie müssen essen, Jim«, sagte eine Stimme von der Tür her.
»Ich esse doch«, sagte er und schob sich hastig einen Löffel voll Pastete in den Mund.
Beth, die einen geblümten Morgenrock trug, unter dem sich ihr üppiger Busen abzeichnete – ihr langes, natürlich gelocktes braunes Haar hing ihr lose auf die Schultern –, setzte sich zu ihm an den Tisch.
»Möchten Sie einen Whisky?« fragte er und deutete auf die Flasche.
»Ich fühle mich geehrt«, sagte sie lachend, da er seinen Malzwhisky eifersüchtig hütete. »Nein, danke. Ich trinke lieber Wein.«
»Sie wollen wohl heute abend ein Faß aufmachen«, neckte er sie, denn Beth trank selten Alkohol. Sie sagte nichts, sondern lächelte nur, als er ihr Wein einschenkte.
Als sie die Koteletts sah, verzog sie das Gesicht. »Kein Wunder, daß Sie die nicht essen. Soll ich Ihnen ein Omelett machen? Oder Eier mit Schinken?«
»Die Pastete reicht mir. Meinen Hunger habe ich wohl schon übergangen.«
»Sie sehen müde aus, Jim. War es eine schwere Geburt?«
Er fuhr sich mit der Hand über die Augen, als wollte er die Müdigkeit wegwischen. »Das kann man wohl sagen. Eine Steißgeburt. Das Problem mit Ben Luckett ist, daß er glaubt, alles über Ponys zu wissen. Er hätte mich Stunden vorher rufen müssen. Er weiß zwar, wie man die verdammten Biester reitet, aber sonst nichts.«
»Vielleicht wollte er Ihnen bei diesem Wetter die Fahrt nicht zumuten«, gab Beth zu bedenken.
Er haßte es, wenn sie tolerant war und damit auch noch recht hatte, denn genau das hatte Ben zu ihm gesagt. Er schenkte sich Whisky nach, woraufhin sie leicht die Stirn runzelte, aber nichts sagte.
»Was ist es denn für ein Fohlen?«
»Ein Stutenfohlen. Hübsches kleines Ding. Gab es irgendwelche Anrufe?«
»Nichts Dringendes. Ich habe die Zettel auf Ihren Schreibtisch gelegt. Sie können sich morgen darum kümmern.«
»Ich werfe mal einen Blick drauf – für alle Fälle.« Er stand auf. »Danke für das Abendessen«, sagte er wie ein höflicher kleiner Junge.
»Sie müssen sich einen Partner suchen, Jim. Dieses Arbeitspensum schaffen Sie nicht mehr allein. Das würde sogar einen jüngeren Mann umbringen.«
»Vielen Dank, liebe Beth. So alt bin ich noch nicht.« Er lachte gutmütig. »Gute Nacht. Schlafen Sie gut«, sagte er, Glas und Whiskyflasche in der Hand, von der Tür her und ging. Beth blieb am Tisch sitzen und starrte die geschlossene Tür an. Dann stand sie mit einem tiefen Seufzer auf, nahm den schmutzigen Teller und stellte ihn in den Geschirrspüler.
Jim saß in seinem Arbeitszimmer, obwohl »Arbeitszimmer« eine zu großartige Bezeichnung für den chaotischen Raum war, in dem er seine Abrechnungen machte, sich mit Fachliteratur auf dem laufenden hielt und viel nachdachte. In diesem Zimmer durfte niemand saubermachen. Er mochte das Durcheinander, wußte, wo alles war, und fand es im Handumdrehen. Sollte irgend jemand hier aufräumen, ginge ein lebenslanges Ablagesystem verloren. Das mußte er Beth zugute halten – sie war die einzige Frau, die er kannte, die das Zimmer so akzeptierte, wie es war. Sogar Ann, seine Frau, hatte ihn nicht verstanden und oft vorgeschlagen, das Zimmer zu renovieren und mit neuen Büromöbeln auszustatten. Es war schon das Arbeitszimmer seines Vaters gewesen, als er hier Tierarzt gewesen war, und als sich der alte Mann zur Ruhe gesetzt hatte, hatte Jim die Praxis und das Arbeitszimmer übernommen.
Er saß in seinem abgewetzten Captains-Sessel und zündete sich eine Zigarette an – mittlerweile rauchte er nur noch zehn am Tag und war stolz darauf. Er blätterte die Notizzettel durch, die Beth ordentlich gestapelt auf den Schreibtisch gelegt hatte. Sie hatte recht; darunter war nichts, was nicht bis morgen vormittag nach den Operationen warten konnte.
Beth war ein Geschenk des Himmels gewesen. Nach Anns Tod hatte er sich zwei Jahre lang durchgewurstelt, bis vor einem Jahr seine Freundin Fee Walters die Sache in die Hand genommen hatte.
»Du siehst völlig verwahrlost aus, mein lieber Jim, wie ein Landstreicher. Ich kenne da jemanden, der dir helfen kann.« Sie hatte ihm von Beth Morton erzählt, und er hatte widerwillig zugestimmt. Fee hatte ihm allerdings verschwiegen, daß Beth Harry mitbrachte – einen fünfjährigen Jungen, dem ständig die Nase lief. Als er das beim Vorstellungsgespräch erfuhr, hätte er sie am liebsten wieder weggeschickt. Aber in Beths Blick lag so viel Verzweiflung – sie wirkte wie ein in die Ecke getriebenes Reh –, daß er statt dessen ja sagte. Er hatte es nie bedauert, obwohl er sich wünschte, es würden weniger von ihren getrockneten Blumenarrangements herumstehen. Er hatte diesbezüglich aber nie etwas gesagt, denn ihr schien dieses Hobby viel Vergnügen zu machen. Mittlerweile mochte er sogar Harry. Der Junge verbrachte die meiste Zeit mit seinen Sega-Spielen am Computer und machte niemandem Ärger. Jim hatte allerdings manchmal Gewissensbisse und fragte sich, ob der Junge nicht mehr Aufmerksamkeit brauchte und sich nicht auch mit anderen Dingen beschäftigen sollte.
Beth hatte Jim das Leben wieder einigermaßen erträglich gemacht. Ohne ein Wort darüber zu verlieren oder ihre Nase in seine Angelegenheiten zu stecken, schien sie seine Not zu verstehen. Er goß sich Whisky ins Glas. Natürlich hatte Beth recht, er brauchte Hilfe. Die letzten drei Jahre waren die Hölle gewesen. Er war ständig müde, weil er der einzige Tierarzt in der Gegend und häufig nachts unterwegs war. Er war überlastet, das wußte er. Und obwohl er das Rauchen eingeschränkt hatte, trank er zuviel, um diesen verdammten Streß abzubauen. Die Zeiten hatten sich geändert, und die Menschen stellten für die Versorgung ihrer Haustiere höhere Ansprüche, als sein Vater sie je gekannt hatte. Neue Behandlungsmethoden, neue Medikamente machten es möglich, das Leben der Tiere zu verlängern, die noch vor zehn Jahren eingeschläfert worden wären. Aber diese Fortschritte erforderten mehr Arbeit, mehr Geräte und mehr Zeit für die Weiterbildung. Und das alles zusammen verursachte noch mehr Streß, der ihn wiederum zur Whiskyflasche trieb.
Er konnte sich nicht erinnern, wann er zum letzten Mal Urlaub gemacht hatte. Stellvertreter verlangten inzwischen bis zu hundertfünfzig Pfund pro Tag – falls überhaupt einer aufzutreiben war –, und deshalb kam für ihn ein Urlaub nicht in Frage. Da er der einzige Tierarzt in der Gegend war, konnte er seine Praxis nicht einfach schließen. Wer würde sich dann um die Tiere kümmern? Kein Wunder, daß unter Tierärzten die höchste Selbstmordrate aller Berufsgruppen herrschte.
Das alles war ihm klar, aber er wußte auch, warum er sich keinen Assistenten oder Partner gesucht hatte. Der Grund dafür war völlig irrational, denn er hatte das Gefühl, er würde Ann verraten, wenn er sich einen neuen Partner suchte. Ann und er hatten sich auf dem College kennengelernt und nach ihrem Abschluß Seite an Seite gearbeitet, wobei er die großen Tiere behandelte und sie sich um die kleinen kümmerte. Er war sich ziemlich sicher, daß die Leute hinter seinem Rücken munkelten, es sei an der Zeit, daß er Anns Tod überwinde, aber er wußte, daß er noch einen langen Weg zu gehen hatte. Zu oft, so wie jetzt, überwältigte ihn die Erinnerung an diesen letzten Morgen, als er Ann beobachtet hatte, wie sie sich geschmeidig in den Sattel ihres Jagdpferdes geschwungen und ihm zum Abschied zugewinkt hatte. Er jagte nicht, hatte nie Gefallen daran gefunden. Er sah einfach keinen Sinn darin, sein Leben damit zuzubringen, Tiere zusammenzuflicken, um dann an einem Samstag hinauszureiten und sie zu töten. Deshalb war er nicht bei Ann gewesen, als ihr Reitpferd bei einem Sprung über einen Zaun gestürzt war und Ann unter sich begraben hatte. Auf der Fahrt ins Kreiskrankenhaus war sie gestorben, und er hatte sich nicht einmal von ihr verabschieden können. Er hatte das Pferd sofort verkauft, obwohl er es am liebsten an Ort und Stelle erschossen hätte. Aber die Vernunft hatte gesiegt, denn er hatte gewußt, daß Ann nie damit einverstanden gewesen wäre.
Er fragte sich oft, ob er anders fühlen, leichter damit fertig werden könnte, wenn er bei ihr gewesen wäre. Doch mit dieser Ungewißheit mußte er leben.
Es war schon nach Mitternacht, als Thomasine die Hündin in ihre Küche trug und zu Boden setzte. Wieder sah sie mit zur Seite geneigtem Kopf erwartungsvoll zu ihr hoch. Vorsichtig untersuchte sie das verletzte Bein und entdeckte eine schlimme Schnittwunde und an der Unterseite des kräftigen, weißpelzigen Kiefers eine blutige Abschürfung. Sie füllte eine Schüssel mit warmem Wasser, badete die Wunden und trocknete sie mit einem Küchentuch.
»Möchtest du etwas zu essen? Ich habe kein Hundefutter, das ist dir wohl klar, wie? Du mußt dich eben mit den Resten des gestrigen Abendessens begnügen. Essen Hunde Lasagne?« Sie füllte eine Schale mit den Essensresten und eine andere mit Wasser. Hunde aßen Lasagne, und mit Appetit. »Ich hätte dich fragen sollen, ob du mehr Parmesan haben möchtest.« Sie lachte und goß sich ein Glas Wein ein, an dem sie nippte, während sie der Hündin zusah, die, auf drei Beinen stehend, mit geräuschvollem Vergnügen die Nudeln in sich hineinschlang.
Auf der Straße hatte sie geglaubt, die Hündin wäre schwarz, doch ihr Fell war nur vom Regen dunkel gewesen. Jetzt sah Thomasine, daß der Körper rehbraun mit einem etwas dunkleren Rücken war. Die Ohren waren schwarz und so weich wie feinster Samt. Die Nase war ein kleiner schwarzer Knopf unter dunkelbraunen Augen. Thomasine war sich bewußt, daß ihr diese Augen die Vernunft geraubt hatten.
»Ich will dich nicht haben, weißt du. Ich hätte darüber nachdenken müssen und keine so überstürzte Entscheidung treffen dürfen. Was ist, wenn niemand dich haben will? Bei mir kannst du nicht bleiben, daß ist dir doch klar, wie?«
Die Hündin setzte vorsichtig ihr verletztes Bein auf den Boden, reckte das Hinterteil in die Luft, streckte die Vorderpfoten aus und legte den Kopf darauf. Dann streckte sie den ganzen Körper und furzte kräftig.
»Na, das ist eine eindeutige Antwort. Pfui!« schimpfte Thomasine amüsiert.
Die Hündin legte sich auf den Rücken, reckte alle vier Beine in die Höhe und drehte sich wie ein Kreisel. Über dieses Kunststück mußte Thomasine lachen. Macht sie das mit Absicht, fragte sie sich. Um mich zu unterhalten? Um Aufmerksamkeit zu bekommen? Dann hörte die Hündin mit diesem Spiel auf, stand auf und wandte der Decke, die Thomasine in ihrer Waschküche gefunden und vor den Holzofen gelegt hatte, demonstrativ den Rücken zu.
»Tja, wenn dir die Decke nicht gefällt, mußt du eben auf dem Fußboden schlafen. Morgen kriegst du einen Karton. Ich gehe jetzt zu Bett. Hier bist du in Sicherheit, niemand wird dir weh tun.«
Sie bückte sich und nahm der Hündin das breite, häßliche Halsband ab. »Das brauchen wir doch nicht, oder? Was für ein schreckliches Ding.« Sie öffnete die Besenkammer, in der der Staubsauger stand, und warf das Halsband in eine Ecke. »So, da liegt es gut.« Es ist verrückt, mit einem Hund zu reden, sagte sie sich, als sie die Küche durchquerte. Ehe sie das Licht ausmachte, warf sie der Hündin eine Kußhand zu und sagte trotzdem: »Gute Nacht.«
Während sie sich auszog, mußte sie daran denken, wie sehr sie sich davor gefürchtet hatte, heute abend nach Hause zu kommen – geschieden, mit Brief und Siegel, ihr neuer Status. Sie hatte über ein Jahr lang allein in dem Haus in London gelebt und hätte eigentlich daran gewöhnt sein müssen. Aber dort hatte ihr die vertraute Umgebung Trost gespendet, während hier alles neu war – das Haus, die Nachbarn, sogar die Geschäfte. Sie war erst letzte Woche, kurz vor dem Scheidungstermin, hier eingezogen. Wahrscheinlich hatte sie sich zu lange an ihr altes Heim geklammert und hätte früher hierherkommen sollen.
Sie kletterte in ihr Messingbett, lehnte sich in die nach Lavendel duftenden Kissen zurück und gab sich wieder diesen Gedanken hin, die völlig sinnlos waren, denen sie jedoch trotzdem beinahe jede Nacht nachhing. Gedanken an die Zeit, als sie und Robert glücklich miteinander gewesen waren, als er noch zufrieden mit ihr und ihrer Ehe gewesen war. Zum x-ten Mal fragte sie sich, warum sie ihn verloren hatte und wie sie es hätte verhindern können.
Die Erinnerung an den Abend, als er ihr gesagt hatte, daß er Chantal kennengelernt habe und die Scheidung wünsche, stand ihr auch heute noch mit bitterer Deutlichkeit vor Augen. Sie war zusammengebrochen. Ihr schauderte bei dem Gedanken an die schreckliche Szene, die sie ihm gemacht hatte. Zuerst hatte sie einen ungläubigen Schrei ausgestoßen. Dann hatte sie getobt und ihm seine Falschheit vorgeworfen, um ihn anschließend auf Knien anzuflehen, zu ihr zurückzukehren. Sie hatte sich an seine Hosenbeine geklammert und an ihm gezerrt. Kalt hatte er ihre Hände gelöst und war vor ihr voller Entsetzen und Verachtung zurückgewichen. Noch in dieser Nacht hatte er sie verlassen.
Thomasine hatte drei Tage lang ununterbrochen geweint und dann Pläne und Ränke geschmiedet. Mit übermenschlicher Anstrengung hatte sie ihre Haltung wiedergewonnen und sich gezwungen, einen kühlen Kopf zu behalten. Sie hatte die Rolle der ruhigen, geduldigen, verständnisvollen Frau so gut gespielt, daß sie über sich selbst verwundert war. Von Vernunft geprägte Treffen fanden zwischen ihr und Robert statt. In aller Ruhe wurden die Einzelheiten der Scheidung geregelt, während sie innerlich die ganze Zeit vor Schmerz schrie.
Ihre Strategie hatte versagt. Ihr Plan war gewesen, daß er in ihr so eine wundervolle Frau sehen sollte, die er einfach nicht verlassen konnte. Er würde Chantal fallenlassen und zu ihr zurückkehren. Was war sie doch für eine Idiotin gewesen!
»Aber du mußt doch gemerkt haben, daß da etwas im Gange war«, hatte ihre Mutter heute abend beim Dinner gesagt.
»Nein, wirklich nicht. Es kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel.«
»Dann bist du entweder blind oder dumm«, hatte ihre Mutter mit dem für sie charakteristischen Taktgefühl gesagt.
»Wahrscheinlich bin ich beides«, hatte sie völlig demoralisiert und resigniert geantwortet.
Thomasine setzte sich halb auf, als das Bellen und Kratzen in der Küche in ihr Bewußtsein drang. Im Pyjama lief sie die Wendeltreppe von ihrem Schlafzimmer im Zwischengeschoß hinunter. »Was soll denn dieser Lärm?« fragte sie wütend. Aber ihr Ärger schwand schnell, als die Hündin sie schwanzwedelnd begrüßte. »Na, komm schon. Aber nur für heute nacht«, sagte sie, ohne zu wissen, daß das die fatalsten Worte waren, die ein Hundebesitzer sagen konnte.
Die Hündin ließ sich glücklich auf dem Boden neben ihrem Bett nieder. Was spielte es schon für eine Rolle, daß sie jetzt in ihrem Schlafzimmer war? Ich kann ihr ja auch hier einen Korb hinstellen, dachte Thomasine. »Zwei Körbe für dich, wenn das kein Luxus ist«, sagte sie und vergaß ganz, daß sie der Hündin, die bereits leise schnaufend schlief, vorhin versprochen hatte, einen Karton zu besorgen.
Zwei Meilen von Middle Shilling entfernt, in seinem Wochenendrefugium, wälzte sich Oliver Hawksmoor unruhig in seinem Bett. Er hatte eine schlimme Erkältung, die er selbst als Grippe diagnostiziert hatte und an der er schon seit sieben Tagen laborierte. Er fühlte sich hundeelend und fragte sich, ob das auf die Krankheit oder auf seine neue Lebenssituation zurückzuführen sei. Herrgott, dieses Bett war verdammt unbequem! Er rutschte mit dem Hintern zur Seite und landete auf Toastkrümeln, da er am Abend Toast im Bett gegessen hatte. Fluchend kletterte er aus dem Bett und zerrte das Laken von der Matratze. Er steckte es in den Korb für die schmutzige Wäsche und öffnete den Wäscheschrank.
»Das darf doch nicht wahr sein! Dieses Miststück!« Er starrte in den bis auf ein Badetuch, zwei Handtücher und einen Stapel Zierdeckchen leeren Schrank. »Ach, scheiß drauf!« Er knallte wütend die Tür zu. Im Schlafzimmer zog er Jeans, einen schwarzen Seidenrollkragenpullover und darüber einen hellblauen Kaschmirpullover an. Er spritzte sich Eau de Cologne ins Gesicht, um wach zu werden, und streckte sich im Spiegel die Zunge heraus. In der Küche kritzelte er für Grace White, seine Putzfrau aus dem Dorf, eine Nachricht auf einen Zettel, entschuldigte sich für die Unordnung und lehnte den Zettel an den Teekessel.
Da nur Wahnsinnige bei diesem stürmischen Wetter schnell fuhren, paßte er widerwillig seine Geschwindigkeit den Verhältnissen an. Er schob eine CD in den Player, und Joan Sutherlands Stimme füllte den mit schwarzem Leder ausgekleideten Innenraum seines BMW. Sophia hätte nicht die ganze Bettwäsche mitnehmen dürfen. Das voll eingerichtete Cottage war nicht Teil ihres Abkommens. Alles in Bishop's End war noch so, wie es gewesen war, als er es von seiner Großtante Phoebe geerbt hatte. Liebe alte Phoebe, würdest du doch noch leben, dachte er und fragte sich, wie sie seine neuen Lebensumstände beurteilen würde. Phoebe hatte Sophia nie gemocht: »Warum nennt sie sich nicht Sophie? Mit diesem a klingt ihr Name für mich verdächtig ausländisch. Ich wüßte gern, ob sie so getauft wurde.«
»Sie wurde als Engländerin geboren und erzogen, Tante Phoebe.«
»Sie stammt aus einer Kaufmannsfamilie, nicht wahr?« hatte Phoebe mit einem leichten Rümpfen ihrer Adlernase gefragt, die ihn immer an eine Skulptur erinnerte, die er einmal auf einem Grabmal der Plantagenets in Frankreich gesehen hatte.
»Wie kommst du nur auf diesen Gedanken, Tante?«
»Es gefällt mir nicht, wie sie die Möbel taxiert. Als wäre sie Besitzerin eines Ladens, die Inventur macht. Ein wohlerzogenes Mädchen tut so etwas nicht. Ich glaube, du machst einen verhängnisvollen Fehler, mein lieber Oliver.« Phoebe hatte das völlig ohne Bosheit gesagt und nur die Fakten dargelegt.
Tante Phoebe hätte sich zwar nicht über die Enttäuschung und Empörung ihres Großneffen, aber doch über ihre richtige Einschätzung Sophias gefreut. Sophia hatte darauf bestanden, das Mobiliar seines Londoner Domizils von einem Gutachter des Auktionshauses Sotheby schätzen zu lassen. Kein netter Zug. Gemeinsam hatten sie alle Besitztümer aufgeteilt und festgelegt, wer was bekommen sollte. Aber konnte er nach diesem Vorfall mit der Bettwäsche noch sicher sein, daß sie sich an ihre Vereinbarung hielt? Die Gütertrennung hatte zwar wie eine ziemlich einfache Angelegenheit ausgesehen: Sophia war damit einverstanden gewesen, daß er – vorausgesetzt, sie bekam das Bauernhaus in Frankreich und ein Haus in London –, das Holland-Park-Haus und Bishop's End behalten konnte. Diese Regelung konnte sich ah kostspieliger erweisen, als er gedacht hatte. Sophia hatte ihre Sachen gestern aus ihrem Londoner Haus holen lassen wollen. Vielleicht wäre er besser dabeigewesen, um den Abtransport zu überwachen, anstatt sich voller Selbstmitleid in seinem Bett in Middle Shilling zu verkriechen.
Er hielt vor seinem eleganten Stadthaus – noch ein Grund, um Tante Phoebe dankbar zu sein, denn er hatte es von ihrem Erbe gekauft. Phoebe hatte die Fähigkeit besessen, Liebesromane am laufenden Band zu produzieren, und damit ein Vermögen verdient, das sie klug angelegt und Oliver, ihrem Lieblingsgroßneffen, hinterlassen hatte. Dieses unverschämte Glück hatte ihn bei der restlichen Familie nicht beliebt gemacht, aber damit hatte er zu leben gelernt – was ihm keine allzugroßen Schwierigkeiten bereitet hatte.
Es war drei Uhr morgens, als er die Haustür aufschloß und eintrat. Als erstes fiel ihm auf, daß das Konsoltischchen und der Spiegel fehlten. Er ging ins Wohnzimmer, das praktisch leergeräumt war. Sophia hatte ihm ein Sofa, einen Couchtisch, einen Beistelltisch und einen Sessel gelassen. Die Bilder, die ihm geblieben waren, stellte er dankbar fest, zählten zu den kostbarsten der Sammlung. Wahrscheinlich hatte ihr der Nerv gefehlt, sie mitzunehmen. Trotzdem würde er um den Verlust der weniger wertvollen Gemälde trauern. Er setzte sich in den Sessel, sah sich düster in dem nackt wirkenden Raum um und zündete sich eine Zigarette an.
Was, zum Teufel, war in diese Frau gefahren? Wie konnte man sich nur so in jemandem täuschen? Vom ersten Augenblick an hatte er Sophia geliebt, als er sie anläßlich einer Vernissage in der Royal Academy of Arts gesehen hatte. Oliver sammelte Gemälde, und sie war Kunststudentin im Courtauld Institute gewesen. Sie war hübsch und reizend auf jene Weise, wie es junge Frauen sind, die vom Leben verwöhnt werden. Als er erfuhr, daß ihr Vater kürzlich ein Anwesen in der Nähe von Middle Shilling gekauft hatte, glaubte Oliver an eine Fügung des Schicksals und kaufte die LP von Kismet. Ihr Vater war durch seine Wohnungsbaugesellschaft, die er geschickt durch die verschiedenen Rezessionen und Wirtschaftsflauten der vergangenen dreißig Jahre manövriert hatte, ungeheuer reich geworden – natürlich verriet Oliver seiner Tante Phoebe nie, woher das Geld stammte. Sophias geschiedene Mutter, Constance, war die Tochter eines Grafen, den Ben Luckett unter seine Fittiche genommen hatte, um sein gesellschaftliches Ansehen aufzuwerten. Constance, die Oliver sehr verehrte, lebte jetzt von Unterhaltszahlungen in Südfrankreich. Dabei fiel ihm ein, daß Constance ihn davor gewarnt hatte, ihre Tochter zu heiraten, was ihm damals sehr merkwürdig vorgekommen war. Sophia haßte ihre leibliche Mutter nur etwas weniger als ihre Stiefmutter, Cora, die sie für eine vulgäre Frau hielt, die es nur auf das Geld ihres Vaters abgesehen hatte. Er hingegen mochte Cora, was Sophia unendlich geärgert hatte.
Vermutlich sollte er einen Rundgang durchs Haus machen, um zu sehen, was alles verschwunden war, und dann seine Anwälte kontaktieren. Sollte er sich die Mühe machen? Wahrscheinlich würde er morgen anders darüber denken. Er haßte Auseinandersetzungen, die in Form von Briefwechseln zwischen den Anwälten stattfinden würden. Schließlich ging es nur um Geld. Er hatte zwar keine Frau und keine Kinder, aber davon besaß er genug und hatte für den Rest seines Lebens ausgesorgt, denn Phoebes Bücher verkauften sich immer noch in hohen Auflagen. Erstaunlich, wie einem Geld über die meisten Dinge hinweghalf.
Er drückte seine Zigarette aus und ging müde nach oben ins Schlafzimmer. Wunder über Wunder, dachte er, als er sah, daß Sophia hier kaum etwas verändert hatte – nur ihr Toilettentisch war verschwunden. Aber den hätte er wahrscheinlich sowieso auf den Sperrmüll geworfen. Er setzte sich auf die Bettkante und zog seine Schuhe aus.
Was war in ihrer Ehe schiefgelaufen? Hatte es daran gelegen, daß sie keine Kinder hatten? War das so einfach? Aber es war nicht seine Schuld gewesen, das hatten ihm die Ärzte bestätigt. Um die Ursachen für Sophias Sterilität festzustellen, hatte er viel Geld ausgegeben, und sie hatte sich den teuersten Behandlungen unterzogen – vergeblich. In dieser Hinsicht hatte er echtes Mitgefühl für Sophia empfunden, denn sie schien sich nach Kindern zu sehnen, obwohl ihm schleierhaft gewesen war, wie ein harmonisches Familienleben mit ihren gesellschaftlichen Pflichten zu vereinbaren gewesen wäre. Er hätte gern einen Sohn gehabt, der seinen Namen und den ganzen Kram weiterführte. Daß sein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen war, hatte er einfach als persönliches Pech abgetan und sich damit abgefunden.
Hauptsächlich hatte er sich gefragt, ob Sophia seiner überdrüssig geworden war, weil er sie langweilte. Er hatte sie gefragt, woraufhin sie ihn wütend angeschrien hatte, er unterstelle ihr, oberflächlich zu sein. Er konnte ihr wirklich keinen Vorwurf machen, denn er hielt sich für langweilig. Er hatte seinen Beruf, in dem er kein Senkrechtstarter war, weil ihm der nötige Ehrgeiz fehlte. Da er jedoch ein ausgeprägtes Maß an Arbeitsethik besaß, arbeitete er in einer Brokerfirma in der City und verdiente sich damit seinen Lebensunterhalt. Da er hinsichtlich seines beruflichen Aufstiegs keine besonderen Ambitionen hegte, hatte er selten mit Sophia über seine Arbeit gesprochen. Wenn er es sich recht überlegte, konnte er sich kaum noch daran erinnern, worüber sie überhaupt miteinander gesprochen hatten – gewiß nicht übers Angeln. Sogar ihr gemeinsames Interesse an der Kunst war geschwunden, da Sophia jetzt von der Avantgarde fasziniert war, für die Oliver nichts übrig hatte. Noch hatte sie seine Liebe zu Bandage, seinem Bullterrier, geteilt.
»Bandage«, rief Oliver, stand auf und ging in sein Ankleidezimmer, wo Bandages Korb normalerweise stand. Er war nicht da. Bandage war auch nicht im Badezimmer. Der Bullterrier hatte die Angewohnheit, sich in eine Ecke des Zimmers zu verkriechen, wenn er deprimiert war oder schmollte. Oliver war überzeugt, daß sein Hund solche Gefühle besaß. Bandage saß oft mit dem Rücken zum Zimmer da, die Schnauze an die Wand gedrückt, und verharrte in dieser Stellung fünf Minuten oder sogar eine Stunde. Aber jetzt konnte er den Bullterrier nirgends entdecken. Er rannte nach unten, nahm zwei Stufen auf einmal und riß die Küchentür auf. Dort stand ein zweiter Korb, in dem sich Bandage gern verkroch. Der Korb war zwar da, das Spielzeug ordentlich darin aufgestapelt, aber kein Hund. »Bandage«, schrie er immer wieder und polterte die Treppe wieder hoch.
»Wimpole, wo ist Bandage?« fragte er die lieb aussehende, grauhaarige Frau, die, in einen schäbigen blauen Wollmorgenrock schlüpfend, auf dem Treppenabsatz erschien. Wimpole war sein Kindermädchen gewesen. Sie war vom ersten Tag seines Lebens an bei ihm gewesen und würde wohl bis zum letzten Tag ihres Lebens bei ihm bleiben.
»Was soll denn dieser verdammte Radau?« fragte sie ärgerlich.
»Wimpole, achte auf deine Sprache!«
»Sie haben mir einen Schrecken eingejagt. Was ist denn los?«
»Ich kann Bandage nicht finden.«
»Ihre Frau hat ihn mitgenommen«, sagte sie sarkastisch. »Sie sagte, sie würde ihn ihrem Vater bringen. Sie hat nicht auf Wimpole gehört.«
Oliver lehnte sich auf der Treppe gegen die Wand und nahm geistesabwesend wahr, daß auch der Hockney verschwunden war: soviel zu seiner Theorie, Sophia hätte nicht den Nerv besessen, die besten Gemälde mitzunehmen. »Sie hat das Bild mit dem Motiv vom Swimmingpool mitgenommen, das Sie so gern haben, und noch ein paar aus dem Salon. Diese habgierige Kuh.«
»Meinetwegen kann sie die verdammten Bilder haben, daran liegt mir nichts. Aber Bandage kriegt sie nicht.«
»Das habe ich ihr gesagt. Aber sie meinte, da sie ihn gekauft habe, gehöre er ihr.«
Oliver seufzte. »Stimmt, sie hat für ihn bezahlt, aber er war ein Geschenk für mich.«
»Von wegen Geschenk! Geschenke nimmt man nicht zurück, wenn es einem in den Kram paßt, oder? Diese Familie hat keine Klasse, das habe ich immer gesagt, ganz wie Ihre Tante Phoebe. Wie gut, daß sie das nicht mehr erleben mußte. Möchten Sie einen Drink?«
»Nein, danke, Wimpole. Aber nimm du dir ruhig einen. Ich muß nachdenken.«
»Sie hätten nicht nach Bishop's End fahren dürfen. Wären Sie hiergewesen, wäre das nicht passiert. Oder Sie hätten den Hund mitnehmen müssen.«
»Sonst nehme ich Bandage doch immer mit ... ach, da fällt mir ein ... Sophia sagte, ihr Vater wolle ihn einem Freund zeigen und sie würde ihn zu den Lucketts bringen. Aber inzwischen müßte er eigentlich wieder zu Hause sein.«
»Was wollen Sie jetzt unternehmen?« Die beiden waren in den Salon gegangen, und Wimpole bereitete sich einen großen Scotch mit Eis zu.
»Sollte Sophia vorhaben, Bandage zu behalten, kann sie das vergessen!« sagte er wütend.
Aber später, als Oliver im Bett lag, tat er etwas, das er als Kind aus Angst vor dem Schwarzen Mann getan hatte: Er steckte den Kopf unter die Kissen. Alles konnte er ertragen, nur nicht den Verlust seines Hundes.
In Okaleigh Kennels, weit genug von dem Dorf Middle Shilling entfernt, damit das Bellen der Hunde niemanden störte, ging Eveleigh Brenton endlich zu Bett.
Was war das nur für ein Tag gewesen! Vor Aufregung würde sie bestimmt nicht schlafen können. Crufts. Heute abend war sie von der Ausstellung zurückgekehrt. Zwar hatte sie keinen Preis gewonnen – was sie dieses Jahr auch nicht erwartet hatte –, aber das machte nichts. Nur dabeizusein hatte ihr genügt. Andere Hundebesitzer und Züchter zu treffen, mit den Preisrichtern zu reden, von Menschen umgeben zu sein, die wußten, was es bedeutete, Hunde zu besitzen, diese wichtigsten Wesen in ihrem Leben. Es war eine Freude, niemandem ihre Liebe zu diesen Tieren erklären zu müssen. Und sie hatte einen prächtigen Bernhardinerrüden entdeckt und stellte sich bereits vor, was für schöne Welpen er und ihre Brünnhilde produzieren würden. Auch die Hunde waren aufgeregt gewesen und hatten lange gebraucht, bis sie sich in ihren Zwingern beruhigt hatten.
Jedenfalls steht eines fest, sagte sie sich, als sie die Nachttischlampe ausknipste, Crufts ist einmalig auf der Welt.
In jedem Zimmer des schicken georgianischen Reihenhauses in Shillingham brannten Lampen, und draußen leuchtete die Kutscherlaterne über dem Lorbeerbaum in dem weißen Holzkübel. Durch die Fenster gesehen vermittelte die überwiegend in Pfirsichfarben gehaltene Dekoration einen warmen, einladenden Eindruck. Das Haus war perfekt gestylt. Die Eingangshalle war mit schwarzem und weißem Marmor gefliest – Gill neigte dazu, Besucher hinter vorgehaltener Hand und mit einem kleinen Lachen darauf hinzuweisen, daß es beste Amtico-Fliesen seien. Die Teppiche im Wohnzimmer waren cremefarben, die Sofas und Sessel mit rostrot und grün gestreiftem Seidenstoff bezogen – zumindest sahen die Bezüge wie Seide aus, waren aber zu sechzig Prozent aus Polyester, noch eines ihrer kleinen Geheimnisse. Der Sekretär war Chippendale. Das Canterbury-Musikregal, in dem sich statt Notenblättern Hochglanzmagazine stapelten, war georgianisch wie der Satz Beistelltische. Chippendale, georgianische Stilmöbel und Hepplewhite – beste Nachbildungen von Brights in Nettlebed.
Die beiden Schlafzimmer waren in Weiß mit einem Hauch Pfirsich gehalten; das Bad in eduardischem Stil mit Messinghähnen ausgestattet und die Küche aus Kiefernholz im provenzalischen Stil gehalten.
Da Haus war ein richtiges kleines Schmuckstück, für das Justin und sein Freund Gill sieben Jahre lang geknausert, gespart und geschuftet hatten.
Im ganzen Haus gab es nur eine Dissonanz, und zwar im Wohnzimmer. In einer Ecke versteckt stand ein schäbiger, hellbrauner, mit Dralon bezogener Sessel, über den ein Kelim gebreitet war, der schon bessere Tage gesehen hatte und dessen orange-rotbraunes Muster einigermaßen zu den vorherrschenden Farben paßte.
Dieser Sessel gehörte dem dritten Mitglied der Familie – Sadie. Sadie war ihr Kosename, denn offiziell hieß sie Saradema, Princess Light of Snippers, Sproß von Champion Felix, Prince of Darkness of Barton. Sie war eine Zwergpudelhündin mit kohlschwarzen Augen in einem hübschen, intelligenten Gesicht. Sie war sich ihrer Bedeutung bewußt, denn sie saß immer mit hocherhobener Schnauze wie eine Königin in ihrem Sessel, die darauf wartet, bedient zu werden.
Justin und Gills ganze Liebe gehörte Sadie, die Hündin war die Freude ihres Lebens. Die beiden liebten Sadie so abgöttisch, wie es nur Menschen mittleren Alters tun können, die keine Kinder haben. Beide waren überzeugt, daß es unmöglich war, ein Kind mehr zu lieben, als sie ihren Pudel liebten. Doch diese Hypothese würde nie auf die Probe gestellt werden. Da keiner von beiden ein Geheimnis daraus machte, daß er nicht an Gott glaubte und Kinder für lärmende und unordentliche, aber für den Fortbestand der Menschheit unerläßliche Übel hielt, fanden beide es höchst merkwürdig, daß sie unzählige Male gebeten worden waren, Patenonkel zu sein. Betrübt kamen sie zu der Schlußfolgerung, daß ihre heterosexuellen Freunde von fiskalischen Überlegungen getrieben wurden und darauf spekulierten, daß – da sie nie eigene Kinder haben würden – ihr Erbe einem Patenkind zufallen könnte, wenn sie eines Tages in den herrlichen Friseursalon im Himmel eingingen. Deshalb hatten sie diesbezügliche Angebote stets abgelehnt.
Beide wußten, daß sie zynisch waren. Das Leben hatte sie so gemacht. Es war schwieriger, in der Kleinstadt Shillingham schwul zu sein als in der Weltstadt London. Deshalb hatten sie sich wie Schildkröten einen Panzer gegen Getuschel und komische Blicke zugelegt.
Wurden sie gelegentlich von ihren Kunden zu Partys eingeladen, so geschah das zum Vergnügen der Gäste und nicht aus Freundschaft, wie beide wußten. Vor allem Gill übertrieb bei diesen Gelegenheiten und gab sich betont tuntenhaft – als müßten sie für ihr Abendessen eine Vorstellung geben –, um die Erwartungen zu erfüllen. Es war traurig, daß niemand sie wirklich kennenlernen wollte, doch damit konnten sie umgehen.
Doch seit etwa sechs Monaten fühlten sie sich wirklich bedroht, denn eine Horde Rüpel hatte sich den Brunnen am Marktplatz zum Treffpunkt auserkoren. Und die beiden hatten Angst, daß die ständigen Sticheleien irgendwann in Gewalttätigkeiten ausarten könnten. Ihr Friseursalon lag in einer vom Marktplatz abführenden, hübschen kleinen Straße, die allerdings eine Sackgasse war. Um nach Hause zu kommen, mußten sie deshalb immer den Marktplatz überqueren. Vor allem am Samstag abend, wenn zahlreiche Rowdys am Cromwell-Brunnen herumlungerten, mußten sie Spießruten laufen, wurden beschimpft, bespuckt und beschuldigt, HIV-positiv zu sein. Was Justin und Gill jedoch am meisten empörte, war, daß den noblen, ehrenwerten Bürgern von Shillingham diese Pöbeleien zwar peinlich waren, alle Passanten aber mit gesenktem Kopf schnell weitergingen.
Von den beiden war Justin der sensiblere und litt mehr unter dieser Diskriminierung. Das war verständlich, denn er war als verhätschelter Sohn des Vikars in Upper Shillingham aufgewachsen und hatte anschließend das beschützte Leben eines Chorknaben in Norwich geführt. Ein Stipendium hatte ihm das Studium am Kings College in Cambridge ermöglicht, wo er mit Gleichgesinnten zwar viel Spaß hatte, aber nur einen drittklassigen Abschluß schaffte. Er hatte ein unglückliches Jahr lang als Praktikant in einer Schokoladenfabrik gearbeitet, bis er Gill in einer Bar in London kennenlernte, Friseur wurde und jetzt nur noch in der Badewanne sang.
Gills Weg nach Shillingham war holpriger und beschwerlicher gewesen. Als Sohn eines versoffenen und prügelnden Maurers und einer valiumbenebelten Mutter war er in einer Sozialsiedlung in Morristown aufgewachsen. Das Haus roch nach Verzweiflung und Verwahrlosung. Die Gehwege waren verdreckt, und die Wände mit vulgären Graffiti beschmiert. Die Fahrstühle funktionierten selten und waren zu Latrinen umfunktioniert worden. Einbrüche waren an der Tagesordnung, obwohl es kaum etwas zu stehlen gab. Raubüberfälle gehörten zum täglichen Leben, und Vergewaltigungen wurden nicht angezeigt. Die Siedlung hieß ironischerweise Forest Glade Estate, aber keiner der von der Gemeinde gepflanzten Bäume hatte die Zerstörungswut der gelangweilten, arbeitslosen Jungen überlebt.
Gill merkte früh in seinem Leben, daß er anders als seine Kameraden war. Er war klüger, achtete auf sein Aussehen und mochte hübsche Dinge. Deshalb wurde er schon in der Schule schikaniert und verprügelt, denn er lebte in einer Gesellschaft, die unbarmherzig alles Andersartige ablehnte. Er wußte, daß sich dieser Haß vor allem auf Neid gründete, doch dieses Wissen bot keinen Trost, wenn er mit Fußtritten traktiert wurde.
Gill konnte von seinem Schlafzimmerfenster in dem Hochhaus in der Ferne grüne Felder sehen, und weit dahinter lag London, wohin er eines Tages zu entfliehen hoffte. In diesem Elternhaus konnte er nicht einmal davon träumen, die Universität zu besuchen und einen Abschluß zu machen. Also suchte Gill sich eine Lehrstelle bei einem Friseur im Einkaufszentrum. Drei Jahre lang wusch er Haare, kehrte den Salon, sah dem Friseurmeister zu und sparte jeden Penny seines Hungerlohns, bis er endlich nach London gehen und das Leben beginnen konnte, von dem er wußte, daß es auf ihn wartete.
Daß er Justin kennenlernte, war das Beste, das ihm je im Leben passiert war. Er hatte schon sechs Jahren in London gelebt und war mittlerweile Stylist bei Frederico in Mayfair mit einem eigenen Kundenstamm. Er hatte jede Menge Liebhaber gehabt und war mit sechsundzwanzig an dem Punkt angelangt, wo er sich nach einer festen Beziehung sehnte. Den Partner dafür fand er in einer verräucherten Bar. Es war Liebe auf den ersten Blick, und seitdem lebten sie zusammen – seit zehn Jahren.
Der Tod von Justins Vater und das damit verbundene Erbe hatte es ihnen ermöglicht, sich nach einem eigenen Haus umzusehen. Vor sieben Jahren waren sie nach Shillingham gezogen. Keiner von beiden hätte erklären können, warum sie eine Stadt in der Nähe der Umgebung wählten, in der sie ihre Kindheit verbracht hatten, denn keiner von beiden hatte geglaubt, daß ihre Wurzeln in ihrem Leben eine so große Rolle spielten. Shillingham war eine hübsche Stadt, in der es relativ wenig Kriminalität gab. Doch ausschlaggebend für ihre Entscheidung war gewesen, daß sie sich das georgianische Haus ihrer Träume hatten leisten können und ihnen noch genug Geld übrigblieb, um den Mietvertrag für ein Geschäft zu übernehmen und ihren eigenen Friseursalon zu eröffnen, den sie Snippers nannten.
Während im Haus Pfirsichfarbtöne und Charme dominierten, herrschte im Snippers eine Atmosphäre stilvoller Effizienz. Der Salon war ganz in Schwarz, Weiß und Chrom gehalten. Diese Stilrichtung liebten sie ebenso wie ihr Haus und wie sie später Sadie lieben sollten. Ständig spielte leise Hintergrundmusik –Vivaldi, Oldies und ähnliches, obwohl beide Mozart und Manilow vorgezogen hätten, aber sie mußten auf ihre Kunden Rücksicht nehmen. Beide waren schwarz gekleidet. Gill hatte Justin alles beigebracht, was er konnte.
Sadie war vor drei Jahren in ihr Leben getreten, nachdem sie sich überlegt hatten, wie nett es doch wäre, ein Haustier zu haben. Bücher über Hundezucht wurden gekauft und Händezeitschriften studiert. Da sie beide jedoch Friseure waren, hatten sie sich bald für einen Pudel entschlossen. Es war schwierig gewesen, Sadie aus einem Wurf von sechs Welpen zu wählen – alle sechs hatten ihnen gefallen –, aber Sadie hatte etwas Besonderes, das sie von ihren Geschwistern unterschied: eine Aura der Unnahbarkeit umgab sie, als wisse sie, daß sie anders sei. Diese Eigenschaft brachte in beiden eine Saite der Erinnerung zum Schwingen. Also fiel ihre Wahl auf Sadie.