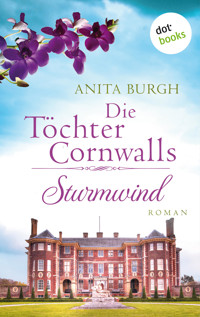Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Töchter Cornwalls
- Sprache: Deutsch
Eine berührende Geschichte über die eine wahre Liebe: Die Familiensaga »Die Töchter Cornwalls: Dämmerstunde« von Anita Burgh jetzt als eBook bei dotbooks. England im Jahre 1940: Die kapriziöse Juniper Tregowan und die schüchterne Polly Blewett könnten nicht unterschiedlicher sein, und trotzdem sind die beiden Freundinnen einander so nah wie Schwestern. Während der drohende Krieg mit Deutschland seine Schatten über das Land wirft, versuchen die beiden, ihre Jugend so gut es geht zu genießen: Juniper stürzt sich Hals über Kopf in das wilde Leben der Londoner Salons, und Polly ist nach einer großen Enttäuschung endlich bereit, sich für eine neue Liebe zu öffnen. Aber ist der charmante Andrew wirklich der Mann, auf den sie schon so lange wartet? Und noch dazu droht Junipers immer verzweifeltere Suche nach Aufmerksamkeit und Anerkennung das Band der Freundschaft, dass die beiden Frauen verbindet, endgültig zu zerreißen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Töchter Cornwalls: Dämmerstunde« ist das Finale der berührenden Familiensaga von Anita Burgh. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 757
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
England im Jahre 1940: Die kapriziöse Juniper Tregowan und die schüchterne Polly Blewett könnten nicht unterschiedlicher sein, und trotzdem sind die beiden Freundinnen einander so nah wie Schwestern. Während der drohende Krieg mit Deutschland seine Schatten über das Land wirft, versuchen die beiden, ihre Jugend so gut es geht zu genießen: Juniper stürzt sich Hals über Kopf in das wilde Leben der Londoner Salons, und Polly ist nach einer großen Enttäuschung endlich bereit, sich für eine neue Liebe zu öffnen. Aber ist der charmante Andrew wirklich der Mann, auf den sie schon so lange wartet? Und noch dazu droht Junipers immer verzweifeltere Suche nach Aufmerksamkeit und Anerkennung das Band der Freundschaft, dass die beiden Frauen verbindet, endgültig zu zerreißen …
Über die Autorin:
Anita Burgh wurde 1937 in Gillingham, UK geboren und verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in Cornwall. Ihre 24 Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und feierten international Erfolge. Mittlerweile lebt Anita Burgh mit ihrem Mann und zwei Hunden in einem kleinen Dorf in den Cotswolds, Gloucestershire.
Bei dotbooks veröffentlichte Anita Burgh ihre Romane »Das Erbe von Respryn Hall«, »St. Edith’s: Hospital der Herzen«, »Glückssucherinnen«, »Die Liebe eines Fremden«, »Wo deine Küsse mich finden«, »Das Lied von Glück und Sommer«, »Wo unsere Herzen wohnen«.
Außerdem veröffentlichte Anita Burgh bei dotbooks ihre Familiensaga »Die Töchter Cornwalls« mit den drei Einzelbänden: »Morgenröte«, »Sturmwind« und »Dämmerstunde«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1991 unter dem Originaltitel »The Stone Mistress« bei Chatto & Windys, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1993 unter dem Titel »Die steinerne Herrin« bei Droemer Knaur.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1991 by Anita Burgh
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1993 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Eli Yeung, Le Do
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-468-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Dämmerstunde« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anita Burgh
Die Töchter Cornwalls: Dämmerstunde
Roman
Aus dem Englischen von Traudl Weiser
dotbooks.
Für Mic Cheetham und die Insel Mull
Teil I
Kapitel 1
1
Es war heiß. Die Atmosphäre in dem überfüllten Raum war stickig vom Zigaretten- und Zigarrenrauch. Die Kellner arbeiteten nach einem eigenen Signalsystem. Der Rhythmus der Musik dröhnte unerbittlich. Der Schnulzensänger kämpfte tapfer gegen das Klappern von Geschirr, das ständige Knallen von Champagnerkorken und das Geschrei an, das hier als Unterhaltung diente. Die kleine, zentral gelegene Tanzfläche war mit Paaren vollgestopft, die sich wie vor einem Weltuntergang aneinanderklammerten, während sie sich auf dem Marmorboden wiegten.
Eine Frau trat ein, blieb auf der obersten Stufe der Treppe stehen, die zur Mitte des Raums hinunterführte. Eine Woge von Beifall schlug ihr entgegen, den sie anmutig zur Kenntnis nahm, ehe sie langsam hinabschritt und durch die eng stehenden Tische ging. Der Oberkellner eilte dienstbeflissen herbei und bahnte ihr einen Weg durch die Menge. Sie war in Begleitung von vier jungen Männern, die alle vor Stolz grinsten, weil sie für diesen Abend auserwählt worden waren. Sie verweilte einen Augenblick, um die Gäste an den Tischen zu begrüßen, stand da, eine Hand in die Hüfte gestemmt, den Oberschenkel provozierend vorgeschoben, den Rücken elegant gestreckt. Sie entdeckte jemanden, den sie kannte, schwebte zu ihm, küßte ihn vertraulich. Ihr Blick schweifte durch den Raum, sie winkte anderen, aber weniger wichtigen Gesichtern in der Menge zu. Die Gruppe erreichte ihren Tisch. Mit geschmeidiger Anmut bewegte sich die Frau zwischen den Tischen und gepolsterten Bänken. Der Kellner entfaltete ihre Serviette, ließ sie knattern wie ein Segel und legte sie ihr ehrerbietig auf den Schoß. Gläser wurden herangetragen, Menüs studiert.
Francine Frobisher lehnte sich in dem rotsamtenen Polstersessel zurück. Sie nahm eine Zigarette aus einem Goldetui, steckte sie mit übertriebener Langsamkeit in eine lange Elfenbeinspitze, die sie dann sanft streichelte. Sie sah den Mann, der neben ihr saß, träge an und lachte über die Erregung in seinen Augen. Als sie die Zigarettenspitze zwischen ihre Lippen steckte, flammten vier Feuerzeuge auf. Ihr Blick schweifte von einem ihrer Begleiter zum nächsten, während sie entschied, wem sie huldvoll die Ehre erweisen würde, ihre Zigarette anzünden zu dürfen. Sie wählte den Mann, dem sie zugelacht hatte, und die anderen wandten sich enttäuscht ab.
Francine hatte diesen Mann aus verschiedenen Gründen gewählt. Er war Amerikaner, und sie mochte deren unkomplizierten Enthusiasmus im Bett; sie kannte ihn nicht, was immer reizvoll für jede neue Bekanntschaft war; er war jung – und je älter sie wurde, um so mehr schätzte sie die Jugend –, aber vor allem hatte sie ihn gewählt, weil er sie mit seinem schwarzen Haar, seinen grauen Augen und seinem leicht schiefen und sardonischen Lächeln sofort an Marshall Boscar erinnert hatte. Marshall war der einzige Mann, den sie je geliebt hatte, oder vielmehr, Francine bildete sich ein, ihn geliebt zu haben, denn es war unwahrscheinlich, daß sie je einen anderen Menschen mit derselben Hingabe wie sich selbst geliebt hatte. Francine hatte mit einem Bataillon Männer geschlafen, aber keiner hatte sie so beeindruckt wie Marshall. Marshall war eine Herausforderung gewesen, doch kaum hatte sie geglaubt, ihn erobert zu haben, war er ihr entglitten. Jetzt war er tot und würde ihr nie gehören.
Francine kam die meisten Abende nach der Show hierher, in den Garibaldi Club. Er entsprach ihrem Geschmack, lag in der Nähe der West-End-Theater, bot gute Musik, passables Essen und ein kultiviertes Publikum, das sie nie mit aufdringlichen Bitten um Autogramme belästigte. Und er war stets voller Menschen, was eine Unterhaltung schwierig machte. Auch das gefiel ihr. Nach einer Vorstellung redete sie für eine Weile nicht gern, zog es vor, nur zu beobachten und Zeit zu haben zu entscheiden, wer ihr Bett in dieser Nacht teilen würde.
Mit vierundvierzig mußten sich die meisten Frauen ihrer Generation mit breiten Hüften, grauem Haar und Falten abfinden. Doch Francine nicht. Die Natur hatte ihr freundlicherweise einen guten Knochenbau und einen perfekten hellen Teint verliehen, der ihr schönes blondes Haar vorteilhaft ergänzte. Ihre Augen waren von einem erstaunlichen Grün, so dunkel wie die Blätter der Stechpalme. Aber sie hatte diese Gaben nie als selbstverständlich betrachtet, sondern über die Jahre hart daran gearbeitet, ihre Schönheit zu bewahren. Und Francine war dafür belohnt worden, denn ihrem guten Aussehen hatte sie größtenteils ihre Position als berühmter West-End-Musical-Star zu verdanken.
Ihre Begleiter konnten sich glücklich schätzen, daß eine Unterhaltung im Garibaldi schwierig war, denn außer ihren Vorstellungen und ihrer Schönheit besaß Francine keine Interessen und hatte daher nichts Bemerkenswertes zu sagen. Sie las keine Bücher, nur Manuskripte. In der Tageszeitung überflog sie nur die Klatschspalten. In Illustrierten interessierte sie allein der Modeteil, den sie mit professioneller Sorgfalt studierte. Sie ging nie ins Theater, um anderen Schauspielern zuzusehen, und die einzige Musik, die sie hörte, waren Plattenaufnahmen ihrer eigenen Lieder.
Europa war im Krieg: Männer starben zu Tausenden; Frauen wurden Witwen, Kinder Waisen; Juden wurden niedergemetzelt; Angst verbreitete sich in der Welt –, das alles berührte Francine nicht. Für sie war eine Tragödie ein abgebrochener Fingernagel, ein Makel auf ihrer Haut, ein schlecht sitzendes Kleid. Francine betrachtete den Krieg als einen Bonus, denn er brachte volle Häuser, ein Publikum, das sich verzweifelt nach ihrer Magie sehnte, um für ein paar Stunden den bedrückenden Alltag vergessen zu können.
Ihr Begleiter beugte sich vor und flüsterte ihr ins Ohr: »Möchten Sie tanzen?«
»Nein, danke«, entgegnete sie. Die Tanzfläche war zu voll. Francine tanzte nur gern, wenn sie sicher war, Aufmerksamkeit zu erregen.
»Möchten Sie woanders hingehen?«
Sie schüttelte den Kopf. Das hatte keinen Sinn. Sie kannte alle Clubs; dieser hier gefiel ihr am besten.
Zwei Frauen, Anfang zwanzig, in Begleitung eines etwas älteren, großen, schlanken, uniformierten Mannes, dessen Gesicht eher interessant als gutaussehend zu nennen war, kamen leichtfüßig die mit rotem Teppich belegte Treppe herunter. Wieder eilte der Oberkellner dienstbeflissen herbei, verneigte sich unterwürfig – hier war ein Gast, nicht berühmt wie Francine, der jedoch eine andere Qualität besaß, die für Männer seines Berufs wichtig war Reichtum.
»Alphonse, wie geht's Ihrer Familie? Gut, hoffe ich. Haben Sie einen Tisch für uns?« Eine der beiden jungen Damen lächelte ihn bezaubernd an, wartete aber nicht auf seine Antwort. »Nur einen winzigen Tisch?« Sie war zierlich und blond. Ihre haselnußbraunen Augen, mit Gold gesprenkelt, waren groß und ausdrucksvoll. Ihr Gesicht besaß jene feinknochige Schönheit, nach der sich unweigerlich alle Köpfe umdrehten, wenn sie einen Raum betrat.
»Aber natürlich, Lady Copton. Für Sie habe ich immer einen Tisch frei.« Alphonse verneigte sich, winkte gereizt andere Kellner herbei, um die Wichtigkeit dieses Gastes zu unterstreichen, und führte Juniper Copton und ihre Begleiter zu einem Tisch.
»Du bestellst, Jonathan.« Sie legte die große Speisekarte beiseite, als wäre sie es müde, Entscheidungen zu treffen.
»Aber ich weiß nicht, was du willst«, wandte Jonathan Middlebank ein, während seine Gedanken rasten, und er überlegte, wie er das alles bezahlen sollte, falls Juniper die Rechnung nicht übernahm. Das war zwar ein vages Risiko, denn sie bestand immer darauf zu bezahlen, aber es war auch vorgekommen, daß sie einfach gegangen war und ihre Gäste und die Rechnung völlig vergessen hatte.
»Etwas Leichtes und Champagner. Wie steht's mit dir, Polly?« Polly, durch Heirat Comtesse de Faubert et Bresson geworden, die jedoch ihren Mädchennamen, Frobisher, bevorzugte, war der absolute Gegensatz zu Juniper. Sie war groß, hatte glattes, fast schwarzes Haar und braune Augen, so dunkel, daß sie unergründlich wirkten. Ihre Gesichtszüge waren eher ausgeprägt als zart, und ihr Ausdruck ließ auf eine intelligente, ernsthafte Persönlichkeit schließen. Polly betrachtete die Speisekarte. Sie war nicht hungrig, sie trank wenig, sie fand die verräucherte Atmosphäre in dem Nachtclub bedrückend und fragte sich bereits, warum sie überhaupt hier war. Noch während sie darüber nachdachte, wußte sie schon die Antwort. Juniper hatte darauf bestanden, daß sie mitkam, und nur wenige Menschen konnten sich ihr widersetzen, am allerwenigsten Polly.
»Ich habe keinen großen Hunger. Ein Sandwich vielleicht und etwas Sodawasser«, sagte sie schließlich.
»Also, Polly, wirklich! Wir feiern. Du mußt Champagner trinken. Ich bestehe darauf. Bestell den besten, Jonathan. Iß wenigstens ein Omelett, Polly.«
»Na gut.« Polly zuckte resigniert die Schultern.
»Möchtest du denn nicht feiern?« fragte Juniper hartnäckig.
»Natürlich.« Polly log, denn sie sah keinen Grund zum Feiern. Gewiß nicht, weil sie nach einem Monat in Devon nach London zurückgekehrt war, noch weil Jonathan Middlebank seinen zweitägigen Kurzurlaub vom Militär dazu benutzt hatte, sie zu besuchen. Tatsächlich fühlte sie sich in seiner Gegenwart äußerst unwohl, was durch Junipers Anwesenheit noch verstärkt wurde. Sie mochte Jonathan, würde ihn immer mögen – man konnte nicht jemanden lieben, wie sie ihn geliebt hatte, und jedes Gefühl. verlieren, nicht wenn man Polly war. Sie hatte schon vor langer Zeit Jonathan und Juniper den Betrug verziehen, den die beiden an ihr begangen hatten, denn sie war unfähig, einen Groll zu hegen. Nein, ihr Unbehagen rührte daher, daß sie – trotz aller Anstrengungen – nicht vergessen konnte, daß es passiert war.
»Also, erzähl mir alles über eure großartige Flucht aus Frankreich«, sagte Jonathan, nachdem er den Champagner und das Essen bestellt hatte.
Mittlerweile hatte Juniper aus ihrer und Pollys Heldentat in Frankreich, ihrer knappen Flucht vor der deutschen Besatzungsmacht, eine abenteuerliche Geschichte konstruiert. Polly hatte Junipers Darstellung schon mehrmals gehört, bewunderte jedoch noch immer die Leichtigkeit, mit der Juniper die Ängste und Alpträume dieser drei Wochen in einen Schabernack verwandelte, über den sich Jonathan jetzt vor Lachen krümmte.
Während die beiden miteinander plauderten, sah sich Polly in dem überfüllten Raum um und fragte sich, wie die Menschen so gedankenlos glücklich sein konnten, während das Leben, das sie gewohnt waren, zerstört wurde. Oder versteckten sie ihre Gefühle hinter gespielter Tapferkeit? Plötzlich erstarrte Polly. Während einer Tanzpause hatte sie am anderen Ende des Raums ihre Mutter, Francine, entdeckt. Ihr Puls begann zu rasen, und ihre Hände wurden feuchtkalt – die übliche Reaktion beim Anblick ihrer Mutter. Denn Francine beherrschte mit ausgefeilter Perfektion den Trick, die erwachsene Polly mit ein paar ihrer gut gewählten, beißenden Sätze zu einem linkischen Schulmädchen zu degradieren.
Polly saß unschlüssig da. Sie wußte nicht, was sie tun sollte. Wenn sie zu ihr ging, würde sie gedemütigt zurückkommen. Wenn sie nicht ging und Francine sie hier sah, drohte ihr bei einem Besuch bei ihrer Mutter – der längst überfällig war – ein schmachvoller Streit.
»Entschuldigt mich. Ich gehe mir nur die Nase pudern.« Polly mußte ihre Stimme heben, um von den beiden gehört zu werden. Sie drängte sich durch die Menge zur Toilette, um ihr dezentes Make-up aufzufrischen. Wenigstens wollte sie Francine nicht mit einer glänzenden Nase gegenübertreten.
»Wie geht es Polly?« fragte Jonathan, plötzlich ernst, während er Polly mit den Blicken folgte.
»Gut. Ihr Mann ist tot, weißt du«, sagte Juniper im Plauderton.
»Ist er im Kampf gefallen?«
Juniper lachte leise, ein kehliges, tiefes, wohlklingendes Lachen. »Großer Gott, nein! Doch nicht Michel. Er war mit seiner Mätresse auf seinem Château – hat sich zweifelsohne vor den Deutschen verkrochen. Er ist in den Keller gegangen, um Wein zu holen, und ist über den Saum seines Morgenrocks gestolpert. Dabei hat er sich den verdammten Hals gebrochen.«
Jonathan war über Junipers offensichtliche Belustigung schockiert.
»Du brauchst mich nicht so böse anzusehen, Jonathan. Du weißt verdammt gut, was er für ein Scheißkerl war. Michel war ein unbeschreiblicher Sadist und hat der armen Polly das Leben zur Hölle gemacht. Ich bin froh, daß er tot ist. Es tut mir nur leid, daß er auf der Stelle tot war. Anscheinend hat er nichts gemerkt.«
Jonathan schauderte unwillkürlich. Solche Neuigkeiten in Junipers schöner, tiefer Stimme mit dem leichten amerikanischen Akzent zu hören, ließen sie noch entsetzlicher klingen. Heimlich berührte Jonathan unter dem Tisch Holz. Er war viel zu abergläubisch, um in diesen schlimmen Zeiten, die jeden verwundbar machten, schlecht von Toten zu sprechen.
»Weißt du, was du tun solltest, Jonathan, mein Schatz? Du solltest zugreifen und Polly bitten, dich zu heiraten, um die verlorene Zeit aufzuholen.«
»Sie würde mich nicht nehmen. Ich kann es ihr nicht verübeln, nicht nachdem ...« Er wandte verlegen den Blick ab.
»Unsinn, das war meine Schuld. Ich habe dich verführt. Sag bloß nicht, du hättest das schon vergessen ... wenig schmeichelhaft für mich.« Juniper lachte boshaft, was Jonathans Unbehagen noch steigerte.
»Ich war überzeugt, sie hätte mittlerweile jemanden kennengelernt – einen Mann, der zu ihr paßt.« Er wollte nicht an Vergangenes, das ihn auch nach dieser langen Zeit noch beschämte, erinnert werden.
»Das hat sie. Andrew Slater – ein absolutes Schätzchen. Sie hat ihn in Paris kennengelernt, kurz nachdem sie Michel verlassen hat. Aber er wird vermißt, ist wahrscheinlich tot Du solltest dir Polly schnappen, ehe es ein anderer tut. Na, komm schon, Jonathan, gib's doch zu. Du warst immer verrückt nach ihr.«
»Ach, Juniper, du bist unverbesserlich ...« Er schüttelte über ihre Schnoddrigkeit amüsiert den Kopf. »Ich bezweifle, daß Polly ihn für tot hält. Sie wird nie die Hoffnung aufgeben. Ich kenne Polly. Jetzt wäre der ungeeignetste Augenblick, einen Annäherungsversuch zu wagen.«
»Natürlich glaubt sie, daß er lebt. Ich habe ihr gesagt, es sei töricht, ihr Leben zu vergeuden und auf jemanden zu warten, der nicht zurückkommen wird. Was glaubst du, wie viele Männer bei Dünkirchen überlebt haben?«
»Nur wenige.«
»Na, da hast du's«, sagte Juniper sachlich.
»Sie wird Zeit brauchen, um darüber hinwegzukommen.«
»Im Krieg bleibt einem keine Zeit. Ich würde keinen Tag vergeuden.«
»Nein, Juniper, du nicht.« Jonathan lächelte über ihre Ehrlichkeit, die selbst ihre schockierendsten Aussagen akzeptabel machte.
Sie klappte ihre schwere, goldene Puderdose auf und inspizierte ihr Gesicht. Anscheinend zufrieden mit dem, was sie sah, ließ sie den Deckel wieder zuschnappen.
»Laß uns tanzen«, sagte sie.
»Du kennst mich doch, Juniper. Ich habe vier Füße ...« Er lächelte entschuldigend.
»Mann, was kenne ich für langweilige Leute!« Sie gab ihm einen liebevollen Stoß. »Hast du ein paar Pennies? Ich will telefonieren und Verstärkung anfordern ... Männer, die gern tanzen.« Lachend gab sie ihm einen flüchtigen Kuß auf die Wange, glitt von der Sitzbank und bahnte sich einen Weg die Treppe hinauf zum Telefon.
Weit entfernt, auf der Straße, heulte eine Sirene auf und warnte vor einem Fliegerangriff. Sie wurde von der Menge im Garibaldi nicht gehört. Die Menschen lachten und tanzten weiter.
Ein Kellner drängte sich zur Band durch und flüsterte dem Dirigenten etwas ins Ohr. Billy »Hot Feet« Jackson klopfte mit seinem Taktstock laut gegen den Notenständer, um sich Gehör zu verschaffen.
»Wir haben Fliegeralarm, falls das jemanden interessieren sollte«, sagte er lakonisch. Die Menge lachte.
Francines Begleiter sprang auf und streckte ihr die Hand hin. Sie schüttelte lächelnd den Kopf.
»Sollten wir nicht in den Luftschutzkeller gehen?« fragte er ängstlich.
»Wozu?« Sie zuckte mit den Schultern. »Der Gestank dort ist widerlich. Sie sind wohl erst seit kurzem in London, wie?« Er nickte. »Na, dann können Sie die Situation auch nicht verstehen. Die Sirenen heulen dauernd, aber es passiert nichts. Sollten Flugzeuge kommen, würden nicht wir, sondern nur die Armen bei den Docks bombardiert werden. Setzen Sie sich wieder. Kein Grund zur Aufregung.«
Die kurzfristig gedämpfte Stimmung im Club war vorbei,nur ein paar nervöse Gäste waren gegangen. Das Orchester spielte wieder, und der Lärm erreichte den üblichen Geräuschpegel.
Polly stand mit frisch gepuderter Nase und neu aufgelegtem Lippenstift am Tisch ihrer Mutter und wartete auf eine Gelegenheit, sie anzusprechen. Einige von Francines weniger beachteten Begleitern warfen ihr anerkennende Blicke zu.
»Hallo, Francine«, sagte Polly schüchtern. Undenkbar, sie in Gegenwart ihrer Bewunderer »Mutter« zu nennen. »Du siehst gut aus.«
»Lieber Himmel – Polly! Bist du etwa noch ein Stück gewachsen? Du wirkst größer. Ich dachte, du wärst in Frankreich. Was machst du hier?« Das war Francines Begrüßung für die Tochter, die sie seit über vier Jahren nicht gesehen hatte.
»Ich bin geflohen, und ...«
»Wann bist du zurückgekommen?«
»Im Juli. Unser Schiff landete in ...«
»Welchen Monat haben wir jetzt? September? Wie lieb von dir, sofort zu mir zu eilen, um mich zu sehen.« Francines Augen funkelten bedrohlich.
»Ich wollte dich morgen besuchen.«
»Dann ruf vorher an. Es könnte mir ungelegen sein«, sagte Francine kalt.
»Natürlich.« Polly entfernte sich erleichtert. Die Begegnung war weniger unangenehm verlaufen, als sie befürchtet hatte.
Die Menschen fünf Stockwerke über ihnen hörten sie kommen, hörten das schrille Heulen der Bombe, die todbringend auf sie herabstürzte. Weit unten, im Club, hatte »Hot Feet« unter begeistertem Applaus gerade verkündet, daß der neue Sänger A Nightingale Sang in Berkeley Square interpretieren würde.
Die Hölle brach los, als die Sprengbombe durch die Decke auf die Tanzfläche krachte und explodierte. Alles versank in einer erstickenden Wolke braunen Staubs.
Unmittelbar danach herrschte absolute Stille. Dann durchdrangen Geräusche die Dunkelheit – Schreie, Stöhnen, Flüche.
Polly erlangte in einer dunklen, erstickenden Welt voller wahnsinniger Schreie ihr Bewußtsein wieder. Einen Augenblick wußte sie nicht, wo sie war, noch warum sie in dieser von einem beißenden Geruch angefüllten Finsternis auf dem Boden saß. Und dann erinnerte sie sich ... »Mutter«, rief sie, und dann lauter, um die Schreie zu übertönen: »Mutter!«
Francine saß mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt auf dem Fußboden. Die Sitzbank lag quer über ihren Beinen, und sie war zwischen Möbelstücken eingekeilt. Etwas Schweres lag in ihrem Schoß, aber sie war zu desorientiert, um darauf zu achten. »Um Himmels willen, wer immer du bist, hör mit diesem verdammten Gekreisch auf. Deine Mutter kann dir jetzt nicht helfen«, sagte Francine schneidend.
»Mutter, bist du das?«
»Ich bin Francine Frobisher«, kam die frostige Antwort. Sogar in dieser Situation leugnete sie ihre Mutterschaft.
»Gott sei Dank bist du am Leben«, sagte Polly mit aufrichtigem Gefühl. »Ich bin's, Polly. Ich bin hier drüben.«
»Was soll mir das nützen? Ich kann nicht sehen, wo ›hier drüben‹ ist, du Närrin.«
»Bist du verletzt?«
Behutsam berührte Francine ihr Gesicht mit den Fingerspitzen und hätte vor Erleichterung weinen können, als sie kein Blut spürte.
»Anscheinend nicht. Aber ich bin eingeklemmt.«
Polly kroch in die Richtung, aus der die Stimme ihrer Mutter kam, stieß gegen die schwere Sitzbank und versuchte, sie anzuheben.
»Ach, um Himmels willen, Polly, hör auf damit. Überlaß das der Rettungsmannschaft. Mach dich lieber nützlich – such meine Handtasche und gib mir eine Zigarette.«
»Du solltest lieber nicht rauchen. Vielleicht ist Gas ausgeströmt.«
»Du warst schon immer eine schreckliche Pessimistin«, sagte Francine gereizt.
»Da du keine Hilfe brauchst, will ich jetzt Juniper suchen«, sagte Polly und tastete blindlings umher.
»Um die würde ich mir keine Sorgen machen. Sie ist unverwüstlich.«
Jede Bewegung war mühsam. Überall lagen Menschen, manche stöhnten, andere waren erschreckend still. Trümmer von zerschmetterten Möbeln behinderten Polly, und sie hatte Angst, über Verletzte zu stolpern.
»Helft mir ...« krächzte eine Stimme, eine von Blut erstickte Stimme. »Bitte, helft mir ...«
Polly näherte sich vorsichtig der Stimme, tastete behutsam mit den Händen. Sie erkannte die Umrisse eines Klaviers und stieß darunter gegen eine Fand, die ihre verzweifelt umklammerte.
»Der Schmerz ...« stöhnte die Stimme.
»Bald kommt Hilfe«, sagte Polly und hielt die Hand fest. »Können ein paar Männer hierherkommen?« rief sie und versuchte die Panik in ihrer Stimme zu unterdrücken. Allein würde es ihr niemals gelingen, das Klavier anzuheben. Hilflos und den Tränen nahe, saß sie da und hielt nur die Hand fest.
»Ich habe mich heute abend verlobt ...« krächzte die Stimme mühsam.
»Wie wunderbar! Wann ist die Hochzeit?« sagte Polly mit erzwungener Fröhlichkeit.
»Sondergenehmigung ... drei Tage ...« Und dann bewegte sich das Klavier ein wenig, und die Frau stöhnte qualvoll. »Bleiben Sie bei mir ...«
»Ich bleibe. Es wird nicht mehr lange dauern. Sprechen Sie nicht. Vergeuden Sie keine Kraft.«
Polly saß in der Dunkelheit und sprach mit einer Fremden. Sie erzählte ihr von ihrer Wohnung in Paris, von Andrew und ihrer Angst um ihn, von Hursty, ihrem Kater, der nach Hurstwood, dem Zuhause ihrer Kindheit in Devon, benannt worden war. Sie redete über alles, was ihr einfiel.
Der schwache Schein einer Taschenlampe tanzte über Möbeltrümmer. Eine zweite Lampe leuchtete auf und fiel auf den Schatten eines Plünderers, der über die Körper stolperte und die Toten ihres Schmucks beraubte. Eine Stimme brüllte: »Hau ab, du Abschaum!« Der Mann verschwand in der Dunkelheit wie eine davonhuschende Ratte. Stimmen riefen tröstende Worte, baten, nicht in Panik zu geraten und auszuharren. Oben auf der Straße war das Heulen der Sirenen zu hören.
Es dauerte noch eine halbe Stunde, ehe ein Feuerwehrmann Polly erreichte. Das Licht seiner Taschenlampe huschte über sie.
»Bitte, holen Sie mehr Männer, um das Klavier anzuheben. Darunter liegt eine Frau, die entsetzliche Schmerzen hat«, bat sie, schirmte ihre Augen ab und erkannte über sich die dunkle Gestalt eines Mannes. Er bewegte den Lichtstrahl hin und her, bis er auf das Gesicht einer hübschen jungen Frau fiel. Ihre blauen Augen waren weit offen, starrten leblos ins Licht. Aus ihrem Mundwinkel sickerte ein dünner Faden Blut, so rot wie ihr Haar.
»Helfen Sie ihr, bitte. Sie war so tapfer«, flehte Polly inständig.
»Du lieber Gott, sie ist tot«, sagte der Feuerwehrmann und löste sanft Pollys Hand. Sie begann zu zittern, ihr ganzer Körper zuckte krampfhaft, und sie rang keuchend nach Atem. Der Feuerwehrmann hüllte sie in eine Decke. »Ben, komm hierher ... die Frau steht unter Schock.«
»Meine Mutter ... meine Mutter liegt dort drüben ...« sagte Polly mit klappernden Zähnen.
Wieder huschte der Lichtstrahl durch die staubige Luft. Er glitt über Verletzte und Tote und traf dann Francine, die wie eine elegante Stoffpuppe an der Wand lehnte.
»Ihr habt euch aber Zeit gelassen«, sagte sie. »Heiliger Strohsack«, entfuhr es dem Feuerwehrmann. Francine schaute auf ihren Schoß hinunter, den der Lichtstrahl beleuchtete. Das schwere Gewicht, das sie darin gespürt hatte, war der Kopf ihres jungen amerikanischen Begleiters.
»Ach, sehen Sie nur! Er hat mein Kleid ruiniert«, sagte sie gereizt, stieß den Kopf an, der davonrollte, und betrachtete stirnrunzelnd die Blutflecken auf ihrem Kleid.
»Ganz ruhig, meine Liebe. Regen Sie sich nicht auf«, sagte der Feuerwehrmann freundlich. Er nahm an, daß auch sie unter Schock stünde. Was nicht zutraf. Es war ernst gemeint.
2
Polly weigerte sich, in den Krankenwagen zu steigen.
»Hören Sie, ich bin nicht verletzt. Es gibt genügend Verwundete, die Hilfe brauchen«, sagte sie hartnäckig.
»Schock kann eine üble Sache sein«, entgegnete der Ambulanzfahrer ebenso beharrlich.
Polly streckte ihm ihre Hand hin. »Sehen Sie, ich zittere nicht mehr. Es geht mir gut.« Sie nahm die Decke ab und faltete sie ordentlich, ehe sie sie dem Mann gab. »Ich muß nach Freunden suchen.« Sie wandte sich von der offenen Tür der Ambulanz ab, obwohl ihr schwindlig und übel war, aber sie beschloß, beides zu ignorieren.
»Mir scheint, du kannst einen großen Brandy vertragen.« Polly hörte die vertraute Stimme, in der sogar jetzt noch ein Lachen perlte. Aus Angst, nur zu träumen, wagte sie sich kaum umzudrehen. Doch da stand Juniper. Obwohl sie mit Staub bedeckt war, Mörtel im Haar hatte und der Absatz eines Schuhs abgebrochen war, sah sie noch immer schön aus. Wortlos sank Polly in Junipers Arme. Erst jetzt ließ sie ihren Tränen freien Lauf. »Sei still, Schätzchen. Ist ja gut.« Juniper drückte Polly an sich.
»Dir ist nichts passiert. Ich kann es kaum glauben – die Wand, an der wir saßen – sie ist nicht mehr da ...« Pollys Tränen gruben kleine Furchen in den Staub auf ihrem Gesicht. Sie wischte sie mit dem Handrücken weg.
»Sieh nur, was du für eine Schweinerei machst.« Juniper wischte Pollys Gesicht mit einem sauberen Taschentuch ab. »Natürlich ist mir nichts passiert. Ich sagte doch, dieser Krieg würde Spaß machen.«
»Oh, Juniper! Wie kannst du nur so etwas sagen?«
»Ganz einfach – ich hab's eben gesagt. Was für eine Aufregung! Hier, nimm einen kräftigen Schluck.« Sie hielt ihr eine silberne, mit dem Familienwappen verzierte Taschenflasche hin.
»Aber wo warst du?«
»Oben, beim Telefon. Ich war mitten in einer Unterhaltung und hoppla, da sauste ich durch die Luft wie eine Kanonenkugel.« Sie kicherte.
»Und Jonathan?« fragte Polly und trank einen Schluck Brandy.
»Ihm geht's auch gut. Seine Ehre ist ein wenig angeknackst – er saß auf der Herrentoilette fest.«
»Wo ist er jetzt?« Polly mußte auch lachen und fühlte den Brandy warm durch ihre Adern strömen.
»Bei den Helfern, wie ein guter Pfadfinder. Mein Gott, wir sehen aus wie Landstreicher! Schau dir dein Kleid an.« Polly sah, daß ihr gelbes Taftkleid vom Saum bis zur Taille zerrissen war. Hastig raffte sie den Rock zusammen.
»Niemand wird daran Anstoß nehmen, Polly«, sagte Juniper freundlich. »Aber nimm meinen Umhang, wenn es dir peinlich ist. Ich bringe dich nach Hause.«
»Meine Mutter ...«
»Deine Mutter ist längst fort.«
»In welches Krankenhaus wurde sie gebracht?«
»In keins. Ich kann mir deine Mutter nicht in einem öffentlichen Krankensaal vorstellen, du etwa? Sie weigerte sich mitzufahren, und da kam einer ihrer Verehrer zufällig in seinem Bentley vorbei und entführte sie. Alle waren sehr beeindruckt«, sagte Juniper ironisch. »Komm jetzt. Ich bringe dich nach Hause und dulde keinen Widerspruch. Hier sind wir nur im Weg.«
Irgendwie gelang es Juniper, in dem Gedränge ein Taxi aufzutreiben. In der relativen Sicherheit von Junipers Haus angelangt, wurde Polly von einer Müdigkeit überwältigt, die jeden Schritt zu einer Anstrengung machte. Juniper hingegen schwirrte aufgeregt im Zimmer herum, konnte weder stillsitzen noch aufhören zu reden.
Polly lehnte mehr Brandy ab, saß jedoch nachdenklich da und schlürfte die Ovomaltine, die ihr die Köchin zubereitet hatte. Sie dachte über ihre Reaktion nach, als sie ihre Mutter in dem zerbombten Nachtclub in Gefahr wähnte. Polly mochte ihre Mutter nicht. Sie konnte sich nicht daran erinnern, sie je gemocht zu haben, und hatte deswegen angenommen, für sie auch keine Liebe zu empfinden. Aber ihre Reaktion heute abend hatte diese Annahme widerlegt. In diesen paar Minuten hatte sie wirklich Angst gehabt, ihre Mutter sei tot. Vielleicht hatte ihre Mutter dasselbe für sie empfunden? Es wäre schön, wenn sie zu Francine eine bessere Beziehung aufbauen könnte. Vielleicht würde ihr das helfen, die Leere auszufüllen, die der vorzeitige Tod ihres Vaters in ihr hinterlassen hatte.
»Warum bist du so ernst?« fragte Juniper, als ihr endlich die Puste ausging.
»Ich habe über meine Mutter nachgedacht und wie ich reagiert habe, als ich dachte, sie sei tot. Ich mag sie nicht, aber dort im Nachtclub habe ich entdeckt, daß ich sie liebe«, sagte Polly verwirrt.
»Blut ist dicker als Wasser. Sieh uns doch an ...« Juniper goß sich noch einen Brandy ein. »Wir sind der Beweis dafür.«
Polly antwortete nicht. Nach ihrer Rückkehr aus Frankreich hatte sie beschlossen, mit Juniper nicht mehr über deren Meinung, sie seien Halbschwestern, zu diskutieren. Juniper wollte es so und würde kein gegenteiliges Argument akzeptieren, während Polly zutiefst überzeugt war, daß es nicht wahr sein konnte, und es auch nicht wollte. Sie hatte ihren Vater, Richard Frobisher, zeit seines Lebens geliebt und hatte nicht die Absicht, ihn jetzt, da er tot war, zu verleugnen.
»Ich möchte ins Bett gehen, wenn es dir nichts ausmacht. Ich bin sehr müde.« Sie stand auf und ging mit so schweren Beinen zur Tür, als trüge sie Taucherstiefel.
»Aber, es ist noch so früh ...«, beklagte sich Juniper.
»Nicht für mich.« Polly schloß die Tür fest hinter sich.
Polly wurde früh von einer bleichen Juniper geweckt.
»Polly, wach auf! Ich reise sofort nach Schottland.«
»Nach Schottland?« fragte Polly verschlafen.
»Ich habe gerade ein Telegramm von Caroline erhalten. Harry ist krank. Ich muß zu ihm.«
»Natürlich mußt du das.« Polly war sofort hellwach. »Armer kleiner Kerl. Was fehlt ihm?«
»Er hat hohes Fieber ... sie kriegen die Temperatur nicht runter. Ach Polly, ich habe solche Angst.«
Polly war schon aus dem Bett und schlüpfte in ihren Morgenrock. »Möchtest du, daß ich mitkomme?«
»Dafür ist keine Zeit. Das Taxi wartet schon. Mit etwas Glück erreiche ich noch den Frühzug.« Sie küßte Polly. »Ich rufe an, sobald ich Näheres weiß. Ach, Polly ...« Juniper sah sie qualvoll an.
»Kinder haben oft Fieber. Mach dir nicht zu viele Sorgen. Wahrscheinlich ist er wieder gesund, wenn du ankommst.«
»Meinst du wirklich?«
»Ja.« Polly umarmte sie kurz. »Beeil dich, sonst verpaßt du noch den Zug.«
Vom Fenster im oberen Stockwerk beobachtete Polly, wie Juniper Hals über Kopf die Treppe hinunterlief. Obwohl es ihr leid tat, daß der kleine Junge krank war, freute sie sich über Junipers Reaktion auf diese Nachricht. Juniper hatte immer behauptet, nichts für ihren Sohn, Harry, zu empfinden, aber vielleicht war sie gerade dabei, das Gegenteil herauszufinden, so wie es Polly letzte Nacht ergangen war.
Später an diesem Morgen saß Polly am Bett ihrer Mutter. Sie hatte eben vorgeschlagen, daß sie Juniper nach deren Rückkehr aus Schottland bitten würde, Francine bei sich aufzunehmen. »Zu mehreren ist man sicherer«, hatte sie heiter hinzugefügt. Auf die Reaktion ihrer Mutter auf diesen vernünftigen Vorschlag war sie nicht vorbereitet.
»Du mußt verrückt sein, Polly. Ich? Ich soll mit dieser Frau unter einem Dach leben? Niemals! Und du bist ein Dummkopf, weil du ihr vertraust. Dieser kleinen Hure!« Francine spuckte das letzte Wort gehässig aus.
»Mutter!« Polly zuckte zusammen und starrte Francine verblüfft an.
»Wenn du wüßtest, was ich weiß.«
»Was weiß ich nicht?«
Francine war innerlich zerrissen: Sie hätte gern die Beziehung ihrer Tochter zu Juniper zerstört. Es wäre so leicht, ihr zu erzählen, daß Juniper als siebzehnjähriges Mädchen versucht hatte, Pollys Vater zu verführen – den anbetungswürdigen Vater, gegen den Polly kein Wort der Kritik duldete. Wie gern hätte Francine diese Verehrung zerstört! Aber sie schwieg, denn mit diesem Eingeständnis hätte sie zugegeben, daß ihr ein junges Mädchen beinahe den Platz im Bett eines Mannes streitig gemacht hätte – ein unerhörtes Ereignis.
»Ich bin nicht gewillt, es dir zu erzählen«, sagte Francine eisig.
»Aber du solltest nicht allein hierbleiben.«
»Ich bin nicht allein. Clara ist bei mir.«
»Clara könnte dich verlassen.«
»Blödsinn! Sie ist zu alt, um sich Arbeit beim Zivildienst zu suchen. Ich kann mich glücklich schätzen, sie zu haben. Einige meiner Freunde bekommen weder für gute Worte noch für Geld Dienstmädchen.«
Polly bemühte sich vergeblich, Mitgefühl zu zeigen. Der Mangel an Dienstmädchen stand nicht auf ihrer Liste der Prioritäten.
»Letzte Nacht wurde mein Kleid ruiniert. Es war brandneu. Clara sagt, den feinen Kreppstoff kriegt sie nicht wieder hin.«
»Wir haben Glück, noch am Leben zu sein«, sagte Polly kurz angebunden. Sie war unfähig, Francines Klagen um ein ruiniertes Kleid zu verstehen.
»Ich hatte immer Glück«, prahlte Francine.
»Vierundsechzig Menschen starben. Mich schaudert, wenn ich daran denken, wie nahe wir dem Tod waren.« Ein leises Zittern überlief Pollys Körper bei der Erinnerung an die vergangene Nacht. Sie legte ihre Hand auf die Bettdecke, schob sie behutsam zur Hand ihrer Mutter und berührte sie sanft. »Ich habe mich dir gestern abend so nahe gefühlt, Mutter ...« begann sie zaghaft.
Francine zog ihre Hand so abrupt weg, als wäre sie gestochen worden. »Vierundsechzig? Ich frage mich, wie viele ich wohl gekannt habe ...«
Das schrille Läuten des Telefons unterbrach sie. Während ihre Mutter einen dramatischen Wortschwall über die Bombenexplosion im Garibaldi losließ, schlenderte Polly zum Fenster und schaute auf die Straße hinunter, wo Arbeiter den Schutt wegräumten. Müßig strich sie über den kreuz und quer übers Fenster gespannten Klebstreifen, der das Glas bei einer Detonation vorm Zerbersten schützen sollte. Sie war mit einer verworrenen Vorstellung, zwischen sich und Francine wieder eine Brücke zu bauen, hergekommen. Aber sie mußte sich ehrlicherweise eingestehen, daß sie in dem Augenblick, als sie Francines Zimmer betrat, nichts empfunden hatte. Hatte ihr der Schock letzte Nacht einen Streich gespielt und ihr Emotionen vorgegaukelt? Wenigstens hatte sie versucht, mit ihrer Mutter zu reden. Und wenn diese nichts von ihren Gefühlen wissen wollte, was konnte Polly anderes erwarten? Francine war nie eine Mutter im wahren Sinn des Wortes gewesen. In ihrer Egozentrik hatte es keinen Platz für mütterliche Gefühle gegeben. Liebend gern hatte sie es ihrem Mann, Richard, überlassen, Polly aufzuziehen. Warum hatte sie angenommen, Francine würde sich ändern?
Francine legte den Hörer auf, läutete nach dem Dienstmädchen und bestellte Tee. Polly wandte sich vom Fenster ab und sah, daß ihre Mutter eingehend ihre Fingernägel musterte.
»Wir haben einen Gedenkgottesdienst für deinen Vater zelebrieren lassen«, sagte Francine plötzlich.
»Das freut mich.«
»Jetzt wird man seine Leiche nie mehr finden.«
»Wahrscheinlich nicht«, antwortete Polly mühsam; sie konnte nicht so ungezwungen über ihn reden.
»Ich habe nie verstanden, warum er so kurz vor Kriegsausbruch mit einem Flugzeug den Kanal überqueren wollte.«
»Ich glaube, er wollte nach Frankreich fliegen, um mich zu suchen.«
»Ach, Polly, wohl kaum. Wie kommst du nur auf diese Idee?« Francine lächelte spöttisch – unvorstellbar, daß sich jemand wegen Polly in Ungelegenheiten stürzen könnte. Polly, der es an Francines dramatischer blonder Schönheit mangelte, war eine bittere Enttäuschung für ihre Mutter gewesen. Francine hatte nie Pollys andersartige Schönheit zu würdigen gewußt.
»Hast du die alte Vettel, deine Großmutter, gesehen?«
»Noch nicht. Ich möchte mir in London Arbeit beim Zivildienst suchen. Sobald ich etwas gefunden habe, werde ich sie besuchen.«
»Du wirst Schwierigkeiten haben, etwas zu finden. Alle melden sich freiwillig. London wimmelt von Frauen, die seit einem Jahr darauf warten, von den Behörden zum Zivildienst eingeteilt zu werden.«
»Ich hatte gehofft, dem Frauenkorps beitreten zu können. Aber sie scheinen an mir nicht interessiert zu sein.«
»Darüber solltest du dich freuen. Die Uniformen sind abscheulich – formlos und kratzig. Nein, du hältst dich da besser raus. Außerdem ist es so unweiblich. Allerdings wirst du schwerlich etwas anderes finden. Eigentlich beherrschst du doch keine Tätigkeit wirklich gut, nicht wahr?« Francine warf ihr einen boshaften Blick zu.
»In Frankreich habe ich mit einem Lastwagen Verpflegung zur Front gefahren. Und ich kann ganz gut tippen. In Paris habe ich für eine Illustrierte gearbeitet«, entgegnete Polly gelassen, ohne auf die Spitzen ihrer Mutter einzugehen. »Ich hoffte, hier etwas Ähnliches tun zu können.«
»Aber hier passiert doch nichts. Die Regierung macht uns hysterisch, und dann passiert nichts.«
»Letzte Nacht ist etwas passiert.«
»Ach! Nur eine Nacht. Die kommen nicht wieder.«
Polly war sich unschlüssig, ob sie vom Mut ihrer Mutter beeindruckt sein oder vielmehr, was wahrscheinlich der Wahrheit näher kam, ihre Dummheit verachten sollte. »Ich hätte geglaubt, du wärst bei der ersten sich bietenden Gelegenheit nach Berkshire geeilt.« Francine bewunderte wieder ihre Fingernägel, war scheinbar nicht an Pollys Antwort interessiert. Polly wußte es besser. Sosehr Francine ihre Schwiegermutter, Gertie Frobisher, auch haßte, konnte sie doch nie widerstehen, so viel wie möglich über sie in Erfahrung zu bringen.
»Großmama ist nicht in Berkshire. Ihr Haus wurde von einem der Ministerien beschlagnahmt. Sie wohnt bei Junipers Großmutter auf Gwenfer in Cornwall.«
»Lieber Himmel, wie schrecklich! Sie könnte genausogut auf dem Mond leben, so weit entfernt ist dieser Ort von jeder Zivilisation«, verkündete Francine, die diese Grafschaft nicht ein einziges Mal besucht hatte.
Das Telefon läutete wieder, und Francine erging sich in einer weiteren dramatischen Schilderung der nächtlichen Ereignisse. Sie winkte Polly mit einer Hand zu, und dieses Winken war eine unmißverständliche Geste der Entlassung. Polly ging leise.
Ehe sie die Wohnung verließ, betrat sie den Raum, der früher das Arbeitszimmer ihres Vaters gewesen war. Sie sog prüfend die Luft ein, konnte jedoch keinen vertrauten Geruch wahrnehmen. Statt dessen stieg ihr der Duft von Orangen in die Nase, die in Kisten an einer Wand gestapelt waren. Sie blickte sich voll Erstaunen um. Das Zimmer war eine Kriegsschatztruhe: Kisten mit Champagner, zwei große Kanister Speiseöl, Blechdosen mit Schinken, Kaviar, Zunge, Lachs und Obstkonserven. Ihre Mutter mochte zwar vorgeben, an den Krieg keinen Gedanken zu vergeuden, aber sie war zweifelsohne darauf vorbereitet.
Polly setzte sich in den Stuhl ihres Vaters, lehnte ihre Wange gegen das kühle Leder und sehnte sich nach ihm. Würde dieser Schmerz in ihr je nachlassen? Dann stand sie auf, blickte sich noch einmal in dem Zimmer um, als würde sie es zum letztenmal sehen, holte ihren Mantel und ihre Gasmaske aus der Halle und verließ die Wohnung ihrer Mutter. Sie wußte nicht, warum sie sich die Mühe gemacht hatte, hierherzukommen. Nichts hatte sich verändert, am wenigsten ihre Mutter.
Der Sonntag in London war normalerweise ein ruhiger Tag, aber nicht heute. Überall herrschte hektische Aktivität. Es war schwierig voranzukommen. Die Straßen lagen voller Geröll, überall waren Schlaglöcher und Bombentrichter. Der erste nächtliche Luftangriff auf London hatte schreckliche Spuren hinterlassen.
Pollys Weg wurde durch eine Barrikade blockiert, die von einem Polizisten bewacht wurde.
Kein Durchgang, Miss – gebrochene Wasserleitung.«
Drei Häuser waren getroffen worden, deren Frontwände zwar eingestürzt, deren Räume jedoch erhalten geblieben waren. In einem Stockwerk ragte ein Bett halb über den Abgrund, ein Gemälde an einer Wand hing schief, eine Treppe führte ins Nichts, aber sonst war alles intakt. In einem offenen Schrank sah man Kleider hängen, ein Teetisch war gedeckt, ein Nachttopf stand unter einem Bett. Die Zimmer sahen wie riesige Puppenstuben aus, in denen die Bewohner fehlten.
Aus Neugier gesellte sich Polly zu der Menge, die vor der Barrikade stand. Manche Menschen umklammerten Kleiderbündel, andere besaßen nichts mehr. Ein Mann hielt eine Pendeluhr. Ein kleines Mädchen, das Gesicht mit Dreck beschmiert, preßte einen Käfig mit einem Hasen darin an sich. Ein Schrei ertönte, als Arbeiter um ihr Leben liefen. Ein Stück weiter unten in der Straße stürzte die Vorderseite eines fünfstöckigen Hauses beinahe träge in sich zusammen. Alle zogen die Köpfe ein und schützten ihre Augen vor der Staubwolke, die wie ein Wirbelsturm herangefegt kam.
Der Staub legte sich. Die Menschen starrten stoisch auf die Verwüstung. Es gab keine Tränen, keine Hysterie. In London herrschte Chaos, überall ragten Ruinen auf, Menschen waren gestorben, und Pollys Mutter hielt das alles für unwichtig.
Polly ging weiter durch die bombardierte Stadt. Über ihr schien die Sonne auf die Sperrballons, die wie gigantische prähistorische Monster dahinschwebten. Ihr Anblick war allen ein Trost gewesen, hatte ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Doch letzte Nacht hatten sie versagt. Von der Wohnung ihrer Mutter in Mayfair zu Junipers Haus in Belgravia war es normalerweise ein Fußmarsch von zwanzig Minuten, doch an diesem Morgen dauerte er wegen der Umwege, eingestürzten Häuser und Bombenkrater über eine Stunde.
Polly schloß die Tür auf und ging direkt zum Telefon. Was sie letzte Nacht und heute gesehen hatte, bestärkte ihren Entschluß zu helfen. Obwohl Sonntag war, rief sie jeden ihrer Bekannten an, der ihr behilflich sein könnte, Arbeit zu finden – irgendeine Arbeit – irgend etwas Nützliches zu tun.
3
Das trübe Licht in dem Eisenbahnwaggon war zu schwach, um lesen zu können. Man konnte nur nachdenken oder schlafen, aber Juniper fühlte sich für letzteres zu unbehaglich. Der Waggon war überfüllt: Auf sechs Sitzplätzen saßen acht Passagiere, zwei Soldaten standen zwischen den Sitzen, hielten sich am Gepäcknetz fest, in dem ein kleiner Junge auf Taschen und Paketen lag und friedlich schlief.
Die Menschheit in Massen stinkt, dachte Juniper. Sie kramte aus ihrer Handtasche eine Parfümflasche und betupfte sich mit Joy.
»'tschuldigung, Miss, wir sind ein bißchen betrunken.« Einer der Soldaten grinste sie an.
»Nein, nein, das ist es nicht ...« Sie lächelte entschuldigend, als wäre sie ertappt worden.
»Wir haben uns seit Tagen nicht gewaschen, wissen Sie, Miss.«
»Ihr Armen«, sagte sie ausdruckslos, schlug ihre Illustrierte auf und gab vor, trotz des trüben Lichts zu lesen. Sie wollte nicht mit dem Soldaten reden, sie wollte mit niemandem reden. Sie bewegte sich auf ihrem Sitz, versuchte ein paar Zentimeter Raum zu gewinnen, doch die fette Frau, die neben ihr saß, füllte mit ihrem überquellenden Körper sofort die winzige Lücke.
Juniper konnte nicht einmal zum Fenster hinaussehen. Wegen der strikten Verdunkelung waren die Jalousien heruntergezogen und durften nicht geöffnet werden. Sie war seit zwei Tagen unterwegs. Gestern, am Sonntag, hatte sie eine unangenehme Nacht im Bahnhofshotel von Newcastle verbracht. Seit Stunden saß sie in diesem Zug und hatte keine Ahnung, wo sie war noch wann sie in Aberdeen ankommen würde. Der Zug hatte wiederholt eine Ewigkeit auf Abstellgleisen ohne Erklärung für den Aufenthalt gestanden. Die Bahnhöfe, durch die sie fuhren, waren namenlos. Die Schilder waren aus Sicherheitsgründen entfernt worden. Sie hätte sich genausogut mitten in Sibirien befinden können.
Jetzt stand ihr eine weitere unangenehme Nacht bevor. Bei dieser Reisegeschwindigkeit ... Großer Gott, wie sie das langweilte! Sie wünschte, sie wäre nicht gefahren. Was hatte sie dazu veranlaßt? Pflichtbewußtsein, vermutete sie und lächelte über sich selbst. Pflichtbewußtsein war kein Wort, das sie oder irgend jemand, der sie kannte, mit ihr in Verbindung gebracht hätte.
Sie reiste gewiß nicht wegen irgendwelcher mütterlicher Gefühle nach Schottland – sie besaß keine. Eines der vernünftigsten Dinge, die sie je getan hatte, wofür sie sich gratulierte, war, ihrem kinderlosen Schwager und seiner Frau das Aufziehen ihres Sohnes zu übertragen. In der Nacht, als sie ihnen Harry übergeben hatte, das wurde ihr jetzt bewußt, hatte sie aus Wut und Trotz und einem Rachebedürfnis ihrem Mann gegenüber gehandelt. Zwangsläufig hatte ihr Entschluß jeden schockiert, am meisten ihre eigene Großmutter. Niemand schien zu begreifen oder zu glauben, daß es möglich war, Mutter zu sein und keine große Liebe für das eigene Kind zu empfinden.
Ihr Sohn kannte sie nicht einmal mehr. Als sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, hatte der Junge sie mit einem deutlichen Mangel an Interesse begrüßt. Warum sollte er sich zu dieser Fremden hingezogen fühlen? Er war erst zwei, und es war unvernünftig zu erwarten, daß er sich an sie erinnerte oder sie mochte. Sie hatte ihre Mutter, Grace, eine dicke und unzufriedene Frau, nicht besonders gemocht, aus gutem Grund, wie sie jetzt wußte. Sie schüttelte fast unmerklich den Kopf. Sie dachte nicht gern an ihre Mutter. Es gab viele Dinge in der Vergangenheit, auf die Juniper nicht gern näher einging.
Jetzt war Harry krank, und sie hatte sich wie eine Närrin einen Platz im ersten Zug nach Schottland erkämpft, nahm die Unbequemlichkeit einer Reise dritter Klasse auf sich und wußte wirklich nicht, warum. Mißmutig betrachtete sie die Ringe an ihren Fingern.
Einst hatte sie geliebt, war voller Liebe gewesen. Sie hatte ihrem Vater, Marshall, und ihrem Großvater, Lincoln Wakefield, absolute Liebe entgegengebracht. Aber beide hatten sie auf unterschiedliche Weise betrogen. Sie hatte es als Verrat empfunden, als sie entdeckte, daß ihr Vater mit Francine ein Verhältnis gehabt hatte, während er ihre Mutter umwarb, und diese Beziehung Jahre später wieder aufgenommen hatte, was zweifellos ihre Mutter zum Selbstmord veranlaßt hatte. Und Lincoln, der Mann, den sie am meisten geliebt und den sie für den gütigsten Mann der Welt gehalten hatte, hatte sich als skrupelloser Tyrann entpuppt. Sie hatte auch Alice, ihre Großmutter, geliebt und tat es noch, aber nicht mehr mit der bedingungslosen Liebe eines Kindes. Und keine Frau hätte ihren Mann mehr lieben können, als Juniper Hal Copton geliebt hatte. Er hatte von ihr alles bekommen, was er sich wünschte, aber er hatte ihr Vertrauen zerstört, und sie hatte gefühlt, wie sich um ihr Herz ein Eisring bildete. Es hatte andere Männer gegeben, zu viele Tröster, dachte sie, aber sie hatte keinen von ihnen geliebt. Sie fing an, sich zu fragen, ob sie je wieder lieben könnte ...
Der Zug kam ruckartig zum Stehen.
»Aberdeen«, rief eine Stimme.
Juniper sprang auf und prallte gegen den Soldaten, der sie angesprochen hatte.
»Kein Grund zur Panik, Miss. Für diesen Zug ist hier Endstation.«
Sie setzte sich wieder, kam sich albern vor und wartete geduldig, bis ihre Mitreisenden Pakete, Taschen und Koffer eingesammelt hatten. Während sie zusah, wie die merkwürdigsten Gepäckstücke hinausgetragen wurden, fragte sie sich, ob der Krieg daran schuld war, daß die Menschen in einem derartigen Chaos reisten. Oder war das in der dritten Klasse üblich? Da sie gewöhnlich erster Klasse, von einem Heer von Gepäckträgern umgeben, die ihre eleganten Koffer im Schaffnerabteil zur Aufbewahrung gaben, reiste, hatte sie keine Vergleichsmöglichkeit. Wenn das die normale Art zu reisen war, dann hoffte sie, dieser abscheuliche Krieg würde bald enden. Er verursachte zu viele Unannehmlichkeiten.
Endlich stand sie auf dem Bahnsteig, ihr einziger Koffer und ihre Tasche standen neben ihr. Ein eiskalter Wind peitschte von der Nordsee herein, drang ihr bis auf die Knochen, und sie hüllte sich enger in ihren Pelzmantel. Großer Gott, wer konnte bei diesen Temperaturen überleben?
»Juniper!«
Beim Klang ihres Namens drehte sie sich um.
»Leigh«, rief sie überrascht beim Anblick ihres Schwagers, der sich durch die Menge zu ihr hindurchdrängte. »Wie konntest du wissen, daß ich mit diesem Zug kommen würde?«
»Polly hat uns informiert. Ich habe in regelmäßigen Abständen den Bahnhofsvorsteher angerufen. Du hast dich nur um zehn Stunden verspätet – nicht übel.« Ihr Schwager lachte, für den Bruchteil einer Sekunde sah sie ihren Mann Hal vor sich und war erschreckt über die Freude, die diese Ähnlichkeit in ihr hervorrief.
»Du bist mit dem Auto da? Kriegst du denn Benzin?« fragte sie erstaunt, als sie Leighs alten Morris auf dem Bahnhofsparkplatz stehen sah.
»Ich bekomme eine Sonderzuteilung, weil ich ein hohes Tier bei der Bürgerwehr bin.« Er zuckte geringschätzig die Schultern, als wollte er sich dafür entschuldigen, daß er nicht bei der Armee war. »Ich ziehe daraus keinen persönlichen Nutzen. Ich mußte heute sowieso nach Aberdeen fahren, um an einer Versammlung teilzunehmen«, fügte er hastig hinzu.
»Mein lieber Leigh, ich habe keine Sekunde angenommen, du würdest mogeln. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der dazu absolut unfähig ist«, sagte sie leise lachend und legte ihm die Hand auf den Arm.
Sie fuhren langsam durch die dunkle Nacht und den peitschenden Regen. Leigh saß gekrümmt über dem Lenkrad und spähte in die Dunkelheit. Die Straße vor ihnen wurde nur spärlich durch die Schlitze in den Abdeckungen der Scheinwerfer erhellt, die wegen der Verdunkelung Vorschrift waren.
»Eine abscheuliche Nacht, nicht wahr? Aber wir schaffen's schon. Ich kenne die Gegend wie meine Westentasche.«
Juniper spähte durchs Fenster und zuckte zurück, als die Äste eines kleinen Baums den Wagen streiften. »An meiner Seite ist ein ziemlich tiefer Straßengraben«, sagte sie so nonchalant wie möglich.
»Tut mir leid.« Er zog den Wagen nach rechts und fuhr vorsichtig auf der Mitte der Straße weiter.
»Warum, um Himmels willen, lebt ihr hier oben? Es ist das Ende der Welt.«
»Ich mag die Landschaft. Die Schönheit und den Frieden gibt es im Süden nicht. Und die Menschen sind wundervoll.«
»Aber es ist so kalt.« Juniper hüllte sich noch enger in ihren Mantel und wünschte, sie hätte Stiefel anstelle der Pumps angezogen.
»Großer Gott, Juniper, du findest es kalt? Wir haben erst September. Du müßtest die Kälte im Winter erleben.«
»Ihr solltet im Winter wie die Vögel in den Süden ziehen.«
»Vögel können sich Nester bauen. Wir haben kein Geld dafür.«
»Aber Leigh, ich dachte, wer für Harry sorgt, bekommt das Geld aus dem Erbe deines Vaters. Das hat er doch testamentarisch verfügt.«
»Das konnten wir nicht durchsetzen, Juniper. Hal hat das Testament angefochten und gewonnen. Zu der Zeit warst du in Frankreich. Es hatte keinen Zweck, dich damit zu belästigen.«
»Leigh, das tut mir leid. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, es sei alles geregelt: Ich werde dafür sorgen, daß ihr mehr Geld bekommt.«
»Liebe Juniper, du bist großzügiger, als dir guttut. Ich würde nicht im Traum daran denken, mehr Geld für Harrys Unterhalt anzunehmen.«
»Ich wünschte, dein Bruder hätte mehr von deinem Charakter, Leigh«, sagte Juniper mit gespielter Beiläufigkeit, konnte jedoch einen leicht zynischen Unterton in ihrer Stimme nicht unterdrücken. Leigh verstand ihre Verbitterung, was seinen Bruder betraf Sie hatte ihm eine großzügige Unterstützung gewährt, was andere Frauen in ihrer Position nicht getan hätten.
»Gibt's Neuigkeiten wegen deiner Scheidung?«
»Ja. Ich habe letzte Woche mein vorläufiges Scheidungsurteil bekommen. Deswegen mußte ich in London bleiben. Eigentlich wollte ich sofort nach meiner Rückkehr aus Frankreich nach Cornwall.«
»Ich hatte angenommen, du würdest Schwierigkeiten bei der Scheidung haben. Hal ist nicht der Mensch, der leicht aufgibt. Hast du ihn gesehen?«
»Nein. Seine Stellungnahme wurde schriftlich vorgelegt. Er hat sich nach Amerika abgesetzt, zweifelsohne mit seinem Liebhaber und zweifelsohne, um den Unannehmlichkeiten des Krieges zu entfliehen. Das sieht ihm ähnlich, nicht wahr?« Sie lachte. »Dem Richter hat das gar nicht gefallen, und ich dachte schon, er würde die Verhandlung vertagen, aber da ich die Klage eingereicht hatte ...«
»Es war großartig von dir, seine Homosexualität nicht als Scheidungsgrund anzugeben. Dieser Skandal hätte für unsere Familie das gesellschaftliche Aus bedeutet.«
»Dann hätte er eine Gefängnisstrafe bekommen. Mit diesem Makel konnte ich unseren Sohn doch nicht belasten. Nein, Hal hat das getan, was in solchen Fällen üblich ist – er hat mit einer Frau eine Nacht in einem Hotel in Brighton verbracht. Ich wette, es war für sie eine langweilige Nacht!« Beide lachten. »Hal hat mehr Geld verlangt, weißt du.«
»Dieser Fiesling! Du hast natürlich abgelehnt.«
»Nein. Ich hab's ihm gegeben. Was hat es für einen Sinn weiterzukämpfen? Es ist mir wirklich zu lästig. Schließlich ist es nur Geld.«
»So spricht eine reiche Frau. Wer bekam das Sorgerecht zugesprochen?«
»Ich. Heutzutage erhält die Mutter automatisch das Kind zugesprochen. Das ist eine wesentliche Verbesserung im Vergleich zu der Rechtslage, die zu Zeiten unserer Eltern galt. Und kein Richter würde Hal als geeigneten Elternteil ansehen – seine Spielleidenschaft habe ich nämlich nicht verschwiegen.«
»Zu diesem Punkt habe ich eine schlechte Nachricht für dich, Juniper. Meine Mutter will das Sorgerecht für Harry beantragen. Ich hielt es für besser, dich zu warnen.«
»Was will sie tun?« Juniper explodierte. »Nur über meine Leiche. Warum muß sich deine Mutter immer einmischen? Unser Arrangement ist die perfekte Lösung. Du und Caroline seid glücklich, Harry ist glücklich, ich muß mir keine Sorgen machen ... Mit welcher Begründung, um Himmels willen?«
Leigh war die Situation zutiefst peinlich, und er mußte tief Luft holen, ehe er antwortete: »Sie will dich für eine ungeeignete Person erklären lassen.« Er hüstelte. »Moralisch gesehen.«
»Mich?« Juniper lachte, aber es war ein leeres, blechernes Lachen. Sie starrte in die undurchdringliche Finsternis. Anscheinend ermöglichte man ihr nicht, daß ihr Haß auf ihre Schwiegermutter allmählich abklingen konnte. Bald nach ihrer Hochzeit hatte sie entdeckt, mit welchen Machenschaften diese Frau dafür gesorgt hatte, daß ihr ältester Sohn eine reiche Erbin heiratete. Gleichzeitig hatte sie festgestellt, was für eine teure Verwandte sie erworben hatte. Juniper hatte ihr ein Haus in Kent, außerdem eine Wohnung in London gekauft und bezahlte nach wie vor alle ihre Rechnungen. Und das war das Ergebnis. Nun, dachte sie, die beiden würden keinen Penny mehr bekommen. Sie würde die besten Anwälte engagieren und eher den Namen der Coptons in den Schmutz ziehen als zuzulassen, daß diese Frau Einfluß auf ihren Sohn bekam. Sie würde ihr weh tun, mein Gott, wie würde sie ihr weh tun. Diese Frau würde ihre Einmischung noch bitter bereuen. Sie würde ... ihre Gedanken rasten vor Wut. Sie sah zu Leigh hinüber, sein Profil war in der Dunkelheit kaum erkennbar. Sie kuschelte sich noch enger in ihren Pelzmantel, entspannte sich dann plötzlich, lächelte in sich hinein und streckte sich wie eine Katze.
»Weißt du, ob es hier in der Nähe einen Pub gibt? Ich brauche einen Drink«, sagte sie unvermutet, als hätte die vorherige Unterhaltung nicht stattgefunden.
»Ungefähr zwei Meilen von hier gibt es ein Gasthaus. Vielleicht kriegen wir dort auch etwas zu essen. Nur eine Kleinigkeit. In dieser Gegend sind die Hotels ziemlich primitiv.«
»Ich brauche einen Brandy. Auf Essen lege ich keinen Wert.«
Beim Gasthaus angekommen, das wegen seiner geschlossenen Läden keinen einladenden Eindruck machte, schlug Leigh den Kragen seiner Jacke hoch, half Juniper aus dem Auto und legte ihr seinen Mantel zum Schutz vor dem strömenden Regen um die Schultern.
Der Wirt und die Gäste von The Dunoon Arms hatten noch nie jemanden wie Juniper gesehen. Sie stand mitten in der Kneipe, das blonde Haar klebte ihr am Kopf, ihr Gesicht war vom Regen naß, ihr Pelzmantel glänzte vor Feuchtigkeit, und sie war noch immer schön. Sie lächelte den beiden alten Männern zu, die vor dem Torffeuer saßen – dieses Lächeln hatte schon viele Männerherzen gebrochen.
»Darf ich mich ein bißchen am Feuer wärmen? Ich friere und bin naß.« Die zwei knorrigen Hochländer schoben ihr sofort einen Stuhl vor den Kamin.
Leigh kam mit zwei großen Brandys von der Bar zurück. »Du sagtest, dir läge nicht viel am Essen, also habe ich für uns beide das gleiche bestellt: Suppe und Lachs. Ist dir das recht?«
»Hört sich gut an«, sagte sie und leerte ihren Brandy in einem Zug. Der ungewohnte, billige Brandy brannte ihr in der Kehle, und sie mußte husten. Trotzdem hielt sie Leigh ihr leeres Glas hin und fragte: »Kann ich noch einen haben?« In ihren großen, haselnußbraunen Augen lag ein Ausdruck bittender Unschuld. Wortlos nahm Leigh ihr Glas und kehrte zur Bar zurück.
Sie hatten Glück gehabt. Gasthäuser in Schottland konnten von sehr minderer Qualität sein, wie Leigh gewarnt hatte, aber hier war die Gemüsesuppe heiß und köstlich, die Brötchen frisch gebacken und der Lachs vortrefflich, ebenso der Apfelkuchen.
»Das war eine der besten Mahlzeiten, die ich je gegessen habe«, sagte Juniper, tätschelte ihren flachen Bauch und leerte ihr Weinglas.
»Möchtest du einen Brandy zum Kaffee?«
»Wie wär's mit einer weiteren Flasche Wein? Er hat köstlich geschmeckt.«
»Noch eine Flasche? Wein ist hier Mangelware. Vielleicht hat der Wirt keinen mehr vorrätig. Und außerdem wäre ich nicht mehr fähig weiterzufahren.«
»Müssen wir denn? Es ist hübsch hier, warm und behaglich. Als gäbe es keinen Krieg und wir hätten die Zeit zurückgedreht.« Juniper reckte sich genüßlich in der Wärme des Torffeuers.
Leigh wirkte unschlüssig.
»Wir könnten Caroline anrufen. Bestimmt wäre es ihr lieber, du sitzt sicher und geborgen in einem Gasthaus, anstatt bei diesem schrecklichen Wetter weiterzufahren«, beharrte sie hartnäckig.
»Vielleicht hast du recht. Falls es hier ein Telefon gibt. Du bist nicht in London. Außerdem weiß ich nicht, ob es hier Fremdenzimmer gibt. Nur die wenigsten dieser einfachen Gasthäuser vermieten Zimmer.«
»Ach, frag doch, Leigh. Bitte«, sagte sie eifrig wie ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen, das ich nicht enttäuschen möchte, dachte er.
Er ging zur Bar und sprach mit dem Wirt. Ja, sie hätten zwei Zimmer, würden sofort Wärmflaschen in die Betten legen, und ja, sie hätten Telefon, das einzige im Umkreis von Meilen, wurde ihm stolz gesagt. Und ja, sie hätten noch Wein, in dieser Gegend werde nicht viel Wein getrunken.
Fünf Minuten später kam er mit einer weiteren Flasche des Claret zurück, der Juniper so gut geschmeckt hatte.
»Caroline ist deiner Meinung, Juniper. Sie sagt, wir sollen hier übernachten. Weiter oben im Tal ist das Wetter noch schlechter.«
»Siehst du, ich habe immer recht«, sagte Juniper, streifte ihre Schuhe ab und wärmte ihre Füße am Feuer.
Zwei Stunden später lag sie zitternd in ihrem Bett. Die Wärmflasche war nur noch lauwarm. Bei jeder Bewegung kam sie mit den eiskalten Laken in Berührung. Unter der Tür und durchs geschlossene Fenster strömte ein kalter Luftzug. Sie schlüpfte in ihren Pelzmantel, den sie als zusätzliche Decke auf ihr Bett gelegt hatte. Dann saß sie da und wartete. Sie wartete, bis im Gasthaus kein Geräusch mehr zu hören war, schlüpfte aus dem Bett, öffnete leise die Tür und schlich über die knarrenden Flurdielen zu Leighs Zimmer. Sie öffnete verstohlen die Tür, blieb stehen und lauschte auf die regelmäßigen Atemzüge des schlafenden Mannes. Behutsam hob sie die Bettdecke und schlüpfte neben ihn.
»Leigh«, wisperte sie. »Leigh, ich möchte, daß du mich liebst.« Ihre Hand glitt über ihn, und sie begann, seinen Körper mit feuchten, beißenden Küssen zu bedecken. Leigh stöhnte vor Lust.
»Juniper, wie schön, dich zu sehen«, rief, Caroline, kam die moosbedeckte, zerbröckelnde Treppe des riesigen Herrenhauses heruntergelaufen und umarmte ihre Schwägerin, während sich Leigh ums Gepäck kümmerte.
»Auch ich freue mich über dieses Wiedersehen.« Juniper küßte Caroline auf beide Wangen. über deren Schulter hinweg sah sie Leigh nervös zur Treppe gehen, wobei er unstet von links nach rechts blickte. O Gott, dachte Juniper, er wird es ihr beichten. Damit hatte sie zwar gerechnet, denn es war Teil ihres Plans, aber dieses Bekenntnis sollte nicht während ihrer Anwesenheit stattfinden, denn sie haßte Szenen. Sie sah ihn stirnrunzelnd an, wollte ihn beschwören zu schweigen, aber er wandte den Blick ab.
»Wie geht es Harry?« fragte sie fröhlich.
»Ich mache mir Vorwürfe, daß du die Strapazen der weiten Reise auf dich genommen hast. Er hat kein Fieber mehr und ist schon wieder auf.«
»Wie schön! Dadurch habe ich mich wenigstens aufgerafft, euch beide zu besuchen.« Juniper sah Caroline und Leigh strahlend an und bemerkte verärgert, daß er errötete. »Außerdem finde ich London entsetzlich langweilig«, fügte sie hastig hinzu, um zu verhindern, daß Caroline ihren Mann ansah.
Im Haus war es noch kälter als draußen. Sie weigerte sich, Leigh ihren Mantel zu geben und steckte ihre Hände tief in die Taschen.
»Das ist also der schottische Familiensitz der Coptons«, sagte sie und blickte sich in der spärlich möblierten Eingangshalle um. Eine Sammlung von ausgestopften, mottenzerfressenen und staubigen Tierköpfen schielte auf sie herab.
»O Mann, da überläuft mich ja eine Gänsehaut. Sind sie dir nicht unheimlich?« fragte sie erschrocken.
»Nein, ich mag sie. Den dort habe ich Sebastian genannt.«
Caroline deutete auf einen besonders großen Hirschkopf mit mächtigem Geweih. »Ich male mir gern aus, daß ihre Körper im Himmel auf die Coptons gewartet haben, die sie erlegten, und sie fürchterlich verdroschen.«
»Kommen Coptons in den Himmel?« fragte Juniper belustigt. »Sind sie nicht alle böse?«
»Ich hoffe sehr, daß Leigh dort sein wird«, antwortete Caroline lächelnd.
»Natürlich ist Leigh anders, nicht wahr? Leigh ist ein guter Copton.« Juniper kicherte. Leigh vermied es, sie anzusehen, und bückte sich, um das klägliche Feuer im Kamin anzufachen. Juniper ging gerade darauf zu, als eine Wolke beißenden Rauches herausquoll. Hastig wich sie zurück.