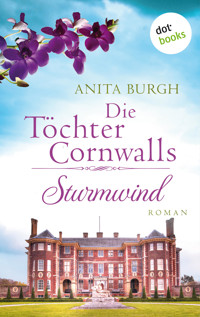
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Töchter Cornwalls
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte von Freundschaft, Verrat und Liebe: Die Familiensaga »Die Töchter Cornwalls: Sturmwind« von Anita Burgh als eBook bei dotbooks. England in den 1930er Jahren. Schon ihre Großmütter waren beste Freundinnen, verbunden durch Schicksal, Leid und Liebe – und als die exzentrische Juniper Tregowan nach vielen Jahren in Amerika nach Cornwall zurückkehrt, sind auch sie und die schüchterne Polly Blewett bald unzertrennlich. Obwohl die beiden jungen Frauen unterschiedlicher nicht sein könnten, werden sie beste Freundinnen und erleben gemeinsam eine aufregende Zeit – bis Polly das Herz gebrochen wird und sie ohne ein Wort aus England flieht. Obwohl Juniper bisher nur für rauschende Bälle und ihr eigenes Vergnügen zu leben schien, zögert sie keine Sekunde: Sie macht sich auf die gefährliche Suche nach Polly, koste es, was es wolle … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Töchter Cornwalls: Sturmwind« ist der zweite Band der berührenden Familiensaga von Anita Burgh. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 779
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
England in den 1930er Jahren. Schon ihre Großmütter waren beste Freundinnen, verbunden durch Schicksal, Leid und Liebe – und als die exzentrische Juniper Tregowan nach vielen Jahren in Amerika nach Cornwall zurückkehrt, sind auch sie und die schüchterne Polly Blewett bald unzertrennlich. Obwohl die beiden jungen Frauen unterschiedlicher nicht sein könnten, werden sie beste Freundinnen und erleben gemeinsam eine aufregende Zeit – bis Polly das Herz gebrochen wird und sie ohne ein Wort aus England flieht. Obwohl Juniper bisher nur für rauschende Bälle und ihr eigenes Vergnügen zu leben schien, zögert sie keine Sekunde: Sie macht sich auf die gefährliche Suche nach Polly, koste es, was es wolle …
Über die Autorin:
Anita Burgh wurde 1937 in Gillingham, UK geboren und verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in Cornwall. Ihre 24 Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und feierten international Erfolge. Mittlerweile lebt Anita Burgh mit ihrem Mann und zwei Hunden in einem kleinen Dorf in den Cotswolds, Gloucestershire.
Bei dotbooks veröffentlichte Anita Burgh ihre Romane »Das Erbe von Respryn Hall«, »St. Edith’s: Hospital der Herzen«, »Glückssucherinnen«, »Die Liebe eines Fremden«, »Wo deine Küsse mich finden«, »Das Lied von Glück und Sommer«, »Wo unsere Herzen wohnen«
Außerdem veröffentlichte Anita Burgh bei dotbooks ihre Familiensaga »Die Töchter Cornwalls« mit den drei Einzelbänden: »Morgenröte«, »Sturmwind« und »Dämmerstunde«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1990 unter dem Originaltitel »The Golden Butterfly« bei Chatto & Windus, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1992 unter dem Titel »Der goldene Schmetterling« bei Droemer Knaur.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1990 by Anita Burgh
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1992 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Deign unter Verwendung von shutterstock/TIGER KINGDOM, Ethel Davies
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-467-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Sturmwind« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anita Burgh
Die Töchter Cornwalls: Sturmwind
Roman
Aus dem Englischen von Traudl Weiser
dotbooks.
Die Autorin dankt
Romi Earle dafür, daß
sie ihr so freimütig
ihre Erinnerungen
an Frankreich 1940
mitgeteilt hat
Für Alison Samuel,
meine Lektorin und Freundin
And all about her wheeled and shone,
Butterflies, all golden.
JOHN DAVIDSON
Erster Teil
Kapitel 1
»Falls es Krieg gibt, will ich daran teilnehmen.« Das hatte Grace gesagt, und so hatte sie es gemeint – damals. Zwei Jahre später bereute sie oft, daß sie diese Auseinandersetzung mit ihren Eltern gewonnen hatte.
Es schien eine Ewigkeit her zu sein, nicht nur zwei Jahre, seit sie in New York im Salon ihrer Eltern gestanden und sich gegen sie behauptet hatte. Es war leicht gewesen, ihren Kopf durchzusetzen – wie es immer leicht gewesen war. Mit neunzehn besaß Grace Erfahrung im Umgang mit ihren Eltern, wußte, wann sie überreden, wann sie schmeicheln oder schmollen und wann sie einen Wutanfall vortäuschen mußte, um ihren Willen durchzusetzen.
Grace saß am Schreibtisch, die Petroleumlampe, teilweise abgeschirmt, zischte neben ihr – eine Oase des Lichts in der Mitte des langen, abgedunkelten Raums. Sie saß still da – in einer Insel des Schweigens, doch von atmenden, seufzenden, sich im Schlaf hin und her werfenden, ruhelosen Männern in schwarzen Eisenbetten umgeben. Zum Schutz gegen die kühle Morgenluft hüllte sie sich enger in ihren blutroten Umhang, der einzige Farbfleck in der Finsternis der Nacht.
Ein Geräusch, halb Seufzen, halb unterdrücktes Stöhnen, ließ sie aufblicken. Ihre Ohren waren darin geübt, solche Zeichen von Schmerz von den gewöhnlichen Lauten schlafender Männer zu unterscheiden. Sie stand auf und ließ den Blick über die ihrem Schreibtisch am nächsten stehenden Betten schweifen, in denen die Männer lagen, die nur noch von ihrer Hoffnung am Leben erhalten wurden. Alle schliefen. Sie lauschte aufmerksam. Das Stöhnen wiederholte sich nicht.
Sie wachte als einzige Schwester im Krankensaal, die anderen waren gegangen, um während dieser unerwarteten Ruhepause schnell einen Happen zu essen. Seit Beginn der neuen Offensive hatten sie kaum Zeit zum Essen und Schlafen gefunden. Die Tage der Woche und die Stunden des Tages waren nicht mehr klar abgegrenzt. Jetzt wurde die Zeit durch die Anzahl der durchgeführten und noch anstehenden Operationen bestimmt, die Zahl der Verbände, die gewechselt werden mußten, und die Zahl der Hände von Sterbenden, die tröstend gehalten werden mußten. Woher die Krankenschwestern die Kraft dafür nahmen, war ein fortwährendes Geheimnis. Unzählige Male, wenn die Schwestern vor Erschöpfung am Rande eines Zusammenbruchs standen, fanden sie doch irgendwie genügend Kraft, sich um eine neue Flut von Soldaten zu kümmern, die von den Sanitätswagen gebracht und in ihre Obhut übergeben wurden. Aus qualvollen Augen sahen die Männer sie voller Hoffnung und Dankbarkeit an, und die Müdigkeit der Frauen verschwand sofort, die schmerzenden Füße waren vergessen, und die Arbeit und das Heilen begannen von neuem.
Grace blickte auf den Notizblock auf ihrem Schreibtisch und betrachtete stirnrunzelnd den Brief, den sie versuchte zu schreiben. Es gab nichts, was sie nach Hause schreiben könnte. Es fehlte ihr die Fähigkeit, das immer schlimmer werdende Blutbad, die Greuel zu beschreiben. Jedenfalls hatte sie nicht länger das Bedürfnis, ihren Eltern davon zu erzählen. Was hier geschah, war ihre Welt, die nur ihr, den Patienten und den Mitgliedern des Ärzte- und Pflegepersonals gehörte. Die andere, die behagliche Welt, in der ihre Eltern lebten, hatte für sie keine Bedeutung mehr. Wie konnte sie den entsetzlichen, stinkenden Horror dieses Krieges schildern? Wie würden sie reagieren, während sie im Luxus ihres Salons, elegant gekleidet, nach einem vorzüglichen Dinner mit einem guten Claret dasaßen? – Mit Unverständnis.
Sie las, was sie geschrieben hatte, daß es Nacht war, daß sie allein war, daß ein Mann eben gestöhnt hatte ... Um zu überleben und nicht den Verstand zu verlieren, hielt Grace es für das Beste, sich nur auf den Augenblick zu konzentrieren. Es war besser, nicht über das Geschehene oder darüber nachzudenken, wen die Sanitätswagen heute nacht bringen könnten.
Sie hörte das Sperrfeuer in der Ferne. Das war jetzt die Hintergrundmusik in ihrem Leben. Sie hatte fast vergessen, wie es klang, wenn ein Vogel sang, denn hier gab es keine Vögel, die sangen, nur das Donnern der großen Kanonen an der Somme, die nichts als Tod und Zerstörung brachten.
Erst kürzlich war ihr der Gedanke gekommen, daß sie außerhalb dieses Lazaretts in Frankreich weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft hatte. Es war ihr unmöglich, sich an die Wärme und Behaglichkeit ihres Zuhauses zu erinnern. Es gab Zeiten, da war sie überzeugt, das Leben sei nur ein Traum und daß sie ihr ganzes Leben hier, in dieser Hölle, verbracht hätte.
Das Stöhnen ließ sie wieder aufhorchen. Dieses Mal hatte sie sich nicht geirrt. Sie nahm ihre Lampe und ging leise zwischen den Bettreihen hindurch. Als sie die Lampe hochhielt und das Licht auf die Betten fallen sah, wußte sie genau, welche Vision sie zu ihrem mutigen Entschluß veranlaßt hatte – sie hatte sich als moderne Florence Nightingale gesehen. Niemand hatte sie vor dem Blut, dem Eiter, dem Wundbrand, dem Gestank und der schrecklichen Angst der Patienten in dem großen Saal gewarnt.
»Haben Sie schlimme Schmerzen, Captain?« fragte sie flüsternd den Patienten, der vor zwei Tagen mit einem zerschmetterten Bein und blind eingeliefert worden war. Sie beugte sich über ihn, glättete sein Bettuch und hob sanft seinen Kopf, um das Kissen umzudrehen. Er war ein großer, muskulöser Mann, und sie fragte sich, wie er unter dem Verband über seinen blinden Augen aussah. Ihre Brüste streiften ihn. Er griff nach ihrer Hand.
»Ich habe schreckliche Angst, Schwester. Wo bin ich?«
»Sie sind in Sicherheit, Captain. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Ich bin bei Ihnen«, tröstete sie ihn, ein junges, einundzwanzigjähriges Mädchen, selbst so voller Angst, daß sie ihr den Schlaf raubte. Und einem Zusammenbruch so nahe, daß sie regelmäßig am ganzen Körper zitterte, ehe sie ihren Dienst antrat. »Ich werde mich um Sie kümmern«, sagte sie automatisch.
»Er war einer von uns. Ich habe ihn getötet.«
»Ganz ruhig, das haben Sie bestimmt nicht getan«, sagte Grace in dem mechanischen, beschwichtigenden Tonfall ihres Berufs.
Marshall hatte sich geändert. Früher hatte er nur mit dem Hedonismus gespielt, jetzt war er jedoch fest entschlossen, sich Hals über Kopf in ein Leben voller Zügellosigkeit zu stürzen – wenn er wieder gesund war.
In den Wochen seiner Verwundung hatte sein Leben nur aus einer Reihe von Bruchstücken bestanden, manche strahlend und klar, andere trübe und undeutlich. Am Anfang hatte er um seine Erinnerung gekämpft, hatte verzweifelt versucht, die Stücke zusammenzufügen, ihnen einen Sinn zu geben. Doch jetzt hatte er sich mit dem Gedanken abgefunden, den Rest seines Lebens mit diesem unfertigen Puzzle in seinem Kopf existieren zu müssen.
Er fragte sich, ob sein Erinnerungsvermögen besser werden würde, wenn er wieder sehen konnte – wenn er wieder sehen würde – fügte er in seinen Gedanken beschwörend hinzu, so als berührte er einen Talisman oder klopfte auf Holz. Eigentlich dumm, ein Verhalten, als ob ein Gedanke die Fähigkeit eines Chirurgen beeinflussen oder den Schaden an seiner Bindehaut mindern könnte.
Er hatte die Dunkelheit immer gehaßt. Jetzt lebte er in einer dunklen Welt und mit der Bedrohung, daß sie ewig dauern könnte. Er hatte gleich zu Anfang beschlossen, was er in dem Fall tun würde – eine Kugel in die Schläfe, schnell und sauber. Kein Blindenstock für ihn, kein blindes Tasten durchs Leben. Wenn er keine hübsche Frau mehr sehen, den Wein im Glas nicht mehr bewundern, seinem Golden Retriever nicht mehr zusehen und die Tautropfen auf einer Spinnwebe nicht mehr bestaunen konnte dann wollte er nicht mehr leben.
»Zeit für Ihre Medizin, Captain Boscar.« Die Krankenschwester berührte leicht seinen Arm, um ihm zu zeigen, daß sie da war. Er richtete sich im Bett auf, verfluchte den Schmerz, der durch sein zerschmettertes Bein schoß.
»Aber, aber, Captain. Keine unflätigen Ausdrücke an einem so schönen Tag«, sagte die Krankenschwester mit ihrer monotonen Stimme, als würde sie mit einem Kind reden. Am liebsten hätte er sie frohen Herzens umgebracht, wenn sie so mit ihm sprachen. Wie kamen Schwestern nur zu der Annahme, daß es Patienten nichts ausmachte, wie Schwachsinnige behandelt zu werden?
Er haßte den Gedanken, daß »Schöne Brüste« so mit ihm reden könnte. Das war eine seiner glücklichsten Erinnerungen, das wundervolle, sanfte Nachgeben einer jungen Brust, die ihn berührte, als die Schwester sich über ihn gebeugte hatte, um sein Bettuch zu glätten. Gewiß würde eine Frau mit einem solchen Busen nicht mit ihm wie mit einem Idioten reden? Aber er hatte keine Ahnung, welche Krankenschwester es gewesen oder in welchem Krankenhaus es geschehen war. Es hatte zu viele gegeben. Das war das Problem mit den Bruchstücken, er konnte sie nie logisch zusammenfügen.
Er lag ruhig da und wartete auf die Wirkung des Morphiums. Viermal am Tag gaben sie ihm eine Dosis – einen Segen für die nächsten paar Stunden, wenn die Droge seine Qual zu einem dumpfen Schmerz verringerte.
Er wußte über sein Bein Bescheid. Er wußte, daß die Ärzte es gerettet hatten – gerade noch; daß ein weiterer Monat vergehen würde, bis er stehen konnte; daß er immer hinken würde. Das alles konnte er akzeptieren, wenn nur der Schmerz aufhören würde. Aber keiner konnte ihm sagen, ob das je der Fall sein würde.
Als er sich entspannt auf das Kissen zurücklegte, wußte er, daß es wieder passieren würde, noch ehe es geschah. Es war, als würden Blätter in seinem Gehirn rascheln – und dann, wie immer, aus dem Nichts, hörte er es: »Rosemary!« rief die Stimme in seinem Kopf. Er zuckte zusammen. Dieses Fragment seiner Erinnerung haßte er am meisten. Die Stimme war so klar, als befände sich der Mann mit ihm im selben Zimmer. Würde er denn nie verschwinden, würde er ihn nie in Ruhe lassen? Weil dieser Mann, der da draußen im Schlamm nach Rosemary gerufen hatte, die Schande seines Lebens war. Er hätte gern den Kopf geschüttelt um diese Erinnerung loszuwerden, aber das durfte er wegen seiner Augen nicht tun. Also wappnete er sich gegen seine Vision, denn er wußte, es gab kein Entfliehen davor ...
»Rosemary!« Es war kein Ruf, sondern ein Schrei gewesen. Er war vom anderen Ende des Bombentrichters gekommen. Er war darauf zugekrochen.
»Wer ist da?« hatte er gerufen.
»Hilf mir! Um Gottes willen, hilf mir!«
Der Schmerz in seinem Bein hatte Sterne vor seinen Augen aufblitzen lassen, als er mühsam durch den Schlamm und Schleim gekrochen war, barmherzigerweise war ihm nicht bewußt gewesen, daß ein Teil des Schleims die Überreste seiner Kameraden gewesen waren. Er hatte eine Stunde gebraucht, um die schreiende Stimme zu erreichen.
Als er dort angekommen war, hatte er sich weit weg gewünscht. Der Mann hatte nur noch einen halben Kopf und keine Beine mehr gehabt. Er hätte tot sein sollen und sich nicht ans Leben klammern dürfen, indem er nach einer Frau schrie.
»Du solltest Mutter schreien, anstatt nach einer anderen Frau. Das erwartet man von dir«, hatte er barsch gesagt.
»Sie ist meine Mutter«, hatte der Mann mit dem halben Kopf gekeucht, Blut war aus seinem Mund geströmt.
Der Captain hatte das Verbandszeug aus seinem Tornister genommen und eine Entschuldigung gemurmelt, als er dem armen Teufel in der Dunkelheit ungeschickt den Kopf verbunden hatte.
»Rosemary!« hatte der Mann geschrien und stundenlang weitergeschrien, nur dieses eine Wort, das sich in Marshalls Kopf gebohrt hatte, während er neben ihm im Schlamm gelegen hatte, zu erschöpft, um fortkriechen zu können. Gott, hatte er gedacht, wenn ich da je rauskomme, tue ich nur noch, was mir Spaß macht.
»Warum, verdammt noch mal, stirbst du nicht endlich!« hatte er schließlich geschrien. Und der Mann war gestorben. Das war das Schreckliche an dieser Erinnerung, das würde er sich nie verzeihen können.
Aber er konnte sich nicht daran erinnern, wie er hierhergekommen war, noch wußte er, wie er in diesen Trichter zu dem Schwerverletzten gelangt war. Er erinnerte sich nur deutlich an den Trichter, den Schlamm, weich und glucksend, nicht unangenehm, beinahe behaglich, aber so kalt in der Nacht. Und die Ratten. Merkwürdigerweise hatten ihm die Ratten nichts ausgemacht.
Er konnte sich an die Lichter in jener Nacht erinnern. Diese besonderen Lichter, die Phosphorbomben – wahrscheinlich weil sie das letzte waren, was er vor der Explosion der Granate gesehen hatte, dem ohrenbetäubenden Krachen, das ihn ins Jenseits hätte befördern sollen. Statt dessen lag er in einem Bett, irgendwo in England.
»Besuch für Sie, Captain Boscar.«
»Hallo, alter Knabe. Ich bin Richard Frobisher.« Er fühlte wie seine Hand genommen und mit festem Griff geschüttelt wurde. »Ich glaube, unsere Väter sind alte Bekannte.«
Marshall akzeptierte die Zigarette, die Richard ihm zwischen die Lippen steckte, und in ihrer zunächst zögerlichen Unterhaltung begannen sie einander zu erforschen, achteten auf einzelne Worte, gemeinsame Interessen, Anzeichen dafür, daß sie miteinander auskommen, vielleicht Freunde werden könnten.
»Was fehlt dir?« fragte Marshall.
»Ich wurde vor ein paar Monaten verwundet«
»Wo?«
»In der Nähe von Delville.«
»Nein, ich meine, wo an deinem Körper«, sagte Marshall lachend, obwohl er es nicht hätte tun sollen – wegen seiner Augen.
»Oh, an der Brust. Unglücklicherweise kann ich nicht an die Front zurück.«
»Unglücklicherweise? Sei doch kein verdammter Narr. Glücklicherweise. Wer, außer einem Verrückten, würde in diese Hölle zurückkehren wollen?«
»Herrgott, was für eine Erleichterung, dich das sagen zu hören. Ich habe es satt, das Gegenteil behaupten zu müssen. Jeder erwartet von mir, daß ich es bedauere, kriegsversehrt zu sein.«
»Zum Teufel damit, was die Leute erwarten. Sie waren nicht dort, sie begreifen nichts.«
»Als die Ärzte mir sagten, daß ich nicht mehr rausgeschickt werde, hätte ich am liebsten auf der Straße getanzt. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht einmal, woher ich überhaupt die Courage hatte, einzurücken und mich niederschießen zu lassen«, sagte er ironisch. »Und du?«
»Ich? Ich kann mich an fast nichts erinnern. Oh, ich weiß, wer ich bin und alles über mich, bis zum 3. Juli, und danach ... zum Teufel. Ich weiß nicht, wo ich war, wie ich hierherkam, ich war in einem Bombentrichter, daran erinnere ich mich, aber wie lange ...«
»Du warst drei Tage lang im Niemandsland, einer der letzten, der gefunden wurde. Es ist ein Wunder, daß du überlebt hast, und ein noch größeres Wunder, daß du geistig gesund bist. Das hat man mir erzählt.«
»Geistig gesund?« Marshall lachte kurz auf, dachte an seine Erinnerungslücken und wünschte, er würde diesen Mann besser kennen und sich ihm anvertrauen können. »Wer weiß?«
»Was ist mit deinen Augen? Bist du ...«
»Blind? Ich weiß es nicht. Der Verband kommt nächsten Monat runter, dann werde ich es wissen.«
»Und das Bein?«
»Hätt's beinahe verloren, schätze ich, aber es wird allmählich besser.«
Sie plauderten über dieses und jenes. Wen sie kannten und wo sie gewesen waren und wohin sie gehen wollten. Nach einer Stunde hatten beide das Gefühl, daß sie wahrscheinlich Freunde werden würden.
»Wenn Sie doch nur stillhalten könnten, Captain.«
Stillhalten? Er wollte den Verband selbst herunterreißen. Warum dauerte es nur so lange – sadistische Bastarde. Er fühlte das Blut in seinen Ohren pochen, als wäre sein Herz dorthin gerutscht. Seine Handflächen waren schweißfeucht, und er hielt den Atem an, als der Verband abgenommen wurde.
»Sie können jetzt Ihre Augen öffnen, das Zimmer ist verdunkelt. Wie viele Finger halte ich in die Höhe?« fragte der Arzt ruhig. Vorsichtig öffnete Marshall die Augen und schloß sie sofort wieder. Obwohl das Zimmer verdunkelt war, schmerzte das Licht, als würde es seine Augäpfel durchbohren. Blinzelnd, wie in der Sonne, öffnete er sie noch einmal.
»Drei, Doktor«, murmelte er mühsam, während er mit zusammengekniffenen Augen die drei dicken Finger des Arztes vor seinem Gesicht ansah. »Drei!« Und er begann vor allen, vor dem Arzt und den Krankenschwestern, vor Erleichterung zu weinen.
Kapitel 2
Marshall blickte über den Tisch und betrachtete eingehend seinen neuen Freund, von dem er bisher nur die Stimme kannte. Richard war aus dem Krankenhaus entlassen worden, als Marshall noch den Kopfverband getragen hatte. Ihm gegenüber saß ein schlanker, vierundzwanzigjähriger Mann, mittelgroß, mit einem Schopf dunkelroten Haars, dessen Lockenpracht auch die reichlich aufgetragene Pomade nicht bändigen konnte. Sein Gesicht war zartgliedrig mit hohen Wangenknochen, einer schmalen Nase und schönen hellgrauen Augen. Beim Reden gestikulierte er ausdrucksvoll mit seinen langen, schmalen Händen.
Er war das krasse Gegenstück zu seinem Gefährten. Marshall war gut einsdreiundachtzig groß und kräftig gebaut, jetzt achtundzwanzig. Trotz seines Aufenthalts im Krankenhaus hatte er den schweren, muskulösen Körper eines Sportlers. Sein eckiges Gesicht mit dem festen Kinn und dem vollen Mund war normalerweise von den Stunden im Freien angenehm gebräunt, aber die Monate als kriegsversehrter Rekonvaleszent hatten seinen Teint blaß werden lassen. In dieser Blässe wirkten seine blauen Augen größer und verliehen zusammen mit dem beinahe schwarzen Haar seinem Gesicht einen beinahe wilden Ausdruck. Er besaß die Haltung und das Gesicht eines Mannes, der immer beachtet wurde, und das wußte er.
Beide Männer trugen Zivil. Richard, weil er als Kriegsversehrter zurückgestellt worden war, und Marshall, weil ihm seine Uniform nach dem Krankenhausaufenthalt nicht mehr paßte.
»Was wollen wir unternehmen? Wir sollten Silvester feiern, jetzt, da wir 1916 mehr oder weniger heil überlebt haben.« Marshall klopfte auf den Spazierstock, der an seinem Stuhl lehnte.
»Es fällt einem nicht leicht, etwas zu feiern, wenn man an die armen Kerle an der Front denkt, nicht wahr?«
»Wir können doch auf ihr Wohl trinken. Bestimmt würden sie dasselbe für uns tun, wenn die Rollen umgekehrt verteilt wären«, sagte Marshall hastig, besorgt darüber, daß Richard es ernst meinen könnte. Er jedenfalls hatte die Absicht zu feiern.
»Es überrascht mich, daß du ausgerechnet am letzten Tag des Jahres aus dem Krankenhaus entlassen wurdest. Haben sie denn keine Angst, du könntest dich sinnlos betrinken?«
»Ich habe auch vor, mich zu betrinken. Aber sie haben mich nicht entlassen, ich habe mich selbst entlassen. Nachdem du fort warst, habe ich mich zu Tode gelangweilt. Und ich bin überzeugt, alle Offiziere werden von den häßlichsten Krankenschwestern versorgt. Das wünsche ich mir heute nacht, eine Frau – es ist so lange her ...« Marshalls Lippen umspielte bei dem Gedanken an einen weiblichen Körper ein genüßliches, träges Lächeln.
»Wir gehen ins Empire. Eine Freundin von mir tritt dort in der Show auf. Ich werde sie bitten, eine Freundin mitzubringen, und dann können wir im Eddington feiern. Ich habe dort eine Suite.«
»Daisy hat mir dort Hausverbot erteilt.«
»Wann war das?«
»1914. Lebenslang, hat sie gesagt.« Marshall schnitt eine Grimasse.
»Was hast du denn, um Himmels willen, angestellt?«
»Ich kann mich nicht erinnern, ich war so betrunken ... ich glaube, ich habe ihre Aspidistra angepinkelt.«
»Doch nicht die Aspidistra?« fragte Richard lachend.
»Genau die.« Marshall schüttelte in gespielter Reue den Kopf.
»Sie hat's sicher vergessen. Und außerdem ist die liebe alte Daisy Lavender nicht nachtragend.« Richard wählte Zigarren für beide aus dem geschnitzten Kästchen, das ihm ein Kellner hinhielt.
»Da gibt's nur ein Problem«, sagte Marshall, nachdem ihre Zigarren zu ihrer Zufriedenheit brannten. »Ich fürchte, du wirst ohne mich gehen müssen. Ich bin im Augenblick in einer etwas peinlichen finanziellen Notlage – bloß vorübergehend, verstehst du, und das Eddington ist verdammt teuer.«
»Mein lieber Freund, da es mein Vorschlag war, bist du selbstverständlich mein Gast. Es würde mir nicht im Traum einfallen, dich für irgend etwas bezahlen zu lassen.«
»Das ist außerordentlich nett von dir, alter Knabe. Wenn ich wieder bei Ka se bin, lade ich dich ein«, sagte Marshall sichtlich erleichtert. Er konnte sich nicht vorstellen, wann dieser gloriose Tag je anbrechen würde, aber durch sein eigenes großzügiges Angebot konnte er Richards Gastfreundschaft unbeschwert akzeptieren.
»Verzeihung.« Beide blickten auf und sahen eine hübsche junge Dame im Abendkleid an ihrem Tisch stehen. Ihre Hände umkrampften ein kleines besticktes Täschchen.
»Mit Vergnügen«, sagten beide gleichzeitig. Einander angrinsend, sprangen sie auf und wollten den einzigen freien Stuhl der Lady anbieten.
»Für Feiglinge wie euch«, sagte sie eisig, öffnete ihr Abendtäschchen und nahm zwei weiße Federn heraus, die sie auf den Tisch legte.
»Oh, hören Sie mal«, empörte sich Richard. »Das ist verdammt unfair ...«
Marshall sagte nichts, aber sein Gesicht drückte alles aus, als er einen Schritt auf die junge Dame zutrat. Da sie fürchtete, er wolle sie schlagen, hob sie schützend den Arm vors Gesicht. Aber Marshall entriß ihr nur ihre Handtasche, öffnete sie und schüttelte mit einer schwungvollen Geste die Federn hoch in die Luft. Ein Windhauch vom Fenster erfaßte sie und wirbelte sie in hohem Bogen durch den Speisesaal.
»Da haben Sie Ihre Federn, Madame«, zischte Marshall ihr mit solcher Vehemenz zu, daß die junge Dame vor ihm zurückwich und zwei stämmigen Kellnern in die Arme fiel. Ohne weiteres Aufhebens packten diese sie bei den Ellbogen, hoben sie hoch, ignorierten ihr Kreischen und ihre strampelnden Beine und trugen sie aus dem Restaurant. Die meisten Gäste konzentrierten sich voller Verlegenheit auf ihr Essen.
Der Oberkellner kam mit bestürztem Gesichtsausdruck an den Tisch der beiden geeilt. Als er den Saal durchquerte, verneigte er sich nach links und rechts, murmelte in einem Gemisch aus Italienisch und Englisch fortlaufend Entschuldigungen, während sein Blick durch sein geliebtes Restaurant schweifte. Mit einer behenden Bewegung schnappte er nach einer Feder, die auf einem Bissen Filet Mignon gelandet war, der an einer Gabel steckte und eben in einem herzoglichen Mund verschwinden sollte. Zwei weitere Federn entfernte er von dem Diadem einer Marquise, ließ mit einer geschickten Geste das mit einer Feder verzierte Glas mit Claret vom Tisch eines Barons verschwinden und bedeutete dem Weinkellner, es zu ersetzen. Schließlich erreichte er völlig außer Atem den Tisch von Marshall und Richard.
»Captain Frobisher, ich bin zutiefst bestürzt.« Das Gesicht des Oberkellners war vor Empörung verzerrt. Er rang die Hände, zupfte jedoch gleich darauf Federn von Richards Anzug.
»Schon gut, Luigi. Es war nicht Ihre Schuld. Diese verdammten Frauen tauchen überall auf.« Richard versuchte den Mann zu beruhigen.
»Ich find's einfach unverschämt«, platzte Marshall heraus und wischte sich die Federn ab. »Wie können Sie ein derartiges Gesindel in Ihr Restaurant lassen?«
»Sir, entschuldigen Sie bitte ... Aber, Sir, Sie haben die junge Dame gesehen, sie wirkte absolut respektabel«, sagte Luigi mit weinerlicher Stimme, die um Vergebung flehte.
»Es war unsere Schuld, weil wir keine Uniform tragen. Sie konnte es nicht wissen«, sagte Richard verständnisvoll.
»Ich sehe nicht ein, warum ich nicht anziehen kann, was ich will, wenn ich zum Dinner ausgehe. Einen derartigen Affront hätte ich im Ritz nicht erwartet«, sagte Marshall entrüstet. »Komm, Richard, laß uns gehen.« Er griff nach seinem Spazierstock, wirbelte ihn beschwingt durch die Luft und humpelte mit übertriebener Dramatik zur Tür. Die anderen Gäste erhoben sich und applaudierten den beiden Freunden enthusiastisch. Marshall akzeptierte den Applaus mit einem breiten Grinsen und einem theatralischen Salut. Richard folgte ihm peinlich berührt nach draußen.
Auf dem Gehsteig brach Marshall in brüllendes Gelächter aus.
»Was ist daran so komisch?«
»Welch ein Glück, daß dieses Miststück aufgetaucht ist. Der Auftritt war es wert, die Zeche nicht bezahlen zu müssen, meinst du nicht auch?«
»Du lieber Himmel, Marshall. Das habe ich glatt vergessen«, sagte Richard und wollte umkehren.
»Wo willst du hin?«
»Ins Restaurant, um zu bezahlen, natürlich.«
»Sei doch kein verdammter Dummkopf.«
»Wirklich, Marshall, wir müssen bezahlen. Es wäre Zechprellerei.«
Marshall stapfte in der eisigen Kälte auf und ab, schlang die Arme um seinen Körper, um sich warm zu halten, während er auf Richard wartete.
»Ich hoffe, du hast nicht für mich bezahlt«, sagte er, sobald Richard wieder erschien.
»Sie haben mich für keinen von uns beiden bezahlen lassen, stell dir nur vor.«
»Na, da hast du's«, meinte Marshall selbstzufrieden.
»Das ist etwas anderes. Es war ihre Entscheidung. Taxi.« Richard hob die Hand, und als ein Wagen hielt, kletterten sie hinein. Richard gab dem Fahrer Anweisungen und ließ sich dann in den Sitz zurückfallen. Das Vorkommnis hatte ihn aufgeregt. Nicht so sehr das Benehmen der jungen Frau – das war nur ein albernes Mißverständnis gewesen –, sondern Marshalls kleinlicher Betrugsversuch verstörte ihn. Er haßte Gemeinheit in jeder Form und verabscheute Unehrlichkeit. Er konnte diesen Charakterzug in einem Menschen wie Marshall nicht verstehen. Verstimmt schaute er zum Fenster hinaus. Aber andererseits wollte er es sich mit seinem neuen Freund nicht verderben. Er mochte ihn. So viele seiner alten Freunde waren jetzt tot, elend gestorben da draußen in den Schützengräben, so daß er jetzt nur noch wenige Freunde hatte. Er wischte das Kondenswasser von der Scheibe. Marshall konnte nichts dafür, daß er knapp bei Kasse war. Vielleicht hätte er an Marshalls Stelle ähnlich gehandelt? Jedenfalls würde er Francine in fünf Minuten wiedersehen. Dieser Gedanke stimmte ihn derart fröhlich, daß er Marshall einen Schluck aus seiner Taschenflasche anbot und ihm auf die Schulter klopfte.
»Tut mir leid, daß ich vorhin so grob war«, sagte er schüchtern.
»Grob? Ich hab's nicht mal gemerkt, alter Knabe. Warst du das tatsächlich?« entgegnete Marshall edelmütig, als das Taxi vor dem Theater hielt. Marshall kramte in seinen Taschen nach Kleingeld, aber Richard schob ihn beiseite und bestand darauf, das Taxi zu bezahlen.
Richard lief behende die Treppe zum Foyer hinauf, während Marshall mühsam hinterherhinkte. Richard erwartete ihn auf dem oberen Absatz und murmelte Entschuldigungen für seine Gedankenlosigkeit.
»Sie muß ja was ganz Besonderes sein«, sagte Marshall grinsend, als er endlich oben ankam.
»Das ist sie, das ist sie.«
Die Show war in vollem Gang, als sie zu der Bar im ersten Rang kamen und zwei große Brandies bestellten. Das Theater war vollgepackt, das Publikum bestand hauptsächlich aus Männern in Uniform, die sich lautstark unterhielten und den Komödianten völlig ignorierten, dessen Scherze niemandem ein Lachen entlockten. Die beiden Freunde stützten sich mit den Ellbogen auf das mit Samt bezogene Geländer, das die Bar vom Auditorium trennte.
Der schwere Vorhang senkte sich, und der Komödiant wurde mit spärlichem Applaus verabschiedet. Hinter dem Vorhang hörte man die Kulissenschieber fluchen. Das Publikum rutschte unruhig auf den Sitzen hin und her, und im Theater herrschte plötzlich angespannte Erwartung.
Das Orchester im Graben stimmte In a Monastery Garden an. Der Vorhang teilte sich und enthüllte eine schlecht gemalte Landschaft. Wolken waren auf einen unwahrscheinlich blauen Himmel gepinselt, grellbunte Blumen blühten zwischen baumähnlichen Gebilden, und die ganze Kulisse schwankte bedrohlich. Völlig unpassend stand in dieser Landschaft eine wackelige weiße Treppe, deren oberes Ende in der Seitenkulisse verschwand.
Mit ohrenbetäubendem Geschrei wurden die Tänzerinnen begrüßt, die als Milchmädchen verkleidet auf die Bühne tanzten. Sie kamen etwas aus dem Rhythmus, als der frenetische Lärm das Orchester übertönte. Dann übernahm ein Mädchen die Führung, und die Gruppe hopste dilettantisch umher, während die Männer klatschten, mit den Stiefeln aufstampften, pfiffen und schrien.
Marshall gähnte vor Langweile über die amateurhafte Vorführung und fragte sich, wie, um Himmels willen, das Wesen aussehen mochte, das Richard hierher, so weit vom West End entfernt, gelockt hatte.
Der Trommler kämpfte jetzt mit wirbelnden Armen gegen den Lärm an, und die Milchmädchen bildeten zwei Reihen, versanken in einen tiefen Knicks und deuteten mit dramatischer Geste zur Spitze der Leiter. Dann kam eine lange Pause. Die Männer verstummten. Das Publikum schien den Atem anzuhalten.
Zuerst erschienen ein Fuß und ein Bein in einem blauen Seidenstrumpf. Seide raschelte, und dann stand plötzlich eine große, schlanke Frau auf der obersten Stufe. Ihr blondes Haar lugte unter einem breitkrempigen, mit Straußenfedern geschmückten Hut hervor, der ihr Gesicht verbarg. Langsam hob sie den Kopf und lächelte. Das Gebrüll, das dieses Lächeln auslöste, hätte das Dach des Theaters emporheben können. Wie eine Königin akzeptierte die Darstellerin diesen Applaus und schritt voller Grazie, trotz der weiten, mit Flitter besetzten Röcke ihrer Krinoline, die Treppe herunter. Ihre Haltung war so elegant, daß man die wackelige, primitiv bemalte Treppe übersah – sie hätte eine Prinzessin sein können, die eine Marmortreppe herabschritt. Langsam bewegte sie sich zur Bühnenmitte und hob gebieterisch die Hand, worauf die Beifallsrufe verstummten.
»Wir lieben dich, Mädchen!« rief ein Mann von der Galerie.
Sie neigte leicht den Kopf und warf dem Publikum eine Kußhand zu. Wieder brandete Applaus auf. Mit zurückgeworfenem Kopf und ausgebreiteten Armen stand sie auf der Bühne und ließ den Beifall über sich hinwegfluten. Dann nickte sie dem Dirigenten zu und hob Schweigen gebietend die Hand. Ihre Bewunderer verstummten sofort.
Sie sang ein Potpourri von Liedern. Ihre Stimme war ganz hübsch, aber nicht außergewöhnlich. Der Zauber lag nicht in ihrer Stimme, sondern in ihrer Vortragsweise. Und in ihrer persönlichen Ausstrahlung, die das Publikum die schäbige Umgebung vergessen ließ und jedem Mann das Gefühl gab, sie sänge ausschließlich für ihn. Es war, als ob sie auf eine merkwürdige Weise jeden einzelnen von ihnen lieben würde.
»Mein Gott, sie ist phantastisch!« Marshall applaudierte enthusiastisch, als sich die Sängerin graziös verneigte.
»Nicht wahr?« sagte Richard mit glänzenden Augen und klatschte frenetisch.
»Meinst du etwa ... Du Glückspilz.« Marshall gab Richard einen spielerischen Stoß, der ihn stolz wie ein kleiner Junge angrinste.
»Ja, das ist meine Freundin. Und eines Tages wird sie das West End erobern. Sie wird ein Star sein. Dafür werde ich sorgen. Ich will sie einem Freund von mir vorstellen, der ihr dabei helfen wird, Karriere zu machen. Das war ihr letztes Lied vor dem Finale. Komm, wir gehen jetzt zu ihr in die Garderobe.
Marshall erhob sich trotz seines steifen Beins mit erstaunlicher Behendigkeit vom Stuhl.
»Miss du Bois sagt, Sie können gleich nach oben gehen, Captain Frobisher!« rief der Bühnenportier aus der Wärme und Behaglichkeit seiner verglasten Loge. Mit den Füßen auf dem Tisch und einem Bierkrug neben sich, studierte er die Rennsportseiten der Abendzeitung.
»Wie geht's deinen Füßen, Fred?«
»Werden besser, Sir. Ich bezweifle allerdings, daß ich je wieder so laufen kann wie früher. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich bin lieber hier als da draußen bei den armen Hunden. Sie wissen schon, was ich meine.«
Richard ging durch einen langen Korridor, dessen Ziegelwände schmutziggelb gestrichen waren und nur trübe von vereinzelten Gaslampen beleuchtet wurden. Am Ende des Korridors kletterte er eine Eisentreppe hinauf. Oben angekommen, gerieten beide in einen Schwarm kichernder Tänzerinnen, die sich an ihnen vorbeidrängten und sie mit koketten Blicken bedachten. Marshall blieb regungslos stehen und atmete ihren Duft ein, als die Mädchen an ihm vorbeitrippelten.
»Oh, mein Gott, wie ich Frauen liebe«, seufzte Marshall und blickte der schnatternden Schar nach, die lärmend die Treppe hinunterpolterte. Er drehte sich um und sah Richard in einer Tür am Ende des Korridors verschwinden. Als er die Garderobe betrat, wurde Richard gerade von einer nach teurem Parfüm duftenden Spitzenwolke umarmt.
»Liebling, darf ich dir meinen Freund, Marshall Boscar, vorstellen? Marshall, das ist Miss Francine du Bois.«
»Mr. Boscar ...« Eine lange, schmale Hand streckte sich ihm entgegen, und Marshall stand einer Frau gegenüber, die – trotz des grellen Bühnen-make-ups – das schönste weibliche Wesen war, das er je gesehen hatte. Ihr langes, silberblondes Haar fiel locker auf ihre samtenen Schultern. Ein leichtes Lächeln umspielte ihren vollen Mund. Aber das Außergewöhnlichste an ihr waren die Augen – riesige grüne Augen, wirklich grüne Augen, nicht haselnußbraun und golden gefleckt. Die Iris war von einem dunkelgrünen Rand umgeben, und lange dichte Wimpern schützten diese wunderschönen Augen.
Richard beobachtete seinen Freund, der die Frau begrüßte, die er mit so viel Stolz liebte, als hätte er sie erschaffen.
»Wir dachten, wir gehen zu Daisy und feiern ins Jahr 1917 hinein. Was hältst du davon, Francine?«
»Was für eine großartige Idee.« Ihre Stimme war tief und heiser, eine Stimme voller sexueller Versprechungen, die Marshall sofort erregte. »Ist Mr. Boscar in Begleitung einer Freundin, oder soll ich jemanden für ihn einladen?« Als sie ihm zulächelte, sah sie ihm direkt in die Augen. Der Blick sagte ihm, daß sie ihn begehrte, und der Blick sagte ihm, daß er ihr gehören würde.
»Er wurde erst heute aus dem Krankenhaus entlassen«, erklärte Richard.
»Oh, ich hoffe, es ist nichts Ernstes, Mr. Boscar.« Sie betrachtete ihn forschend von Kopf bis Fuß, und er wußte, es war keine Einbildung, daß ihr Blick länger auf seinen Lenden verweilte.
»Nein, keineswegs. Ich hinke nur ein bißchen.« Er tätschelte seinen Spazierstock.
»Betty, geh und frag Miss Flora Belle, ob sie uns beim Abendessen Gesellschaft leisten möchte«, sagte sie lebhaft zu einem Dienstmädchen, das – von Marshall unbemerkt – in einer schattigen Ecke des Zimmers stand, die mit Kleidern und Blumenvasen vollgestopft war.
»Vielleicht möchtet ihr euch die Wartezeit mit einem Glas Champagner versüßen?« Francine deutete auf ein Silbertablett mit einer Magnumflasche in einem Eiskübel, das inmitten von Parfümflaschen und Puderdosen auf ihrem Garderobentisch stand. »Vor mir liegt nur noch das Finale, dann bin ich frei.« Sie warf beiden eine Kußhand zu und schlüpfte zur Tür hinaus, um auf die Bühne zurückzugehen.
Kapitel 3
»Ich dachte, ich hätte Ihnen Hausverbot erteilt.« Daisy Lavender stand hochaufgerichtet, starr wie eine Statue, mit vor der Brust verschränkten Armen da und versperrte den Weg in ihr Hotel.
»Das haben Sie, Daisy, das haben Sie«, sagte Marshall und verneigte sich in übertriebener Höflichkeit vor ihr.
»Hören Sie auf, sich derart aufzuspielen, es beeindruckt mich kein bißchen. Und für Sie bin ich Mrs. Lavender, Mann.« Ihr Cockney-Akzent stand im krassen Gegensatz zu ihrer eleganten, beinahe königlichen Haltung.
»Ich bitte um Verzeihung, Mrs. Lavender.«
»Er ist wirklich sehr zerknirscht, Mrs. Lavender.« Richard bemühte sich, ernst zu klingen.
Daisy beäugte Marshall argwöhnisch.
»Boots«, rief sie dröhnend. »Bring Federn!«
Boots, der Portier, kam zu der kleinen Gruppe geschlurft. Seine Gestalt war vom Alter und von der Gicht so gekrümmt, daß man nur selten sein Gesicht zu sehen bekam. Er hielt Daisy ein kleines Körbchen hin, aus dem sie zwei lange weiße Federn nahm.
»O nein, nicht schon wieder«, seufzte Marshall.
»Ich mag keine Feiglinge. Ripper!« rief sie, und aus einer Ecke der Halle kam ein kleiner Terrier ungewisser Herkunft angewetzt und schnappte knurrend nach den Beinen der Männer, als wäre er zehnmal größer, als er wirklich war. »Pack sie, Ripper,« rief Daisy aufgeregt.
»Mrs. Lavender. Ich bin's, Richard Frobisher. Basils Sohn. Ich wohne hier.« Richard wich den spitzen Zähnen des Hundes aus. »Captain Boscar ist Offizier.«
»Ich mag keine Soldaten in Zivil. Warum tragt ihr keine Uniform? Schämt ihr euch etwa? Warum tragt ihr sie nicht?«
»Weil ich Federn für mein Kissen brauche«, sagte Marshall lakonisch, griff nach den Federn und steckte sie in seine Brusttasche.
»Ha! Ich mag ihn.« Daisy, die Hände in die Hüften gestemmt, warf den Kopf in den Nacken und lachte schallend. »Wie ich sehe, hinken Sie ...«
»Er ist erst heute aus dem Krankenhaus entlassen worden, Daisy.«
»Na, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Das ist natürlich etwas anderes. Aber Sie ...«, und sie deutete mit dem Finger streng auf Marshall. »Führen Sie sich nicht wieder auf wie letztes Mal, sonst fliegen Sie hochkant raus.«
»Ja, Mrs. Lavender«, antwortete Marshall und salutierte mit einem halb spöttischen, halb schuldbewußten Lächeln. Daisy musterte ihn scharf und beschloß, ihn im Auge zu behalten.
Stolz führte Richard seinen Freund nach oben. Es war der Ehrgeiz jedes jungen Mannes, der sich in der Stadt amüsieren wollte, bei Daisy wohnen zu dürfen. Die Adresse steigerte das Ansehen ungemein, und hier wurden nie Fragen nach der weiblichen Begleitung gestellt. Das Essen war exzellent, der Champagner floß in Strömen, und wenn man viel Glück hatte, gab es keine Rechnung zu bezahlen. Aber Daisy war sehr eigen in der Beurteilung ihrer Gäste. Hatte der Vater in den neunziger Jahren, als das Eddington eröffnet wurde, zu ihren Günstlingen gezählt, war einem der Zutritt mehr oder weniger gesichert. Sonst war er beinahe unmöglich.
»Er muß zu einer von drei Kategorien gehören«, sagte sie gern. »Sonst lasse ich ihn nicht rein.«
Die drei Kategorien, die Daisy am meisten bewunderte, waren Aristokraten, Amerikaner und Reiche. Der kleine Lord Fauntleroy hätte Daisys Idealvorstellung entsprochen.
Das Geschäftsgebaren im Eddington war ein Geheimnis. Wenn man Daisys Wohlgefallen besaß, konnte es leicht geschehen, daß die eigenen Ausgaben einem der Reichen auf die Rechnung gesetzt wurden. Aber dort zu wohnen war ein Risiko, denn es konnte durchaus geschehen, daß sie einen selbst plötzlich zu der Kategorie der Reichen zählte und einem die Ausgaben aller anderen aufbürdete.
Vom Augenblick ihres Erwachens bis in die frühen Morgenstunden, wenn Daisy zu Bett ging, trank sie unaufhörlich Champagner. Aber niemand hatte sie je betrunken gesehen, und niemand konnte ihr nachsagen, nicht zu wissen, was in ihrem Etablissement vor sich ging. Nichts entging ihrem Adlerauge.
Zu Daisy konnte ein junger Mann, ohne das Risiko, in Verlegenheit zu geraten, ein Mädchen mitnehmen. Wenn er mit ihm die Treppe hinaufeilte, wußte er, daß es mit Daisys Einverständnis geschah, wovon auch die Magnumflasche Champagner zeugte, die sie regelmäßig aufs Zimmer bringen ließ.
Obwohl in vielen Zimmern unerlaubten Begierden gefrönt wurde, hatte Daisy eine Vorliebe für Bischöfe. Das Eddington zählte zu den von der Kirche von England empfohlenen Hotels. Manch ein ältlicher Bischof und seine Gattin wurden von Daisy beherbergt und verköstigt, ohne zu ahnen, was um sie herum vorging.
Doch seit kurzem machte sich in Daisy eine Veränderung bemerkbar. Der Krieg schien dieser scheinbar unverwüstlichen Frau sehr zu schaffen zu machen. Die Namen ihrer jungen Gäste oder Söhne von alten Freunden erschienen mit deprimierender Regelmäßigkeit auf den Listen der Gefallenen, und das ging Daisy sehr nahe. Sie fühlte sich beraubt. Marshall hätte sich keine Sorgen zu machen brauchen, ob er sich das Eddington leisten konnte oder nicht, denn Daisy hatte beschlossen, keinen Scheck von ihren jungen Männern einzulösen, solange Krieg herrschte. Daher füllte sich eine Schublade ihres Schreibtisches schnell mit nicht eingelösten Schecks. Jenen, die keine Uniform trugen, gab sie eine Feder, hetzte Ripper auf sie und warf sie auf die Straße, ohne sich die Mühe zu machen zu fragen, warum sie keinen Wehrdienst leisteten. Daher blieb für einige Dienstuntaugliche und auch Kriegsversehrte Daisys Tür verschlossen.
»Mit Feiglingen will ich nichts zu tun haben«, pflegte sie zu sagen und mit einer wegwerfenden Handbewegung jene abzuwimmeln, die sie für unwürdig hielt.
Richard, der zu den Glücklichen zählte, wohnte hier, seit er aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Sein Vater, Basil, war als junger Mann einer von Daisys bevorzugten Kunden gewesen, der so hoch in ihrer Gunst gestanden hatte, daß noch heute sein gerahmtes Foto die Wand in ihrem Salon schmückte. Den Gerüchten nach war es mehr als nur Freundschaft gewesen, deswegen bewohnte Richard eine der besten Suiten, mit Blick auf den Garten.
Er öffnete die Tür zu einem großen Wohnzimmer, wo ein Tisch für vier Personen gedeckt war und die Möbel und das Tafelsilber im Licht des Feuers schimmerten. Angrenzend gab es zwei Doppelschlafzimmer mit brennenden Kaminfeuern, diskret verhängten Lampenschirmen und zurückgeschlagenen Bettdecken. Jedes Schlafzimmer verfügte über ein eigenes Bad – eine neuartige Einrichtung, denn Daisy besaß eine Vorliebe für Innovationen.
Richard und Marshall machten viel Wirbel um Francine und Flora. Für Marshall war es ein besonderes Vergnügen, sich wieder in der Nähe von warmen, süß duftenden weiblichen Wesen aufzuhalten. Er war zu lange von Frauen in gestärkten Schwesterntrachten, die nach Karbol rochen, umgeben gewesen.
Flora war hübsch, wenn auch etwas klein geraten, hatte dunkle Augen und lockiges, dunkles Haar. Neben Francine verblaßte sie allerdings zur Bedeutungslosigkeit.
Selbstbewußt in ihrer Schönheit, die ihr besondere Rechte zu verleihen schien, übernahm Francine sofort die Gestaltung des Abends. Sie wählte das Menü und die Getränke aus. Da Marshall die Rechnung nicht bezahlen würde, ließ er sie gewähren, wunderte sich jedoch über Richards Verhalten. Diese Frau brauchte einen starken Mann, sehnte ihn förmlich herbei.
Während des Abendessens versuchte sich Marshall auf Flora zu konzentrieren, fand es aber äußerst schwierig, ihr seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Francine flirtete mit Richard, doch er wußte, dieser Flirt galt ihm. Sie fütterte Richard mit Leckerbissen, trank aus einem Glas mit ihm, und während der ganzen Zeit beobachteten die großen grünen Augen Marshall, sagten ihm, daß sie ihn verwöhnen wollte.
Als Richard den Arm um Francines Taille legte und sie ins Schlafzimmer führte, fühlte Marshall eine Woge des Zorns in sich aufsteigen. Er begehrte sie. Völlig frustriert wandte er sich Flora zu.
»Nun, Kleine, Zeit fürs Bett?« sagte er plump und war sich bewußt, daß das keine Art war, eine Frau zu verführen. Aber es war ihm völlig egal, wie sie reagierte.
»Gedulde dich einen Augenblick, Schatz. Ich will mich für dich schönmachen«, sagte Flora nuschelnd und machte sich leicht schwankend auf den Weg ins zweite Schlafzimmer.
Marshall goß sich noch ein Glas Port ein und starrte es mißmutig an. Zu Beginn des Abends hatte er sich verzweifelt nach einer Frau gesehnt, und jetzt, da hinter dieser Tür eine auf ihn wartete, war es ihm beinahe lästig. Er stand auf, durchquerte das Wohnzimmer, öffnete die Tür und schlüpfte hinein.
In dem trüben Licht sah er Flora schlafend und schnarchend in ihren Kleidern auf dem Bett liegen. Er lachte stillvergnügt in sich hinein, zog die Bettdecke über sie und ging leise hinaus. Er schlich den Korridor entlang, die Treppe hinunter und hatte beinahe die Haustür erreicht ...
»Sie wollen sich wohl davonschleichen, ohne zu bezahlen, wie?« Er fuhr herum und sah Daisy, die trotz der späten Stunde in der Tür zu ihrem Salon stand.
»Nein, keineswegs. Captain Frobisher hat mich eingeladen. Ich bin sein Gast.«
»Ach, ein richtiger Schmarotzer, wie? Ich wette, Sie leben immer auf Kosten anderer.«
»Jedenfalls gebe ich mir darin die größte Mühe«, entgegnete er mit seinem charmanten, leicht schiefen Lächeln. Daisy musterte ihn von Kopf bis Fuß. Einem gutaussehenden Mann hatte sie nie widerstehen können, und vor ihr stand ein Prachtexemplar. Groß und breitschultrig, aber schmal in den Hüften. Dichtes, glattes, dunkles Haar. Große blaue Augen und ein voller Mund – in ihrer Jugend hatte sie diese Sorte Männer geliebt.
»Haben Sie Lust auf ein Glas Schampus?« Mit einer Handbewegung deutete sie in ihren Salon, der gleichzeitig als Büro diente. Marshall war sich bewußt, daß nur auserwählten Gästen die Ehre zuteil wurde, von Daisy in ihren Privatsalon gebeten zu werden.
»Einen Brandy hätte ich gern.«
»Es gibt Schampus oder nichts, wenn Sie mit mir trinken.«
»Schampus wäre großartig«, fügte er hastig hinzu, als er ihr in ihr Heiligtum folgte. Der Raum war so mit Möbeln vollgestopft, daß ein Mann von Marshalls Größe Schwierigkeiten hatte, sich darin zu bewegen, ohne etwas umzustoßen. Der ausladende Schreibtisch war mit Papieren überhäuft, die Wände waren mit Fotos und Porträts von Daisys Freunden bedeckt, die alle auch ihre Gäste gewesen waren oder noch dazu zählten.
»Setzen Sie sich«, sagte Daisy, entkorkte geschickt die Flasche und goß Champagner in Sektgläser. Sie reichte ihm eins. »Trinken wir auf das neue Jahr, auf 1917. Mögen es Ihnen alles bescheren, was Sie sich wünschen.«
»Auf 1917«, wiederholte er, betrachtete die sprudelnde Flüssigkeit in seinem Glas und überlegte, welche Wünsche er hatte. Zu dieser Stunde im letzten Jahr hätte er gesagt: Geld und Frauen. Und dieses Jahr? Frauen wollte er noch immer haben – daran änderte sich nie etwas. Auch Geld hatte er dringend nötig. Aber jetzt ... nach dem Erlebnis im Bombentrichter ... nach den verzweifelten Schreien des sterbenden Soldaten ... Er schüttelte den Kopf. »Auf meinen Sohn«, sagte er plötzlich zu seiner eigenen Überraschung und prostete Daisy mit dem Glas zu.
»Wie alt ist er?«
»Er ist noch nicht geboren«, antwortete er und lachte über seine verrückte Idee. »Er ist noch nicht einmal gezeugt worden. Ich bin nicht verheiratet.«
»Haben Sie eine Frau in Aussicht?«
»Nein, habe ich nicht.«
»Dann war das ein sehr komischer Toast.«
»Ja, da haben Sie recht.«
»Das liegt am Krieg. Er macht einem bewußt, wie kurz das Leben ist, weckt in einem die Sehnsucht nach Fortbestand.« Daisy füllte die Gläser wieder. »Netter Kerl, dieser Richard. Ich kenne seinen Dad seit Jahren. Es ist schön, wenn die Söhne die Nachfolge ihrer Väter antreten.«
»Fortbestand?« fragte er lächelnd.
»Wahrscheinlich«, antwortete sie und sah ihn lange und eindringlich an. »Was hat er mit dieser Francine zu schaffen? Sie paßt nicht zu ihm. Sie ist gefährlich.«
»Was meinen Sie mit gefährlich?«
»Die nimmt sich, was sie haben will, und macht jeden fertig, der sich ihr in den Weg stellt. Ich hab's erlebt, habe gesehen, wie sie die Jungs zerstört hat ...«
»Ach, ich glaube nicht, daß Richard eine derart enge Beziehung zu ihr hat.«
»Nein? Da bin ich anderer Meinung. Er ist ihr völlig verfallen. Da Sie sein Freund sind, sollten Sie versuchen, ihn aus den Krallen von Francine Blewett zu befreien.« Sie spuckte den Namen fast aus.
»Blewett. Ist das ihr richtiger Name?«
»Oh, ja. Doch sie nennt sich du Bois, macht auf französisch. Ich kannte ihre Mutter. Na, das war eine Frau. Grundehrlich und anständig. Da gab's keine undurchsichtigen Geschichten. Mit Ia wußte man immer, woran man war. Ihr gehörte das beste Bordell in London. Ihr Tod war eine Tragödie. Sie wurde von einem dieser neumodischen Automobile überfahren ... war noch keine dreißig. Mein Gott, wie lange ist das jetzt her? Vier, fünf Jahre?« Marshall lauschte schweigend Daisys Erinnerungen. Er war neugierig. »Niemand hat ihren Platz einnehmen können. Blossom's war danach nie mehr dasselbe.«
»Ich kenne Blossom's.« Er richtete sich interessiert auf.
»Sie hätten es in den alten Zeiten erleben müssen, mein Junge. Nie gab es schönere Frauen ... und diese Kleider! Dazu das beste Essen und den besten Schampus. Das war ein Palast, sag ich Ihnen. Und Ia hatte Stil. Als die alte Königin starb, steckte sie ihre Nutten in Trauerkleidung ... schwarz, bis auf die Haut! Was für ein Anblick. Es hat ihre Einnahmen verdoppelt, das kann ich Ihnen sagen. Nach ihrem Tod wurde alles verkauft. Von dem Erlös wurde jungen Mädchen geholfen. Ha! Was für eine verrückte Idee, die meisten wollen sich doch gar nicht helfen lassen. Ihre Mädchen haben das Bordell gekauft. Ia hat sie ihn ihrem Testament bedacht, aber es hat nicht funktioniert. Nun, das war vorherzusehen. Sie sind sich gegenseitig an die Kehle gegangen und waren schließlich völlig zerstritten. Ein tragisches Ende. Es gehört jetzt irgendeiner Ausländerin, was die sich allerdings einbildet, über englische Aristokraten und deren Vorlieben zu wissen, kann ich mir nicht vorstellen.« Daisy drückte ihre Mißbilligung über alles Nichtbritische mit einem verächtlichen Schnauben aus.
»Und Ia ist Francines Mutter?«
»Ja. Sie sollte stolz darauf sein, anstatt eine Frau wie Ia zu verleugnen. Das Mädchen ist mit ihrer Mutter nicht zu vergleichen.«
»Woher wissen Sie das alles?«
»Ach, ich kannte Ia gut, auch ihre Freundin, Gwen, die für sie arbeitete. Die ist jetzt bei mir. Ia hat natürlich gut für sie gesorgt«, sagte Daisy rechtfertigend. »Gwen hat eben ihr Leben lang gern gearbeitet Von ihr habe ich vieles erfahren. Francine ist oft hier ... hoffentlich glaubt Ihr Freund nicht, er sei der einzige?«
»Seltsamerweise wollte ich gerade dorthin gehen.«
»Zu Blossom's? Hatten Sie oben kein Glück?«
»Nein. Die Dame hat zuviel getrunken. An Leichenschändung habe ich kein Interesse.«
Daisy lachte schallend über diesen Witz.
»Vielleicht sind Sie daran interessiert, mich nach Hause zu bringen, Captain?«
Er drehte sich um und sah Francine in der Tür stehen. Von Kopf bis Fuß in einen weißen Pelz gehüllt, ähnelte sie einer Eisfee aus einem nordischen Märchen.
»Aber natürlich, Miss du Bois.«
»Ich bin sehr müde.«
Marshall eilte an ihre Seite. »Danke für den Champagner, Mrs. Lavender.«
»Sie dürfen mich Daisy nennen«, sagte sie grinsend. »Vielleicht ist das die Lösung«, murmelte sie dann geheimnisvoll, als Marshall Francine in die eisige Nacht hinausführte.
Kapitel 4
Marshall lehnte sich völlig entspannt in die Kissen zurück und schaute zur Decke. Er atmete tief und zufrieden, er liebte den Geruch eines Zimmers nach dem Liebesakt. Den moschusartigen Geruch von Sperma und Schweiß, vermischt mit dem Duft von Puder und Parfüm. Ein wundervoller Geruch, an den er sich oft im Elend und Gestank der Schützengräben während der Gefechtspausen zu erinnern versucht hatte. Er mochte die Zimmer von Frauen, die sanften Pastellfarben, die Kinkerlitzchen, das weibliche Durcheinander.
»Worüber denkst du nach?« wisperte Francine. Geistesabwesend streichelte er ihr Haar. Ohne Ausnahme stellten Frauen immer dieselbe Frage. Warum nahmen sie an, er würde überhaupt denken? Warum erlaubten sie ihm nicht – so wie jetzt –, nur dazuliegen und die Decke zu betrachten? Wenn man ihnen die Wahrheit sagte, daß man an überhaupt nichts dachte, waren sie unweigerlich gekränkt.
»Ich habe über Richard nachgedacht«, sagte er, um sie zu ärgern.
»Was ist mit ihm?« Francine setzte sich auf und bedeckte ihre Blöße anmutig mit einer Ecke des Satinbettuchs.
»Warum hast du Satinbettücher? Ich hasse sie, weil sie dauernd wegrutschen«, entgegnete er, anstatt ihre Frage zu beantworten.
»Ich tausche sie für dich aus. Ich kaufe Leintücher«, sagte sie hastig.
»Meinetwegen brauchst du dir diese Mühe nicht zu machen. Ich komme nicht mehr hierher.« Er schwang die Beine über die Bettkante.
»Marshall, warum nicht? Was habe ich getan?«
Sie ließ das Bettuch fallen und rutschte übers Bett zu ihm, legte die Arme um ihn und preßte ihre Brüste gegen seinen Rücken. Genau wie er es vorausgeahnt hatte. Er lächelte in sich hinein, als er das wundervolle Gefühl ihrer nackten Haut an seinem Körper spürte. Das weiche, nachgebende Gefühl ...
»Richard ist mein Freund.« Er drehte sich abrupt zu ihr um.
»Er ist auch mein Freund.«
»Dann haben wir uns teuflisch benommen.«
»Ich weiß, ich weiß. Ach, mein Liebling, verstehst du meine Verzweiflung nicht?« fragte Francine dramatisch. Marshall lächelte über ihr theatralisches Getue. »Aber ich kann nichts dafür. Vom ersten Augenblick an habe ich dich begehrt. Mein Liebling, verzeih mir ...« Sie glitt vom Bett und kniete sich vor ihn. Er legte sich zurück, blickte zur Decke und ließ sich von ihr lieben.
»Wer ist Rosemary?« fragte Francine später und blickte ihn von der Seite an, als sie den Tee eingoß.
Marshall schaute abrupt von dem Teller mit Schinken und Ei auf, den Francines Dienstmädchen vor ihn hingestellt hatte. »Das geht dich nichts an«, fuhr er sie an und fühlte, wie sich sein Magen bei der Erwähnung des Namens verkrampfte. »Ich mag es nicht, wenn in meinem Bett der Name einer anderen Frau fällt. Auch nicht im Schlaf«, sagte sie schmollend. Er schwieg. »Wer ist sie?« Er zwang sich zu essen. »Ich habe dich gefragt, wer sie ist. Ich mag so etwas nicht. Ich dulde es nicht«
Marshalls Gabel und Messer fielen klappernd auf den Teller. »Halt sofort den Mund, Francine, sonst gehe ich ...«
Francine griff nach ihrem Besteck und schaute ihn mit ihren großen Augen voller Tränen an – es war ein nützlicher Trick, den sie vor Jahren gelernt hatte, bei Bedarf zu weinen. Er funktionierte immer. Aber zu ihrer Bestürzung versagte der Trick dieses Mal, denn Marshall schob seinen Stuhl zurück, stand auf und verkündete, er müsse gehen.
»Ich erzähl's ihm, wenn du willst«, sagte sie, wünschte sich verzweifelt, er möge bei ihr bleiben.
»Wem willst du was erzählen?«
»Ich erzähle Richard von uns. Ich sage ihm, es war meine Schuld.«
»Das wirst du nicht tun.« Marshall sah sie wütend an, musterte kurz ihr Gesicht, und da er überzeugt war, daß sie nur ein Spiel mit ihm trieb, griff er nach seinem Mantel und zog ihn an. »Was willst du ihm sagen? Da gibt es nichts zu erzählen«, brauste er auf.
»Marshall«, die großen grünen Augen sahen ihn ängstlich an, »das war die wundervollste Nacht meines Lebens.«
»Es freut mich, daß Ihr sie genossen habt, Madame, aber ich wünsche nicht, daß mein Freund etwas von unserem übermütigen Treiben erfährt. Hast du mich verstanden?«
»Aber Marshall! Ich kann nicht bei ihm bleiben, wenn ich so für dich fühle. Nie habe ich einem Mann derartige Gefühle entgegengebracht. Ich möchte jede Minute mit dir verbringen. Mein ganzes Leben!« Sie stand in einer theatralischen Pose da, warf ihr langes Haar in den Nacken und drehte ihr Gesicht so, daß er ihr stolzes und schönes Profil sehen konnte.
Marshall lachte. »Das würde ich dir nicht empfehlen, meine Süße. Mit Richard bist du besser dran. Er kann sich eine Frau wie dich leisten, ich nicht. Ich besitze ganze hundert Pfund, und wenn die ausgegeben sind ...« er zuckte die Schultern, »weiß ich nicht, wie es weitergehen soll.«
Er bemerkte amüsiert, daß Francine eine Sekunde lang zur Statue erstarrte, zögerte.
»Ich verdiene genug Geld. Es reicht für uns beide«, antwortete sie zu seinem Erstaunen.
»Sei nicht töricht, meine Süße. Dafür liebst du das gute Leben zu sehr.«
»Nein«, antwortete sie und schüttelte mit angespanntem Gesicht den Kopf. »Für dich würde ich es aufgeben. Es ist mir ernst damit.« Francine sagte die Wahrheit. Sie hatte mit vielen Männern geschlafen, aber niemand hatte ihr die Befriedigung gegeben wie er, noch ihr das Gefühl absoluter Weiblichkeit vermittelt – sie war nicht bereit, ihn gehen zu lassen.
Er legte ihr die Hände auf die Schultern. »Hör mir zu, Francine. Du redest Unsinn. Wir kennen einander nicht, haben nur eine Nacht zusammen verbracht. Es wird nie wieder eine solche Nacht geben ...« Bei diesen Worten stieß sie einen kleinen qualvollen Schrei aus. »Ich wünsche nicht, daß Richard davon erfährt ... er liebt dich, weißt du. Ich verspreche dir, wenn du es ihm sagst, wirst du mich nie wiedersehen.«
Sie betrachtete ihn schweigend, abschätzend und lachte dann, ein kehliges Lachen. »Das glaube ich dir nicht, Marshall, mein Liebling. Jetzt könntest du mich nicht mehr meiden, auch wenn du es versuchen würdest. Du würdest sogar zu mir zurückkommen, wenn ich es Richard erzählen würde. Dessen bin ich mir sicher.« Sie sah ihn dreist an, befand sich jetzt auf sicherem Boden. Ihre Zungenspitze glitt langsam über ihre Lippen. Während er sie beobachtete, wußte er, daß sie die Wahrheit sprach. Er wollte beide, sie im Bett und Richard als Freund.
»Wenn du ihm etwas verrätst, werde ich ihm sagen, wer du wirklich bist ... ich werde ihm alles über deine Mutter und das Bordell erzählen, das sie so erfolgreich betrieben hat«
Ihre grünen Augen funkelten wütend. »Wovon sprichst du? Meine Mutter ... welches Bordell? Es gibt nichts in meiner Vergangenheit, dessen ich mich schämen müßte.«
»Was ist mit Blossom's?«
»Das sind üble Gerüchte«, entgegnete sie fast schreiend. »Die verfolgen mich schon seit Jahren. Ich weiß nicht, wer sie in die Welt gesetzt hat, aber die Leute verbreiten sie aus Neid. Mein Vater ist ein Aristokrat ... du brauchst mich nur anzusehen, um das zu erkennen. Meine Mutter ist im Kindbett gestorben.«
»Wer ist denn dein Vater?«
»Ich habe geschworen, darüber Stillschweigen zu bewahren. Als ich zum Theater ging, war mein Vater außer sich vor Zorn. Ich habe ihm versprochen, nie meinen wirklichen Namen zu enthüllen«, log sie mit geübter Dreistigkeit.
»Welchen Namen? Blewett?«
»Ich heiße nicht Blewett!« Sie stampfte mit dem nackten Fuß auf. »Mein Vater ist Franzose, ein Herzog, deswegen benutze ich einen französischen Künstlernamen.« Wieder schleuderte sie ihre lange, blonde Mähne stolz in den Nacken. »Dahinter steckt diese alte Vettel, Daisy Lavender, stimmt's? Sie hat mich nie gemocht. Weißt du warum? Weil ich jung und schön bin und sie alt und jenseits von Gut und Böse ist ... Sie ist eifersüchtig.«
Marshall lachte, er mochte ihren Stolz, er bewunderte ihre beherzten Lügen ... »Komm her ...« befahl er, und auf dem Tisch, zwischen Marmelade und Toast, nahm er sie wieder.
Marshall hatte in seinem Zimmer im Club gerade ein Bad genommen, als Richard eintraf.
»Oh, mein Kopf«, jammerte er und ließ sich in einen Sessel fallen, während sich Marshall anzog. »Wieviel haben wir denn getrunken?«
»Zuviel.« Marshall lachte über das leidvolle Gesicht seines Freundes.
»Du siehst gut aus.«
»Eine anstrengende Nacht kann sehr anregend sein.«
»Mit Flora?«
»Nein, sie ist umgekippt. Ich habe Francine nach Hause gebracht und bin dann zu Blossom's gegangen«, log er schamlos.
»Ich war so beschämt, als ich aufwachte und sah, daß Francine gegangen war, während ich wie ein Schwein schnarchte. Danke, daß du dich um sie gekümmert hast.«
»Es macht dir nichts aus, daß ich sie nach Hause gebracht habe?«
»Lieber Himmel, nein! Wenn ich dir nicht vertrauen kann, wem dann?«
»Das ist wahr.« Marshall wandte den Blick ab und rückte seine Krawatte zurecht.
»Marshall, ich bin gekommen, um dich um einen Gefallen zu bitten. Meine Eltern bestehen darauf, daß ich für ein verlängertes Wochenende nach Hause komme. Würdest du mich begleiten? Mir helfen, die Langeweile zu vertreiben?«
»Es wäre mir ein Vergnügen.«
Kapitel 5
»Wer wird noch bei euch sein?« fragte Marshall, als sie in Richards Auto durch den trüben Januartag fuhren.
»Ich weiß es nicht genau. Mein Bruder Charles verbringt seinen Urlaub zu Hause ... deswegen werde ich herbeizitiert. Du weißt, wie Mütter sind ... sie wollen die ganze Familie um sich versammelt haben.«
»Hätte ich dann überhaupt mitkommen sollen?« fragte Marshall verunsichert, denn er wußte nichts über Mütter und Familien. Er war ein Einzelkind, und seine Mutter war jedenfalls nicht wie andere Mütter, sondern hatte sich immer über Konventionen hinweggesetzt.
»Mein Gott, ja. Es werden noch andere Gäste anwesend sein. Mutter hat gern ein volles Haus. Sie möchte mir die Tochter einer Freundin, eine Amerikanerin, vorstellen. Sie muß sehr reich sein, wenn Mutter derart viel Wert darauf legt, daß ich sie kennenlerne. Natürlich werden meine Eltern wegen des Krieges nicht den gewohnten Aufwand betreiben.«
»Ist sie schön?«
»Meine Mutter?« Richard war so erstaunt über diese Frage, daß der Wagen leicht ins Schleudern geriet.
»Nein, nein. Achte auf die Straße!« Marshall lachte. »Die Amerikanerin.«
»Ich bezweifle es, beides trifft selten zusammen, nicht wahr? Geld und Schönheit«
»Davon verstehe ich nichts. Meine Frauen waren alle hinreißend und arm.«
Sie fuhren jetzt an Schloß Windsor vorbei.
»Ich wette, das Leben war amüsanter, als der alte König noch lebte«, sagte Marshall, als sie die Hauptstraße entlangratterten.





























