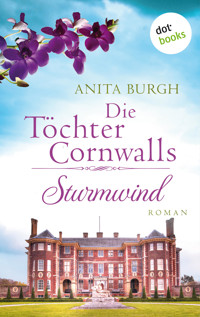Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manchmal können wir nur unserem Herzen vertrauen: Der bewegende Feelgood-Roman »Wo unsere Herzen wohnen« von Anita Burgh jetzt als eBook bei dotbooks. Heimlich träumt Kate davon, Schriftstellerin zu werden – aber davon will niemand etwas wissen, vor allem nicht ihr stets nörgelnder Ehemann. Doch dann lernt Kate auf einer Party die Literaturagentin Joy und die Lektorin Gloria kennen: der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, zumal die beiden Feuer und Flamme sind für Kates heimlich geschriebenen Roman! Endgültig auf Wolke Sieben könnte Kate tanzen, als auch noch der sympathische Journalist Stewart mit ihr zu flirten beginnt … wenn da nur nicht ihr langweiliger Noch-Ehemann wäre und die Angst, sich voll und ganz auf das Abenteuer, das man Leben nennt, einzulassen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der verzaubernde Liebesroman »Wo unsere Herzen wohnen« von Anita Burgh. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 775
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Heimlich träumt Kate davon, Schriftstellerin zu werden – aber davon will niemand etwas wissen, vor allem nicht ihr stets nörgelnder Ehemann. Doch dann lernt Kate auf einer Party die Literaturagentin Joy und die Lektorin Gloria kennen: der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, zumal die beiden Feuer und Flamme sind für Kates heimlich geschriebenen Roman! Endgültig auf Wolke Sieben könnte Kate tanzen, als auch noch der sympathische Journalist Stewart mit ihr zu flirten beginnt … wenn da nur nicht ihr langweiliger Noch-Ehemann wäre und die Angst, sich voll und ganz auf das Abenteuer, das man Leben nennt, einzulassen …
Über die Autorin:
Anita Burgh wurde 1937 in Gillingham, UK geboren und verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in Cornwall. Ihre 24 Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und feierten international Erfolge. Mittlerweile lebt Anita Burgh mit ihrem Mann und zwei Hunden in einem kleinen Dorf in den Cotswolds, Gloucestershire.
Bei dotbooks veröffentlichte Anita Burgh ihrer Romane »Das Erbe von Respryn Hall«, »St. Edith’s: Hospital der Herzen«, »Glückssucherinnen«, »Der Weg zum Herzen einer Frau«, »Wo deine Küsse mich finden«, »Das Lied von Glück und Sommer«
Außerdem veröffentlichte Anita Burgh bei dotbooks ihre Familiensaga »Die Töchter Cornwalls« mit den drei Einzelbänden: »Morgenröte«, »Sturmwind« und »Dämmerstunde«
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2020
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Originaltitel »Advances« bei Macmillan, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1994 unter dem Titel »Vorschußlorbeeren« bei Knaur.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1992 by Anita Burgh
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1994 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Pajor Pawel, Shutova Elena
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-263-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Wo unsere Herzen wohnen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anita Burgh
Wo unsere Herzen wohnen
Roman
Aus dem Englischen von Traudl Weiser
dotbooks.
Für Suzanne Baboneau,mit Liebe und Dankfür ihre wundervollen Ideen.
Danksagungen
Ich möchte meinen Freunden aus der Welt der Schriftsteller und Verleger für ihre Hilfe bei diesem Buch danken, selbst wenn es ihnen manchmal nicht bewußt war.
Insbesondere: Alison Samuel und Gail Lynch von Chatto and Windus; Billy Adair, Suzanne Baboneau, Tom Burns, Philippa McEwan, Martin Neild, Jane Wood und Vivienne Wordley von Pan Macmillan; Mic Cheetham von Sheil Land Associates; Marina Oliver und den vielen anderen, die zu zahlreich sind, um sie zu erwähnen. Und besonders Billy Jackson für seine beständige Unterstützung und der geduldigen Carol Slater, die alles getippt hat.
Teil I
Kapitel 1
Der weiße Nebel klebte feucht am Fenster. Julius Westall schob den schweren Brokatvorhang vor dem Fenster zur Seite und spähte hinaus, er erinnerte sich an andere Nebel, andere Tage. Nebel, die ohne warnendes Vorzeichen über den Platz gewogt waren und Menschen und Gebäude mit ihren mächtigen, wirbelnden, gelben Wolken verhüllt hatten. Nebel, schweflig in ihrer Dichte. Nebel, in denen alles passieren, unermeßliche Abenteuer beginnen konnten ...
Er wandte sich abrupt vom Fenster ab. Aus ihm wurde ein alter Mann, der in Tagträumen den Bezug zur Wirklichkeit verlor. Dieser Weg führte in die Senilität, und das Leben war schon kompliziert genug, ohne dem fortschreitenden Alter nachzugeben.
Auf seinem Schreibtisch lag der Geschäftsbericht des letzten Jahres. Er – eine hochgewachsene, aristokratische Gestalt – stand da und blickte auf den glänzenden, schwarzen Aktendeckel hinunter. Sein dichtes Haar, früher blond, war jetzt silbergrau, der einst scharfe Blick seiner blauen Augen war verblaßt und die Iris von einer Aureole des Alters umgeben. Doch seine Haltung war straff, die eines Mannes, der gut in Form war, obwohl er wußte, daß er es nicht war. Eine allgemeine Müdigkeit war sein Problem, dahinter steckte nichts Ominöses, davon war er überzeugt. Müde des Kampfes gegen die Übermacht, müde der Hoffnung, die Bilanzen auszugleichen – was nie geschehen würde –, müde, Geld zu verlieren, müde der Verantwortung für Familienbeziehungen, die er nicht verbessern konnte, müde in jeder verdammten Hinsicht. Er mußte sich an den Gedanken seiner normalen Erschöpfung klammern, um die Angst vor mangelnder geistiger Spannkraft zu verdrängen.
Aus einem Schränkchen neben seinem Schreibtisch – einem schönen Möbel mit marmorierter Platte und Beinen in Form von Goldadlern mit ausgebreiteten Schwingen nahm er ein Glas und eine Flasche Glenfiddich und goß sorgfältig eine reichliche Portion ein.
»Verzichte als erstes auf Whisky und Zigarren, Julius«, hatte Sir Archibald McKinna, sein in der Gesellschaft angesehener und eleganter Arzt aus der Harley Street heute morgen gesagt. Doch Sir Archibald war während seiner Schulzeit »Baldie« genannt worden, und es fiel Julius, der sich noch gut an den rotznäsigen Schüler Archibald erinnerte, schwer, dessen Worte ernst zu nehmen. Oder benutzte er diese Erinnerungen als Ausrede? Hatte er gewußt, selbst als ihm sein alter Freund eine Standpauke hielt, daß er die Ratschläge nicht beachten würde – sich nicht mit den Konsequenzen abfinden konnte?
Wollte er den Rest seines Lebens ohne Alkohol, Zigarren und kräftige Speisen, die er so liebte, verbringen? Wozu? Für ein zusätzliches Jahr, vielleicht zwei? Zusätzliche Zeit, um sich Sorgen wegen des Geschäfts zu machen, mit seinen Kindern zu streiten und von seiner Frau ignoriert zu werden.
Natürlich würde er kürzertreten. Er könnte es sogar lernen, Gefallen daran zu finden. Schließlich hatte er seine Rosen, für deren Pflege er gern mehr Zeit aufbringen würde. Merkwürdig, wie er so spät im Leben zur Gartenarbeit gekommen war. Er hatte nie zuvor irgendeine Neigung dazu verspürt und konnte seine Freunde nicht verstehen, deren Leidenschaft es war. Gärten waren Orte gewesen, um die sich andere kümmerten und in denen er gelegentlich saß. Und dann, ziemlich plötzlich, kurz nach seinem sechzigsten Geburtstag, war ihm die Idee gekommen, einen Rosengarten anzulegen, und während der vergangenen fünf Jahre hatte er seine Liebe, Freizeit und Geld dafür verschwendet. Er erkannte jetzt, daß Rosen in den Vordergrund gerückt waren, nachdem Gemma, die letzte einer langen Reihe von Geliebten, ihn wegen eines jüngeren und reicheren Mannes verlassen hatte. In der Vergangenheit hätte er sich aufgemacht und schnell einen Ersatz gefunden; er stellte jedoch fest, daß es ihm nach Gemma nicht mehr der Mühe wert war – daher die Rosen.
Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, daß er nach fünfundsechzig Lebensjahren, Jahren voller amouröser Abenteuer, über seine Liebe für die Blumen nachdachte. Aber andererseits, was oder wen sollte er sonst lieben?
Bestimmt nicht seine Familie. Jane, seine Frau, hatte ihm nach sechs Jahren Ehe und zwei Kindern kalt verkündet, daß es keinen Sex mehr geben würde, als hätte sie durch die Geburt der Kinder ihre Pflicht getan und könnte sich nun auf ihren Lorbeeren ausruhen. Jane hatte natürlich nicht unverblümt von Sex gesprochen. Sie war viel zu vornehm, um die Existenz dieses Wortes, geschweige denn dessen Ausübung, anzuerkennen. Nein, sie hatte ihn eines Abends mit der Tatsache konfrontiert, daß seine Sachen aus ihrem Zimmer entfernt worden waren und daß er jetzt ein eigenes Zimmer habe. Die eigentliche Bedeutung dieser Maßnahme bedurfte keiner Diskussion zwischen ihnen. Er verstand. Und er war nicht überrascht. Was er als rücksichtsvoller Liebhaber auch versucht hatte, nie war es ihm gelungen, Leidenschaft in seiner sonst so perfekten Frau zu wecken. Er hatte Mitleid mit ihr gehabt – damals. Wie trostlos, nie Erfüllung und Entspannung in einer schönen physischen Beziehung zu erfahren. Um ehrlich zu sein, hatte ihn ihre Entscheidung erleichtert, als wäre er für ihre Frigidität nicht länger verantwortlich. Julius hatte das Gefühl des Versagens nicht gemocht, das ihre mangelnde Reaktion in ihm geweckt hatte – es gab ihm das Gefühl, sie im Stich zu lassen –, andererseits jedoch hatte er zu seiner Verteidigung bezweifelt, daß es einen Mann gäbe, der in Jane Gefühle erwecken konnte.
In der Nacht nach seiner Vertreibung aus ihrem Schlafzimmer war er ihr zum erstenmal untreu geworden. Er hielt es für sein gutes Recht; sie nicht. Und als Geliebte auf Geliebte folgte, hatte er beobachtet, wie Janes hübsches Gesicht dünnlippig, verbittert und zänkisch wurde. Sie hatte ihn einmal geliebt, aber Julius hatte beobachtet, wie sich diese Liebe in eiskalten, höflichen Haß wandelte. Jane blieb die letzte Rache – sie verweigerte ihm die Scheidung.
Scheidung. In der heutigen Zeit wäre eine Scheidung keine Affäre mehr gewesen und hätte seinem Ansehen überhaupt nicht geschadet. Doch Julius war mit den alten Werten aufgewachsen, eine Scheidung stand für sie außer Frage. Der äußere Schein hatte gewahrt werden müssen, und jetzt war es zu spät, sich darüber Gedanken zu machen. Er hatte die Grundregeln ihrer beider Beziehung akzeptiert – die Fassade, daß alles in Ordnung war, aufrechtzuerhalten –, wenn er jedoch an die verlorenen und leeren Jahre dachte, fragte er sich, warum und für wen er es getan hatte.
Zwangsläufig waren seine Liaisons bekannt geworden und hatten ihm den Ruf eines Lebemannes eingetragen. Unfair, da er sich doch immer nur eine glückliche, liebevolle Ehe gewünscht hatte. Jane jedoch, die nicht sehr beliebt war – ihres schwierigen Charakters wegen fiel es niemandem leicht, sie zu mögen –, begegnete man als betrogener Ehefrau mit Sympathie. Julius hatte die wahren Umstände keiner Menschenseele erzählt, nicht einmal seinem Heer von Geliebten. Das war nicht seine Art.
Und seine beiden Kinder? Er kannte sie nicht einmal, er wollte sie jetzt auch nicht mehr kennenlernen. John, sein Sohn und Erbe, hatte den Beruf des Verlegers verschmäht und war ins Bankgeschäft eingestiegen. Jetzt war er fast vierzig, ein aufgeblasener Wichtigtuer, der genug verdiente, um vor der Welt zu prahlen, wie erfolgreich er war. Caroline war eine bigotte Frau und lebte mit ihrem Mann, einem unbedeutenden »Landadeligen«, der sich als Herr der Gemeinde aufzuspielen versuchte, auf dessen Grundbesitz. Julius hatte einmal zufällig ein Gespräch mit angehört, in dem jemand behauptete, es sei möglich, seine Kinder nicht zu mögen, aber nichts könne einen daran hindern, sie zu lieben. Nun, diese Hypothese kann ich Lügen strafen, dachte er, goß sich noch einen Whisky ein und prostete stumm Sir Archibald zu.
Ihm lagen nur dieser Raum, der Verlag und seine Rosen am Herzen. Er lehnte sich in dem hochlehnigen Ohrensessel zurück und betrachtete zufrieden sein Büro, wie so oft in den dreißig Jahren, seit er es von seinem Vater geerbt hatte. Er hatte immer lange Arbeitstage gehabt – war ausnahmslos morgens als erster gekommen und abends als letzter gegangen – und hatte von Anfang an beschlossen, diesen Raum, in dem er mehr Zeit verbringen würde als zu Hause, so schön und behaglich wie möglich einzurichten. Daher dieser kostbare Schreibtisch, die beiden riesigen George-III.-Vitrinen-Schränke, in dem jedes Buch, das er je verlegt hatte – in bestes Marokko-Leder gebunden – stand, das Chippendale-Büchertreppchen, der herrliche Amritsar-Teppich und die Bilder. Ah, diese Bilder, sein Stolz und seine Freude. Sutherland, Hitchens, Bacon, Spencer, jedes mit Liebe gekauft und jetzt ein kleines Vermögen wert.
Der Verlag Westall and Trim war von seinem Ur-Ur-Großvater im Jahr 1859 gegründet worden. Jede folgende Generation hatte mit Stolz ihr »Haus« weitergeführt. Trims Nachkommen hatten schon vor langer Zeit ihre Teilhaberschaft an Julius' Vorfahren verkauft. Als er den Verlag übernommen hatte, war der Name nur noch ein Teil des Firmenemblems. Westall war ein Name, auf den man in der Welt der Literatur stolz sein konnte, ein Name, den jeder gern weiterführen würde – jeder, außer seinem Sohn, der mit seinem unbarmherzigen Buchhalterblick die Bilanzen geprüft hatte und in das für ihn sicherere Bankwesen eingestiegen war.
In dieser Hinsicht mußte Julius zugeben, daß John recht hatte: Gegen diese Entscheidung gab es keine Einwände. Für Westall zu arbeiten, hätte es ihm nicht ermöglicht, das schöne Haus in der Ebury Street, die kleine Farm in Sussex und den Schlupfwinkel in der Dordogne zu kaufen. Aber das Bankgeschäft konnte John nie die Aufregungen bieten, die Julius während seines gesamten Arbeitslebens als Verleger empfunden hatte. Er war überzeugt, daß nichts in der Welt damit zu vergleichen sei, einen neuen Autor zu entdecken und das Wagnis einzugehen, auf diesen Unbekannten zu setzen. Nichts kam der Befriedigung gleich, ihn oder sie zu hegen, zu unterstützen, zu überzeugen, zu umschmeicheln, Mitgefühl und Verständnis für die Wutanfälle und Selbstzweifel zu haben und mit der Geduld Hiobs auf dieses Endprodukt – Das Buch – hinzuarbeiten. Ein Buch, das spurlos untergehen, aber auch ein Buch, das gepriesen, ausgezeichnet und verkauft werden konnte. Die Autoren hielten sich selbst für wichtig, doch für Julius waren sie nur Mittel für einen einzigen Zweck – die Produktion dieses kostbaren Buchs. Wo im Bankgeschäft hatte er das Vergnügen, für eine seiner Ideen den richtigen Autor zu finden – was beinahe so befriedigend war, wie selbst Schriftsteller zu sein. Das verlor nie an Reiz. Jedesmal, wenn ein neues Buch vom Drucker eintraf, in den Schutzumschlag gehüllt, für dessen Entwurf die Designer gestritten und geschuftet hatten, empfand Julius immer dasselbe Gefühl der Aufregung und des Stolzes.
Er war viele Wagnisse eingegangen und hatte Bücher verlegt, die letztendlich nur von ihm und vom Autor geliebt worden waren. Andere, von denen er gewußt hatte, daß sie nie die Unkosten einbringen würden, hatte er trotzdem publiziert, weil er Verleger war und glaubte, daß sie veröffentlicht werden sollten. Julius ging es um Bücher, nicht um Profit, und dort lag seit den neunziger Jahren das Problem. Alle seine Vorfahren hatten über andere finanzielle Mittel verfügt – Wertpapiere und Vermögen, mit denen sie ihr Leben gegen die Höhen und Tiefen, die es immer im Verlagswesen gibt, auspolstern hatten können –, doch Julius besaß nichts dergleichen. Was die Erbschaftssteuer nicht verschlungen hatte, war nach und nach in den Verlag geflossen, damit sich dieses unersättliche Monster – sein »Haus« – über Wasser halten konnte.
In früheren Zeiten war ein Autor einem Verlag treu geblieben, bis er aufhörte zu schreiben oder starb – und beides fiel nach Julius' Erfahrung gewöhnlich zusammen. Aber das hatte sich alles verändert. Er besaß noch immer diese wertvolle Gabe, die ihn zu einem guten und hochangesehenen Verleger machte, die Fähigkeit, Talente zu entdecken, die oft von anderen übersehen wurden. Er erledigte stets seinen Teil der Arbeit bis zur Vollendung, doch unweigerlich schlugen die Konzernhaie, die heutzutage in den trüben Gewässern lauerten, zu und boten enorme Vorschüsse, die sein Verlag nicht aufbringen konnte. Autorenloyalität war längst ausgestorben. Er verübelte es den Autoren nicht und schickte sie mit seinen besten Wünschen für eine glückliche Zukunft auf den Weg. Denn wer, außer den Reichsten, konnte diesen Verführern den Rücken kehren?
Diese Vorschüsse! Er haßte dieses Wort, verabscheute die ermüdend langen Verhandlungen, die zwangsläufig damit verbunden waren und bei denen sich habgierige Autoren hinter ebenso habgierigen Agenten, die die Verträge aushandelten, versteckten. Es hatte Zeiten gegeben, da akzeptierte ein Autor ein paar Hundert Pfund als Anleihe auf zukünftige Tantiemen – eine bescheidene Summe, um über die Runden zu kommen. Jetzt gab es Autoren, deren Vorschüsse waren so hoch, daß sie nie einen Penny an Tantiemen verdienten. Vorschüsse, so ungeheuer – eine halbe Million Pfund, eine Million Pfund, alles war möglich –, daß die Verleger nie hoffen konnten, dieses Geld wiederzugewinnen. Das Ganze war ein Wahnsinn.
Von seinen eigenen Autoren konnte er sich nur auf zwei verlassen: Gerald Walters, jetzt für seine Verdienste in der Literatur geadelt, Nobelpreisträger und Nestor englischer Schriftsteller, den Julius in Cambridge kennengelernt und dessen erstes Buch Westall voller Stolz publiziert hatte. Alle drei bis vier Jahre landete ein chaotisches Manuskript auf Julius' Schreibtisch. Gerald, dachte er oft, ist wohl der einzige lebende Autor, der sein Werk in diesem Zustand, anstatt ordentlich getippt, abliefern darf.
Dann war da noch Sally Britain – eine außergewöhnliche Kriminalschriftstellerin, Gewinnerin des Golden Dagger Award, die ihm jeden September seit fünfzehn Jahren einen wunderschön ausgeklügelten Krimi präsentiert hatte. Eine reizende Frau, mit der er eine glückliche Sommeraffäre genossen hatte, kurz nachdem sie für den Verlag schrieb. Sally machte nicht den Eindruck, eine Romantikerin zu sein, doch im Verlauf der Jahre, als sie noch immer bei ihm blieb, fragte er sich oft, ob es nicht um der alten Zeiten willen war.
Jedes Jahr war Julius besorgt, denn er wußte, daß diese beiden Schriftsteller von großen Verlagen umworben wurden, die Werbekampagnen und unermeßliche Auflagen versprachen, doch glücklicherweise hatten beide immer abgelehnt. Aber schließlich gehörten sie zu der kleinen Gruppe von erfolgreichen Schriftstellern, die mit dem Geld, das sie verdienten, zufrieden waren und sich den Luxus der Loyalität leisten konnten.
Die anderen hatten, einer nach dem anderen, das – wie sie es vermutlich sahen – sinkende Schiff verlassen. Und neue Autoren – anfänglich von speichelleckerischer Dankbarkeit, nachdem Westall den Grundstein für ihre Karriere gelegt hatte – waren von Angeboten weggelockt worden, die für Julius zahlenmäßig Telefonnummern glichen.
Die Zeiten waren nicht mehr wie früher ... Da, jetzt hing er schon wieder den Gedanken eines alten Mannes nach ...
Die Lösung des Problems war leicht. Er mußte nur andeuten, daß er aus dem Geschäft aussteigen wollte, und die Konzerne würden sich gegenseitig in einem mörderischen Konkurrenzkampf überbieten, wie Piranhas würden sie zuschlagen, doch Westall and Trim würden nicht mehr derselbe Verlag sein.
Seine Familie war sich dessen ebenso bewußt wie er, und es hatte viele Diskussionen darüber gegeben, die gewöhnlich in Streit ausarteten, und bei denen er als egoistischer Narr beschimpft worden war. Mag sein, aber er konnte nicht verkaufen. Er würde lieber in den Sielen sterben. Doch er brauchte frisches Blut im Verlag, jemanden, der das Haus mit neuem Elan weiterführte.
Jedoch nicht Crispin. Niemals! Er bereute noch immer den Tag, an dem er auf seine Schwester, Marge, gehört und zugestimmt hatte, seinen Neffen, großspurig und frisch aus Oxford, als Mitherausgeber in den Verlag aufgenommen hatte. Jetzt war er Finanzdirektor – gewiß ein fähiger, Julius war schließlich kein absoluter Narr und bestimmt nicht, was das Personal betraf. Doch Crispin, mit seiner ehrgeizigen Arroganz, seinem Anflug von Skrupellosigkeit, seiner Gier, war nicht der Mensch, den Julius mochte, und er war gewiß nicht der Mensch, dem er die Liebe seines Lebens überantworten konnte. Crispin würde innerhalb von vierundzwanzig Stunden den Verlag verkaufen, davon war Julius überzeugt.
Wahrscheinlich mußte er auf den alten Archibald hören – wenn nicht seinetwegen, dann wenigstens wegen des Verlags. Er war noch nicht bereit, aufzugeben. Vor ihm lagen noch viele Aufgaben. Aber er brauchte Hilfe, darüber war er sich jetzt im klaren. Jemanden, der jünger als er war, aber ebenso dachte wie er. Er hatte noch eine Anzahl von Ideen in petto. Vielleicht war es an der Zeit, sie hervorzukramen, abzustauben und ernsthaft darüber nachzudenken.
Die Uhr auf dem Kaminsims schlug die volle Stunde. Julius verglich die Zeit mit seiner Armbanduhr. Zehn Uhr. Es lohnte sich wohl kaum, jetzt noch nach Hause zu gehen. Er schloß den Geschäftsbericht, den er hätte studieren sollen, und sperrte ihn in seinen Safe. Die Flasche Glenfiddich in der Hand und ein Manuskript unter dem Arm, stieg er in die Mansarde hinauf, wo er sich schon vor Jahren eine kleine Wohnung eingerichtet hatte – Schauplatz vieler seiner Eroberungen.
Blöder geiler Bock! Er lachte über sich selbst. Das alles war vorbei, und er dankte Gott dafür. Als junger Mann hätte er sich nie vorstellen können, daß der Tag kommen würde, an dem er dankbar dafür war, daß sich sein Hormonspiegel gesenkt hatte. Jetzt sah er darin den größten Vorteil des Alters, denn nicht einmal mehr die Erinnerungen daran quälten ihn.
Er öffnete den kleinen Kühlschrank, um nachzuschauen, was Roz im Fall, daß er hier übernachtete, für ihn eingekauft hatte. Roz war die perfekte Sekretärin. Wie schade, daß ihr Ansehen in seinen Augen durch ihre Affäre mit Crispin gelitten hatte – von der er natürlich nichts wissen durfte.
Kapitel 2
Wie für viele Frauen gab es für Kate Howard einen Augenblick am Tag, der etwas Besonderes war. Ehe dieser Zeitpunkt jedoch gekommen war, galt es, dem Chaos des frühen Morgens zu begegnen. Als erstes mußte sie ihre Familie auf den Weg zur Arbeit und zur Schule bringen. Nachdem Mann und Kinder widerstrebend aufgestanden waren, hatte sie unzählige Sachen – wie Kleidungsstücke, Schulranzen, Aktenkoffer, Schulhefte, Essensgeld – gesucht und gefunden. Sie hatte in einem Streit über Nichtigkeiten die Vermittlerin gespielt. Sie hatte ihre Lieben gefüttert und getränkt, mit ihrer Tochter, die eine Hungerkur machte, über die Notwendigkeit zu essen diskutiert und ihren Sohn wegen seiner Art, das Essen hinunterzuschlingen, gescholten. Schon vor langer Zeit hatte sie sich damit abgefunden, daß ihr Mann, der sich hinter seiner Zeitung versteckte, taub gegen Lärm war. Wie gewöhnlich hatte sie die Morgenpost abgefangen und die Strom- oder Telefonrechnung verborgen, da sie aus Erfahrung wußte, daß solche Angelegenheiten besser am Ende des Tages als am Morgen aufgenommen wurden. Sie hatte allen einen Abschiedskuß gegeben und nachgewinkt. Dann schlug die Tür hinter dem letzten zu, und Schweigen senkte sich über das Haus, ein unvergleichliches Schweigen: Ihr Augenblick war gekommen.
Kate saß jetzt am Küchentisch und blickte mit Ekel auf das schmutzige Frühstücksgeschirr. Sie lehnte sich auf dem Stuhl zurück und ließ sich von der Ruhe umfluten, beruhigen und für den Rest des Tages kräftigen. Sie fühlte den Frieden im Haus in ihren Körper dringen, als würde er durch ihre Adern fließen.
Kate war nie ein Morgenmensch gewesen. Das Läuten des Weckers war für sie jedesmal eine quälende Wiedergeburt. Sie stand immer als erste auf, duschte hastig, putzte sich die Zähne, bürstete ihr Haar und vermied es, in den Spiegel über dem pampasgrünen Becken mit den vergoldeten Wasserhähnen zu blicken.
Sie war auch immer als erste unten, nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil ihr dann eine halbe Stunde blieb, in der sie mit niemandem reden mußte. Richtete jemand vorher das Wort an sie, bekam er unweigerlich eine barsche Antwort, die den ganzen Haushalt für den Rest des Tages in Aufruhr versetzte.
Jahrelang hatte sie schlechten Gewissens geglaubt, nur in ihrer Familie herrsche jeden Morgen dieses Chaos, daß irgendwie alles ihre Schuld sei, weil sie den Fehler begangen hatte, ihren Haushalt mit dem ihrer Mutter zu vergleichen, in dem alles wie ein Uhrwerk funktionierte und keine bösen Worte fielen. Jetzt wußte sie es besser. Von Freunden hatte sie erfahren, daß es nicht ihr allein so erging, sondern in Millionen von Haushalten ähnlich chaotische Verhältnisse herrschten. Das Haus ihrer Mutter war eine Ausnahme gewesen.
Wenn die Familie fort war, frühstückte Kate oder aß nichts, je nachdem, ob sie diät lebte oder wieder einmal eine Abmagerungskur aufgegeben hatte, was gewöhnlich zutraf. Aber zuerst räumte sie das Geschirr vom Tisch, füllte den Geschirrspüler, wischte den Herd ab und machte sich dann Tee und Toast. Dachte sie an die Mengen von Essen, die ihr Sohn und ihr Mann konsumierten, ohne ein Gramm zuzunehmen, ärgerte sie sich maßlos über ihr Schuldgefühl, wenn sie ihren Toast aß und einen Löffel Zucker in ihren Tee tat. Dann zündete sie sich ihre erste Zigarette des Tages an – die sie am meisten genoß – und befand sich endlich in einem relativen Frieden mit der Welt.
Kate konnte sich keines völligen Friedens erfreuen, denn sie hatte einen Punkt in ihrem Leben erreicht, wo sie sich wieder so verwirrt fühlte wie als Heranwachsende. In dem Maße, wie ihre Hormone verrückt spielten, unterlag sie beängstigenden Stimmungsschwankungen. War sie glücklich und in Hochstimmung, konnte sie sich nicht darauf verlassen, daß diese Phase andauerte, denn dunkle Gefühle konnten auf der Lauer liegen, um sich ihrer zu bemächtigen. Verfiel sie in eine dieser Depressionen, versuchte sie dagegen anzukämpfen und sie zu vertreiben, damit diese düstere Stimmung nicht in ihre Seele kroch, was katastrophale Auswirkungen hätte. Diese Gemütsveränderung hatte so leise und heimlich von ihr Besitz ergriffen, daß es weder ihr noch den Menschen in ihrer Umgebung bewußt geworden war.
Kate nannte es aus Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ein Gefühl, denn es war keine richtige Depression, kein medizinisch diagnostizierbarer Zustand. Sie hatte vielmehr das Gefühl, alle Freude wäre aus ihrem Leben verschwunden und damit ein Großteil ihrer Spontaneität. Ganz allmählich und auf heimtückische Weise fühlte sie sich leer und farblos werden, und je stärker dieses Gefühl wurde, um so mehr drückte es sich in ihrem Aussehen aus – ein Passant auf der Straße würde nicht länger Notiz von ihr nehmen, würde an der unbedeutenden Frau, zu der sie geworden war, ohne einen zweiten Blick vorübergehen. Sogar ihr Gang hatte sich verändert. Heutzutage ging sie mit gesenktem Kopf dahin, um nicht dem ausdruckslosen Blick eines Fremden zu begegnen, dessen Desinteresse der Beweis dafür wäre, daß ihre Jugend ein für allemal dahin und sie jetzt zu einer Frau mittleren Alters geworden war.
Kate war über ihre Reaktion auf den Verlust eines nicht mehr jugendlichen Aussehens erstaunt. Das hatte sie nicht erwartet. Sie hatte angenommen, nur schönen Frauen läge etwas daran. Kate war nie schön gewesen und hatte sich eingebildet, das fortschreitende Alter – wenn ihre Haut die Elastizität verlor, sich Falten bildeten, ihre Taille fülliger wurde und sie auf Männer nicht mehr anziehend wirkte – mit einem Achselzucken abtun zu können.
Jetzt stellte sie fest, daß sie ständig über diesen Mangel an Interesse nachdachte. Sie hatte nie mit Männern herumgespielt, hatte nie Lust dazu gehabt – doch jetzt, da es dafür zu spät war, empfand sie ein gewisses Bedauern, es nie mehr tun zu können. Eine Trauer, daß sie nie erfahren würde, wie es war, wenn ein anderer Mann sie begehrte.
Eine ihr bisher unbekannte Unzufriedenheit hatte angefangen, in ihr Leben einzudringen. Dabei hatte sich ihr Leben nicht verändert, nur sie selbst. Ihr Alltag war seit beinahe vierundzwanzig Jahren derselbe – ein Alltag, den sie nie in Frage gestellt hatte, weil sie zu beschäftigt gewesen war, um überhaupt darüber nachzudenken. Aber jetzt merkte sie, daß sie anfing, sich darüber zu ärgern, und hatte manchmal das Gefühl, ihr Haus würde zu einem Gefängnis, aus dem es kein Entrinnen gab.
Das war der Augenblick, in dem ihre Schuldgefühle an die Oberfläche kamen, denn worüber konnte sie so unzufrieden sein? Sie hatte alles, was sich eine Frau nur wünschen konnte – oder vielmehr, was sich eine Frau ihrer Erziehung wünschen sollte. Tony, ihr Mann, arbeitete hart für sie alle – zu hart eigentlich, denn sie wünschte sich, er würde mehr Zeit mit der Familie verbringen. Er trank nicht übermäßig, war kein Schürzenjäger und verbrachte seine ganze Freizeit zu Hause, worum sie viele ihrer Freundinnen, deren Ehemänner gern ausgingen, beneideten. Lucy und Steve, ihre Kinder, waren gesund und gutaussehend. Die beiden hatten ihnen nie Probleme bereitet, es hatte weder unpassende Freunde noch Drogen gegeben, und ihr und Tony waren politisch konträre Ansichten erspart geblieben, die in anderen Familien zu Streits vulkanischen Ausmaßes geführt hatten. Die beiden waren ideale Kinder. Lucy, ein heller Kopf, stand kurz vor dem Abitur und strebte – wie ihr Vater – eine juristische Karriere an, was ihn immens gefreut hatte. Steve, ein wenig träger, aber charmanter als seine Schwester, war dabei, die mittlere Reife abzuschließen, und wollte Landschaftsgärtner werden. Tony konnte diesen Wunsch nicht verstehen, und Kate glaubte, er hielt den Beruf für etwas unter Steves Würde. Kate hatte zu ihrem Sohn ein unbefangeneres Verhältnis als zu ihrer Tochter.
Kates Leben war voraussagbar gewesen. Sie hatte mit ihren Eltern – der Vater Anwalt, die Mutter Hausfrau – in einer großen Doppelhaushälfte in einem guten Wohnviertel von Bristol gelebt. Sie war eine mittelmäßige Schülerin gewesen, und falls sie als Teenager von Reisen und Abenteuern geträumt hatte, so hatte sie stets gewußt, daß es nur Träume waren. Sie war dazu erzogen worden, einen zu ihr passenden Mann zu heiraten und Kinder zu bekommen – die beste Rolle für eine Frau, wie ihr ihre Mutter oft genug versichert hatte.
Nur während ihres Studiums an der pädagogischen Hochschule – mit Hauptfach Hauswirtschaftslehre – war sie von zu Hause fort gewesen, hatte jedoch die meisten Wochenenden bei ihren Eltern verbracht und kaum Anteil am gesellschaftlichen Leben der Hochschule genommen, denn damals hatte sie schon Tony – Anwaltsgehilfe in der Kanzlei ihres Vaters – gekannt. Sie hatte nie unterrichtet, denn gleich nach ihrem Lehrerdiplom, hatte sie ihn geheiratet. Ihr Leben war ihr vorherbestimmt. Es würde dem ihrer Mutter ähneln, und Kate wußte, daß es richtig war.
Das junge Paar hatte ein Jahr lang glücklich in einer kleinen Wohnung in Bristol gelebt, bis Tony eines Tages ganz aufgeregt mit der Beschreibung dieses Hauses, das damals renoviert werden mußte, heimgekommen war. Es würde ein kostspieliges und langfristiges Projekt sein, und eine Finanzierung konnten sie sich nur leisten, wenn sie ihre Familienplanung verschoben. Es kam nicht in Frage, daß Kate arbeitete, um mitzuverdienen. Eine derartige Idee hätte Tony niemals gutgeheißen.
Es war hart für Kate, auf ein Kind zu einem Zeitpunkt zu verzichten, als sie es sich wünschte, und so sehr sie das Haus auch mochte, wäre es ihr lieber gewesen, sie hätten ein billigeres Haus gekauft und früher Kinder bekommen. Doch Tony hatte sein Herz daran gehängt, und Tony setzte immer seinen Willen durch. Er erwartete das von ihr, und sie akzeptierte es, denn hatte nicht immer ihr Vater alle Entscheidungen auch allein getroffen?
Sie hatten fünf Jahre an dem Haus gearbeitet – Tony sah ihre Fähigkeiten als Innenausstatterin mehr als Hobby denn als Arbeit an. Als das zweite Badezimmer installiert worden war, verkündete er endlich die Neuigkeit, nach der sie sich gesehnt hatte – Tony sagte, sie könnten eine Familie gründen. Zuerst wurde Lucy geboren und zwei Jahre später Steve. Sie waren eine perfekte Familie in ihrem perfekten Heim.
Es war ein Juwel von einem Haus, aus schönem Cotswold-Steinen erbaut, und stand in einem Dorf, das sich in die Täler der Mendip-Hügel schmiegte. Hier hatte sich in Jahrhunderten nichts verändert, wenn man die Teerstraßen, Elektrizität, Telefon, Fernsehantennen und fließendes Wasser unberücksichtigt ließ. Kate hatte ein ans Schlafzimmer angrenzendes Bad, einen Aga-Herd in der Küche, einen schönen Garten und ein eigenes – wenn auch gebrauchtes – Auto in der Garage. Sie lebte mit dem Besten aus der alten und der neuen Zeit. Sie hatte alles.
Warum hatte sie also angefangen, ihr Leben in Frage zu stellen? Warum hatte sie das Gefühl, etwas im Leben verpaßt zu haben und daß jetzt, auf irgendeine Weise, alles vorbei war?
Nachts im Bett, wenn ihr so heiß war, daß sie nicht schlafen konnte, wußte sie die Antwort auf ihre Frage. Sie wollte etwas tun, jemand sein, nicht nur Frau und Mutter, sondern auch wichtig für andere Menschen. Dieser Gedanke gab ihr Hoffnung und das Gefühl, daß noch nicht alles verloren war. Aber morgens war es nur noch ein Traum, und das »Gefühl« beherrschte sie für den Rest des Tages.
Nach dem Frühstück zündete sich Kate ihre zweite Zigarette an und las die Daily Mail von der ersten bis zur letzten Seite. Nur dieser kurze Zeitraum gehörte allein ihr, und sie erlaubte sich den Genuß, sich selbst zu verwöhnen.
Es gab Zeiten, da liebäugelte sie mit dem Gedanken, daß sie sich vielleicht anders fühlen würde, wenn sie reicher wären. Ihr Mann bekam als Teilhaber einer Anwaltskanzlei in der nahegelegenen Stadt Graintry bestimmt ein gutes Gehalt. Sie wußte nicht, wieviel er verdiente, weil Tony es ihr nie gesagt hatte, aber es war nie genug, und sie mußte mit dem Haushaltsgeld sparsam umgehen.
Die Jahre der Sparsamkeit waren eine Herausforderung gewesen, der sie voller Stolz begegnet war. Sie hatte ihre ganze Kraft ins häusliche Leben gesteckt und stolz »Hausfrau« auf Formulare geschrieben. Der Ruf, eine gute Hausverwalterin zu sein, den sie in ihrem Freundeskreis besaß, hatte ihr Entschlußkraft und Zielstrebigkeit verliehen.
Lucy, die es klüger als Kate verstand, Tony zu manipulieren, hatte ihrem Vater kürzlich Kleidergeld entlockt, worum Kate, die es müde war, um Geld für eigene Kleider zu bitten, und daher oft selbst schneiderte, ihre Tochter beneidete. Als sie ihren Mann fragte, ob ihr nicht auch dieser Zuschuß zustehe, hatte er ihr einen Blick zugeworfen, der keiner Erklärung bedurfte. Kate hatte schon früh in ihrer Ehe erfahren, daß sie bei Tony nichts erreichte, wenn sie ihn direkt um etwas bat. Es schien ihn zu verärgern und sein Nein kam praktisch automatisch.
Kate schlenderte manchmal durch Debenhams und betrachtete sich die Make-ups, die Feuchtigkeitscremes und die Cremes gegen Falten. Sie hätte die Kosmetikartikel kaufen können, das Haushaltsgeld hätte für einen gelegentlichen Luxus gereicht, aber sie tat es nicht. Es kam ihr Tony gegenüber unrecht und unfair vor, derartige Beträge für sich selbst auszugeben. Der Supermarkt war ihr Schönheitssalon. Zweimal im Jahr ließ sie sich dort eine Dauerwelle machen und legte sich die übrige Zeit das Haar selbst. Die einzige Extravaganz, die sie sich leistete, waren Schuhe, sie kaufte nur gute und teure. Doch das war ihr von ihrer Mutter eingehämmert worden, also ebenfalls nicht wirklich ihre eigene Entscheidung.
Sie nähte alle Vorhänge selbst, versah sie mit Futterstoff und stärkte die Schabracken. In ihrem ganzen Eheleben hatte sie keine Suppendose geöffnet, und es war eine Freude, ihre Speisekammer mit den Regalen voller ordentlich aufgereihter, hausgemachter Marmeladen, Chutneys und eingelegter Früchte zu betreten.
Kate war eine mustergültige Hausfrau. Aber in letzter Zeit hatte sie sich während ihrer stillen Augenblicke voller Abscheu in ihrer makellosen Küche umgeschaut. Sie saß da und träumte von Friseur- und Manikürterminen in teuren Londoner Salons; träumte davon, alle ihre sorgfältig geschneiderten Kleider hinauszuwerfen und eine neue Garderobe in den Boutiquen von Graintry zu kaufen; träumte von Gesichtscremes, die das Haushaltsgeld einer Woche verschlingen würden; träumte davon, eine Gesundheitsfarm aufzusuchen und sich eine Woche lang verwöhnen zu lassen. In ihrer Vorstellung weilte sie auf einer einsamen exotischen Insel, und der warme Tropenwind strich durch ihr frisch gesträhntes Haar. In diesen Träumen existierte immer irgendwo im Hintergrund eine schattenhafte Gestalt – ein Mann natürlich. Und obwohl sie ihm noch kein Gesicht gegeben hatte, wußte sie, daß es nicht Tony war. Kate war in einem gefährlichen Alter. In einem Alter, das um so gefährlicher war, weil sie keinen Ausweg aus der häuslichen Falle sah, in der sie sich mit fünfundvierzig befand. Sie fürchtete sich davor, den Rest ihres Lebens darin bleiben zu müssen.
Kapitel 3
Crispin Anderson hatte nicht beabsichtigt, das Restaurant derart verstohlen zu betreten, wodurch er mehr Aufmerksamkeit erregte, als er wollte, aber unter diesen Umständen war es schwierig, nicht hinterhältig auszusehen. Aus Angst, belauscht zu werden, hatte er seine Verabredung von einer Telefonzelle aus getroffen; er hatte seine Sekretärin belogen und ihr gesagt, er wolle einkaufen gehen; er hatte ein Taxi mit dem Bestimmungsort Harrods bestellt und dort das Taxi gewechselt, da er wußte, daß sein Fahrziel auf dem Firmenkonto des Taxiunternehmens erscheinen würde. Als er in dem Restaurant, weit entfernt von den neugierigen Blicken in Bloomsbury, ankam, war er in Hochstimmung und fühlte sich wie ein Spion. Der Treffpunkt, den er gewählt hatte, lag in der Unterwelt von Battersea. Bei der Überquerung der Themse war er sich wie ein kühner Reisender vorgekommen – es ist fast wie die Überquerung des Rubikon, dachte er und lachte leise über seinen Witz. Er machte selten Witze und verstand noch seltener die witzigen Bemerkungen anderer – daher kam wohl die übermäßige Freude an diesem Gedanken.
Er verschmähte den ersten Tisch an einem Fenster, der ihm angeboten wurde, und steuerte auf einen Platz im rückwärtigen Teil des Restaurants zu, der verborgen hinter einer Topfpflanze lag. Er blickte sich in dem kaum halbvollen Raum um und vergewisserte sich, daß niemand anwesend war, den er kannte. Dann erst entspannte er sich. Wer würde schon so weit zum Mittagessen fahren? Außerdem kannte er niemanden, der in dieser Gegend wohnte.
Crispin lebte in einem hohen, weißgestrichenen Haus in Chelsea, das ihm großzügigerweise von seiner Großmutter väterlicherseits vererbt worden war. Mit den beiden Gehältern, die er und seine Frau verdienten, hätten sie sich niemals eine derart renommierte Adresse leisten können. Sie behaupteten, ihr Haus stamme aus der Zeit Georgs IV. – aus der Epoche des Regency –, und er hatte sogar seiner Frau die Tatsache verheimlicht – die er aus den Urkunden erfahren hatte –, daß es viktorianischen Ursprungs war. Alles an dem Haus war perfekt, und es gab nichts in seinem oder Charlottes Leben, das es hätte verunstalten können. Sie hatten keine Kinder und wollten keine haben. Charlottes Wunsch, sich nicht fortpflanzen zu wollen, war für ihn der entscheidende Faktor gewesen, sie zu heiraten. Sie besaßen weder einen Hund noch eine Katze noch ein Nagetier, das Haar verstreute, kotzte, pinkelte oder furzte.
Sie hatten mit größter Sorgfalt die richtigen Stoffe, Tapeten, Möbel, Gegenstände und Bilder ausgesucht. Alles war zeitgemäß – wenn man die paar ärgerlichen Jahre ignorierte, die das Haus in die verkehrte Epoche versetzten. Sie aßen von Porzellantellern und tranken aus Gläsern, die vor der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hergestellt worden waren. Beide wären lieber gestorben, als Plastik im Haus zu dulden – sogar ihre Zahnbürsten waren aus Schildpatt, deren Borsten regelmäßig ersetzt wurden.
Die elektrischen Geräte, die sie wegen ihres aufwendigen Lebensstils brauchten – Waschmaschine, Trockner und Staubsauger, auf dem ihre Putzfrau unerbittlich beharrte –, waren in den Keller verbannt worden, damit deren Anblick nicht ihre empfindsamen Augen beleidigte.
In ihrem kleinen Kreis von engen Freunden, die alle in ähnlichen Häusern lebten, waren sie für ihre exquisiten Dinners bei Kerzenlicht und Kaminfeuer bekannt – es gab keine Zentralheizung im Haus. Crispin besaß eine schöne Auswahl an bestickten Westen und Krawatten, während Charlotte ihre Sammlung antiker Kleider hätschelte. Es gefiel ihm, sie dabei zu beobachten, wie sie in ihrem verzierten Musselinkleid anmutig die Gäste verwöhnte, wobei er sich vorstellte, er würde später Jane Austen bumsen.
In Wirklichkeit war das Haus ihre private Traumwelt. Beide waren von der Vergangenheit fasziniert, doch im Geschäftsleben trug Crispin stets makellose Anzüge aus der Savile Row, und Charlotte kleidete sich bei Catherine Walker ein. Es faszinierte ihn, daß in Charlotte eigentlich zwei Frauen steckten: die sanfte, reizend gewandete Frau im Haus und die elegante Frau, die bei Phipps and Secton, einer der größten Werbeagenturen der westlichen Welt, eine führende Position bekleidete.
Peter hatte sich verspätet, worüber er froh war. Es gab ihm die Möglichkeit, noch einmal die Unterlagen in seinem Aktenkoffer durchzusehen. Das war eigentlich nicht nötig, denn Crispin kannte die Zahlen auswendig, doch was geschäftliche Belange betraf, war er von peinlicher Genauigkeit.
Er bestellte ein Perrier mit einer Scheibe Zitrone. Crispin trank bei geschäftlichen Besprechungen nie Alkohol. Dieser Angewohnheit hatten viele Männer ihren Untergang zuzuschreiben. Sein Onkel Julius, der ausgedehnte Mittagessen und reichlich Alkohol genoß, war ein Musterbeispiel dafür. Wahrscheinlich hatte diese Vorliebe zu dem Schlamassel beigetragen, in dem er jetzt steckte. Crispin hatte weder Geduld noch Verständnis für solche Menschen oder solche Verhaltensweisen.
Er betrachtete zufrieden die ordentlichen Zahlenreihen. Roz hatte ihm dieses Mal alle Ehre gemacht. Eine der vernünftigsten Entscheidungen, die er während seiner zehnjährigen Tätigkeit bei Westall and Trim getroffen hatte, als er letztes Jahr begonnen hatte, ernsthaft seine Zukunft zu planen, war die Verführung von Julius' Privatsekretärin gewesen.
Es war die Schuld seines Onkels, daß er zu diesen Mitteln greifen mußte: Julius hatte eine romantische, dumme Einstellung dem Verlagswesen gegenüber, die Crispin seit einiger Zeit vor Frustration verrückt machte. In diesem Geschäft war Geld zu verdienen – großes Geld –, er sah das am Beispiel der erfolgreichen Verlage, die nicht durch einen träumenden alten Narren an der Spitze behindert wurden. Die unabhängigen Verlage blieben auf der Strecke. Deren Tage gehörten der Vergangenheit an. Crispin war fest entschlossen, sobald wie möglich in die Reihe der reichen Konzernherren aufzusteigen.
Jetzt, wo er alle Informationen, die er brauchte, in den Händen hatte, rückte dieser Tag immer näher. Zuerst hatte er alle möglichen verrückten Pläne geschmiedet, um seinen Onkel von der Spitze zu verdrängen, aber dank Roz' Hilfe hatte er keinen dieser plumpen Fehler begangen. Er hatte gelernt, daß er warten mußte, und wie sich herausstellte, nicht mehr allzulange. Jetzt war die Zeit gekommen, die Fühler im Verlagsgewerbe auszustrecken, damit er in der Minute des Todes seines Onkels den richtigen Kurs einschlagen konnte.
Im vergangenen Jahr hatte es Augenblicke gegeben, wo er sich fragte, ob sich die Ausgaben für eine Geliebte, verbunden mit den Kosten einer teuren Ehefrau, jemals lohnen würden. Zu Beginn seiner Affäre mit Roz war sein größtes Hindernis ihre absolute Loyalität Julius gegenüber gewesen. Es hatte ihn enorme Geduld und Selbstbeherrschung gekostet, den richtigen Augenblick abzuwarten.
Dabei war es nicht schwierig gewesen, Roz für sich zu gewinnen. Crispin sah gut aus, war klug und konnte diesen ungezwungenen Charme entwickeln, dem alle Frauen, auf die er es abgesehen hatte, zum Opfer gefallen waren. Und das war einer der Gründe, warum Crispin Frauen so verachtete, denn ihm war völlig klar, wie oberflächlich dieser Charme war. Er betrachtete ihn, ebenso wie seine Intelligenz und sein gutes Aussehen, als nützliche Instrumente, sein Werkzeug sozusagen.
Dank dieses Charmes hatte er nur sechs Monate gebraucht, um Roz dazu zu bringen, ihm die Liste der Anteilseigner an Westall and Trim zu besorgen. Da der Verlag ein privates Unternehmen mit unbeschränkter Haftung war, hatte es keine andere Möglichkeit gegeben, an diese Informationen zu kommen. Seine Mutter besaß auch Anteile, aber sie hatte sich – typisch für sie – geweigert, ihm zu sagen, wie viele.
Ihre Einstellung hätte ihn nicht verwundern sollen, denn er kannte seine Mutter nur als eine sehr verschwiegene Frau, die von einer beinahe pathologischen Heimlichtuerei besessen war. Das hatte dazu geführt, daß er sie nach sechsunddreißig Jahren überhaupt nicht kannte. Sie war seit sechs Jahren Witwe, und obwohl er versucht hatte, ihre Finanzlage zu ergründen und herauszufinden, ob sie daran dachte, wieder zu heiraten, war es ihm nicht gelungen, ihr irgendwelche Informationen zu entlocken. Manchmal hatte er das Gefühl, daß sie nur ihm gegenüber so geheimnisvoll war, weil sie ihn nicht mochte. Diese Abneigung berührte ihn kaum, denn sie beruhte auf Gegenseitigkeit. Er bedauerte im nachhinein seinen Vater, der mit dieser Frau sein Leben geteilt hatte. Er wußte nicht, wie ihre Einstellung ihrem Bruder, Julius, gegenüber war, was seine Pläne unnötig erschwerte. Er hatte sich einmal um ihre Hilfe bemüht und ihr seine Zukunftspläne anvertraut, doch nachdem sie ihm gesagt hatte, die Anteilscheine gingen ihn nichts an, hatte er es aufgegeben, an ihre mütterlichen Gefühle zu appellieren.
Die Namen der Anteilseigner hatten ihn allerdings keinen Schritt weitergebracht. Julius besaß 49 Prozent; sein Bruder, Simon ein unbedeutender und erfolgloser Maler in Crispins Augen – hielt 20 Prozent der Anteile, ebenso wie Crispins Mutter, Marge. Julius' Frau, Jane, besaß 9 Prozent und der Lepanto Trust die restlichen 2 Prozent.
Selbst unter der unwahrscheinlichen Voraussetzung, daß es Crispin gelang, Onkel Simon und Tante Jane zu überreden, ihm ihre Anteile zu verkaufen, würden sie nur mit Julius' 49 Prozent gleichziehen. Der Schlüssel zur Anteilsmehrheit lag also bei diesem Trust. Was oder wer dieser Trust war, hatten weder er noch Roz herausfinden können. Die letzten Dividenden waren auf ein Konto bei der Hoare's Bank überwiesen worden. Eine Adresse des Empfängers war nicht verfügbar. Unter diesen Umständen würde er sich eine weitere Geliebte, eine Angestellte bei Hoare's, zulegen müssen, um an die nötigen Informationen zu kommen.
Bis letzte Woche war er verzweifelt gewesen und hatte keine Möglichkeit gesehen, die Kontrolle über Westall and Trim zu erlangen. Diese Situation hatte sich entscheidend geändert, seit er von Roz erfahren hatte, daß der alte Knabe seinen Arzt in der Harley Street aufgesucht hatte. Crispin war an diesem Tag vor Aufregung über die möglichen Konsequenzen dieses Arztbesuchs zu keiner Arbeit fähig gewesen. Zunächst hatte sich Roz geweigert, nähere Einzelheiten zu erzählen. Da Crispin jedoch wußte, daß sie Julius' einzige Vertraute war, hatte er sie nicht weiter bedrängt, sondern zum Abendessen eingeladen, wobei er ganz beiläufig das Gespräch auf dieses Thema lenkte. Roz hatte sich eine Weile geziert und von ihrem Versprechen, Stillschweigen zu bewahren und keinen Vertrauensbruch begehen zu wollen, geredet. Scheinbar hatte er ihren Wunsch respektiert, das Thema gewechselt und von seiner sagenhaft glücklichen Kindheit erzählt, in der sein Onkel eine so liebevolle Rolle gespielt hatte. Das genügte, denn Roz brach in Tränen aus und plauderte die ganze Geschichte aus. Wie sich herausstellte, war Julius' Herz in schlechtem Zustand, und sein Arzt hatte ihm dringend geraten, das Trinken und Rauchen aufzugeben und eine strikte Diät einzuhalten, sonst seien seine Tage gezählt. Crispin gab sich besorgt und beunruhigt, konnte diese Heuchelei jedoch kaum aufrechterhalten, als Roz ihm unter weiteren Tränen erzählte, daß Julius seitdem aus einer verrückten Trotzhaltung heraus noch mehr tränke. Damit Roz endgültig Verrat an Julius beging, hatte er sein letztes Mittel eingesetzt und versprochen, ihretwegen seine Frau zu verlassen – vorausgesetzt, sie öffne Julius' Privatsafe und kopiere dessen Testament.
Es versetzte ihn immer wieder in Erstaunen, welche Macht Männer auch in dieser Zeit der sexuellen Gleichberechtigung nur durch ein Eheversprechen auf Frauen ausüben konnten. Natürlich meinte er es nicht ernst. Er würde Charlotte nie verlassen, vor allem nicht für eine Frau wie Roz. Sie war zwar recht nett und im Bett viel enthusiastischer als Charlotte, aber Roz paßte nicht zu ihm. Er hatte mit Entsetzen festgestellt, daß sie Kleider aus Kunstfasern trug und eine Sammlung von abscheulichen Ohrringen besaß. Aber sie hatte ihm geglaubt und ihm letzte Nacht, im Bett ihrer kleinen Wohnung, die langersehnte Kopie des Testaments gegeben.
Das Testament war sein zweiter Schlüssel zur Macht. Es hatte ihn immer beunruhigt, was Julius mit seinen Anteilen vorhatte. Julius hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, daß er seine Kinder verabscheute, deswegen hatte Crispin befürchtet, er könnte seine Anteile an alte, loyale Angestellte oder das Hundeheim von Battersea oder ähnliche Institutionen vererben.
Nachdem er das Dokument gelesen hatte, war seine Erleichterung grenzenlos gewesen. Julius war wie alle Männer seiner Generation: Er hatte seinen gesamten Besitz seinen Kindern vererbt – alles, bis auf diese gewaltigen Gemälde, die er dem Fitzwilliam Museum in Cambridge überschrieben hatte. Crispin hatte nichts dagegen einzuwenden. In seinen Augen bestand diese Sammlung aus einem Haufen Kitsch, auch wenn sie ein kleines Vermögen wert war. Crispin zog ein nettes, verständliches Stilleben oder eine Landschaft vor. Trotzdem könnte es nützlich sein, die Konten zu überprüfen, um herauszufinden, wer dafür bezahlt hatte – vielleicht waren sie ein Teil des Firmenvermögens.
Im Besitz dieser Information konnte er ernsthaft anfangen zu planen. Er kannte seine Cousins, John und Caroline. Keiner von beiden hatte Interesse am Verlag, und beide brauchten Geld. John, weil er Geld anhäufte, wie andere Menschen Briefmarken oder Schmetterlinge sammelten, und Caroline, weil ihr kleiner Landsitz jeden Penny verschlang, den sie und ihr Mann auftreiben konnten. Beide würden nur allzu glücklich sein, an den Meistbietenden zu verkaufen – und Käufer, das wußte er, würde es jede Menge geben. Westall and Trim war ein angesehener Verlag, und ein halbes Dutzend Unternehmen – englische und amerikanische – wären nur zu glücklich, einen solchen Verlag zu kaufen.
»Tut mir leid, daß ich mich verspätet habe.« Peter Holt setzte sich an den Tisch. »Du sagtest zwar, Diskretion sei unbedingt erforderlich, aber geht das nicht ein bißchen zu weit?« Er schnitt eine Grimasse.
»Mir wurde gesagt, das Essen sei erstaunlich gut.«
»Hoffentlich hast du recht«, sagte Peter mit Nachdruck. »Einen doppelten Gin und Tonic«, bestellte er bei dem wartenden Kellner. Crispin schürzte leicht verächtlich die Lippen. »Ich nehme an, hinter dieser ganzen Heimlichtuerei steckt ein Geheimnis, das du mir anvertrauen willst«, sprach er weiter, während er die Serviette auf seinen Knien ausbreitete und die Karte aufschlug.
»Möchtest du Wein zum Essen?« fragte Crispin ausweichend. Er wollte erst später über Geschäfte reden, weil er wußte, daß ihm diese Unterredung ein Genuß sein würde. »Aber natürlich – Rotwein, wenn du damit einverstanden bist.«
Crispin studierte die Weinkarte. Er hätte gern einen billigen Tafelwein bestellt, weil er keinen Wein trank, da er jedoch Peter für sich gewinnen wollte, entschied er sich für eine besonders teure Flasche Burgunder.
»Also, was gibt's Neues?« fragte Peter, während er ein Brötchen auf dem Tischtuch zerkrümelte.
Crispin mußte sich zwingen, diese Unsitte zu ignorieren. »Ich habe dich angerufen, Peter, weil ich – wie du weißt – immer den größten Respekt vor dir hatte und unserer Freundschaft höchste Wertschätzung beimesse.« Peter antwortete nichts, denn das war ihm neu. Er zwang sich statt dessen zu einem freundlichen Lächeln. »Ich habe mich an dich gewandt – nur an dich, möchte ich hinzufügen –, weil mir bald sehr viel an dem Interesse eines größeren Verlags liegen wird.«
»Du verläßt Westall?«
»Nein«, widersprach Crispin leicht verärgert. »Ich will damit sagen, daß ich bald der Chef von Westall sein werde. Seien wir doch ehrlich, Peter, die Zeiten der unabhängigen Verlage sind vorbei. Ich habe stets zu respektieren gewußt, was du und Phillip aus Shotters gemacht habt. Ihr seid die Aufsteiger par excellence im Verlagsgeschäft. Wir, die Familie, werden Westall verkaufen und hätten gern dich als Käufer. Damit verbinde ich natürlich ein oder zwei Bedingungen – einen Sitz im Vorstand, der Name Westall bleibt unter meiner Leitung. Im Impressum ...«
»Und einen Sack voll Geld«, sagte Peter lachend.
»Natürlich.« Crispin lehnte sich bewußt zurück, um keinen zu gierigen Eindruck zu machen.
»Der alte Knabe setzt sich also zur Ruhe und überläßt dir den ganzen Laden?«
Crispin zuckte nur mit den Schultern.
»Wann soll das geschehen?«
»Dazu möchte ich noch nichts sagen. Und es wäre mir lieb, wenn du mit keiner Menschenseele über diese Unterredung sprichst. Ich wollte dich nur informieren, damit du zum gegebenen Zeitpunkt in einer guten Ausgangsposition bist. Allein das Gerücht über einen bevorstehenden Kauf würde unweigerlich eine stürmische Nachfrage auslösen.« Er griff in seinen Aktenkoffer und schob eine schwarze Mappe über den Tisch. »Das sind die Verkaufszahlen des Verlags für die letzten zehn Jahre, plus Hochrechnung, plus Details über laufende Geschäfte.«
»Du gehst ein verdammt hohes Risiko ein, mir das alles zu geben.«
»Ich vertraue dir bedingungslos, Peter.« Crispin setzte sein charmantestes Lächeln auf.
»Tja, danke.« Peter steckte die Mappe in seinen Aktenkoffer. »Gut. Wo bleibt der Wein? Ich habe eine Regel, Crispin: Ich vermenge nie Essen mit Geschäft.«
Crispin mußte ihm zwangsläufig zustimmen, war jedoch enttäuscht. Peter klang ganz wie sein Onkel Julius.
Nach dem Mittagessen nahm Crispin ein Taxi zu Harrods. Er kaufte zwei Sea-Island-Baumwollhemden, seidene Socken und einen Karton mit Taschentüchern aus irischem Leinen. Dann betrat er eine Telefonzelle und machte drei Anrufe. Das erste Gespräch führte er mit dem Generaldirektor von Tudor Holdings UK, die englische Zweigstelle eines großen amerikanischen Verlagskonzerns; das zweite mit dem Vorstandsvorsitzenden von Pewter, dem größten der englischen Verlagsimperien. Dann rief er seinen Cousin, John Westall, an.
Kapitel 4
Peter manövrierte seinen Mercedes auf den für ihn reservierten Parkplatz vor dem großen Verlagshaus Shotters. Er sammelte seine Unterlagen zusammen, eilte in die Rezeption, nickte freundlich dem Mädchen hinter dem Schreibtisch zu und betrat den Lift, der direkt ins oberste Stockwerk in die weitläufige, weißgestrichene Empfangshalle der Chefetage fuhr. Sein Anblick löste hektische Aktivität aus. Em, seine Sekretärin, griff nach den Notizzetteln auf ihrem Schreibtisch und Ben, sein persönlicher Assistent, eilte ans Ende der Halle, um ihm die große Mahagonidoppeltür zu öffnen. Der grüne Anzug, den Ben heute trug, übertraf an Abscheulichkeit seine übliche Aufmachung, und die Frisur – über der Stirn gelockt und oben flach wie ein Brett, als hätte er die ganze Nacht auf dem Kopf gestanden – gefiel ihm auch nicht. Er beschloß mit Ben über dessen Aussehen zu sprechen, wußte jedoch, daß er es nicht tun würde. In Bens Alter hätte er jede Kritik abgelehnt, und er mochte den jungen Kerl – außerdem war er der intelligenteste Assistent, den er je gehabt hatte.
Mehrere Menschen saßen in den großen, bequemen, dunkelblauen Lederarmstühlen, die genau zu dem Blau des Teppichs paßten, der extra für Shotters mit dem Emblem – eine kleine Pistole in Gold – gewebt worden war. Peter hatte schon beim Entwurf des Teppichs erhebliche Zweifel angemeldet, war aber den Überredungskünsten seiner Frau und des zwitterhaften Designers nicht gewachsen gewesen und hatte um des lieben Friedens willen nachgegeben. Er gab zu oft nach, um Streit zu vermeiden, und haßte sich dann dafür. Es half ihm nichts, daß er jetzt jeden Tag mit Genugtuung feststellen konnte, daß er recht gehabt hatte: Der Teppich war abscheulich. Mit einem entschuldigenden Lächeln auf den Lippen eilte er an den Wartenden vorbei. Ein Blick auf seine Uhr zeigte ihm, daß er sich wieder einmal verspätet hatte.
Er ging durch die Tür, die Ben noch immer für ihn offenhielt, und betrat den riesengroßen Raum, der sein Büro war.
»Weißt du, Ben, ich bin durchaus fähig, eine Tür aufzumachen«, sagte Peter in einem ungewohnten Anflug von Ärger. »Wie bitte?« fragte Ben verwirrt.
»Ach, vergessen Sie es. Wer sitzt da draußen?« Verärgert über sich selbst, nickte er kurz in Richtung Empfangshalle. Es war das zweite Mal in dieser Woche, daß er Ben und Em angeschnauzt hatte. Das sah ihm nicht ähnlich. Vielleicht brauchte er einen Check-up oder Urlaub oder irgendwas anderes.
»Ihre zwei Verabredungen für halb drei und Viertel nach drei. Der für Viertel nach drei ist verdammt früh dran.«
»Ist wohl scharf auf einen Auftrag«, sagte Peter mit einem Grinsen, um sein schlechtes Benehmen wettzumachen. Er warf seinen Aktenkoffer auf seinen völlig überladenen Schreibtisch. Er legte sein Jackett ab und blätterte hastig die Zettel mit den telefonischen Nachrichten durch, die Em ihm gereicht hatte. »Was Wichtiges dabei?«
»Ihre Frau hat angerufen, um sie an den Opernbesuch heute abend zu erinnern. Sie kommt um sieben hierher. Joyce Armitage besteht darauf, mit Ihnen persönlich zu sprechen. Sie weigert sich, ihr Anliegen mit Gloria zu erörtern, die glaubt, es gehe wohl um die neue künstlerische Gestaltung ihrer Bücher«, erklärte Em entschuldigend. »Und ein Regisseur von BBC hat angerufen und gefragt, ob Sie Interesse daran hätten, in einer Sendung über das Verlagswesen aufzutreten. Ich habe ihm gesagt, Sie könnten erst am späten Nachmittag zurückrufen. Er ist bis sieben Uhr erreichbar. Der Rest kann warten.« Em klappte ihren Notizblock zu.
»Ich hasse Auftritte im Fernsehen«, klagte Peter.
»Denken Sie an die kostenlose Werbung. Vielleicht wird die Sendung hier aufgezeichnet – wir könnten die Neuerscheinungen hinter Ihrem Schreibtisch aufstellen«, sagte Ben aufgeregt und arrangierte im Geiste bereits Bücher und Plakate.
»Ich finde Sie wundervoll im Fernsehen«, sagte Em mit ihrem schüchternen Lächeln.
»Danke, Em – Sie und meine Mutter!« Er lachte. »Seien Sie ein Engel und bringen Sie mir eine Tasse Kaffee. Ich komme eben von einem der widerlichsten Mittagessen meines Lebens. Also, Ben, wer wartet da draußen?«
»Stone, von Stone und Salomon, mit den Layouts.«
»Wer?«
»Sie machen die Werbung für Bella Fords neues Buch.«
»Ach ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Sie wird allmählich ein heikles Miststück – zu anspruchsvoll.«
»Die Verkaufszahlen ihres letzten Buches steigen noch immer.«
»Ich wünschte mir fast, sie würde einen Flop landen, damit mir das Vergnügen gegönnt wird, ihr nächstes Buch abzulehnen. Ich verabscheue diese Frau. Bitte den Graphiker zu mir ins Büro. Bella geht in die Luft, wenn wir dieses Mal etwas verkehrt machen. Wer sonst noch?«
»Marsh von einer Public-Relations-Firma, die auf Werbung für Bücher spezialisiert ist. Und dann ist da noch ein junger Kerl, Chris Gordon, der einen Job sucht.«
»Schicken Sie ihn zur Personalabteilung.«
»Er sagt, seine Mutter habe Ihre Frau bei einem Wohltätigkeitslunch kennengelernt und er käme auf deren Empfehlung hin«, sagte Ben und verkniff sich ein Lächeln.
Peter lockerte verzweifelt seine Krawatte. Er wünschte, Hilary würde ihm nicht ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen aufhängen. Den jungen Mann nicht zu empfangen, hätte nur einen Streit zur Folge, also gab er wieder einmal nach. »Na gut, aber er muß warten, bis ich die anderen empfangen und meine Telefonate erledigt habe. Besorgen Sie mir Informationen über ihn – schauen Sie sich seinen Lebenslauf an. Rufen Sie Lorna an und fragen Sie sie, ob irgendwelche Jobs verfügbar sind. Gut. Sagen Sie Em, daß ich in fünf Minuten meinen Kaffee haben möchte.«
Nachdem Ben gegangen war, warf sich Peter der Länge nach auf das sechssitzige Sofa. Er schleuderte seine schwarzen Lederslipper von den Füßen, schloß die Augen, konzentrierte sich auf seine Zehen und entspannte sich völlig. Vier Minuten lag er so da und stand dann erfrischt auf. Es war ein Trick, den er als Student von einem Hypnotiseur bei einer Vorlesung über Parapsychologie gelernt hatte. Er funktionierte immer, obwohl er wußte, daß in den Vorzimmern eine Menge Witze darüber gemacht wurden. Er durchquerte den weitläufigen Raum, öffnete eine versteckte Tür in der Mahagonivertäfelung und betrat einen kleinen Duschraum. Er klatschte sich kaltes Wasser ins Gesicht, bürstete sein Haar, bemerkte ein paar silberne Fäden mehr in seinem ehemals blonden Haar, das allmählich mausfarbig wurde. Er inspizierte seine Fingernägel, zog sein Jackett an, drückte den Knopf an seinem Schreibtisch und begrüßte mit ausgestreckter Hand seinen ersten Besucher, der nervös das imposante Büro betrat.
»Stone ... bitte, entschuldigen Sie ... der Verkehr ... Zeigen Sie mir die Layouts ... Bella Ford ist begeistert ...«
Nach sechs Uhr hatte er den letzten Besucher aus seinem Büro komplimentiert. Er nahm aus der Aktentasche die Mappe, die Crispin ihm gegeben hatte, öffnete sie auf dem Schreibtisch und begann, die Zahlen zu studieren.
»Worum ging es denn bei diesem mysteriösen Lunch?« fragte Phillip Stern, sein Partner, der den Kopf zur Tür hereinsteckte, die in sein Büro führte.
»Komm rein, Phillip. Crispin führt nichts Gutes im Schilde ...« Er deutete auf die geöffnete Mappe.
Phillip stakste mit seinen langen, dünnen Beinen durchs Büro und warf einen Blick auf die Unterlagen.
»Ist es ihm ernst damit?« fragte er und ließ sich in einen Sessel plumpsen.
»Den Eindruck macht er zumindest. Er behauptet, wir wären die ersten, denen er den Tip gegeben hat ... der Verkauf stünde unmittelbar bevor. Er beansprucht einen Sitz im Vorstand, et cetera, et cetera ...«
»Setzt dieser widerliche Kerl auch nur einen Fuß durch diese Tür, bin ich draußen. Im Ernst!«
»Mach dir keine Sorgen. Obwohl ich zugeben muß, daß er verdammt gut in seinem Job ist, würde ich nie mit einem Arschloch wie ihm zusammenarbeiten. Man müßte dauernd auf der Hut sein, daß er einem nicht in den Rücken fällt.«
»Ich kann nicht glauben, daß sich der alte Julius zur Ruhe setzen will«, sagte Phillip kopfschüttelnd.
»Mir geht's genauso. Zweifelsohne weiß er nichts von diesem Angebot.«
»Ist er krank?«
»Das ist die einzige Erklärung, die mir dazu einfällt.«
»Und die Zahlen?«
»Schlimm.«
»Wieviel verlangt er?«
»Soweit sind wir nicht gekommen, aber den versteckten Andeutungen nach zu schließen, würde ich sagen, er denkt an ungefähr zwanzig Millionen.«
»Du machst Witze. Er ist verrückt!«
»Crispin ist ein kleines gieriges Arschloch. Er mißt dem Namen einen zu hohen Wert bei – was vielleicht in den achtziger Jahren gerechtfertigt war, aber jetzt nicht mehr.«
»Was ist der Verlag wert?«
»Ich habe erst einen flüchtigen Blick auf die Unterlagen geworfen. Natürlich ist da der Grundbesitz, und sie haben Gerald Walters und Sally Britain. Aber der Rest?« Peter stützte sein Kinn auf die Hände. »Was ist da sonst noch? Ehrenwerte literarische Verluste, die meiner Schätzung nach bei fünf Millionen liegen. Der Verlag muß auf Vordermann gebracht werden, braucht mehr Angestellte, mehr Autoren, mehr Geld – einen Haufen Geld. Der Verlag ist ein aussterbender Dinosaurier. Ein Wunder, daß er überhaupt so lange überlebt hat.«
»Julius muß ihn mit seinem Privatvermögen so lange über Wasser gehalten haben. Eine fatale Situation. Aber ohne ihn wird es nicht mehr dasselbe sein, nicht wahr?«
»Nein. Armer Julius. Ich gehe jede Wette ein, daß Crispin schon mit drei oder vier Verlagen gesprochen hat. Wir hätten als erste das Angebot bekommen, daß ich nicht lache!«
»Bestimmt hat er Kontakt mit Tudor Holdings aufgenommen. Mit wem sonst? Mit Sovereign?«
»Nein, ich tippe auf Pewter. Ich treffe Mike Pewter heute abend. Mal sehen, was ich aus ihm herausholen kann. Möchtest du einen Drink?«
»Nein, danke. Ich habe Eintrittskarten für die Stones. Milly wartet unten auf mich.«
»Philister.«
»Ganz recht, Partner, das bin ich und stolz darauf. Genieß deinen Verdi oder was auch immer ...«
Während Peter duschte, dachte er nach. Er konnte nie aufhören zu denken und zu planen und hatte sich schon vor langer Zeit damit abgefunden, daß er nicht einmal im Urlaub abschalten konnte. Sogar im Schlaf träumte er vom Geschäft.