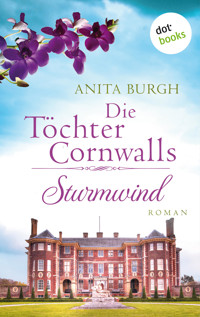Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Töchter Cornwalls
- Sprache: Deutsch
Der Auftakt einer Familiensaga über die Kraft der Freundschaft und Liebe: »Die Töchter Cornwalls: Morgenröte« von Anita Burgh als eBook bei dotbooks. England, 1898: Sie könnten nicht unterschiedlicher sein, doch sie werden unzertrennliche Freundinnen – bis eine Lüge sie zu Feindinnen macht … Alice Tregowan wächst behütet und sorglos als Tochter eines reichen Fabrikanten auf, als eine Zufallsbegegnung ihr eine bisher unbekannte Welt eröffnet: Ia Blewett ist die Tochter eines Arbeiters, der in den Zinnminen der Tregowan Company schuftet. Über alle Standesschranken hinweg verbindet die beiden Mädchen eine Freundschaft, die stärker ist als jede gesellschaftliche Konvention und Fessel. Doch dann lernt Alice Tregowan eines Tages einen jungen Mann kennen – und eine finstere Lüge reißt das Leben der beiden Freundinnen auseinander. Aber so sehr sie sich hassen sollten, ihr Schicksal scheint für immer miteinander verbunden zu sein … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Töchter Cornwalls: Morgenröte« ist der erste Band der berührenden Familiensaga von Anita Burgh. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
England, 1898: Sie könnten nicht unterschiedlicher sein, doch sie werden unzertrennliche Freundinnen – bis eine Lüge sie zu Feindinnen macht … Alice Tregowan wächst behütet und sorglos als Tochter eines reichen Fabrikanten auf, als eine Zufallsbegegnung ihr eine bisher unbekannte Welt eröffnet: Ia Blewett ist die Tochter eines Arbeiters, der in den Zinnminen der Tregowan Company schuftet. Über alle Standesschranken hinweg verbindet die beiden Mädchen eine Freundschaft, die stärker ist als jede gesellschaftliche Konvention und Fessel. Doch dann lernt Alice Tregowan eines Tages einen jungen Mann kennen – und eine finstere Lüge reißt das Leben der beiden Freundinnen auseinander. Aber so sehr sie sich hassen sollten, ihr Schicksal scheint für immer miteinander verbunden zu sein …
Über die Autorin:
Anita Burgh wurde 1937 in Gillingham, UK geboren und verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in Cornwall. Ihre 24 Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und feierten international Erfolge. Mittlerweile lebt Anita Burgh mit ihrem Mann und zwei Hunden in einem kleinen Dorf in den Cotswolds, Gloucestershire.
Bei dotbooks veröffentlichte Anita Burgh ihrer Romane »Das Erbe von Respryn Hall«, »St. Edith’s: Hospital der Herzen«, »Glückssucherinnen«, »Die Liebe eines Fremden«, »Wo deine Küsse mich finden«, »Das Lied von Glück und Sommer«, »Wo unsere Herzen wohnen«
Außerdem veröffentlichte Anita Burgh bei dotbooks ihre Familiensaga »Die Töchter Cornwalls« mit den drei Einzelbänden: »Morgenröte«, »Sturmwind« und »Dämmerstunde«
***
eBook-Neuausgabe Mai 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1989 unter dem Originaltitel »The Azure Bowl« bei Chatto & Windus, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1991 unter dem Titel »Die blaue Schale« bei Droemer Knaur.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1989 by Anita Burgh
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1991 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/riekephotos, SAKhanPhotography, Japan’sFireworks, vso
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-453-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Morgenröte« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anita Burgh
Die Töchter Cornwalls: Morgenröte
Roman
Aus dem Englischen von Traudl Weiser und Ingeborg Ebel
dotbooks.
Elizabeth Rose Vincent zum Gedenken
Erster Teil
Erstes Kapitel
1
Alice Tregowan hatte eine unkonventionelle Erziehung genossen. Etty, ihre Mutter, haßte sie. George, ihr Vater, schien sich ihrer Existenz nicht einmal bewußt zu sein.
So war es nicht immer gewesen. Früher einmal hatte Etty eine so enge Beziehung zu ihren Kindern gehabt, wie man es von einer reichen jungen Mutter im England des Jahres 1881 erwarten konnte, das heißt,, ihr pflichtbewußtes, jedoch nur halbherziges Interesse hatte deren Kleidung, Umgangsformen sowie ihrer Gesundheit und Ernährung gegolten. Jeden Tag zur Teestunde wurden die Kinder zum Spielen in ihr Boudoir gebracht, wo sie in träger Schönheit auf einer Chaiselongue lag und sich für die unvermeidlichen Anstrengungen eines weiteren Abends, der gesellschaftlichen Verpflichtungen galt, ausruhte.
Die Art der Kinderspiele hing vom Erschöpfungszustand der Mutter ab. Falls sie nicht zu müde war, konnte es geschehen, daß sie ihnen vorlas, mit ihnen Mikado oder manchmal sogar eine Runde »Happy Families« spielte. Doch meistens war sie zu müde und lag mit geschlossenen Augen da, die Hände kraftlos verschränkt auf ihrem Körper ruhend – einem üppigen Körper, der für ein paar kurze Stunden vom Käfig ihres Korsetts befreit und nun bequem in ein mit Spitzen besetztes und besticktes Negligé gehüllt war.
In diesem Fall wurde von den Kindern erwartet, daß sie leise spielten. Problematisch dabei war nur, daß der mit Möbeln überladene Raum jede Bewegungsfreiheit aufs äußerste einschränkte. Die kleinen Tische waren mit Kästchen, Fotografien in Silberrahmen und Nippes vollgestellt – alles kostbare Gegenstände, die von keiner Kinderhand berührt werden durften. In diesem Raum schien jedes nur erdenkliche Material vorhanden zu sein. Jade und Malachit wetteiferten mit Onyx, Lack mit Bronze; Kristall funkelte, Perlmutt schimmerte. Eisen und Messing bildeten Rahmenwerk. Spitze, Chintz, Brokat, Seide und Satin, gerüscht und gerafft, stritten um die Aufmerksamkeit des Betrachters. Die Vorhänge an den hohen Fenstern waren stets halb geschlossen, die Jalousien heruntergelassen, denn Lady Tregowan fürchtete, daß ein Sonnenstrahl ihren Alabasterteint ruinieren und ihr Gesicht mit Sommersprossen verunzieren könnte. Sommer wie Winter brannte im Kamin ein Feuer und überhitzte den Raum derart, daß sogar die Blätter der Palme, die in einem Kübel in der Ecke stand, trübe vor sich hinwelkten.
Alice fürchtete sich vor diesem Zimmer und davor, darin etwas zu zerbrechen, so wie sie sich vor ihrer Mutter fürchtete. In Gesellschaft war Etty eine schöne, anmutige, geistreiche und fröhliche Frau. Ihren Kindern war sie ein Rätsel. Einen Augenblick schenkte sie ihnen ihre volle Aufmerksamkeit, doch im nächsten Moment war sie über die Maßen verärgert und wies ihre Kinder von sich. Von einer Minute zur anderen wechselte ihre Stimmung. Alice gefielen die täglichen Besuche bei ihrer Mutter überhaupt nicht.
In ihrem Londoner Haus hatten die Kinder unter dem gläsernen Kuppeldach ihre Suiten – Schlaf- und Wohnzimmer, ein Schulzimmer, die Zimmer der Kindermädchen und eine winzige Küche, in der Toasts und heiße Schokolade zubereitet wurde. Die Einbauschränke reichten vom Boden bis zur Decke und waren zum Bersten mit Kleidung gefüllt, dem Besten, was das White-House-Geschäft zu bieten hatte. Jedes Spielzeug, das sich ein Kind nur wünschen konnte, war vorhanden.
In diesem Reich herrschte das Kindermädchen Queenie Penrose mit ihren zwei Gehilfinnen. Queenie mit ihrem fülligen Körper und üppigem Busen, der so weich wie das weichste Daunenkissen war, und deren großflächiges, gutmütiges Gesicht mit den runden Wangen rot wie ein Apfel glänzte. Queenie, deren Nacken nach Seife und Biskuits roch, bedeutete Wärme, Sicherheit und Liebe.
Etty betrat nur gelegentlich das Kinderzimmer – rauschte in ihren knisternden Seidenkleidern mit funkelnden Juwelen herein, verströmte den Duft eines teuren Parfüms und die huldvolle Freundlichkeit einer Königin aus einem weit entfernten Land.
Von den vergitterten Fenstern aus konnten die Kinder, wenn sie sich auf Zehenspitzen stellten, das geschäftige Treiben auf dem Platz unten beobachten, das je nach Tageszeit vom Kommen und Gehen der Lieferanten bestimmt wurde. Morgens erklang als erstes das Klappern der Kannen, aus denen die Milch, frisch von den Kühen im Hyde Park, in hohe, weiße, emaillierte Krüge geschöpft wurde, die von dem Küchenmädchen an die Tür gebracht wurden. Dann kamen der Briefträger, der Fleischerjunge mit dem quietschenden Handkarren, der alte Blumenverkäufer, der Fischverkäufer, der Garnelenverkäufer und die hübschen Obstverkäuferinnen. Später folgte der Leierkastenmann mit dem Äffchen, das biß. Und im Winter erklang die Glocke des Muffinverkäufers, der einen Hut trug, der so flach wie ein Brett war.
An den meisten Abenden, wenn es sich Queenie mit einem Krug Stout und einem Schauerroman in ihrem Zimmer gemütlich gemacht hatte, stahlen sich Alice und Oswald aus ihren Betten und kauerten an der Treppe. Dort spähten sie durch die Balustrade in das mit einem Drahtnetz geschützte Treppenhaus hinunter. Das Netz war gespannt worden, nachdem Oswald einen Spielzeugzug hatte hinunterfallen lassen, der nur um Haaresbreite den Kopf eines Lakaien verfehlte. Weit unten zischten die Gaslichter in ihren reichverzierten Messingleuchtern. Die Kinder beobachteten das Kommen und Gehen der Freunde ihrer Eltern wie durch das verkehrte Ende eines Teleskops. Die Kleider der Damen raschelten und knisterten. Die bauschigen Röcke waren mit Rüschen, Schleifen und Spitzenvolants geschmückt und im Rücken gerafft, so daß die Damen wie farbige Glocken dahinschwebten. Die Gäste bildeten auf dem schwarzweißen Marmorfußboden wie in einem Kaleidoskop ständig wechselnde Muster.
Wenn die Tregowans auf ihren riesigen Besitz in Berkshire reisten; folgten die Kinder mit den Dienstboten nach. Dort durften sie sich ausschließlich in ihren Quartieren aufhalten, doch die Kinderzimmer waren noch geräumiger, und sie genossen mehr Freiheit, denn sie spielten im Park und am Fluß und ritten begeistert auf ihren Ponies.
Der Besitz in Berkshire hieß Fairhall. Das ursprünglich in der Bauweise der Zeit Jakobs I. errichtete Haus war von einem Vorfahren der Tregowans niedergerissen und im klassischen georgianischen Stil wiederaufgebaut worden, bis die jetzige Generation mit ihrer Vorliebe für das Moderne umfangreiche Veränderungen hatte vornehmen lassen und die ehemals perfekten Proportionen mit Strebepfeilern, Zinnen, Spitzbögen und Kuppeln verschandelt worden waren. Nur im Inneren konnte ein aufmerksamer Betrachter noch gelegentlich einen klassischen Bogen, die Überreste eines Säulenganges oder den Teil eines eleganten Kaminsimses entdecken, die der Zerstörung entgangen waren.
In diesem Haus gab es keine kleinen Räume. Einer schien größer als der andere zu sein. An der Dekoration war nicht gespart worden. Die mit Stuck verzierten Decken leuchteten in Karmesin- und Blautönen und waren reichlich mit Blattgold verziert. Holz- und Balkenwerk schmückten Schnitzereien, die jedes nur erdenkliche Tier und mythische Gestalten darstellten. Riesige Gemälde von modernen Künstlern hingen an den Wänden. Die Möbel ergänzten den pompösen Rahmen – ein Büfett war so groß wie ein Baum, der Speisezimmertisch bot Platz für ein Bataillon.
Die längste Zeit des Jahres stand das Haus in seiner stillen, grotesken Pracht leer, doch wenn die in Mode gekommenen Parties veranstaltet wurden, wimmelte es darin von Leuten. Etty und George liebten Gesellschaften im großen Stil und bewältigten die damit verbundenen Aufgaben mit Nonchalance. George Tregowan war auf sein neues Haus so stolz wie auf seine Frau. Als physisch sehr attraktiver Mann, doch von beschränkter Intelligenz, beobachtete er versonnen seine schöne Frau, die glänzender Mittelpunkt jeder Gesellschaft war. Etty war ihm geistig weit überlegen, aber er bewunderte ihre Klugheit. Für ihn war sie ein wunderschönes, kluges Kind, dem er jeden Wunsch erfüllen wollte und dessen Launenhaftigkeit er mit Nachsicht ertrug. Auf sehr diskrete Weise – die ihr gesellschaftlicher Status verlangte – waren sie einander untreu. Er hatte seinen Sohn, also duldete er ihre Abenteuer. Er dachte weder an Liebe, noch sprach er davon: derlei Sentimentalitäten entsprachen nicht seinen Vorstellungen von männlicher Würde. Auch wenn er viele Liebschaften hatte, galt Etty seine unverbrüchliche Loyalität.
Einmal im Jahr, im Frühjahr, fuhren die Familie und Queenie, Ettys Zofe, Georges Kammerdiener und Phillpott, der Butler, quer durch die Stadt nach Paddington und bestiegen ihren privaten Salonwagen für die Reise zu ihrem anderen Besitz im Westen.
Ihr Waggon wurde an den regulären Zug angekoppelt, in dem weniger bedeutende Leute reisten. Alice liebte diese Reise. Aufgeregt lauschte sie dem Zischen und Fauchen der Lokomotive im Bahnhof, die ungeduldig auf die Abfahrt zu warten schien. Der Salonwagen war mit rotem Plüsch, Gold und glänzendem Mahagoni ausgestattet. Winzige Öllämpchen verbreiteten sanftes Licht, und die goldenen Troddeln an ihren Schirmen schaukelten im Rhythmus des fahrenden Zuges. Der Salonwagen war wie ein Miniaturhaus auf Rädern, wo in der kleinen Küche Phillpott ihre vorgekochten Speisen wärmte.
Alice liebte diese Reise so sehr, daß ihr Ende nur durch die Vorfreude auf Gwenfer erträglich war. Ihr und ihrem Bruder war Gwenfer das liebste Heim von allen.
Gwenfer. Es lag, vor der Außenwelt verborgen, zwischen zwei hohen Klippen, die der Wind umbrauste und deren Fuß von Wogen gepeitscht wurde. Auf den Felsenspitzen wuchsen keine Bäume, denn ihre Wurzeln fanden in dem kargen Boden nicht genug Halt, um den Herbst- und Winterstürmen zu widerstehen. Nur Ginster und Weißdorn klammerten sich in den Felsrissen fest. Doch im Frühjahr und im Sommer entflammten die kahlen Klippen in den Farben des Wilden Knoblauchs, Immergrüns, Fingerhuts und zahlreicher anderer Blumen. Dann wurden sie von Bienen, Schmetterlingen und Libellen umschwirrt, deren unvergleichliche Pracht die Buntheit der sommerlichen Farbenpalette ergänzte. Die Landschaft davor wurde von den Fördertürmen einer Zinnmine beherrscht.
Eine schmale Straße führte im Zickzack durchs Gestrüpp und dann durch ein Eisentor, das nie geschlossen und von zwei Säulen flankiert war, auf denen schon seit Jahrhunderten riesige steinerne Falken thronten. Die Straße schlängelte sich gefährlich steil an den Granitabhängen der Klippen entlang und gab den Blick auf das weit unten liegende Tal frei. Purpurne, pinkfarbene und weiße Rhododendronsträucher säumten die Klippenstraße. Pralle Hortensien standen kurz vor der Blüte, und wilde Rhabarberpflanzen, mannshoch und mit armdicken Stielen, versprachen für den Sommer kühlen Schatten unter riesigen Blättern.
Ursprünglich war Gwenfer ein Cottage, dann eine Farm gewesen. Im Mittelalter war es zunächst zum Herrenhaus und dann zur Ritterburg ausgebaut worden, doch heute, wo es in seiner Größe den Reichtum der Tregowans repräsentierte, war es im ganzen Land nur unter dem Namen Gwenfer bekannt. George Tregowan wäre vielleicht wie seine Vorgänger versucht gewesen, den Besitz zu vergrößern, hätte die Natur das nicht verhindert. Das Haus lag am Ende eines Tales und wurde zu beiden Seiten von den hoch aufragenden Klippen eingegrenzt. Da die Gemäuer aus Granit bestanden, schien es direkt aus den Felsen emporzuwachsen.
Etty kam nur mit stillschweigendem Dulden nach Gwenfer. Es war zu weit von London und der Gesellschaft entfernt. Es war auch für ihre Ansprüche zu klein. Die Anzahl der unerschrockenen Freunde, die sie zu der weiten Reise überreden konnte, mußte auf fünfzehn beschränkt werden, obwohl für Etty zu einer erfolgreichen Hausparty mindestens dreißig Gäste gehörten.
Für das Haus bedeutete es einen Glücksumstand, daß Etty es nicht möchte, denn so blieb es von ihren »Verbesserungen« verschont. Die Wandtäfelung, der Verputz und die großen, steinernen Kamine in den hohen Räumen blieben im Originalzustand erhalten. Die Möbel stammten noch von den elisabethanischen Vorfahren ihres Mannes. Kein überflüssiger Plunder verschandelte Gwenfer. Die Wände blieben weiß, und ihr einziger Schmuck waren Gobelins und Familienporträts. Es gab kein Gas, deswegen spendeten große Wandleuchter und Öllampen ein warmes Licht. Die hohen Flügeltüren führten auf eine weite Terrasse hinaus, an die sich Gärten anschlossen, die Etty nicht künstlich hatte gestalten lassen und die sich bis ins Tal erstreckten, wo ein kleiner Fluß zum Meer strömte. Auch wenn das Meer in Nebel gehüllt war, sogar bei ruhigstem Wetter, konnte man in jedem Zimmer des Hauses das Rauschen der Wellen und das Donnern der Brecher gegen die Felsen hören. Die Gischt spritzte hoch auf, und die Wassertropfen bildeten im Sonnenlicht zarte Regenbögen.
Das Meer, die wilden Gärten und die umliegenden Moore waren für Alice und Oswald das Paradies.
Dieses Leben nahm für Alice an dem Tag, an dem Oswald ertrank, eine dramatische Wende.
Alle waren der Ansicht, daß, was in der Folge geschah, unfair war, denn Alice war nicht bei Oswald gewesen, als dieser sich allen Ermahnungen mim Trotz auf die felsige Spitze der kleinen Bucht vorgewagt hatte, um dort zu fischen. Die gierige See hatte den Jungen mit einer einzigen mächtigen Welle mühelos vom Felsen gerissen, und niemand hatte seine Schreie gehört. Drei Tage hatte das Meer mit ihm gespielt, ehe es seinen zerschmetterten Körper ans Ufer spülte, als wäre es seiner überdrüssig geworden.
Lady Tregowans gebrochener Ehemann versuchte das Unmögliche – den Schock zu mildern, daß ihr Erstgeborener tot gefunden worden war. Die Dienstmädchen suchten hastig Zuflucht in ihren Zimmern und steckten weinend ihre Köpfe unter die Kissen, um das entsetzliche Klagegeschrei ihrer – Herrin auszusperren. Ettys Schreie hallten durch die langen Korridore, die dunkle Eichentreppe hinunter und wurden von den Granitwänden der großen Halle geschluckt, so wie die Schreie der Freude und des Schmerzes von längst verstorbenen Tregowans verhallt waren.
Alice, kaum fünf Jahre alt, war verwirrt, furchtsam und unglücklich. Zu jung, um die Endgültigkeit des Todes zu begreifen, wartete sie geduldig auf die Rückkehr ihres älteren Bruders. Sie wartete zusammengekauert, vergessen in der herrschenden Panik, und fürchtete sich vor den schrecklichen Lauten, die aus dem Zimmer ihrer Mutter drangen. Sie war todunglücklich, denn instinktiv ahnte sie, daß nichts mehr so wie früher sein würde.
In der von Atlantikstürmen umtosten Kirche auf den Klippen, die dort trotzig den Naturelementen Widerstand bot, wurde die Familiengruft geöffnet und Oswalds kleiner Sarg im Beisein seines Vaters, des ortsansässigen Landadels, der Dienstboten und einer Handvoll Minenarbeiter neben den Särgen seiner Vorfahren beigesetzt.
Kaum war die Beerdigung vorbei, gab Etty Anweisung, ihre Koffer zu packen und die Kutsche vorzufahren. Von Kopf bis Fuß in tiefstes Schwarz gehüllt, schwebte sie die Treppe hinunter, sprach mit niemandem ein Wort und bestieg die Kutsche. Starr, ihr Gesicht ein gespenstisches Schemen unter dem dichten Schleier, saß sie da. Sie starrte geradeaus und sah nicht das weiße, tränenüberströmte Gesicht ihrer Tochter am Fenster der Halle.
»Verlaß mich nicht!« rief Alice und hämmerte mit ihren kleinen Fäusten gegen das dicke Glas. Aber ihre Mutter hörte sie nicht.
Der Kutscher knallte mit der Peitsche, und das schwerfällige, altmodische Gefährt setzte sich in Bewegung.
Etty blickte nicht zurück.
An diesem Abend verlangte George, seine Tochter zu sehen. Er stand mit dem Rücken zum Kamin in seinem Arbeitszimmer, hatte ein großes Glas mit Whisky in der Hand und betrachtete das puppenhafte Wesen mit dem langen blonden Haar, das von einer blauen Schleife zusammengehalten wurde. Große, ernste graue Augen erwiderten seinen Blick. Beide fühlten sich äußerst unbehaglich. Für Alice war ihr Vater ein großer, stattlicher Mann, den sie selten sah und mit dem sie nie gesprochen hatte. Für George war Alice nur das zweitgeborene Kind – eine Tochter obendrein – gewesen, von der er kaum Notiz genommen hatte. Sein Interesse hatte ausschließlich Oswald gegolten, und jetzt war Alice alles, was ihm geblieben war.
»Alice, deiner Mutter geht es nicht gut«, platzte er heraus.
»Ach, Papa, nein!« Das kleine Gesicht verzerrte sich ängstlich.
»Sie wird sich wieder erholen. Dann schicken wir nach dir«, fügte er hastig hinzu, denn er fürchtete, das kleine Mädchen könnte anfangen zu weinen.
»Wann, Papa?«
»Das weiß ich noch nicht.« Er wandte ihr den Rücken zu und starrte ins Feuer. Alice wußte, daß sie entlassen war.
Vom Fenster ihres Zimmers aus beobachtete das kleine weiße Gesicht, wie dieses Mal ihr Vater die Kutsche bestieg, und hörte das Knallen der Peitsche.
»Ich wette, er fährt nach London zurück.« Queenie rümpfte mißbilligend die Nase und nahm ihren Schützling in die Arme.
2
Queenie irrte sich. Georges Kutsche polterte quer durchs Moor nach Bodmin, zum Besitz seiner Schwester Maude Loudon.
Maude und er waren früher unzertrennlich gewesen, doch seit seiner Heirat vor zehn Jahren hatte sich ihre Beziehung abgekühlt. Maude war immer gegen Etty gewesen. Um des lieben Friedens willen hätte Maude Gefühle heucheln können, die sie nicht empfand, doch das widerstrebte ihr, und mit der ihr eigenen Offenheit hatte sie aus ihrer Ablehnung kein Hehl gemacht. Sie wußte, daß sie im Recht war und daß ihr Bruder in der Wahl seiner Frau einen schrecklichen Fehler gemacht hatte, denn in Maudes Augen war Etty ein hohlköpfiges Wesen, das George unweigerlich zugrunde richten würde.
Es hätte keine gegensätzlicheren Frauen geben können. Etty lebte nur für die Gesellschaft. Ihre Leidenschaften waren ihre Kleidung, ihre Schönheit, der Klatsch und Männer. Maude dagegen widmete ihr Leben ihrem Mann, ihren Kindern und der Jagd – nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Maude wäre es nie in den Sinn gekommen, die Führung ihres Hauses einem Verwalter und einer Haushälterin zu übertragen. Maude kontrollierte täglich die Speisekammer, wußte genau, wie viele Gläser Marmelade und Eingemachtes in den Regalen standen, und zählte persönlich die Laken und Kissenbezüge. Es war Maude, die die Haushaltsbücher führte und ihr kleines Reich mit Effizienz regierte. Sie wußte, wer auf ihrem ausgedehnten Besitz krank oder in Schwierigkeiten war. Sie kannte die Namen und Geburtsdaten aller Kinder, die nach ihrer Ankunft in Loudon House geboren worden waren. Ihre Pächter verehrten sie; ihre Kinder fürchteten sie.
Seit zwanzig Jahren sorgte sie für ihren Mann Marmaduke, kurz Marmie genannt, und für alles, was ihm wichtig war. In dieser Zeit hatte sie ihm elf Kinder geboren, wovon neun überlebt hatten. Die spärliche Freizeit, die ihr blieb, widmete sie der Jagd. Stolz prahlte sie mit der Behauptung, daß es keinen Knochen in ihrem Leib gäbe, den sie sich nicht auf der Jagd gebrochen hätte. Es war ihre Hoffnung, daß ihr Leben einmal ein schnelles und ordentliches Ende auf der Jagd finden möge. Jetzt war sie vierzig, eine stämmige, in ihrer Pflichterfüllung zufriedene Frau, und nichts erinnerte mehr an das hübsche, schlanke Mädchen, das vor so vielen Jahren Gwenfer verlassen hatte.
Als sich die Kutsche Loudon House näherte, fragte sich George, warum er hierher reiste. Etty würde sein Vorhaben nicht gutheißen. Jetzt hegte er starke Bedenken wegen seines spontanen Entschlusses, denn er hatte vor seiner Schwester immer Angst gehabt, wie er sich eingestehen mußte. Wie würde sie ihn empfangen? Warum wandte er sich mit seinen Problemen ausgerechnet an Maude? Seine schönen Gesichtszüge verfinsterten sich, während er angestrengt nachdachte – was nicht zu seinen hervorragenden Eigenschaften zählte. Blutsbande, das war es. Blut ist dicker als Wasser, jeder wußte das. Diese Erkenntnis heiterte ihn auf, und der finstere Ausdruck verschwand von seinem Gesicht.
Als er eine halbe Stunde später im Salon von Loudon House seiner Schwester gegenüberstand – die jetzt zehn Jahre älter und von matronenhafter Korpulenz war, jedoch ebenso unfreundlich und selbstzufrieden wirkte wie bei seinem letzten Besuch fühlte er sich wieder einmal völlig verunsichert.
»George, mein lieber Freund«, brach Marmie das beklommene Schweigen und ging mit ausgestreckter Hand auf seinen Schwager zu. Er hatte ihn während der vergangenen Jahre vermißt, denn für Marmie war George ein guter Schütze, ein angenehmer Gesellschafter und ein wackerer Zechkumpan.
»Marmie, lieber Sportsfreund. Du bist ganz der Alte geblieben.« Dankbar griff George nach der ausgestreckten Hand. »Du auch, George, alter Junge.«
»Wenn ihr zwei mit eurer gegenseitigen Bewunderung fertig seid, könnte uns George vielleicht höflichkeitshalber mitteilen, was ihn nach all den Jahren hierhergeführt hat«, sagte Maude scharf, so scharf, daß beide Männer sofort schuldbewußt auseinandergingen.
»Ich stecke etwas in der Klemme«, begann George. Maude starrte ihn kalt an. »Ich bin gekommen, um deinen Rat einzuholen«, fügte er hastig hinzu.
Es gab nichts, was Maude lieber tat, als Ratschläge zu erteilen. Ihre Lippen verzogen sich zu einem schmalen Lächeln, denn Maude war zu lebenserfahren, um nicht zu ahnen, daß ihr Bruder etwas von ihr wollte.
Maude hieß George in einem Ohrensessel vor dem prasselnden Kaminfeuer Platz zu nehmen. Mit einem erleichterten Seufzer setzte er sich und akzeptierte dankbar den großen Whisky, den Marmie ihm reichte. Er spürte, wie die drückende Last der Verantwortung von seinen Schultern genommen wurde, und entspannte sich. Er hatte recht gehabt, hierherzukommen: Maude würde alles arrangieren, so wie sie es schon als Kind getan hatte.
Maude setzte sich in einen Sessel George gegenüber und ergriff die Initiative.
»Ich habe von Oswalds Tod erfahren, George. Eine schreckliche Tragödie. Wir waren beide schockiert. Aber unter den gegebenen Umständen hielt ich es fürs beste, fernzubleiben. Ich wäre natürlich gern zur Beerdigung gekommen, jedoch ...« Sie machte eine anzügliche Pause. »Nun, du kennst ja die Situation.« Maude war noch nicht bereit, ihre ablehnende Haltung aufzugeben.
»Dein Brief ... ich danke dir. Das war sehr freundlich ...« Maude wartete ungeduldig, daß George endlich mit seinem Anliegen herausrückte, und trommelte nervös mit ihren Fingern auf die Sessellehne. »Es geht um Etty«, platzte er schließlich heraus und sah sie mit einem leidvollen Blick an.
Maude versteifte sich und richtete sich kerzengerade auf. Ihr üppiger Busen wogte, als sie tief Luft holte, um ihre Nerven zu beruhigen. Ihr Mann füllte hastig noch einmal die Gläser.
»Ich bezweifle, daß ich dir bezüglich dieser Person einen Rat geben kann.« Maudes Stimme war stählern vor Kälte.
George sah den Groll im Gesicht seiner Schwester und wußte, daß er mit Maude niemals über seine Angst um Etty sprechen konnte – ihm wurde bewußt, wie töricht dieser Gedanke gewesen war. Hilflos und voller Verzweiflung hatte er in den letzten Tagen mit ansehen müssen, wie Etty immer tiefer in einem Meer von Kummer versank, aus dem er sie nicht zu retten vermochte. Er hatte sich an Ettys Launenhaftigkeit erinnert, die ihn oft verärgert und gleichzeitig ergötzt hatte. Jetzt befürchtete er allerdings, daß diese Launen nur Vorboten einer depressiven Stimmung gewesen waren. Er nahm einen großen Schluck Whisky. Es hatte keinen Sinn, Maude diese Gedanken anzuvertrauen.
»Nun, eigentlich geht es nicht um Etty, sondern um Alice.« Zufrieden bemerkte er, wie sich Maude entspannt zurücklehnte.
»Alice?«
»Etty trauert schrecklich um Oswald. Sie möchte nicht ... es ist schwierig für sie ... Es scheint ihr Qualen zu bereiten, ihre Tochter um sich zu haben ... wenigstens im Augenblick«, fügte er hastig hinzu.
Maude preßte die Lippen zusammen, was ebenso Mißbilligung wie Verständnis bedeuten konnte. George sah seine Schwester unsicher an, und als sie nichts sagte, redete er weiter.
»Alice ist jetzt allein auf Gwenfer, Maudie. Ich muß zu Etty und halte es für besser, das Kind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mitzunehmen.«
»Hat Alice Mumps gehabt?«
»Mumps? Ich habe keine Ahnung. Da müßte ich das Kindermädchen fragen.«
»Wir haben hier Mumps. Die Hälfte der Kinder auf dem Gut und zwei meiner eigenen sind krank. Wenn sich die anderen anstecken, kann es Monate dauern, bis wir nicht mehr unter Quarantäne stehen. Und dann muß ich Letitia nach London begleiten; um sie in die Gesellschaft einzuführen.«
»Letitia ist Debütantin? Großer Gott, ist sie schon so alt? Wie die Zeit verfliegt.«
»Ja, George, die Zeit verfliegt, und Nichten und Neffen werden erwachsen«, sagte Maude anzüglich, als wollte sie ihn für seine lange Abwesenheit tadeln. »Sie ist siebzehn, und wir hegen große Erwartungen für sie. Aber ich wollte eigentlich sagen, daß Alice sofort zu uns kommen kann, wenn sie schon Mumps hatte. Wenn nicht, muß sie warten, bis die Krankheit abgeklungen ist, was frühestens Ende des Sommers sein wird. Kann sie bis dahin in der Obhut ihres Kindermädchens bleiben?«
»Du nimmst sie also zu dir?«
»Aber natürlich.«
»Ich weiß nicht, für wie lange es sein wird, Maude. Ich weiß nicht, wie lange Ettys Trauer dauern wird ...« George zuckte mit einem hilflosen Ausdruck die Schultern.
»Die Zeit spielt keine Rolle, George. Alice kann für immer bei uns bleiben. Sie ist unsere Nichte, und daher ist es unsere Pflicht, uns um sie zu kümmern, nicht wahr, Marmie?«
»Versteht sich von selbst, George, alter Junge. Blutsbande und das alles« sagte Marmie mit rauher Stimme. Georges’ Nachricht betrübte ihn, denn er hatte immer eine Schwäche für Etty, das hübsche kleine Ding, gehabt. Sie war ein hohlköpfiges Wesen, gewiß, aber wer wollte schon eine geistreiche Frau? Allein der Gedanke an ihren Busen trieb Marmie den Schweiß auf die Stirn, und er wischte sich mit einem weißen Taschentuch darüber.
»Das wäre also erledigt.« Endlich schenkte Maude George ein breites Lächeln. Sie hätte gern hinzugefügt, daß sie keine Ressentiments gegen Alice hatte, denn das arme Kind konnte schließlich nichts dafür, daß Etty seine Mutter war. Sie hätte ihrem Bruder auch gern gesagt, daß sie wußte, daß Alice nicht nur vorübergehend, sondern auf Dauer zu ihr kommen würde. Maude hatte immer vermutet, daß Ettys Lebhaftigkeit und Launenhaftigkeit Anzeichen eines exzentrischen Wesens waren. Doch die Verzweiflung ihres Bruders hielt sie ausnahmsweise davor zurück, ihre Meinung auszusprechen. »Du bleibst natürlich über Nacht«, sagte sie statt dessen.
3
Meerwasser sickerte durch die Felsen. Reuben wußte, das Meer war da; er konnte es riechen. Trotz Staub, der Hitze und dem Geruch nach Schweiß, dem Geruch der Angst der Männer, war das Meer da. Reubens Magen verkrampfte sich. Seit achtundzwanzig Jahren, seit dem Tag, als er mit elf Jahren stolz mit seinem Vater ins Bergwerk gegangen war, lebte er mit diesen Magenkrämpfen und der Angst – jede Stunde, jede Schicht, die er unter Tage arbeitete.
Vorsichtig betastete er die feuchten Felsen über seinem Kopf. »Gott sei Dank«, murmelte er, als er spürte, daß nur wenig Wasser hindurchsickerte.
Es wurde jedes Jahr schlimmer. Je unergiebiger die Erzadern an der Erdoberfläche wurden, um so tiefer trieben die Minenarbeiter Stollen unter das Meer, und so wurde das Risiko täglich größer, denn nur der Fels trennte sie vom Gewicht des Atlantiks, der über ihren Köpfen toste. Reuben liebte das Meer nicht. Wie die meisten Menschen, die in seiner Nähe lebten, fürchtete er es. Reuben hatte zu viele Männer gekannt, die darin ertrunken waren, um das Meer nicht als Feind zu sehen. Er hatte in Stollen gearbeitet, in denen er das Tosen des Meeres hatte hören können. Das waren die schlimmsten Schichten gewesen. Er hatte sich beim Obersteiger darüber beschwert, doch der hatte ihn ausgelacht und ihm gesagt, daß er sich das nur einbilde, denn niemand könne in dieser Tiefe das Rauschen des Wassers durch die Felsen hindurch hören. Reuben wußte es besser. Das Meer war nur wenige Meter über ihm und wartete darauf, ihn zu verschlingen.
Reuben machte eine Pause, klebte die Kerze auf seinem Helm mit einem Klumpen Lehm fest und rief seinem Sohn, Paul, der erst seit kurzem unter Tage arbeitete, zu, daß es Zeit für die Essenspause sei. Reuben knotete sein Taschentuch auf und teilte die Pastete. In dem trüben Licht konnte er nicht erkennen, womit sie gefüllt war, und als er daran schnupperte, fluchte er leise. Wieder nur Zwiebeln und Kartoffeln, kein Fleisch. Paul steckte seine Hälfte der Pastete in die Tasche und kroch zu seinen Kameraden zurück.
Die älteren Männer aßen schweigend. Sie waren erschöpft, zu erschöpft für die Witze und das Geschwätz der Jungen, an dem sie auch Vergnügen gefunden hatten, als sie noch jung und unverbraucht gewesen waren.
Reuben saß allein. Er war nie beliebt gewesen. In seiner Jugend hatte es ihm noch etwas ausgemacht, daß die anderen ihn mieden. Aber das war vor langer Zeit gewesen, jetzt bekümmerte es ihn nicht mehr. Trotzdem war es ihm ein Rätsel geblieben. Die Ablehnung der anderen hatte nichts mit seiner Arbeit zu tun. Als Kumpel wurde er geachtet und genoß das Vertrauen der Kameraden. Manchmal fragte er sich, ob sein Ausgeschlossensein etwas mit seiner Angst vor dem Meer zu tun hatte, denn er fuhr nie mit den anderen zum Fischen hinaus. Er wäre oft gern dabeigewesen, wenn beim Auftauchen der Schwärme von Seebarben die Männer zu ihren Booten liefen, am Strand Freudenfeuer angezündet wurden und die ganze Dorfgemeinschaft das Ereignis feierte. Aber Reubens Furcht vor dem Meer war so groß, daß ihm sogar der Anblick von den Klippen aus Angst einjagte. Denn Reuben wußte, daß das Meer ihm den Tod bringen würde. Aber er konnte diese Angst nicht erklären. Und wenn er fähig gewesen wäre, den anderen seine Gefühle mitzuteilen, wäre er wohl nur zur Zielscheibe ihres Spotts geworden. Zum Teufel mit ihnen, dachte Reuben.
Er wußte, daß sich seine Zeit dem Ende näherte. Er war jetzt beinahe vierzig und hatte sich trotz der harten Arbeit gut gehalten. Auch er war von Unfällen nicht verschont geblieben, aber er hatte keine ernsthaften Verletzungen wie andere davongetragen, denen die Beine zertrümmert oder die Köpfe von herabfallenden Felsen eingeschlagen worden waren. Doch seine Zeit war fast vorbei; sein Körper rächte sich für die unerträgliche Schinderei, die er ihm abverlangt hatte. Jeden Morgen fiel es ihm schwerer, seine Glieder in Bewegung zu setzen. Steife Glieder bedeuteten erhöhtes Risiko – das Risiko, nicht schnell genug vor hereinbrechenden Gefahren davonlaufen zu können und für die Ewigkeit unter der Erde verschüttet zu werden. Reuben wußte nicht genau, was er mehr haßte – das Meer oder die dunkle, feuchte Mine. Es besteht kein großer Unterschied zwischen beiden, dachte er, während er die Überreste der Pastete in sein Taschentuch einwickelte und in der Dunkelheit mit den Händen nach einer trockenen Stelle tastete, wo er sein Essen bis zum Ende der Schicht aufbewahren konnte.
Er schwang seinen Pickel. Es lagen noch Stunden harter Arbeit vor ihm, und dann kam der lange Weg im Kriechgang zurück zur Leiter am Einstiegsschacht und das mühsame Hinaufklettern an die Erdoberfläche– 90 bis 120 Meter hoch. Das gibt jedem Mann nach der Schicht den Rest, dachte Reuben. Es gab Minen, in denen die Verwaltung Förderkörbe für die Arbeiter eingerichtet hatte, aber die existierten in dieser Mine nicht, das war ein zu großer Luxus, solange dieser Bastard Tregowan der Hauptaktionär war.
Reubens Haß auf die Mine und das Meer wurde nur noch von seinem Haß auf Tregowan übertroffen. Bei dem Gedanken an diesen Mann spuckte Reuben einen großen Klumpen Schleim und Staub aus. Reuben haßte Tregowan und die anderen Teilhaber. Er haßte diese fetten, reichen Schweine, die sich von den Früchten seiner Arbeit und seiner Angst ernährten.
Reuben stand im Miners Arms wie gewöhnlich etwas abseits von den Männern seiner Schicht. Sie waren alle mit Staub und Schweiß bedeckt. Die Hitze im Raum durchdrang ihre feuchten Kleider, und jeder Mann verströmte eine eigene Dunstwolke.
Der Raum war lang und schmal; der Tabakrauch hatte die Wände bräunlich gefärbt. Eine große Öllampe hing in der Mitte des Raums und schwang jedesmal wie betrunken im Luftzug, wenn die Tür geöffnet wurde. Dabei entwichen Rauchschwaden, die sich mit dem Gestank der schwitzenden Körper vermischten. Auf der langen Holztheke stand ein Bierfaß. Ein paar Kerzen steckten in leeren Flaschen und verbreiteten ein trübes flackerndes Licht in dem düsteren Raum. Am einen Ende der Theke spielten die jungen Minenarbeiter Shuffleboard mit Halbpennystücken, rissen Witze und maßen ihre Kräfte beim Armdrücken. Am anderen Ende standen die Männer aus Reubens Schicht, ihre Unterhaltung war gedämpft und sorgenvoll: Nathan Zennen hatte ein Gerücht gehört. Trotz ihrer Erschöpfung umdrängten ihn die Arbeiter, um Näheres zu erfahren. Die Tochter einer Cousine von Nathans Frau arbeitete im Haus des Obersteigers.
»Mrs. Johnsons Dienstmädchen erzählte es der Köchin, die es unserer Emmie erzählte, daß davon gesprochen wird, die Creamer- und Crossways-Stollen zu schließen«, verkündete Nathan, paffte seine Pfeife und wartete auf die Reaktion der Männer.
»Was? Aber das würde das Ende für die Bal Gwen bedeuten.« Ungläubiges Gemurmel breitete sich aus.
»Sie müßte geschlossen werden.«
»Wahrscheinlich. Außer wir fördern mehr Zinn oder finden Kupfer.«
»Scheiße! In der Mine gibt es kein Kupfer. Da könnt ihr noch so tief graben, ihr werdet keins finden«, knurrte der alte Dibden und spuckte auf den Boden.
»Was glauben diese Scheißkerle eigentlich, was wir da unten tun? Unsere Ärsche kratzen? Wenn da mehr Zinn rauszuholen wäre, würden wir es doch tun, oder?« fragte Hendon Trelawn wütend. Reuben hörte zu und trank einen Schluck Bier aus seinem Krug.
»Was wissen diese fetten Bastarde überhaupt vom Bergbau? Geld zählen, ja, Geld können sie gut zählen!« Nathan spuckte auch auf den Boden.
»Wenn sie die Mine schließen, woher wollen sie dann ihr Zinn kriegen? Beantworte mir die Frage. Wir brauchen Zinn. Jeder weiß das. Die Trewlin- und First-Stollen sind nicht unerschöpflich«, sagte Hendon aggressiv.
»Vielleicht steigen sie aus«, meinte Nathan geheimnisvoll.
»Aussteigen ...?«
»Red keinen Unsinn ...«
Die Männer äußerten geräuschvoll ihre Skepsis.
»Vielleicht stecken sie ihr Geld lieber in Länder wie Malaya, wo die armen Chinesen für noch weniger Lohn arbeiten als wir«, erklärte Nathan.
»Malaya? Ich habe noch nie von einer Mine namens Malaya gehört.«
»Das ist ein Land, Hendon, du Dummkopf. Irgendwo in Asien. Ich habe darüber gelesen. Scheint dort eine Menge Zinn und Kupfer zu geben. Und die Arbeitskräfte sind spottbillig«, erklärte Nathan geduldig und paffte dabei seine Pfeife.
Da diese Information von dem einzigen Mitglied ihrer Gruppe kam, der lesen konnte, verstummten die Männer. Dem geschriebenen Wort hatten sie nichts entgegenzusetzen.
Reuben starrte mürrisch in seinen Krug. Es war sein drittes Bier heute abend, und er hatte es bis zu diesem Augenblick genossen. Obwohl er die Mine haßte, konnte er sich ein Leben ohne Bal Gwen nicht vorstellen. Die Bal-Gwen-Mine hatte seit Menschengedenken existiert. Reubens Vater und Großvater und Urgroßvater hatten in der Mine gearbeitet. Das rhythmische Stampfen der Pumpmaschinen im Moor bildete den Hintergrund ihres Daseins. Ihr Schweigen käme einem Verstummen des Meeres gleich, dachte Reuben und kippte den Rest seines Ales hinunter.
»Ich gehe«, brummte er vor sich hin, denn er wollte nichts mehr hören.
Draußen, auf der verlassenen Straße, lehnte er sich gegen die Mauer des Pubs, schaute zum Himmel hoch und verfluchte Gott. Wenn er nur seine Angst vor dem Meer hätte überwinden können. Die anderen Minenarbeiter hatten Boote und konnten mit Fischfang ihr Einkommen aufbessern. Doch Reubens Angst war zu groß, und er hatte deswegen seinen Anteil am Boot seinem Bruder überlassen und nur die Schultern gezuckt, als es Ishmail verkauft hatte, um von dem Erlös seine Überfahrt nach Amerika zu bezahlen. Warum hatte er nicht auf seinen Bruder gehört, der versucht hatte, ihn zum Mitkommen zu überreden, und ihm gesagt hatte, daß in den Zinnminen keine Zukunft lag? Reuben hatte nur gelacht und gesagt, daß er hier geboren worden war und hier sterben würde. Wie es jetzt aussah, würde er wohl eher den Hungertod anstatt an Altersschwäche sterben. »Verdammter Tregowan«, fluchte er und schleuderte einen Stein nach einem ausgemergelten Hund, der es wagte, seinen Weg zu kreuzen. Der Stein verfehlte sein Ziel, worauf Reuben noch lauter fluchte. Seine Mutter hatte recht gehabt: Er hätte die ihm zustehende Parzelle annehmen und darauf Gemüse anpflanzen und ein Schwein großziehen sollen – wie es viele taten. Reubens Einwände waren plausibel gewesen – er arbeitete hart genug in der Mine und hatte nicht die Absicht, sich das Rückgrat nach Ende der Schicht beim Umgraben des Bodens zu brechen. Eine vernünftige Begründung, solange es genug Arbeit gab, doch jetzt drohte ihm Arbeitslosigkeit. Vielleicht sollte er den Obersteiger um Zuteilung einer Parzelle bitten.
Er spuckte aus – dafür gab es viele Anwärter, und er müßte eine lange Wartezeit in Kauf nehmen. »Bastard Tregowan!«
Reuben hatte letzten Monat, als er vom Tod von Tregowans Sohn gehört hatte, kurz Mitleid mit dem Mann gehabt. Jetzt freute er sich über dieses Unglück und hoffte, Tregowan möge selbst ins Meer stürzen und ertrinken. Unsicher schwankte er über das Kopfsteinpflaster, bog dann von der Straße ab und stolperte über das Ödland zu der Minensiedlung, die ein Stück vom Dorf entfernt errichtet worden war.
In anderen Gemeinden waren Minenarbeiter angesehene Handwerker, doch nicht auf Tregowans Besitz. Hier mied man ihre Nähe, als würden sich die Leute ihrer schämen.
Die klapprige Haustür krachte gegen die Wand und drohte aus den Angeln zu brechen, als Reuben wütend dagegentrat. Er polterte in den Wohnraum der Hütte.
»Essen«, brüllte Reuben.
Nervös schöpfte Ada Blewett aus einem großen schwarzen Topf auf dem gußeisernen Herd die wäßrige Suppe in einen Teller, stellte ihn vor ihren Mann auf den Tisch und legte ein Stück Brot daneben.
»Was ist denn das?« Er starrte seine hochschwangere Frau an, deren Brüste schwer über ihren angeschwollenen Leib hingen. Ihr Gesicht war grau vor Erschöpfung, Angst und Unterernährung.
»Suppe«, entgegnete sie mit zitternder Stimme.
Reuben rührte mit dem Löffeln darin herum. »Suppe nennst du dieses Spülwasser?« schrie er seine verängstigte Frau an. »Ich schufte mich zu Tode, und du setzt mir diesen Schweinefraß vor.«
»Aber, Reuben, ich habe doch kein Geld«, klagte sie.
»Geld! Geld! Wenn die Gerüchte stimmen, wirst du bald überhaupt kein Geld mehr haben.« Er hob den Löffel an den Mund und schlürfte geräuschvoll. »Verdammt noch mal!« Er spuckte die Suppe quer über den Tisch. Mit einer einzigen Bewegung schleuderte er den Löffel und den Suppenteller durchs Zimmer. Der Teller traf Adas Stirn, der Löffel ihren Mund, und die heiße Suppe durchnäßte ihr zerschlissenes, aber sauberes Kleid, das sich über ihrem Leib spannte. »Sie ist versalzen, du nutzlose Schlampe!« brüllte er. Mit einem Handgriff warf er den Tisch um und stürzte sich auf seine Frau, die bereits schützend die Arme über ihren Kopf hielt, um die Schläge abzuwehren, die jetzt unweigerlich auf sie niederprasseln würden.
Ada war an Reuben gewöhnt. Jede Woche verprügelte er sie ein- oder zweimal. Wie ein Tier, das durch Jahre der Mißhandlung gegen Schmerzen unempfindlich geworden war, wartete sie auf die Schläge. Ada hatte sich resigniert in ihr Schicksal ergeben und ertrug die Prügel mit dumpfer Gelassenheit. Sie verstand ihren Mann, verstand seine Frustration – wie hart er für so wenig Lohn arbeiten mußte. Sie kannte die schrecklichen Gefahren, denen er jeden Tag ausgesetzt war, und sie kannte die Angst, die ihren Mann innerlich auffraß. Sie wußte, daß diese Angst mit jedem Tag, den er älter wurde, wuchs. Sie hätte es ihrem Mann übelnehmen können, daß er einen Großteil dieses kargen Lohns; von dem sie die ganze Familie ernähren mußte, für Bier vergeudete. Doch sie tat es nicht und verstand ihn. Was blieb einem Mann denn von seinem Leben?
Der Schlag traf Adas Schläfe. Ihre zwei jüngsten Söhne kauerten schreiend in einer Zimmerecke. Ihr Vater trat nach ihnen. Er taumelte, als sie aus dem Zimmer und vor seinem Zorn flohen. Mary, seine einzige Tochter, trat vor ihn und versuchte mit einer für ein so mageres Mädchen erstaunlichen Kraft, ihren Vater aufzuhalten.
»Laß meine Mam in Ruhe«, schrie sie und zerrte ihren Vater am Jackenärmel, der weiter auf ihre Mutter einschlug. Reuben drehte sich um und schlug mit der geballten Faust nach Mary.
Die Prügelei wäre wohl wie gewohnt verlaufen, hätte sich Ada nicht instinktiv schützend vor ihre Tochter gestellt. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und stürzte. Da trat Reuben mit seinen schweren Stiefeln auf sie ein.
Glücklicherweise wurde Ada sofort ohnmächtig und spürte die schmerzhaften Tritte in ihren Leib nicht mehr. Reuben war außer sich vor Wut über das zusätzliche Maul, das es bald zu füttern galt.
Als Ada wieder zu sich kam, kauerten ihre Kinder schreiend neben ihr, denn sie hatten gefürchtet, ihre Mutter wäre tot. Als Ada die Augen öffnete, verstummten die Schreie und wichen einem erleichterten Schluchzen. Bei der ersten Bewegung durchfuhr ein entsetzlicher Schmerz Adas Leib. Mit jeder Wehe wurde der Schmerz größer. Ada ahnte, daß das Kind in ihrem Bauch um sein Leben kämpfte.
»Schnell, Paul, hol Mrs. Rosslyn«, sagte sie keuchend zu ihrem ältesten Sohn. Der Junge rannte aus der Hütte und quer über das Ödland zum Dorf.
Mrs. Rosslyn kam zu spät. Nach ein paar weiteren schmerzhaften Wehen umklammerte Ada Marys Hand.
»Es kommt, Mary. Ich kann’s nicht länger zurückhalten.«
»Oh, Mam, warte, bitte, warte«, flehte Mary.
Ada schrie auf, und aus ihrem Leib glitt ein Kind auf den schmutzigen Fußboden. Es kam drei Wochen zu früh und schrie lauter als jedes andere Kind, das Ada geboren hatte.
»Mam«, sagte Mary aufgeregt. »Es ist ein Mädchen.«
Der Anblick ihrer kleinen Schwester schien Mary zu beleben, denn sie ergriff die Initiative. Sie befahl ihren Brüdern, Wasser von der Pumpe in der Gasse zu holen, nahm eine Schere aus der Schublade im Küchenschrank und suchte in einer Schachtel auf dem Regal nach einer Schnur. Rasch band sie die Nabelschnur an zwei Stellen ab und durchschnitt sie. Dann holte sie aus dem Wäscheschrank ein vom vielen Waschen zerschlissenes Leintuch, wickelte das Baby damit ein und reichte es seiner Mutter.
»Oh, Mam, jetzt habe ich endlich eine Schwester«, sagte Mary völlig außer sich vor Aufregung und Freude über dieses wunderbare Erlebnis.
»Falls das Würmchen am Leben bleibt«, seufzte Ada.
»Sie wird leben, Mam. Hör nur, wie sie schreit«, antwortete Mary lachend.
Ada ließ sich erschöpft zurücksinken und schrie vor Schmerz auf, als die Nachgeburt abging. In diesem Augenblick trat Mrs. Rosslyn ins Zimmer.
Mrs. Rosslyn und Mary wuschen Ada, so gut es ging, und richteten ihr ein provisorisches Lager auf dem Fußboden. Reuben lag schnarchend auf dem einzigen Bett im Zimmer und schlief seinen Rausch aus.
»Gib mir die Schale, Mary.« Ada deutete zum Kaminsims. Darauf stand eine azurblaue, mit hellroten Rosen bemalte Schale. Sie war das einzige schöne Stück, das Ada besaß. Die Schale erinnerte sie an glücklichere Tage, als Reuben sie noch geliebt und ihr die Schale geschenkt hatte. Er hatte sie auf einem Fest in St. Just gewonnen. Mary reichte ihr die Schale und nahm das Baby auf den Arm. Mit vor Erschöpfung zitternder Hand suchte Ada nach Geld.
»Nein, Mrs. Blewett. Ich nehme kein Geld. Schließlich war die Arbeit schon getan, als ich kam. Mary war die Hebamme, nicht wahr?« Die rundliche, gutmütige Frau lächelte beide an. »Schaut sie euch an. Ist sie nicht bereits eine perfekte kleine Mutter?«
Mary war dünn, aber groß für ihre zehn Jahre. Sie saß auf der Bettkante, wiegte das Baby in den Armen und summte dabei leise.
»Wie wollen wir sie nennen, Mam?«
»Du hast sie entbunden, Mary, also darfst du auch den Namen auswählen«, sagte ihre Mutter.
Mary betrachtete das Baby lange nachdenklich. »Ich würde sie gern Ia nennen.«
»Das ist ein hübscher Name, Mary. Man hört ihn heutzutage nicht mehr oft. Bestimmt ist es der Name einer Heiligen.«
»Ja, er ist hübsch, nicht wahr? Und es wird ein hübsches Mädchen, also braucht es auch einen hübschen Namen.«
Mrs. Rosslyn betrachtete das Baby skeptisch. Die Blewett-Familie zeichnet sich nicht gerade durch Schönheit aus, dachte sie, sammelte ihre Utensilien ein, verabschiedete sich und eilte so geschäftig hinaus, wie sie gekommen war.
Ada wußte zu der Zeit noch nicht, daß Reubens Tritte etwas Gutes bewirkt hatten. Sie konnte keine Kinder mehr empfangen. In Zukunft, wenn Reuben nachts ungeschickt nach ihrem Körper griff, ertrug sie ohne Angst seine Nähe. Es würde keine weiteren Münder geben, die es zu füttern galt.
4
In Gwenfer wartete Alice, die noch nicht Mumps gehabt hatte, auf eine Nachricht von ihren Eltern, die sie zur Rückkehr nach London aufforderte. Sie wußte nichts über den Besuch ihres Vaters in Bodmin. Aber der Frühling wich dem Sommer, und als die frühherbstlichen Tage anbrachen, war noch immer kein Telegramm eingetroffen.
Nach den ersten paar Wochen vermißte Alice ihre Eltern, die immer nur schattenhafte Gestalten in ihrem Leben gewesen waren, nicht mehr. Es mangelte ihr nicht an Gesellschaft, denn sie hatte Queenie und die beiden Kindermädchen, die Haushälterin und die Köchin. Außerdem waren da noch die Dienstmädchen, die Lakaien, die Stallburschen und die Gärtner. Ein kleines Heer von Menschen kümmerte sich um Alices Wohlergehen und überschüttete sie mit Aufmerksamkeit.
Aber Oswald vermißte Alice sehr. Sie sehnte sich nach seiner Rückkehr und betete jede Nacht, Gott möge ihn ihr zurückschicken. Oft wanderte sie allein zum Meer hinunter und setzte sich auf ihren Lieblingsfelsen – in sicherer Entfernung vom Wasser, denn aus Oswalds Tragödie hatte sie gelernt, dem geliebten Meer nicht zu trauen. Obwohl Oswalds Körper in der Familiengruft lag, wußte Alice, daß sein Geist hier an dem Platz weilte, an dem er am glücklichsten gewesen war. Daran hegte sie nie den geringsten Zweifel. Ihr Lieblingsfels lag dem Klippenvorsprung gegenüber, von dem ihn die Woge in die Tiefe gerissen hatte. Dort saß Alice oft und erzählte ihrem Bruder, was sie gegessen, welche törichten Sachen Queenie gesagt und welche Witze sie gehört hatte. Neben diesen Belanglosigkeiten erzählte sie ihm aber auch von ihrer Einsamkeit und ihrer Sorge darüber, daß ihre Eltern sie vergessen haben könnten. Manchmal mußte sie während ihrer Gespräche mit Oswald weinen, lernte aber, auch das zu akzeptieren, denn sie fühlte sich hinterher viel wohler. Allmählich gewöhnte sie sich an die Tatsache, daß Oswald für immer von ihr gegangen war, aber die Gespräche mit ihm machten sie glücklich.
Im September kam schließlich eine Nachricht, aber nicht von ihren Eltern, sondern von ihrem Onkel und ihrer Tante aus Bodmin. Alices Taschen wurden gepackt, und das Kind war außer sich vor Aufregung. Alice konnte nicht verstehen, warum Queenie und die Kindermädchen weinten, als sie ihr in die Kutsche halfen. Alice weinte nicht, denn sie fuhr in die Ferien.
Bis der Brief kam, hatte Alice wenig über diese Verwandten gewußt, nur daß nie über sie gesprochen wurde. Jetzt erfuhr sie Näheres über ihren Onkel und ihre Tante und ihre neun Cousins, angefangen von Letitia – frisch verlobt – bis zur fünfjährigen und damit gleichaltrigen Gladys. Alice hatte außer ihrem Bruder keine anderen Kinder gekannt und war trotz aller Scheu vor dieser Begegnung ganz aufgeregt vor Freude, endlich Freundschaften schließen zu können. Unter ihren Cousins war vielleicht ein Kind, das ihr Oswald ersetzen könnte.
Auf Loudon wurde sie von der ganzen Familie im Salon erwartet. Scheu betrachtete Alice ihren Onkel und ihre Tante. Das freundliche Gesicht ihres Onkels wurde von dem mächtigsten Backenbart eingerahmt, den sie je gesehen hatte, und sie mochte ihn auf Anhieb. Dann blickte sie ihre Tante an, sah die kleinen schwarzen Augen in dem teigigen Gesicht, den schmalen Mund, das kantige Kinn und wußte sofort, daß diese Frau zu fürchten war.
Alice knickste höflich. Dann gab sie ihren Cousins die Hand. Die älteren lächelten sie freundlich an; Letitia küßte sie sogar. Die jüngeren kicherten, und die jüngste streckte ihr hinter dem Rücken der Eltern die Zunge heraus. Alice beantwortete nervös die Fragen ihrer Tante, die sich ausschließlich für ihre Mutter zu interessieren schien.
Alice atmete erleichtert auf, als die ganze Kinderschar aus dem Salon geschickt wurde, und schloß sich den jüngeren an, die hintereinander einem Kindermädchen hinauf in das obere Stockwerk folgten.
Die Kinderzimmer unterschieden sich erheblich von ihrer gewohnten Umgebung. An den Fenstern hingen keine hübschen Vorhänge, die Wände schmückten keine Bilder, und es gab nur wenig Spielzeug. Die Stühle waren hart, und der Fußboden bestand aus blanken Brettern. Das Bett, das man ihr zeigte, war aus Eisen, worauf eine rauhe, graue Decke lag. Ihr Bett in Gwenfer war weißgestrichen und hatte hübsche Musselinvorhänge und eine weiße Daunendecke. Auf Alice machte das alles einen äußerst deprimierenden Eindruck. Am schlimmsten jedoch war die Kinderfrau, die das Regiment über die Kindermädchen führte und in ihrer Strenge Alices Tante ähnelte.
Zum Tee gab es Brot, Marmelade und Wasser. Weder Kuchen noch Törtchen oder heiße Schokolade. Alice hatte bisher keine Ahnung gehabt, daß Menschen sich derart kärglich ernähren konnten. Sie wußte nicht, daß Maude Loudon ganz strikte Theorien über die Erziehung von Kindern vertrat: Sie behandelte sie wie ihre Pferde – ließ sie füttern, tränken und säubern. Wenn sie ungezogen waren, half gewöhnlich eine Strafpredigt, und in schlimmeren Fällen sorgte die Peitsche für Zucht und Ordnung.
Nach dem kärglichen Imbiß trennten sich die Kinder. Alice blieb mit den zwei jüngsten im Zimmer. Kaum war das Kindermädchen hinausgegangen, trat Gladys, die Jüngste, Alice gegen ihr Schienbein.
»Wir wollen dich hier nicht haben«, lispelte Gladys. »Warum bist du gekommen?«
»Dummkopf, du weißt doch, warum sie hier ist! Ihre Mutter ist übergeschnappt und haßt sie. Deswegen ist sie zu uns gekommen. Ihr Pech!« sagte Gladys’ Bruder Albert altklug. Alice wußte darauf keine Antwort und entschloß sich zu handeln. Prüfend musterte sie Gladys, dann Albert und entschied sich für den Jungen. Sie stürzte sich auf ihn, trat ihn kräftig gegen das Bein, versetzte ihm ein paar Faustschläge, wie Oswald es ihr beigebracht hatte, und warf ihn zu Boden, wo er völlig entgeistert ob dieses überraschenden Angriffs liegenblieb. Dann nahm sich Alice seine Schwester vor, spuckte sie an, zerkratzte ihr Gesicht und riß ihr ein Büschel Haare aus.
»Meine Mutter ist krank, nicht verrückt. Wag ja nicht mehr, so über sie zu reden«, fauchte sie mit zusammengepreßten Zähnen. »Hier bleibe ich nicht«, rief sie, als die Tür aufflog und eine ganze Schar von Kindermädchen, gefolgt von den Geschwistern, hereinstürmte. Das Geschrei war derart ohrenbetäubend, daß Alice ein wenig angst und bange vor dem Chaos wurde, das sie angerichtet hatte.
»Warum hast du das getan, du undankbares kleines Miststück?« schimpfte die Kinderfrau, packte Alices Handgelenk und drehte ihr den Arm auf den Rücken. Schnell wie der Blitz trat Alice der Frau gegen ihr Schienbein und biß gleichzeitig in die Hand, die sie festhielt. »Du boshaftes kleines Biest! Du kommst sofort mit zur Herrin.«
Gefolgt von der ganzen empörten Familie, wurde Alice durch die Gänge zum Zimmer ihrer Tante gezerrt. »Ruhe!« befahl Maude sofort. Das Gezeter verstummte abrupt. »Will mir jetzt jemand den Grund für dieses Geschrei erklären?«
»Sie hat mich gekratzt und an den Haaren gezogen. Und sie hat Albert geschlagen«, klagte Gladys.
»Warum hat sie das getan? Alice, sag es mir.«
»Ich möchte nach Hause. Hier gefällt es mir nicht.«
»Du kannst nicht nach Hause, weil dies hier jetzt dein Zuhause ist«, erklärte Maude geduldig. »Ich habe deinem Vater versprochen, dich zu uns zu nehmen, solange deine Mutter krank ist – falls nötig, bleibst du für immer.«
Da fing Alice an zu schreien. Sie wurde geschüttelt und angeschrien, aber sie schrie weiter. Der Arzt wurde geholt, aber sie schrie nur noch lauter. Dann brachte man sie ins Bett, obwohl es noch hell war, und erst als die Tür geschlossen wurde, hörte sie auf zu schreien – erschöpft und mit schmerzendem Hals. Sie schaute sich im Zimmer um und überlegte, was das Schlimmste wäre, was sie anstellen könnte. Sie nahm den Wasserkrug vom Waschtisch und warf ihn auf ihr Bett. Dann wickelte sie sich in die Decke, legte sich auf den Boden, weinte leise vor Sehnsucht nach Queenie..
Als man am Morgen Alices nasses Bett entdeckte, ohrfeigte das Kindermädchen sie zweimal. Alice war außer sich vor Wut –niemand hatte sie je geschlagen. Sie schlug zurück. Das wütende Kindermädchen rief nach der Kinderfrau, die ihrerseits die Herrin holen ließ. Beim Anblick ihrer Tante fing Alice wieder an zu schreien.
Mehrere Tage weigerte sich Alice zu essen und schrie bei jeder Gelegenheit. Nachts durchnäßte sie ihr Bett mit dem Wasser aus dem Krug. Maude Loudon wußte sich keinen Rat mehr. Trotz ihrer langjährigen Erfahrung mit Kindern und Pferden wurde sie mit Alice nicht fertig. Sie beklagte sich bei ihrem Mann, daß ihr Bruder ihr hätte sagen sollen, daß auch Alice verrückt sei. Niemand fragte das Kind nach dem Grund für sein Verhalten. Jeder wollte es nur mit Schreien zur Vernunft bringen. Auch wenn man Alice danach gefragt hätte, wäre es ihr wahrscheinlich unmöglich gewesen, eine Erklärung abzugeben – ihre Sehnsucht nach Queenie wäre vielleicht auf Verständnis gestoßen, und auch ihre Angst, daß sie die Nachricht von ihren Eltern hier nicht erhalten würde, aber Maude mangelte es bestimmt an Phantasie, um das Bedürfnis des Kindes nach Oswalds Anwesenheit zu begreifen. In Gwenfer war er immer dagewesen, aber hier konnte ihn Alice nicht erreichen.
Nach einer Woche wurde eine triumphierende, wenn auch erschöpfte Alice zu einer überglücklichen Queenie zurückgebracht.
»Ich werde dich nie verlassen«, schwor sie ihrem Kindermädchen. Dann nahm sie ihr gewohntes Leben wieder auf. Sie wartete.
5
Etty war bereits in London, als George dort ankam. Er fand das Personal in einem Zustand größter Bestürzung vor. Ettys Benehmen war – milde ausgedrückt – merkwürdig. Zu jeder Tages- und Nachtzeit ließ sie sich Essen auf ihr Zimmer bringen. Zum Frühstück verlangte sie Roastbeef und mitten in der Nacht Eier mit Speck. Die Speisen wurden selten gegessen. Sie weigerte sich, in ihrem Bett zu schlafen, und verbrachte die Nächte statt dessen eingehüllt in eine Pelzdecke in einem Sessel. Manchmal heulte sie wie ein Tier, so laut, daß Spaziergänger auf der Straße verwundert stehenblieben und zu den Fenstern des herrschaftlichen Wohnhauses hinaufblickten. Etty war leidend und krank und verfiel zusehends.
Beim Personal war der Wahnsinn der Herrin Tagesgespräch. Einige empfanden Mitleid mit ihr, doch die Mehrzahl, vor allem jene, die täglich ihre Ausbrüche ertragen mußten, waren der Ansicht, daß die Herrin allmählich wieder zu Sinnen kommen könnte. Der Umgang mit ihr war so schwierig geworden, daß sogar die Haushälterin und der Butler die Meinung des gemeinen Personals teilten. Doch am schlimmsten war, daß auch den Bediensteten der anderen Herrenhäuser Gerüchte über den wirren Geisteszustand von Lady Tregowan zu Ohren kamen. Es schadete dem Status des Personals der Tregowans, mit diesen Klatschgeschichten in Verbindung gebracht zu werden.
Wegen der Trauerzeit war zunächst nur dem Haushalt das Ausmaß der Krankheit bewußt. Doch eines Morgens beschloß Etty, einen Spaziergang im Park zu machen und begann sich plötzlich zum Entsetzen ihrer Zofe auszuziehen, tanzte über den Rasen, verstreute ihre Kleidungsstücke und sang eine wehklagende Melodie dazu. Die Zofe hüllte ihre Herrin rasch in ihren Mantel und brachte sie nach Hause. Da entschied George, daß es besser wäre, seine Frau in die Abgeschiedenheit ihres Besitzes in Berkshire zu bringen.
Es schien eine gute Entscheidung zu sein. In Fairhall trat allmählich eine Besserung in Ettys Verhalten ein. Drei Wochen lang gab es keine Szenen. Niemand wagte zu hoffen, daß die Krise überwunden sei, denn alle fürchteten einen Rückfall. Der ganze Haushalt schien den Atem anzuhalten.
George schöpfte wieder Hoffnung, als seine Frau ihre Schneiderin kommen ließ. Allerdings bestellte sie keine Kleider in den Farben Mauve oder Grau, wie die Etikette es jetzt erlaubt hätte. Statt dessen waren alle neuen Kleider tiefschwarz – er fürchtete, daß ihre Trauer nie enden würde. Doch dann schlug Etty eine kleine Dinnerparty mit ihren engsten Freunden vor. Der Abend verlief ohne Zwischenfall. Am erfreulichsten war jedoch, daß sie wieder anfing, über ihre Tochter zu sprechen.
Weihnachten stand bevor, und es war Etty, die vorschlug, Alice kommen zu lassen. Jeder im Haus, angefangen von ihrem Mann bis hinunter zum Küchenmädchen, glaubte, daß sich mit Alices Ankunft das Leben wieder normalisieren würde. Alle atmeten auf. Ein Brief wurde an Queenie geschickt.
Alice war die einzige, die nicht überrascht war – sie hatte immer gewußt, daß ihre Eltern eines Tages nach ihr schicken würden. Zusammen mit ihren Kindermädchen bestieg sie den Zug nach London. Dieses Mal fuhren sie nicht in einem privaten Salonwagen, sondern wie andere Fahrgäste in einem normalen Eisenbahnwaggon. Queenie hatte einen großen Korb auf ihrem Schoß, denn sie vertraute der Haltbarkeit der Gepäcknetze nicht. Queenie fühlte sich bei Bahnreisen stets unbehaglich und fürchtete, der Zug könne bei der für sie ungeheuren Geschwindigkeit entgleisen.
Alice hatte keine Angst und hätte am liebsten während der ganzen Fahrt nach London ihren Kopf zum Fenster hinausgestreckt. Queenie verbot ihr dieses Vergnügen und erzählte Geschichten von Reisenden, die durch Funken von der Lokomotive erblindet waren oder, noch schlimmer, denen die Köpfe von Brückenpfeilern abgerissen worden waren.
Alice freute sich auf den Augenblick, wo Queenie ihren Picknickkorb öffnen und sie die Sandwiches verzehren würden. Mit den Händen zu essen war ein viel größeres Vergnügen als die formellen Mahlzeiten, die bei Reisen mit ihren Eltern im Salonwagen serviert wurden. Alice genoß diese Fahrt in vollen Zügen.
In Fairhall angekommen, inspizierte Alice sofort ihre Zimmer. Sie war glücklich, ihre Spielsachen wiederzuhaben, die –sie in den vergangenen Monaten sehr vermißt hatte. Erstaunt bemerkte sie, daß das Fort ihres Bruders zusammen mit den Hunderten von Bleisoldaten verschwunden war. Das enttäuschte sie zutiefst. Während der Fahrt hatte sie sich schon ausgemalt, wie sie damit spielen würde, denn Oswald hatte ihr stets verboten, seine Sachen anzurühren. Auch seine Bücher, sein Schmetterlingsnetz und sogar sein Schaukelpferd waren verschwunden.
Im Stall fand sie ihr Pony wieder, das mangels Bewegung fett geworden war. Oswalds schwarzes Pony konnte sie nirgends entdecken. Als sie den Stallburschen danach fragte, wich er ihrem Blick aus, kaute verlegen an einem Strohhalm und sagte schließlich schroff: »Es wurde verkauft.« Es sei schließlich nicht seine Aufgabe, erzählte er später den anderen Stallburschen, dem kleinen Mädchen zu erzählen, daß die Herrin befohlen hatte, das Pony zu erschießen. Queenie verschwieg Alice, daß Oswalds Spielsachen im Hof verbrannt worden waren.
Das Spielzeug war verschwunden und das Pony tot, damit kein anderes Kind Freude daran haben konnte – das hatte Etty in ihrem Wahn beschlossen.
Am ersten Abend im Haus ihrer Eltern kleidete Queenie Alice mit besonderer Sorgfalt. Ihre Petticoats wurden noch einmal gestärkt, die Volants an ihrem Rock dreimal gebügelt, bis Queenie zufrieden war. Alices blondes Haar wurde mit der Brennschere gelockt und mit einer großen roten Schleife verziert, die farblich zu der Schärpe ihres neuen Kleides paßte.
Alice zitterte vor Erwartung. Neben der Freude, ihre Eltern wiederzusehen, hegte sie auch große Hoffnung – da Heiligabend war –, unter einem Weihnachtsbaum eine Menge Geschenke vorzufinden. Im letzten Jahr war ihre Familie zum erstenmal dem Beispiel der Königin gefolgt und hatte einen mit Kerzen geschmückten Weihnachtsbaum aufgestellt. Alice hatte der Anblick dieses Baums in helle Begeisterung versetzt.
Es gab keinen Baum. Das war die erste Enttäuschung.
»Mama! Papa!« rief sie glücklich. Ihre Aufregung über dieses Wiedersehen ließ sie ihre Scheu vergessen, mit der sie normalerweise ihren Eltern begegnete. Alice lief quer durch den großen Salon auf ihre Eltern zu.
Etty sprang von ihrem Sessel auf und streckte abwehrend die Hände aus. Starr und verkrampft stand sie da, eine häßliche Grimasse verzerrte ihre feingeschnittenen Gesichtszüge.
»Etty, bleib ganz ruhig«, sagte ihr Mann sanft und legte eine Hand auf ihren Arm. Etty reagierte, als wäre sie gestochen worden, und schüttelte ärgerlich seine Hand ab.
»Fröhliche Weihnachten, Mama. Ich habe dir ein Geschenk aus Penzance mitgebracht.« Das Kind lächelte unschuldig. Etty wich nur stumm vor ihrer Tochter zurück, die ihr ein hübsch verpacktes Päckchen hinhielt.