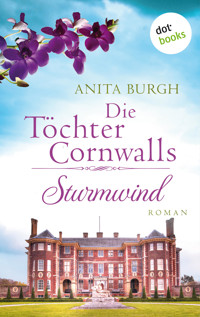Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nur wenn wir loslassen, können wir fliegen: der gefühlvolle Liebesroman »Die Liebe eines Fremden« von Anita Burgh jetzt als eBook bei dotbooks. Nach dem Tod ihres geliebten Ehemanns bricht für Ann eine Welt zusammen: Nie wieder, glaubt sie, wird sie Liebe und Geborgenheit in den Armen eines Mannes verspüren können. Bei einem Besuch in der Tate Gallery in London begegnet sie zufällig dem charmanten Alex – und sofort verspüren beide eine tiefe Faszination füreinander, als würden sie sich schon ein Leben lang kennen. Zögerlich erst, dann immer leidenschaftlicher umwirbt Alex sie und bietet Ann ein luxuriöses Leben in seiner griechischen Heimat: ein Leben, das sie sich nie zu erträumen wagte. Doch Ann spürt, dass ihre neue Liebe nur von Dauer sein kann, wenn zwischen ihnen bedingungsloses Vertrauen herrscht – und dass Alex ein Geheimnis hütet, das ihr Glück für immer zerstören könnte … Jetzt als eBook kaufen und genießen: der berührende Liebesroman »Die Liebe eines Fremden« von Anita Burgh. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Nach dem Tod ihres geliebten Ehemanns bricht für Ann eine Welt zusammen: Nie wieder, glaubt sie, wird sie Liebe und Geborgenheit in den Armen eines Mannes verspüren können. Bei einem Besuch in der Tate Gallery in London begegnet sie zufällig dem charmanten Alex – und sofort verspüren beide eine tiefe Faszination füreinander, als würden sie sich schon ein Leben lang kennen. Zögerlich erst, dann immer leidenschaftlicher umwirbt Alex sie und bietet Ann ein luxuriöses Leben in seiner griechischen Heimat: ein Leben, das sie sich nie zu erträumen wagte. Doch Ann spürt, dass ihre neue Liebe nur von Dauer sein kann, wenn zwischen ihnen bedingungsloses Vertrauen herrscht – und dass Alex ein Geheimnis hütet, das ihr Glück für immer zerstören könnte …
Über die Autorin:
Anita Burgh wurde 1937 in Gillingham, UK geboren und verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in Cornwall. Ihre 24 Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und feierten international Erfolge. Mittlerweile lebt Anita Burgh mit ihrem Mann und zwei Hunden in einem kleinen Dorf in den Cotswolds, Gloucestershire.
Bei dotbooks veröffentlichte Anita Burgh ihrer Romane »Das Erbe von Respryn Hall«, »St. Edith’s: Hospital der Herzen«, »Glückssucherinnen«, »Der Weg zum Herzen einer Frau«, »Wo deine Küsse mich finden«, »Das Lied von Glück und Sommer«, »Wo unsere Herzen wohnen«
Außerdem veröffentlichte Anita Burgh bei dotbooks ihre Familiensaga »Die Töchter Cornwalls« mit den drei Einzelbänden: »Morgenröte«, »Sturmwind« und »Dämmerstunde«
***
eBook-Neuausgabe November 2020
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1988 unter dem Originaltitel »Love the Bright Foreigner« bei Pan Books, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1988 by Anita Burgh
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1996 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/tea maeklong, Olag Gavrilova
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-261-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Liebe eines Fremden« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anita Burgh
Die Liebe eines Fremden
Roman
Aus dem Englischen von Traudl Weiser
dotbooks.
Für Sarah Portley mit Liebe
Love is the Bright foreigner, the foreign self.
Ralph Waldo Emerson, Journals
Teil I
Kapitel 1
Für alle Zeit in ihr erstarrt – wie in einem geistigen Gefrierfach – waren die Geräusche, Anblicke und Gerüche, die sie Sekunden, ehe das Telefon läutete, umgaben. Nebensächlich, unschuldig, kaum bemerkt, waren sie ein Teil ihres Lebens, bis das Telefon läutete, diese Geräusche übertönte und sie für immer ihrer Nebensächlichkeit beraubte.
Der Rasenmäher ihrer Nachbarn hustete und spuckte über den Rasen. Blauer Rauch quoll aus seinem Auspuff in stinkenden Benzinschwaden in ihre Küche. Dieser Rasenmäher war ein gelindes Ärgernis, das sie um ihrer guten Nachbarschaft willen ertragen mußte – bis zu jenem Tag, als er ein Vorbote der Angst wurde.
Dem kurzen Aufflackern blauer Flammen des Herdes folgte das vertraute leise Plop, mit dem die Butangasflasche anzeigte, daß sie leer war. Es klang wie ein Seufzer um ihre verlorene Geborgenheit.
Das geschäftige Zwitschern der Schwalben, die in Schwärmen um das Dachgesims segelten, war immer ein Omen des Glücks für das Haus gewesen. Innerhalb eines Moments spiegelte das Schwirren ihrer zarten Flügel die düsteren, schwarzen Kreise der Panik in ihrem Geist wider.
Die rot-weißen Vorhänge flatterten leicht in einer sanften Brise, die wiederum das Bambusgestänge der leuchtenden Geranie zum Klappern brachte. Das rhythmische Klicken tickte wie eine Uhr die Augenblicke ihres Glücks hinweg.
Eine Hummel suchte aufgeregt summend einen Fluchtweg in den Garten. Durch die gitterartigen Strahlen des Sonnenlichts wirkten die polierten Fliesen noch röter. Der süße Duft der Rosen und der würzige Geruch der Kräuter vermischten sich mit dem üppigen Wohlgeruch frischgemähten Grases. Überall war Sommer.
Und dieser Freitag im Juni war der Beginn eines kostbaren Wochenendes, an dem – wenn auch nur für kurze Zeit – Ben ausschließlich ihr gehören würde. Ann stand am Tisch und hackte sorgfältig und methodisch glänzende grüne und rote Paprika. Sie strich eine Strähne ihres früher blonden Haares zurück, das jetzt zu einem hellen Braun nachgedunkelt war. Ihr ganzes Leben hatte sie es lang getragen, doch vor sechs Monaten hatte sie es sich – sehr zum Mißfallen ihres Mannes – aus einer Laune heraus kurz schneiden lassen. Da die Länge jetzt dieses unansehnliche Zwischenstadium erreicht hatte, hielt sie es mit einer Haarspange zurück. Sie warf einen Blick in ihr gegen das Mehlglas gelehnte Kochbuch. Mit einem leisen Seufzer der Verzweiflung drehte sie sich um und suchte nach ihrer Lesebrille, an die sie sich noch nicht gewöhnt hatte. Sie setzte sie auf ihre Nasenspitze, und ihre klaren blauen Augen, in denen ein Ausdruck der Unschuld lag, konzentrierten sich auf die Schrift. Es waren die Augen eines Menschen, den das Leben freundlich behandelt hatte.
Ann war nicht groß. Früher war sie zierlich gewesen, aber mit den Jahren und weil sie ein wenig nachlässig war, hatte sie etwas zuviel Gewicht angesetzt. Zwar waren Rundungen nicht unattraktiv, doch ihre Figur entsprach nicht dem modischen Trend. Ann wußte das und wünschte sich, sie besäße genügend Selbstbeherrschung, um diesen Mangel zu beheben. Über dieses Thema machte sie sich eine Menge Gedanken, tat aber kaum etwas dafür. Ihr Gesicht jedoch täuschte über ihr Alter hinweg. Ihre makellose Haut besaß die rosige Frische einer viel jüngeren Frau, und sie hatte nur ein paar Lachfältchen. Sie strahlte Sanftheit aus, die von einem vollen und großzügigen Mund unterstrichen wurde.
Der Rasenmäher heulte kurz auf und verstummte dann. Ann blickte hoch, darauf wartend, daß der Lärm wieder einsetzte. An jedem anderen Tag der Woche hätte der Rasenmäher des Nachbarn sie vielleicht geärgert, nicht aber am Freitag. Nichts konnte Anns Freitag verderben.
Nicht immer war dieser Tag etwas Besonderes gewesen. Jahrelang – in der Zeit, in der ihr Mann sich mühsam in der Krankenhaushierarchie hochgearbeitet hatte – war ein freies Wochenende, das er mit seiner Familie verbrachte, ein seltenes Vergnügen. Doch jetzt, da Ben Facharzt war, gehörten die Wochenenden ihm, und er durfte nur in äußersten Notfällen gestört werden. An vielen Wochenenden war er allerdings unterwegs. Mit seiner Erfahrung auf seinem Gebiet war er weltweit auf Ärztekongressen als Redner sehr gefragt. Oft wünschte sich Ann, er würde sie mitnehmen. »... du würdest dich zu Tode langweilen. Mir ist der Gedanke lieber, dich hier zu wissen, wenn ich heimkomme ...«, sagte er immer mit seinem so entwaffnenden Lächeln. Da sie eine gehorsame Tochter gewesen war, war sie auch eine gehorsame Ehefrau und fügte sich seinem Wunsch klaglos.
Doch heute begann keines von jenen Wochenenden; dieses Wochenende würde er zu Hause sein. Ann hatte einen teuren Rotwein – einen Château Latour, den ihr der Weinhändler empfohlen hatte – gekauft. Sie hätte dazu gern ein besonderes Gericht gekocht, aber Ben wollte immer nur Steak und Salat, und so gab sie sich damit zufrieden, exotische Salate zuzubereiten. Während der Woche, wenn Ben operierte, tranken sie selten Alkohol, doch an Wochenenden waren ihnen Wein zum Dinner und hinterher ein guter Brandy zur Gewohnheit geworden. Ann liebte Wein und bedauerte insgeheim, daß sie ihn nicht öfter trinken konnten, nicht nur, weil sie ihn genoß, sondern, was viel wichtiger war, weil er Ben entspannte, ihn umgänglicher machte und weniger kritisch stimmte. Jetzt, da nur noch sie beide im Haus lebten, war ihr die Nähe zu ihm an diesen Wochenenden wichtig.
Das Telefon läutete und unterbrach ihre Gedanken. Sie wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab, als sie zu dem Apparat an der Wand ging.
»Midfield 2433«, meldete sie sich automatisch. Es war das Krankenhaus. Sie lehnte sich gegen die Wand und fragte sich, was ihr Mann wollte. Es war höchst selten, daß er sie tagsüber anrief. Sie lauschte dem vertrauten, antiquierten Surren in der Telefonzentrale des Krankenhauses, während sie zum Fenster hinausschaute. Was für ein herrlicher Sommer für die Rosen. Ihre Blüten schienen in diesem Jahr größer, ihre Farben leuchtender zu sein. Merkwürdig, daß manche Menschen Rosen hassen, sie für vulgär halten. Selbstbewußt ist eine bessere Beschreibung für diese Blumen, dachte sie – ihr Selbstvertrauen in die eigene Schönheit.
»Ann?« Sie erkannte die Stimme des besten Freundes ihres Mannes.
»Paul, was für eine Überraschung«, sagte sie und hoffte, daß sie nicht zu enttäuscht klang, weil nicht Ben am Apparat war. Am anderen Ende der Leitung herrschte Schweigen. »Wie geht es Amy?« erkundigte sie sich höflich und wunderte sich bereits, warum Paul und nicht seine Frau sie anrief.
»Ann ...« Das war keine Frage. Es klang, als würde Paul versuchen, einen Satz anzufangen, und wüßte nicht, wie er ihn beenden sollte. »Ann ... O mein Gott! Ich weiß nicht, was ich sagen soll.« Jetzt erst hörte sie die Anspannung in seiner Stimme, und Angst flackerte in ihr auf.
»Paul. Stimmt etwas nicht? Paul?«
»Ann, es geht um Ben. Er hatte ... Ach, Herrgott noch mal!«
»Paul, was ist passiert?« Sie war erstaunt, wie ruhig ihre Stimme trotz der in ihr aufsteigenden Hysterie klang. »Paul!« sagte sie scharf.
»Ann, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich ... Vielleicht hätte ich zu dir kommen sollen. Vielleicht hätte ich ... Ann, es geht um Ben. Er hatte einen Herzinfarkt ...«
»Nein, das ist nicht möglich, Paul«, entgegnete Ann energisch. »Er ist kerngesund. Er achtet auf seine Gesundheit, das tut er wirklich. Und er nörgelt dauernd wegen der paar Zigaretten, die ich rauche, an mir rum. Du meine Güte, er wiegt noch immer genausoviel wie am Tag unserer Hochzeit.« Die Worte sprudelten nur so aus ihrem Mund. »Nein, Paul, du hast dich geirrt. Es ist wahrscheinlich eine Magenverstimmung!« Sie zwang sich zu einem spröden Lachen, in der Hoffnung, daß es ihre wachsende Angst vertreiben würde.
»Ann, es tut mir leid. Niemand hat sich geirrt. Er ist tot, Ann. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid es mir tut ...
Sie lehnte an der Wand und betrachtete mit zur Seite geneigtem Kopf die Sprechmuschel des Telefons, einen ungläubigen Ausdruck im Gesicht. Und Paul sagte unbarmherzig all die Worte, die sie nicht hören wollte. Andere Worte schwirrten wirr in ihrem Kopf durcheinander, Worte, die, wenn sie sie aussprach, Paul dazu bringen würden, aufzuhören, diese schrecklichen Sachen von sich zu geben. Sie fühlte, wie sich ihr Mund öffnete und wieder schloß, aber kein Ton kam heraus.
»Ann, Ann ...« Paul redete noch immer mit ihr.
»Danke für deinen Anruf«, brachte sie mit übermenschlicher Anstrengung heraus. Alle Schärfe, jede Irritation und Angst waren aus ihrer Stimme gewichen und hatten ihrer gewohnten Höflichkeit Platz gemacht. Langsam legte sie den Hörer auf. Sie lehnte noch immer an der Wand. Wie angenehm kühl sich die Fliesen an meiner Wange anfühlen, dachte sie und fuhr mit der Fingerspitze die Fugen entlang. Da war etwas, worüber sie nachdenken sollte, etwas Wichtiges ... Aber sie wollte lieber nicht denken.
Der Rasenmäher kam erneut stotternd in Gang. Die Lücke in ihrem Geist war wieder geschlossen. Sie erinnerte sich. Aus weiter Ferne hörte sie ein seltsames Geräusch, das lauter und lauter wurde. Sie preßte die Hände gegen die Ohren, um diesen schrecklichen Ton auszusperren. Die Küchentür wurde aufgestoßen, und Meg, ihre Putzfrau, platzte mit einem Ausdruck des Entsetzens im Gesicht herein.
»Mein Gott, Mrs. Grange! Was ist denn los, um Himmels willen?«
Doch Ann war nicht imstande, etwas zu hören, und wußte nicht, daß die seltsamen tierischen Laute, die sie vernahm, von ihr kamen, als sie schreiend in einen Abgrund der Verzweiflung stürzte.
Die Hummel summte, das Bambusgestänge klapperte gegen das vergitterte Fenster – unschuldige Geräusche, die sich unauslöschlich ihrem Gedächtnis einprägten und für immer mit dem Tod verbunden waren.
Kapitel 2
Später konnte sich Ann, sosehr sie sich auch bemühte, nicht präzise daran erinnern, was während der folgenden Stunden, Tage und Wochen passiert war. Diese ganze Periode ihres Lebens blieb eine nebelhafte Erinnerung, in der sie sich als undeutlichen Schatten sah, der sich geisterhaft in einer nebligen Anderswelt bewegte – wie ein Traum, aber doch nicht ganz, denn Träumen kann man sich stellen und sie analysieren, während ihr jegliche analytische Sicht auf die Ereignisse versperrt blieb.
Jeder war freundlich, zu freundlich. gewesen. Sie erinnerte sich daran, daß sie sich wie ein verwundetes Tier in einen verborgenen Winkel hatte verkriechen wollen. Doch das sollte nicht sein. Eine Schar von Freunden und Verwandten hatte das verhindert. Sie war nie allein, durfte es nie sein. Schlaf wurde in Form von Tabletten von ihrem wohlmeinenden Arzt herbeigeführt. Tabletten, die sie nicht nehmen wollte, aber die abzulehnen sie anscheinend nicht die Kraft besaß. Jeden Morgen gab es da ein lächelndes Gesicht, die zu muntere Stimme einer liebevollen Freundin und noch mehr Tabletten, die ihr über den Tag hinweghalfen.
Vorkehrungen hatten getroffen werden müssen, aber sie hatte keine Ahnung, wer sie getroffen hatte. Irgendwann mußte eine Beerdigung stattgefunden haben, denn später erzählten ihr alle, wie wundervoll sie sich während der Tortur gehalten habe. Doch sie wußte, daß das alles nur Schein war, da sie sich nicht einmal daran erinnern konnte, auf dem Friedhof gewesen zu sein.
Und dann wurden alle ihre Freunde wie bei einer organisierten Verschwörung energisch mit ihr und gaben praktische Ratschläge: »... du mußt dich zusammenreißen ...«, »... das Leben muß weitergehen ...«, »... geh öfter aus ... mach Urlaub ... tritt einem Club bei ...« Ann hatte das Gefühl, in einem Meer von Platitüden zu treiben.
Sie pflegte ihre Freunde mit einem Ausdruck verwirrten Unverständnisses anzusehen. Wie konnte sie sich »zusammenreißen«, wenn alles in ihr zerbrochen und sie nicht einmal fähig war, über die Scherben ihres Lebens nachzudenken, nicht wußte, ob sie es überhaupt versuchen wollte. »Das Leben muß weitergehen«, sagten sie, aber ihr fiel kein einziger guter Grund ein, warum es das sollte. Wieso ausgehen? Wohin? Wozu? Ohne Ben gab es da draußen für sie keine Freude. In ihrem Heim kam sie sich sicherer vor, von seinen Sachen umgeben, die ihr das Gefühl seiner Anwesenheit ließen. Sie war auch überzeugt davon, obwohl sie es niemandem sagte, daß er zurückkommen würde. Eines Tages würde die Tür aufgehen, und er würde eintreten, und ihr Leben würde weitergehen wie vorher. Sie konnte dieses Haus nicht verlassen. Niemals. Was wäre, wenn er zurückkehrte und sie nicht da wäre?
Sie lächelte höflich über die Banalität der Kommentare, denn ihr war bewußt, daß niemand das Gefühl der Leere, das sie empfand, verstehen konnte.
Aus Tagen wurden Wochen. Allmählich, ganz unwillkürlich, fing sie an, sich wieder ihrer Familie und ihren Freunden zuzuwenden. Die Trauer, die tief in ihr nur darauf gelauert hatte, daß sie sich mit ihr auseinandersetzte, kroch heimtückisch in ihr Bewußtsein und füllte ihre innere Leere.
Bens Freunde zu treffen war sowohl schwierig als auch eine Freude. Es gefiel ihr, wenn von ihm geredet, sein Name genannt wurde. Sie war stolz, wenn sie seine Eigenschaften priesen. Sie lachte, wenn sie ihr Anekdoten erzählten, die sie noch nicht gekannt hatte. Und doch konnte sie bloß bis zu einem gewissen Grad zuhören, so als gäbe es in ihr ein Meßinstrument, das ihr erlaubte, nur eine vorherbestimmte Menge aufzunehmen, ehe sie fühlte, wie der Schmerz in ihr aufwallte. Ihr Gesicht erstarrte dann zu Stein, ihre Augen bekamen einen fernen, glasigen Ausdruck, und ihr war, als könnte sie nicht mehr vernehmen, was gesagt wurde. Peinlich berührt, wechselten ihre Freunde das Thema, aber es war zu spät. Sie hatten Ann wieder verloren. Sie konnte sich nicht erinnern, zu wie vielen Dinner- und Cocktailpartys sie während dieser Monate mitgenommen worden war. Sie hatte nie geäußert, daß ihr die Teilnahme an diesen gesellschaftlichen Ereignissen am schwersten fiel – Einsamkeit inmitten von Menschen ist die schlimmste von allen.
Schließlich fand sie den Mut, solche Einladungen abzulehnen. Der Kummer hatte wieder seinen Kurs geändert. Jetzt beherrschte sie ein brennendes Verlangen danach, mit dem, was ihr geschehen war, zurechtzukommen. Sie wollte weinen, da sie das Gefühl hatte, das schreckliche Gewicht des Elends, das schwer in ihr lastete, würde dadurch geringer. Es war wie ein bösartiger Tumor, der sie, wie ihr bewußt war, zerstörte.
Sie zog es vor, ihre Abende allein zu verbringen, und lehnte die Angebote ihrer Kinder, sie zu besuchen, ab. Sie machte sich nicht einmal Gedanken darüber, ob sie damit deren Gefühle verletzte, denn diese Erwachsenen schienen nicht mehr die Kinder zu sein, die sie großgezogen hatte, sondern Fremde.
An diesen Abenden versuchte sie zu lesen, doch die Worte verblaßten vor ihren Augen. Im Fernsehen konnte sie kein Programm finden, das sie interessierte. Dann entdeckte sie, daß ihr Musik half, und so saß sie abends mit einem Drink in der Hand da, ließ sich von Tönen überfluten, starrte mit blinden Augen in die Vergangenheit und träumte von der Zeit, als sie glücklich gewesen war. Aber das alles schien jetzt so lange her zu sein – diese goldenen Tage, als ihre Kinder klein gewesen waren und die Sonne nie aufgehört hatte zu scheinen. Irgendwann mußte es geregnet haben, dachte sie logisch, aber sie konnte sich nicht an Regen erinnern. Und sie wachte aus ihren sonnigen Träumen auf und sah sich mit dem freudlosen Grau ihrer Welt konfrontiert.
Sie bestand darauf, daß Bens Sachen unberührt blieben. In seinem Arbeitszimmer an seinem Schreibtisch zu sitzen, über die Armlehnen seines Sessels zu fahren, auf denen seine Hände geruht hatten, war ihr ein kleiner Trost. Sie streichelte seinen Füllfederhalter, seinen Tintenlöscher, sein Telefon, als würde sie mit der Berührung seiner Sachen ihn berühren. Nachts lag sie auf seiner Seite des Bettes und umklammerte ein Jackett von ihm, in dem noch sein Geruch hing.
So wie sie sich des Tages, an dem er gestorben war, bewußt war, erinnerte sie sich auch an den Tag, als über ein Jahr später endlich die Realität zurückkehrte.
Nach einem Anruf legte sie den Hörer auf, lehnte sich gegen die Wand und schaute durch die Küche. Wieder war ein herrlicher warmer Sommertag. Die roten Fußbodenfliesen glänzten. In der sanften Brise klapperte das Bambusgestänge gegen den Fensterrahmen. Bienen summten in ihrer emsigen Suche nach Nektar. Und auf einmal sprang der Rasenmäher des Nachbarn tuckernd an. Anns Hand fuhr zu ihrem Mund hoch – alles war wie früher und doch so anders. Plötzlich erkannte sie, das Warten war vergeblich gewesen, er würde nie zurückkommen. Und sie war wie erstarrt, als diese Erkenntnis ihr Bewußtsein durchdrang.
»O nein!« schrie sie. »O Ben, wie konntest du mir das antun?« Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie sank auf den kühlen gefliesten Boden, und ein langer, schmerzerfüllter Schluchzer ließ ihren Körper erbeben. »Wie konntest du mich verlassen?« schrie sie. Dann trommelte sie mit den Fäusten auf den Boden, und Zorn wallte in ihr auf. »Ich kann dir nicht verzeihen, daß du mich verlassen hast. Nie. Ich kann dir nicht verzeihen!« rief sie in den leeren Raum. »Du Bastard, warum hast du mir das angetan?« Stöhnend wiegte sie sich vor und zurück, als der Schmerz, der so lange in ihr geschlummert hatte, endlich aus ihr herausbrach.
In ihre Tränen des Zorns mischten sich Tränen der Trauer, als sie sich eingestand, daß Ben für immer von ihr gegangen war. Als sie weinte, als ihr Körper in einsamer Qual zitterte, begann endlich der Heilungsprozeß.
Kapitel 3
Wie nach einer langen Krankheit kehrte Ann ins Leben zurück. Sie konnte nicht fassen, daß ihr so viele Monate durch die Finger geglitten waren. Ich hätte genausogut im Koma liegen können, dachte sie, als ihr klar wurde, wieviel passiert war, von dem sie nichts gemerkt hatte. Nicht nur große Ereignisse wie der Regierungswechsel, ein neuer Krieg im Mittleren Osten, sondern auch kleine. Ein Apfelbaum war während des schlimmsten Sturms seit Menschengedenken entwurzelt worden – ein Sturm, an den sie sich nicht erinnern konnte. Sie hatte einen neuen Staubsauger, den sie vermutlich selbst bestellt hatte. Und jemand mußte mit ihr über die Notwendigkeit gesprochen haben, die Rückseite des Hauses neu streichen zu lassen, denn sie war gestrichen – aber wann war das geschehen? Weihnachten und Ostern waren unbemerkt an ihr vorübergegangen. Ein neuer Geistlicher war berufen worden, und neue Bewohner waren ins Mill House eingezogen. Ihr wurde gesagt, daß sie einen Antrittsbesuch bei ihr gemacht hätten.
Sie sammelte alle Tablettenfläschchen ein und stellte sie in die hinterste Ecke ihres Medizinschranks. Sie fing an, wieder Interesse an ihrem Haus zu entwickeln. Es war wie eines, dessen Bewohner lange Zeit fort gewesen waren. Darin herrschte eine gewisse Muffigkeit, und es wirkte unbewohnt. Mit Megs Hilfe begann sie fieberhaft, Zimmer aufzuräumen.
Schließlich fuhr sie wie früher selbst zu den Geschäften. Ihr Auto parkte ständig in der Auffahrt, denn sie brachte es nicht fertig, die Garage zu betreten, wo Bens glänzender neuer Mercedes stand. Er war so stolz darauf gewesen. Irgendwann würde er verkauft werden müssen, aber noch war sie nicht soweit, das zu veranlassen.
Zunächst beinahe schüchtern wagte sie wieder Freunde zu besuchen. Wie in der Vergangenheit schaute sie unangemeldet bei Karen Rigson, ihrer besten Freundin im Ort, vorbei. Karen lebte im alten Pfarrhaus, einem weitläufigen viktorianischen Gebäude, das jetzt, da ihre Kinder erwachsen waren, zu groß für sie und John, ihren Mann, war. Obwohl sie oft davon sprachen, in ein kleineres Haus umzuziehen, wußten alle, daß die beiden nie ihre gewohnte Umgebung verlassen würden.
Ann saß in Karens Küche. Diesen Raum hatte sie immer gemocht. Hier herrschte stets hektische Betriebsamkeit. Früher war die Pinnwand voller Zeichnungen der Kinder, Termine für den Zahnarzt, die Chorproben, den Fahrdienst zur Schule. Die Kinder waren längst aus dem Haus, aber die Pinnwand war noch immer mit Notizzetteln vollgesteckt. Kräuter baumelten in großen wohlriechenden Sträußen von der Decke. Der Duft frischgebackenen Brotes hing in der Luft. Hier herrschte stets ein erfreuliches Durcheinander, das in Anns Küche nicht geduldet wurde, weil Ben ein Pedant gewesen war.
Mit einer Tasse Kaffee und einem Teller voll mit Karens ausgezeichnetem Mürbegebäck vor sich, saß Ann da und beobachtete ihre Freundin, die mit vor Konzentration geschürzten Lippen Wein vom letzten Jahr in Flaschen abfüllte. Eine nach der anderen wurde mit Korken verschlossen und mit von Karen selbst entworfenen Etiketten versehen, auf denen in schwungvoller gotischer Schrift »Château Rigson« stand. Dann wurden die Flaschen in der Speisekammer gelagert. Von ihrem Platz aus konnte Ann Regale voller hausgemachter Marmeladen mit Stoffdeckeln und Karens gedruckten Etiketten sehen. Sie ist ein Eine-Frau-Unternehmen, schoß es Ann zu ihrer Überraschung durch den Kopf.
Zufrieden lächelnd kam Karen zu ihr an den Tisch, und während sie ihren Kaffee trank, berichtete sie aufgeregt von den Ergebnissen der letzten Versammlung des Women's Institute und der geplanten Tagesordnung für kommenden Herbst. Außerdem wurde ihr erzählt, daß dieses Jahr, falls das schöne Wetter anhielt, ein Superjahr für Brombeeren zu werden versprach, daß Karen anfangen müsse, Marmeladengläser für die Erdbeerschwemme, die bestimmt zu erwarten war, zu sammeln – bis Ann schreien wollte. Dieser Impuls war so stark, daß sie ihn nur in ein Husten verwandeln konnte, um nicht daran zu ersticken. Der Raum schien sie plötzlich zu erdrücken. Sie stand so schnell auf, daß der Stuhl über den mit Keramik gefliesten Küchenboden scharrte, entschuldigte sich hastig bei der verblüfften Karen und eilte aus dem Haus.
Ann parkte ihr Auto um die Ecke. Sie machte den Motor aus, saß da, ließ den Blick über diesen hübschen Ort wandern und war verwirrt. Was um Himmels willen war in sie gefahren? Karen war ihre beste Freundin. Sie hatte Stunden in dieser Küche verbracht, über Belanglosigkeiten geplaudert und sich dabei wohl gefühlt. Aber heute hatte etwas an Karen eine Überreaktion in ihr ausgelöst. Ihr lag nichts mehr am Women's Institute, und es interessierte sie nicht, wie viele dieser verdammten Brombeeren reifen würden. Noch erstaunlicher war jedoch, daß sie die Gläser voller Marmelade, die Flaschen mit Wein und diese Etiketten lächerlich gefunden hatte. Sie hatte diese Dinge bestimmt schon hundertmal gesehen, warum also irritierte sie der Anblick plötzlich? Es gab Ann einen Ruck, als sie sich eingestehen mußte, daß es Karens Ausstrahlung von selbstgefälliger Zufriedenheit gewesen war, was ihr auf die Nerven gegangen war und sie zum Schreien gelangweilt hatte. Ein paar Abende später nahm sie wie früher eine Einladung zum Bridge von Freunden an, mit denen sie und Ben oft gespielt hatten. Noch ein Ehepaar war da. Peinlich berührt merkte Ann, daß sie überzählig war und, sollte sie spielen wollen, jemand verzichten müßte. Kopfschmerzen vortäuschend, sagte sie, sie würde lieber zusehen. Als der Rubber zu Ende war und Drinks serviert wurden, saß sie da und hörte sich den Dorfklatsch an. Wie es schien, begegnete man der Frau des neuen Geistlichen mit Mißbilligung. Sie war Sozialarbeiterin, und es hieß, ihre politischen Ansichten seien ein bißchen zu rot angehaucht, um den Einwohnern von Midfield zu passen. Alle waren sich auch darüber einig, daß das Kirchenfest in diesem Jahr eine Katastrophe werden würde. Ann lächelte in sich hinein. Das wurde immer behauptet. Sie wußte nicht, warum sie log, als sie gefragt wurde, ob sie einen Verkaufsstand übernehmen würde, und sagte, daß sie wahrscheinlich wegfahren würde, um Urlaub zu machen, obwohl sie keinerlei diesbezügliche Pläne hatte. Sie hörte zu, und dieselbe rastlose Langeweile, die sie bei Karen empfunden hatte, überwältigte sie. Unter dem Vorwand, daß ihre Kopfschmerzen schlimmer geworden seien, verabschiedete sie sich.
Zu Hause saß sie lange da und überlegte, was in ihr vor sich ging. Sie hatte die gleichen Dinge mit denselben Menschen wie früher getan. Ann konnte sich nicht erinnern, je gelangweilt gewesen zu sein. Das war ein beunruhigendes Gefühl, eine ihr unbekannte Empfindung. Es war, als wäre sie aus ihrer Trauer als anderer Mensch wiedergekehrt.
Sie fing an, sich Sorgen zu machen. Was sollte sie tun? Sie wollte nicht wieder zur Einsiedlerin werden, wußte aber gleichzeitig, daß sie nicht mehr mit diesen Menschen als einzigem gesellschaftlichen Kontakt leben konnte.
Da rettete sie Lydia. Lydia war verhältnismäßig neu im Ort und keine enge Freundin gewesen, als Ben noch lebte. Ann war ihr gelegentlich auf Sherrypartys, bei Gemeinderatsversammlungen und auf dem Kirchenfest begegnet, konnte jedoch nicht behaupten, sie zu kennen. Jetzt war es Lydia, bei der sie sich am wohlsten fühlte. In ihrer Gesellschaft langweilte sie sich nie. Vielleicht war es für Lydia leichter, ein Teil von Anns Gegenwart zu werden, weil sie kein Teil ihrer Vergangenheit gewesen war.
Lydia wohnte am Ortsrand in einem aus zwei Cottages originell umgebauten Haus. Ihr Mann war irgend etwas in der Stadt, aber über dieses Etwas hatte sich Lydia nie näher ausgelassen. Sie war eine von den glücklichen Frauen, die nichts tun mußten, um elegant auszusehen. In ausgebleichten alten Jeans, T-Shirts und Turnschuhen hatte sie noch immer einen schicken Stil, was vielleicht nicht erstaunlich war, da sie jahrelang als Moderedakteurin für eine verwirrende Anzahl von Illustrierten und Zeitungen gearbeitet hatte. Ihre Erklärungen, warum sie ihren Beruf aufgegeben hatte, waren immer sehr vage – sie deutete geheimnisvoll Verschwörungen im Vorstand an und sprach von skrupellosen Konkurrenten. Ann aber glaubte, daß Lydia in Wahrheit die Routine in ihrem Beruf als Redakteurin langweilig gefunden hatte. Sie hatte sich jedoch nicht ganz aus dem Metier zurückgezogen, sondern arbeitete häufig freiberuflich, und wenn die neuen Kollektionen präsentiert wurden, flog Lydia immer im Auftrag irgendeines Verlags nach Paris oder Mailand oder verschwand wochenlang in London. Ann neidete Lydia die Fähigkeit zu arbeiten, wann und wie sie wollte, und daß sie ein Wissen besaß, für dessen Veröffentlichung die Menschen bereit waren zu zahlen.
Ihr Haus strahlte die gleiche mühelose Eleganz aus. Im völligen Widerspruch dazu standen ihr rauhes Lachen, ihre Stimme mit dem starken Cockney-Akzent und ihr Vokabular, welches, wenn sie erregt war, einen Bierkutscher beschämt hätte. Es gab viele Dorfbewohner, die Lydia nicht mochten und sie für schroff, hart und, um ehrlich zu sein, ziemlich vulgär hielten. Ben war einer von ihnen gewesen. Als Ann diese neue Freundschaft vertiefte, hatte sie manchmal ein Gefühl von Treulosigkeit Ben gegenüber, weil ihr jemand gefiel, den er mißbilligt hatte. Doch Ben hatte sich geirrt; Lydia war unter ihrer rauhen Schale einer der nettesten Menschen, die Ann kannte. Und mit ihrer pragmatischen Lebenseinstellung und ihrem sarkastischen Humor war sie in dieser Zeit die ideale Gefährtin.
Ann war von Lydia zum Mittagessen eingeladen worden und saß zur Cocktailstunde noch immer bei ihr.
»Weißt du, Lydia, ich fange an mich zu fragen, ob ich während des vergangenen Jahres nicht leicht verrückt gewesen bin.«
»Natürlich warst du das, meine Liebe.« Lydia lachte über Anns schockiertes Gesicht. »Was für eine Antwort hast du denn von mir erwartet? Verdammt noch mal, das ist doch nicht erstaunlich, oder? Du mußtest mit Bens Tod fertig werden und hattest nichts, um diese plötzliche Leere in deinem Leben auszufüllen. Deine Kinder sind erwachsen, du hast keinen Beruf und nicht einmal einen Hund. Da war nichts, was dich gezwungen hätte, dich zusammenzureißen. Es hat immer nur dich und Ben und das Haus gegeben, und so hast du dich natürlich dorthin verkrochen, wo du dich sicher fühltest. Noch einen Gin?« Sie goß nach und machte es sich wieder auf dem Sofa bequem. »Vielleicht solltest du dir einen Hund zulegen. Hunde sind wundervolle Gefährten, nicht wahr, mein guter Pong?« sagte sie und streichelte den Pekinesen, der auf einem Kissen neben ihr lag.
»Ich hätte gern ein Haustier gehabt, aber Ben mochte keines. Er sagte, sie seien unhygienisch.«
»Unhygienisch!« platzte Lydia heraus. »Typischer Kommentar eines Arztes. Klingt, als wäre dein Ben manchmal ein rechter Bastard gewesen.«
»Ben?« fragte Ann verwirrt.
»Nimm dir einen Hund, keine Katze, die sind zu unzuverlässig«, fuhr Lydia fort, Anns Erstaunen ignorierend.
Ann fand Gefallen an dem Gedanken, ein kleines, von ihr abhängiges Tier zu besitzen. »Ich habe nicht genug zu tun, das ist ein Teil meines Problems. Ich muß mir etwas einfallen lassen. Es war schlimm genug, nachdem die Kinder aus dem Haus und nur noch Ben und ich da waren. Schon damals war ich nicht ausgelastet, und jetzt ist es noch viel schlimmer ...«
»Da kann ich nicht mitreden. Für Hausarbeit fehlt mir jeder Sinn. Ich habe zu meinen Ehemännern gesagt: ›Im Bett tue ich, was dir gefällt, erwarte aber nicht von mir, daß ich dir Bälger gebäre oder als deine Putzfrau fungiere.‹ Und sie waren alle in beiden Punkten sehr verständnisvoll.« Sie brach in lautes Lachen aus.
Ann lächelte Lydia an. In Wahrheit funktionierte Lydias Haushalt wie ein Uhrwerk, ihre Abendessen waren exzellent und fanden in elegantem Rahmen statt. Lydia war in allem eine Perfektionistin.
»Ich habe schon ziemlich in Selbstmitleid geschwelgt. Denk nur an Judy Planter, deren Mann bei einem Autounfall getötet wurde. Sie ist sehr gut damit zurechtgekommen und hat nach ein paar Wochen wieder ein normales Leben geführt und nicht wie ich über ein Jahr lang Trübsal geblasen.«
»Vielleicht hat sie ihren Mann nicht sehr gemocht«, sagte Lydia pragmatisch.
»Das glaube ich nun wirklich nicht. Die beiden schienen eine sehr enge Beziehung gehabt zu haben.«
»Schienen ist wohl der treffende Ausdruck.« Lydia ließ wieder ihr lautes Lachen erklingen. Dieses Lachen unterstrich alles, was sie sagte, wie ein lebendes Ausrufezeichen. Es hätte unangenehm oder störend wirken können, aber Ann fand es liebenswert. »Du bist eben eine sensiblere Seele.«
»Ich glaube, bei mir ... es war ...« Ann suchte nach Worten, um ihre Gefühle zu beschreiben. »Dieser Schock hat mich nicht nur geistig, sondern auch physisch getroffen. Als wäre ich k.o. geschlagen worden und hätte all die Monate eine Gehirnerschütterung gehabt.«
»Aber du hast dich völlig davon erholt, und das ist das wichtigste, meine Liebe.«
Ann lächelte kläglich. »Es wurde auch verdammt noch mal Zeit. Leid ist so selbstsüchtig, Lydia. Man interessiert sich für niemand anderen mehr.«
»Das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß, daß sich eine Scheidung nicht mit einem Todesfall vergleichen läßt, aber irgendwie ist es auch ein schmerzlicher Verlust. Man trauert um verlorene Träume und Hoffnungen. Nach meiner ersten Scheidung war ich in einem entsetzlichen Zustand und bin eine Ewigkeit wie ein Zombie rumgelaufen und war völlig egozentrisch. Beim zweitenmal hatte ich mich schon daran gewöhnt, und es war nicht mehr so schlimm. Sollten George und ich uns trennen, hätte ich mich wohl bis zum nächsten Wochenende davon erholt.« Lydia gluckste vor Belustigung.
»Wag nicht einmal, daran zu denken, Lydia. George ist ein Schatz. Ich könnte es nicht ertragen, wenn eure Ehe zerbräche. Ihr seid ein perfektes Paar.«
»Weil mich der törichte alte Kauz mein Leben leben und sich von mir herumkommandieren läßt.«
»Das stimmt nicht. Ich weiß schon lange, daß das nur ein Spiel ist, das ihr beide da abzieht.«
»Verdammt, du hast mich durchschaut.« Lydia lachte schallend und kippte den Rest ihres Drinks runter. »Um das Thema zu wechseln, möchtest du am Samstag zum Dinner zu uns kommen? Nur im kleinen Kreis. Ich lade die neuen Bewohner von Mill House ein. Die beiden sind sehr amüsant. Sie ist eine wirklich gute Malerin, er ist Steuerberater, aber trotzdem ganz unterhaltsam. Und einer von Georges alten Freunden aus der Army kommt uns besuchen. Er hat sich gerade scheiden lassen«, fügte sie bedeutungsvoll hinzu.
»Das sieht dir ähnlich, Lydia!« Ann lachte. »Ich wäre jede Wette eingegangen, daß du die erste bist, die versucht, mich zu verkuppeln.«
»Du verstehst das falsch, Ann. So etwas Plumpes würde ich doch nie tun. Ich wollte damit nur andeuten, daß auch er unglücklich ist.«
»Mach mir doch nichts vor, du spielst die Kupplerin«, widersprach Ann kichernd.
Lydia grinste reumütig. »Na gut, ich gebe es zu. Aber es war nur ein kleiner Versuch. Ich kann einfach den Gedanken nicht ertragen, daß eine Frau wie du und ein Mann wie er ihr Leben vergeuden. Ich meine, ein bißchen Zerstreuung würde dir doch guttun.«
»Das ist ein seltsamer Gedanke, weißt du«, sagte Ann. »Ich kann mir einen anderen Mann in meinem Leben einfach nicht vorstellen.«
»Unsinn! Du kannst nicht ewig allein leben. Und schließlich ...« Sie machte eine Pause und sah Ann neugierig an. »Ich meine, hast du nicht manchmal Gelüste?«
»Gelüste? Wovon sprichst du, um Himmels willen?«
»Du weißt schon ... Sex. Schmusen, bumsen, nenn es, wie du willst. Nachdem du regelmäßig Sex gehabt hast, kann das doch nicht plötzlich aufhören, ohne daß dein Körper von Zeit zu Zeit danach verlangt.«
»Es sieht dir ähnlich, dieses Thema anzuschneiden.« Ann lachte stillvergnügt in sich hinein. »Ich gebe zu, daß ich mich gefragt habe, wie Witwen damit zurechtkommen. Aber für mich ist das kein Problem. Ich denke nur selten daran.«
»Du lieber Himmel, wenn ich in deiner Haut stecken würde, könnte ich an nichts anderes denken. Ich wäre längst übergeschnappt.«
»Vielleicht ist dir Sex wichtiger als mir. Früher, wenn Ben eine seiner Reisen unternehmen mußte, habe ich ihn nie vermißt. Schließlich ist Sex nur ein kleiner und ziemlich unwichtiger Teil einer Beziehung.«
»Ein kleiner Teil!« rief Lydia aus. »Ich glaube es einfach nicht. George findet dich übrigens auch sehr sexy.«
»Mich? Du machst Witze.« Anns Stimme klang noch verwunderter. Sexy zu sein ist eine Umschreibung, die auf jüngere Frauen zutrifft, dachte sie, und ich habe mich nie in meinem Leben als sexy empfunden. Sie hatte sich immer bemüht, elegant auszusehen – Ben hatte stets großen Wert auf schlichte Eleganz gelegt. Wenn sie in einen Spiegel geblickt hatte, dann nur, um sich zu vergewissern, daß ihre Strumpfnähte gerade saßen, ihr Make-up unauffällig und ihre Frisur tadellos war. Sogar jetzt noch, nachdem Ben nicht mehr da war, achtete sie auf diese Dinge. Und obwohl sie am Bund ihrer Röcke merkte, daß sie abgenommen hatte, betrachtete sie sich nicht unter dem Aspekt physischer Attraktivität. Deswegen war ihr auch auf unbekümmerte Art nicht bewußt, daß sie aus ihrer Trauer mit einer guten Figur hervorging und daß sie sich mit ihrem schmaler gewordenen Gesicht zu einer schönen Frau entwickelte, die Lydia gern hinsichtlich Make-up und Kleidung beraten würde.
Ann sah traurig aus, doch plötzlich platzte es aus ihr heraus: »Nein, es ist nicht der Sex, den ich vermisse. Weißt du, was mir wirklich fehlt? Das Kuscheln. Nachts ist es so leer im Bett, und er ist nicht da, damit ich mich an ihn schmiegen kann.«
»Ann, es tut mir leid. Ich hätte nicht davon anfangen sollen. Meine verdammt große Schnauze. Bitte, verzeih mir«, sagte Lydia betroffen.
»Ist schon in Ordnung. Es tut mir gut zu reden, das brauche ich jetzt am dringendsten. Und ich mag es sehr gern, daß du aussprichst, was du denkst. Das tust nur du. Wage ja nicht, dich je zu ändern.« Sie lächelte ihre Freundin an.
»Nun gut. Was ist jetzt mit dem Dinner am Samstag?«
»Es ist sehr nett von dir, mich einzuladen, aber ich kann noch nicht. Ich habe ja sogar noch Probleme, mit Menschen umzugehen, die ich kenne.«
»Nun, das mußt du am besten wissen. Vielleicht das nächstemal. Du bleibst aber doch heute zum Abendessen, nicht wahr? George geht an die Decke, wenn ich dich fortlasse.«
Und wie so oft in letzter Zeit verbrachte Ann den Abend bei ihrer Freundin. Nach diesem Besuch lag sie jedoch in ihrem Bett, konnte nicht schlafen und dachte über Sex nach. Sie hatte sich schon selbst gefragt, ob diese seltsam rastlose Langeweile, die sie verspürte, etwas damit zu tun hatte. Aber sie hatte diesen Gedanken verworfen, denn was sie zu Lydia gesagt hatte, war die Wahrheit gewesen. Sex war ihr nie besonders wichtig. Sie hatte zwar Gefallen daran gehabt, doch als Ben während der letzten Jahre das Interesse daran verloren zu haben schien, hatte sie das nicht übermäßig gestört. Aus diesem Grund hatte sie auch keinen Gedanken an einen anderen Mann in ihrem Leben verschwendet. Sie hatte Geld, ein schönes Heim – sie brauchte keinen Sex. Ihr fehlte die Gemeinsamkeit, die Art ruhiger Kameradschaft, die sich in einer guten Ehe über die Jahre hinweg entwickelt. Es würde schwierig sein, das zu ersetzen. Nein, der Gedanke an einen anderen Mann war ein sinnloses Unterfangen.
Sie begann wieder, in die Kirche zu gehen, jedoch weniger, um Trost in der Religion zu suchen, denn ihrem Glauben war ein schwerer Schlag versetzt worden, von dem sie sich wohl nie erholen würde, sondern weil der Kirchgang eine angenehme Routine aus ihrer Vergangenheit war. Und sie nahm auch einige Einladungen zu Sherrypartys an, obwohl jeder ein bißchen zu besorgt war, ihr ständig gesagt wurde, sie solle sich setzen, als wäre sie eine Kranke, der durch die Entlastung der Beine der Schmerz in der Seele gelindert werden könnte.
Sie war zufrieden mit den Fortschritten, die sie bei den Versuchen machte, wieder am Leben teilzunehmen. Und obwohl sie überzeugt war, ihrer Einsamkeit nie mehr zu entrinnen, glaubte sie doch, damit leben zu können. Dieses Gefühl war ihr so sehr zur zweiten Natur geworden, daß sie sich gar nicht daran zu erinnern vermochte, einmal nicht einsam gewesen zu sein. Ihr war, als wäre diese Einsamkeit immer ein Teil von ihr gewesen und hätte nur auf den rechten Augenblick gewartet, um sich zu offenbaren.
Endlich war sie in der Lage, Bens Sachen auszusortieren. Sie packte seine Kleidung für eine Wohltätigkeitsorganisation zusammen, bis auf das alte Jackett, an dem sie immer noch hing.
Sie entdeckte, daß es wie ein großes Puzzlespiel war, die Fäden des Lebens wieder aufzunehmen. Langsam und unvermeidlich fanden die einzelnen Teile ihren Platz. Jeden Tag gönnte sie sich jetzt die Hoffnung, ohne Ben überleben zu können.
Kapitel 4
Ann saß am Kiefernholztisch in der unordentlichen und unfertigen Küche des Hauses ihres Sohnes und war traurig. Sie waren einst eine sich so nahestehende und liebende Familie gewesen, aber jetzt war das Band der Kindheit gerissen, und ihre Kinder schienen so schnell sie konnten vor ihr geflohen zu sein. Sie hatte sich daran gewöhnt, die beiden nur noch selten zu sehen und für diese wenigen Begegnungen dankbar zu sein.
Sie beobachtete ihre Tochter. Wie schlank und elegant Fay war, so tadellos gepflegt, daß alles an ihr wie frisch poliert glänzte, sogar die dunklen, intelligenten Augen, eine selbstbewußte junge Frau, so anders als das schüchterne und introvertierte Kind, das sie früher gewesen war. Es erstaunte Ann immer wieder, daß sie dieses elegante, selbstsichere Wesen zustande gebracht hatte. Fay war wie ihr Zwillingsbruder ehrgeizig, und das mit einer Zielstrebigkeit, die Ann faszinierte, da sie selbst nie irgendwelche Ambitionen gehabt hatte. Alles, was sie sich gewünscht hatte, war, zu heiraten, eine Familie zu gründen und Kinder großzuziehen – eine Rolle, die nicht mehr existierte. Obwohl sie Fay nicht verstand, konnte sie ihre Tochter beneiden, und zwar um ihr Selbstvertrauen und ihre Unabhängigkeit, am meisten aber um ihren Beruf. Nach dem Abschluß an der Slade School of Fine Art hatten alle angenommen, Fay würde eine Karriere beim Theater oder Film anstreben; statt dessen hatte sie die Konkurrenz und Hektik der Welt des Designs gewählt. Einen Monat konnte sie an der Innenausstattung eines Sitzungssaals in Manhattan arbeiten und im nächsten in der sengenden Wüstenhitze den Palast eines Scheichs planen. Fay lebte in einem Wirrwarr von Stoffen, Hölzern, feinem Kristall und Farben, übte einen Beruf aus, von dem Ann instinktiv wußte, daß er ihr auch gefallen hätte. Aber diese glamouröse Karriere schien einen hohen Preis zu fordern, denn Fays Nervosität und Gereiztheit bereiteten ihrer Mutter Sorgen. Sie war Fay nie so nahegestanden wie ihrem Sohn, aber manchmal fühlte sie, daß es zwischen ihnen eine Barriere gab, wie ein Schild aus Spiegelglas, das Ann nicht passieren, sondern durch das sie nur beobachten konnte.
Peter lachte. Ann zuckte vor Überraschung zusammen. Sein Lachen war in diesen Tagen selten zu hören. Die beiden waren zwar Zwillinge und hatten das gleiche dunkle Haar und den gleichen Teint, doch im Charakter waren sie völlig verschieden. Fay war die Ruhige und Peter der Extrovertierte der Familie gewesen. Ein lauter, entzückender Junge, für den das Leben ein endloser Spaß war. Aber das war lange her. Jetzt war sein Gesichtsausdruck mürrisch und grüblerisch. Ann war traurig, da sie nicht wußte, was ihn bedrückte, und ihn wegen der Distanz, die zwischen ihnen herrschte, nicht zu fragen wagte. Er sollte eigentlich glücklich sein. Er besaß dieses Haus, ein Hochzeitsgeschenk von Ben und ihr, hatte den akademischen Grad eines Doktors der Philosophie, war jetzt Universitätsdozent für Volkswirtschaftslehre, und es würde niemanden erstaunen, wenn ihm ein Fellowship in seinem College angeboten werden würde. Warum also sah er so unzufrieden aus? Vielleicht war er mit Sally nicht glücklich. Ann versuchte den Schimmer von Aufregung und Hoffnung zu unterdrücken. So durfte sie nicht denken. Wie konnte sie ihrem Sohn eine Scheidung wünschen, vor allem jetzt, da die beiden ihr gesagt hatten, daß ein zweites Kind unterwegs sein könnte? Nervös zündete sie sich noch eine Zigarette an.
Sally war nur eines von vielen Mädchen gewesen, die Peter mit nach Hause gebracht hatte. Sie war stiller und weniger attraktiv als die meisten seiner Freundinnen, und zuerst hatte sie niemand in der Familie ernst genommen. Ann hatte ihren Mangel an Entgegenkommen der Gedankenlosigkeit der Jugend zugeschrieben und ihr Schweigen für Schüchternheit gehalten, aber im Verlauf der Monate sah sie sich zu der unangenehmen Schlußfolgerung gezwungen, daß das Mädchen keine Freundschaft wünschte – am allerwenigsten mit Ann. Es gab Zeiten, da schienen diese großen braunen Augen sie herausfordernd zu betrachten. Anns Beziehung zu ihrem Sohn war immer herzlich und liebevoll gewesen, und so hatte es sie erstaunt, daß er sich zu jemandem, der so kühl und reserviert war, hingezogen fühlte. Aber sie hatte sich keine großen Sorgen gemacht, denn mit einundzwanzig war ihr Sohn zu jung und zu verliebt in die Mädchen gewesen, um an Heirat zu denken. Sie war überzeugt, daß diese Affäre nicht lange dauern würde.
Deswegen war es ihr schwergefallen, erfreut auszusehen, als Peter, der in seiner Unbekümmertheit nichts von der Feindseligkeit zu merken schien, die zwischen seiner Freundin und seiner Mutter entstanden war, verkündete, daß er Sally heirate.
Im Vertrauen auf die enge Beziehung, die in ihrer Familie herrschte, hatte Ann immer selbstgefällig angenommen, daß sie, wenn dieser Tag kam, mit Freuden ein neues Mitglied in ihren Kreis aufnehmen würde. Unglücklicherweise hatte sie nicht mit der Möglichkeit gerechnet, daß ihr Sohn eine Frau heiraten würde, die sie nicht mochte und die sie ihrerseits nicht leiden konnte, jemanden, dessen letzter Wunsch es anscheinend war, ein Teil der Grange-Familie zu werden.
Die Hochzeit war aufwendig, weiß und feierlich gewesen und die einzige, an der Ann mit dem Wunsch teilgenommen hatte, jemand würde Einspruch gegen die Eheschließung erheben.
Es hatte niemals Streit gegeben, kein böses Wort war je gefallen, Sally war nie unverschämt, aber wenn Ann und Ben zu dem jungen Paar kamen, fiel Sallys Begrüßung derart kühl aus, daß die Besuche bald aufhörten. Im ersten Jahr seiner Ehe tauchte Peter regelmäßig in seinem Elternhaus auf. Wenn Ann die beiden zum Dinner oder zu einer Familienfeier einlud, kam Peter immer allein, und die Entschuldigungen für Sallys Abwesenheit waren so vage, daß Ann beinahe erleichtert war, als er keine Ausreden mehr erfand. Das war für alle weniger peinlich. Da nie eine Einladung ins Haus ihres Sohnes erfolgte, lernte Ann die ein, zwei Stunden zu schätzen, die Peter mit ihr verbrachte. Aber seine Besuche wurden seltener und seltener, und es gab Zeiten, da kam es ihr vor, als fänden diese Begegnungen heimlich statt. Es war ihnen beiden zur Gewohnheit geworden, seine Frau nicht zu erwähnen. Ann hatte Angst, über Sally zu sprechen, weil sie fürchtete, zuviel zu sagen und damit zu riskieren, ihren Sohn für immer zu verlieren. Noch Monate nach der Hochzeit hatte sie sich Sorgen gemacht und versucht, die Ereignisse zu analysieren. Bens Einstellung war sehr freimütig gewesen. Sally war ein verzogenes, unangenehmes kleines Miststück, das er von Anfang an nicht gemocht hatte, und die Tatsache, daß sie mit seinem Sohn verheiratet war, war für ihn noch lange kein Grund, seine Einstellung ihr gegenüber zu ändern. Was seinen Sohn betraf, so hatte Ben ihn bis zu seinem Tod für schwach und undankbar gehalten.
»Du mußt dich von ihnen lösen. Die beiden sind keine Kinder mehr, sondern Erwachsene«, hatte Ben eines Abends brüsk gesagt, als Ann wieder einmal dieses Thema angeschnitten hatte. Diese Worte hatten sie gekränkt.
»Aber ich will sie doch nicht festhalten. Ich möchte nur keinen von beiden verlieren. Plötzlich scheint alles vorbei zu sein. Ich werde nicht mehr gebraucht. Zwischen uns sind Barrieren. Und ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe.«
Jetzt, im nachhinein, sah sie sich vor ihrem geistigen Augen mit tränenüberströmtem Gesicht im Salon stehen.
»Um Himmels willen, Ann, reiß dich zusammen. Ich hatte einen scheußlichen Tag, und wenn ich eins jetzt nicht gebrauchen kann, dann dein theatralisches Getue um dieses undankbare kleine Biest. Kinder werden erwachsen!«
»Ich weiß, ich weiß. Aber das heißt doch nicht, daß sie aufhören müssen, einen zu lieben oder zu besuchen.«
»Vielleicht haben sie dich nie geliebt«, hatte Ben barsch erwidert.
»Ben, wie kannst du so etwas sagen? Ich glaube es einfach nicht. Ich weiß, daß mich meine Kinder geliebt haben, vor allem Peter.«
»Na, jetzt anscheinend nicht mehr.«
»Wohin ist denn diese ganze Liebe verschwunden?« hatte sie unter Tränen gefragt.
»Vielleicht hast du sie mit deiner Liebe erstickt. Kein Wunder, daß die beiden von uns weg wollten«, hatte Ben geantwortet.
»Das ist grausam von dir, Ben.« Sie hatte sich über die Augen gewischt. »Wie konnte mir das nur passieren?« hatte sie mehr zu sich als zu ihm gesagt.
Ben hatte anscheinend plötzlich seine Worte bereut, denn er war zu ihr gekommen und hatte seinen Arm um sie gelegt. »Ach, Ann, du darfst dich nicht so aufregen. Schließlich hast du mich, nicht wahr?« Er hatte sie an sich gedrückt. »Es hat doch keinen Sinn, daß wir darüber streiten, oder? Jetzt gibt es nur noch dich und mich.«
Er hatte recht. Welchen Sinn hatte es, daß sie sich entzweiten? Damals hatte sie beschlossen, ihre Kränkung zu begraben, und sich gezwungen, die Leere, die die Kinder hinterlassen hatten, auszufüllen, indem sie sich völlig auf ihren Mann konzentrierte. Aber der war jetzt tot, und sie fühlte sich ganz allein.
Ann betrachtete die am Tisch Versammelten. Das Zusammentreffen schien recht glücklich zu verlaufen. Vielleicht war sie eingeladen worden, um die Kluft zu Sally zu überwinden, einen Neubeginn ihrer Beziehung zu versuchen. Seit Bens Tod waren alle gut zu ihr gewesen. In dieser Zeit hatte sie die drei öfter gesehen als je zuvor. Fay war aus London gekommen und hatte mehrere Wochenenden bei ihr verbracht. Peter hatte öfter auf einen Sprung hereingeschaut, und Sally hatte ihre Einkäufe erledigt und ihr gelegentlich eine Mahlzeit gekocht. Dann, während der schlimmsten Phase ihrer Trauer, hatte sie niemanden in ihrer Nähe geduldet. Aber jetzt? Sie betrachtete die drei, ihre Kinder, die ernsthaft über Politik redeten. Sally räumte die Teller ab ... Doch immer wieder drängte sich ihr der Gedanke auf: Warum bist du wirklich hier?
»Möchte jemand einen Brandy?« fragte Peter.
»Gern«, antwortete Ann und zündete sich noch eine Zigarette an.
»Du rauchst zuviel, Mutter.«
»Nicht zu rauchen hat deinem Vater auch nicht geholfen, oder?«
Eine Weile schwiegen alle verlegen. Ann bereute die Bemerkung, die als Witz gedacht und als solcher, wie ihr bewußt wurde, von zweifelhaftem Geschmack gewesen war. »Würde ich weder rauchen noch trinken, wäre ich schon längst verrückt geworden.« Sie lächelte. Peter, Fay und Sally wirkten noch verlegener und nahmen hastig wieder ihre Unterhaltung auf.
Es ärgerte sie, wie ungezwungen die drei miteinander redeten, aber jedes Wort, das sie zu ihr sagten, sorgfältig abzuwägen schienen. Niemand außer ihr hatte Ben erwähnt. Sie wußte nicht, ob das aus Rücksicht auf sie oder zu ihrem eigenen Schutz geschah.
Ann beobachtete ihre Kinder. Wie dumm es von ihr war, die beiden weiterhin als Kinder zu betrachten, jetzt, da sie Erwachsene waren. Würden sie bis zu ihrem Tod ihre »Kinder« bleiben?
»Du siehst sehr nachdenklich aus, Mummy.« Fay lächelte sie beinahe schuldbewußt an, als hätte sie plötzlich gemerkt, daß sie Ann von ihrer Unterhaltung ausgeschlossen hatten. »Ich denke in letzter Zeit viel nach, Fay. Das habe ich vorher nie getan. Manchmal habe ich nicht einmal gewußt, was ich wirklich dachte, bis ich es aussprach.« Sie lachte und rückte das Besteck neben ihrem Teller zurecht.
»Was ist dir jetzt gerade durch den Kopf gegangen?«
Ann spielte mit dem Löffel, nicht sicher, wie ihre Kinder auf ihre Gedanken reagieren würden. »Ich habe gerade gedacht, wie traurig es ist, daß wir uns so auseinandergelebt haben. Früher hatte ich eine Familie, jetzt scheine ich nichts mehr zu haben.«
Peinliche Stille folgte auf diese Worte.
»Ach, komm schon, Mum, werd nicht gefühlsduselig«, sagte Peter schließlich. »Natürlich hast du immer noch uns.«
»Wirklich? Das glaube ich nicht, Peter. Ich spüre eine Distanz zwischen uns, die in den letzten Jahren entstanden ist und die es früher nicht gegeben hat. Ich sehe euch beide an und entdecke nichts von eurem Vater in euch. Ihr ähnelt ihm zwar äußerlich, aber das ist alles. Anscheinend habt ihr nichts von seinem Charakter geerbt. Ich wünschte, etwas von ihm in euch wiederzufinden, denn dann hätte ich das Gefühl, ihn nicht ganz verloren zu haben.« Während sie das sagte, drehte sie den Löffel hin und her und konzentrierte sich lieber auf dessen schimmernde Form, als ihren Kinder ins Gesicht zu sehen.
»Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln, Mummy. Du wirst dich nur aufregen, wenn du weiter darüber sprichst«, meinte Fay besorgt.
»Ich möchte das Thema aber nicht wechseln. Ich möchte über Ben reden, vor allem mit euch beiden, die ihr ihn gekannt und geliebt habt.« Ann sah jetzt ihre Kinder an, und die Eindringlichkeit ihrer Worte spiegelte sich in ihren Augen wider.
»Mum, du hast eine schlimme Zeit durchgemacht und erholst dich allmählich davon. Fay hat recht. Lassen wir das Thema fallen. Sei ein braves Mädchen.«
Ann verspürte einen Anflug von Gereiztheit, als Peter mit ihr wie mit einem Kind redete. »Ich möchte das Thema nicht ›fallenlassen‹.« Sie hörte den leicht schrillen Klang in ihrer Stimme, den sie nicht unterdrücken konnte und der ihre Kinder aufblicken ließ. »Du meine Güte, sollen wir den Rest unseres Lebens nie mehr über euren Vater reden?«
»Du mußt vorwärts schauen, Mum, nicht zurück«, sagte Peter in übertrieben geduldigem Ton.
»Diese Platitüden machen mich krank. Bitte, erspar du mir wenigstens diese abgedroschenen Phrasen. Bestimmt kannst du , verstehen, was ich fühle. Wie soll ich nicht zurückblicken? Ben war fünfundzwanzig Jahre lang mein Leben. Er hat jede Stunde meiner Tage ausgefüllt. Alles, was ich getan habe, war für ihn, und jetzt soll ich ihn vergessen und nicht mehr über ihn reden? Du könntest mich genausogut bitten, mich nicht mehr an mein Leben zu erinnern oder darüber zu sprechen.« Ihre Stimme war heiser vor Emotionen geworden. Sie mußte das Verständnis ihrer Kinder gewinnen. Wenn sie jetzt nicht zu ihnen durchdrang, dann würde es ihr nie mehr gelingen.
»Ich glaube, ihr solltet eure Mutter reden lassen, wenn sie das will«, hörte Ann erstaunt Sally sagen. »Sie hat recht. Man kann all diesen Jahren nicht einfach den Rücken kehren. Und warum sollten wir so tun, als hätte Ben nie existiert? Im guten wie im bösen.« Sally lehnte beinahe lässig an der Anrichte, während sie sprach.
»Du hältst dich da raus, Sally! Das geht dich verdammt noch mal nichts an«, wies Peter sie ärgerlich zurecht.
»Mach, was du willst.« Sally zuckte mit den Schultern, richtete sich auf und sammelte die restlichen Teller ein. »Wir alle wissen, wie selbstsüchtig du bist, Peter, aber kannst du nicht einmal vergessen, wie du über deinen Vater denkst, und deiner Mutter helfen, die du angeblich so sehr liebst?« sagte sie auf dem Weg zur Spüle.
»Du verdammtes Miststück!«
»Peter!« rief Ann schockiert. »Sprich nicht so mit Sally. Sie hat nur versucht zu helfen.«
»Wollte sie das, Mutter? Bist du dir sicher?«
»Natürlich bin ich mir sicher. Deine Reaktion war ungerechtfertigt.«
»Peter, Sally«, flehte Fay mit einem Ausdruck des Mißfallens im Gesicht. »Ich glaube, wir sollten vorsichtig ...«
»Was meinst du mit vorsichtig?« fragte Ann schnell.
»Ich wollte damit nur sagen, Mummy, daß Menschen, die in Wut geraten, Dinge von sich geben könnten, die sie später bereuen.«
»Was für Dinge?«
»Nichts, Mummy.«
»Nichts!« schnaubte Sally höhnisch. »Das ist ja zum Lachen!«
»Ich warne dich, Sally. Halt den Mund!« Peter bedachte seine Frau mit einem finsteren Blick.
»Ich verstehe nicht. Was geht hier eigentlich vor?« fragte Ann verwirrt.
»Nichts, Mum, wirklich. Kommt, trinken wir den Kaffee im Wohnzimmer«, sagte Peter, stand auf und ging, von Fay gefolgt, voran.
»Ich helfe Ihnen mit dem Geschirr, Sally«, bot Ann an.
»Ist nicht nötig, bemühen Sie sich nicht. Ich habe ja jetzt endlich einen Geschirrspüler«, entgegnete Sally.
»Das sind wundervolle Maschinen, nicht wahr?« Ann versuchte Konversation zu machen, während sie Essensreste von den Tellern kratzte. »Sally, worum ging es denn eigentlich gerade?«
»Sie haben ja gehört, was Peter sagte – um nichts«, antwortete Sally, ohne sich umzudrehen, und füllte weiter den Geschirrspüler.
»Aber irgendwas ist doch los. Ist mit euch beiden alles in Ordnung, Sally?«
»Was wollen Sie damit sagen?« Noch immer kehrte ihr Sally den Rücken zu.
»Stimmt alles zwischen Ihnen und Peter? Kann ich irgendwie helfen?« Es war ihr peinlich, ihrer Schwiegertochter so persönliche Fragen zu stellen.
Endlich drehte sich Sally um und sah Ann an. »Ich glaube nicht, daß meine Angelegenheiten Sie etwas angehen, Mrs. Grange.« Ihre Stimme drückte die Kälte in ihren Augen aus. Ann wich unwillkürlich vor diesem eisigen Blick zurück.
»Ich wollte mich nicht einmischen. Es ist nur ... Könnten Sie mich nach all diesen Jahren nicht Ann nennen?«
»Wenn Sie das wünschen.«
»Das habe ich immer gewollt.« Ann kam sich ziemlich lächerlich vor, wie sie mit einem Geschirrtuch in der Hand mitten in der Küche stand. »Kann ich ganz leise zu Adam hinaufgehen? Ich habe ihn seit Monaten nicht gesehen.«
»Wenn es sein muß. Aber bitte, wecken Sie ihn nicht. Es ist jedesmal ein Theater, bis er wieder einschläft.«
Ann ließ erleichtert die Küche und die feindselige Atmosphäre hinter sich, die Sally so perfekt schaffen konnte. Oben öffnete sie vorsichtig die Tür des Kinderzimmers und ging zu dem Bett, in dem Adam, ihr einziger Enkel, schlief. Lächelnd betrachtete sie das unförmige Bündel. Den Hintern in die Höhe gereckt, das Gesicht seitwärts gedreht, Schnuller im Mund, lag er da. Trotz Sallys Ermahnung drehte sie das Kind sanft um, genoß das Gefühl des warmen, festen, kleinen Körpers, atmete den süßen Babygeruch ein und deckte es wieder zu. Adam wachte nicht auf, umklammerte nur seinen Schnuller und rollte sich sofort wieder herum. Ann lachte leise, obwohl sie einen Kloß im Hals hatte. Es war traurig, daß sie ihren Enkel so selten sah, vor allem jetzt, da sie eine Familie brauchte. Auf Zehenspitzen verließ sie das Zimmer, ging ins Bad und fischte hastig ihr Make-up auf. Obwohl sie nicht wußte, warum, war es ihr heute abend besonders wichtig, gut auszusehen.
Sie öffnete die Tür zum Wohnzimmer, als Peter gerade erklärte: »Na, jemand muß es ihr doch sagen ...« Er brach mitten im Satz ab, als sie eintrat. Fay winkte sie zu einem Sessel neben dem Kaminfeuer.
»Den habe ich für dich reserviert, Mummy.«
»Nun, Peter, was muß mir gesagt werden? Ich nehme an, du sprachst von mir«, meinte sie ohne Umschweife und nahm von Sally eine Tasse Kaffee entgegen.
»Wenn du das wirklich hören möchtest ...«
»Natürlich.«
»Wir haben darüber gesprochen, daß du das Haus verkaufen solltest.«
»Wir?«
»Fay und ich.«
»Moment mal. Du hast diese Sache erst vor einem Augenblick mir gegenüber erwähnt«, warf Fay ein.
»Aber du bist damit einverstanden, oder?«
»Im Prinzip, ja. Doch ich möchte zuerst wissen, wie Mutter darüber denkt.«
»Danke, Fay, das ist sehr rücksichtsvoll von dir«, sagte Ann, ohne sich bewußt zu sein, wie sarkastisch ihre Stimme klang. Sie trank ihren Kaffee schlückchenweise, ließ sich Zeit, denn plötzlich fühlte sie sich bedroht. Die Atmosphäre knisterte förmlich vor Anspannung.
»Es ist viel zu groß für dich, Mutter.«
»Da stimme ich dir zu, Peter.«
»Der Garten ist riesig.«
»Ja, das ist er.«
»Gut. Du wirst also verkaufen? Ein Freund von mir arbeitet für Hockeys. Er sagt, das Haus ist jetzt ein Heidengeld wert, und vernünftig angelegt ...«
»Du hast also schon mit einem Makler gesprochen?«
»Nur mal, um mich zu erkundigen. Die Agentur würde die Angelegenheit gern für dich erledigen.«
»Davon bin ich überzeugt. Aber, nein, danke.«
»Heißt das, du möchtest, daß ein anderer Makler die Sache übernimmt?«
»Nein, Peter. Das heißt, daß ich nicht verkaufen möchte.«
»Warum denn nicht?« fragte Peter gebieterisch.
»Weil ich es nicht möchte.« Vorsichtig stellte sie Kaffee- und Untertasse auf den Tisch, da sie auf einmal das Gefühl hatte, das Porzellan nicht in ihrer Hand halten zu können, ohne daß es klirrte.
»Aber der Unterhalt muß enorm teuer sein.«
»Stimmt. Doch ich kann es mir leisten.«
»Aber überleg doch mal, was du sparen würdest«, entgegnete Peter.
»Sparen? Wofür?«
»Du könntest wunderschöne Ferien machen.«
»Das kann ich schon jetzt.«
»Na gut. Als Rücklage für dein Alter.«
»Bist du sicher, daß ich es nicht verkaufen soll, um für dein Alter vorzusorgen?« brauste Ann, am Ende ihrer Geduld angelangt, auf. Drei Augenpaare starrten sie erstaunt an. Niemand war es gewohnt, daß sie in die Offensive überging.
»Mummy«, sagte Fay, »wie kommst du nur auf so was Schreckliches?«
»Ist das schrecklich? Ich glaube, unter diesen Umständen ist es eine absolut berechtigte Frage. Ihr beide wißt, daß ich das Haus liebe. Ich möchte nirgendwo anders wohnen, und ich kann mir den Unterhalt leisten. Was gäbe es also für einen Grund, es zu verkaufen?«
»Es kommt mir ein bißchen ungesund vor, daß du allein in diesem riesigen Haus herumgeisterst. Du könntest dir ein hübsches kleines Cottage im Ort ...«
»Und zusehen, wie Fremde in meinem Haus leben?« unterbrach Ann ihre Tochter. »Nein, danke.«
»Ein Cottage irgendwo anders ...«
»Es ist nicht so leicht, Freundschaften zu schließen, wenn man älter wird, weißt du. Dann würde ich wirklich trübsinnig werden.«