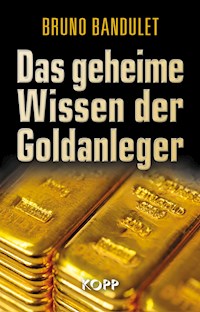
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
»Das geheime Wissen der Goldanleger« ist mehr als ein Buch über die älteste und sicherste Anlage der Welt: ein spannender Wirtschaftskrimi, eine Schilderung des Dreiecksverhältnisses zwischen Dollar, Gold und Euro, eine Geschichte über Geld und Macht und eine kritische Analyse unseres Papiergeldsystems und seiner Risiken. Das Buch wurde geschrieben für Anleger, die schon Gold besitzen und alles Wichtige über das geheimnisvolle Metall wissen wollen – und für solche, die schon einmal daran gedacht haben, in Gold zu investieren, aber bisher zögerten. Zugleich wendet sich das Buch an Leser, die sich von den Zusammenhängen des globalen Finanzkapitalismus faszinieren lassen, die sich um die Zukunft unseres Währungssystems sorgen und Rat suchen, wie sie ihr Vermögen durch schwierige Zeiten retten und krisenfest machen können. Jenseits der Tagesnachrichten erfahren Sie Unbekanntes, wenig Bekanntes und Hintergründe aus der Welt von Gold und Geld. Und Sie profitieren von der Erfahrung und dem Insider-Wissen eines Autors, der seit drei Jahrzehnten auf den Edelmetall- und Devisenmärkten zu Hause ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
4. Auflage Januar 2014 Copyright © bei: Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Dr. Renate Oettinger Umschlaggestaltung: Christine Ibele Umschlagfoto: Degussa Goldhandel GmbH Satz und Layout: Agentur Pegasus, Zella-Mehlis ISBN E-Book 978-3-86445-488-2 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-0 Fax: (07472) 98 06-11Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Widmung
Für Rosmarie
Zitat
»Wenn wir unser als Papierschein auftretendes Geld Symbolgeld nennen, so ist damit wenig gesagt. Das Symbolgeld ist ein abstrakteres Geld als das Sachgeld. Die Abstraktionen des Geldwesens, welche identisch sind mit einer Reihe begrifflicher Ablösungen, nehmen zu. Dieser Vorgang erfährt eine Beschleunigung, seitdem die Goldwährungen, unser letztes Hortgeld, preisgegeben werden, der Geldstoff also zu einem abstrakten Surrogat geworden ist. Gold ist, wie eine lange Erfahrung lehrt, der beste Geldstoff, den es gibt, denn nicht nur ist der Wert, den ihm der Mensch leiht, auf unerschütterliche Vorstellungen von Reichtum, Macht und Glück gegründet, es ist auch qualitativ in allen seinen Vorkommen gleichartig, ist an rare Vorkommen geknüpft, dauerhaft, wenig abnutzbar, leicht erkennbar, leicht zu bearbeiten und in runde Münzform zu bringen.«
»Eine Goldwährung läßt sich außer Kraft setzen, nicht aber kann das Gold außer Kraft gesetzt werden. Das heißt, mit der Goldwährung kann nicht jenes Spiel getrieben werden, das mit den reinen Papiergeldwährungen getrieben wird. Der Vorteil eines Preismaßstabes, der selbst wertvoll ist, ist leicht einzusehen. Seitdem er aufgegeben wurde, aufgegeben werden mußte, hat sich in das Geldwesen etwas Zweideutiges und Betrügerisches eingeschlichen und wird nicht daraus verschwinden, bis die Goldwährungen wiederkehren. Denn Theorien, welche das Geld vollkommen durch Kredit ersetzen oder an seine Stelle ein fiktives, vom Staate zu bestimmendes Wertmaß setzen wollen, entspringen unfruchtbaren Köpfen. Entweder ist dieses Wertmaß selbst Geld, oder es taugt nicht dazu.«
Friedrich Georg Jünger, Die Perfektion der Technik,Vittorio Klostermann
Vorwort
Bevor ich Ihnen vom Goldmarkt erzähle, von Zeiten, in denen das Metall eine exzellente Anlage war, und von anderen Jahren, in denen Geld Gold schlug, will ich berichten, wie alles begann.
Ich war im November 1978 wieder einmal in Afrika, in Johannesburg, dort, wo unbekannte Flüsse vor vielleicht drei Milliarden Jahren auf einer Breite von 500 Kilometern in eine Meeresbucht geströmt waren und die reichsten Goldvorkommen abgelagert hatten, die die Welt je kannte. Dr. Fred Zoellner hatte mich zum Abendessen eingeladen, und er hatte einen Gast mitgebracht: Fritz Plass, den Chefgoldhändler der Deutschen Bank.
Fred Zoellner hatte ich durch mein 1978 erschienenes Buch Schnee für Afrika kennengelernt, das sich kritisch mit der westlichen Entwicklungshilfe auseinandersetzte. Zoellner, Grandseigneur, Schwiegervater von Professor Christian Barnard und Geschäftsmann mit besten Beziehungen zum südafrikanischen Establishment, war fast noch eine Erscheinung aus den kolonialen Glanzzeiten Afrikas. Dank eines Fernschreibers, der den ganzen Tag über tickerte, war er stets bestens darüber informiert, was draußen in der Welt vor sich ging. Er bewohnte ein weitläufiges Anwesen im Johannesburger Vorort Sandton mit einem Wächter am Tor, der bei Annäherung eines erwarteten Besuches unverzüglich die Auffahrt freigab. Er besaß eine beeindruckende Sammlung von wunderschönen Goldmünzen, die General Paul Lettow-Vorbeck während des Ersten Weltkrieges in Deutsch-Ostafrika prägen ließ, um seinen Partisanenkrieg gegen die Engländer zu finanzieren. Zoellner legte Wert darauf, in seinem Haushalt nur Leute aus Malawi zu beschäftigen. Noch heute kann man in Afrika bis hinauf nach Kenia hören, daß Personal aus Malawi besonders zuverlässig ist.
Nach dem Machtwechsel am Kap zog sich Zoellner in die Schweiz in den Kanton Zug zurück, wo wir damals unseren Verlag hatten. Ich traf ihn dort oft zum Gedankenaustausch über die Weltpolitik, den Goldmarkt und den Gang der Dinge in Deutschland. Den Anstoß für meine lange Affäre mit dem Goldmarkt gab bei jenem Abendessen im November 1978 in Johannesburg freilich der Überraschungsgast: Fritz Plass von der Deutschen Bank: »Gold wird wieder interessant«, meinte er, »und es gibt da eine Marktlücke. Warum machen Sie nicht einen Golddienst?«
Warum eigentlich nicht? Zurück in München, schrieb ich erst einmal ein neues Buch mit dem Titel Gold – Strategie für die Krise, und anschließend wurde der monatliche Newsletter GOLD&GELD gegründet, die erste derartige Publikation im deutschsprachigen Raum. Die Nummer 1 erschien im Oktober 1979. Später wurde der Dienst in GOLD&MONEY INTELLIGENCE umbenannt, kam auch auf Englisch heraus und wurde vor allem im asiatischen Raum – von Israel bis Singapur – von institutionellen Investoren bezogen, die nicht ohne Einfluß am Goldmarkt waren. Die englische Ausgabe wurde später wieder eingestellt, sie hatte mehr Arbeit gemacht als erwartet. Der Übersetzer, ein sympathischer Engländer, war sehr versiert, hatte aber die Angewohnheit, sell und buy zu verwechseln.
Ohne Fritz Plass wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mein Glück mit einem Golddienst zu versuchen. Ohne ihn wären der Aufbau und die Erfolgsgeschichte von GOLD&GELD so nicht möglich gewesen. Von ihm erfuhr ich in den ersten Jahren, was sich hinter den Kulissen des Marktes abspielte. Und er nutzte GOLD&GELD, wenn er eine Meinung oder eine Nachricht lancieren wollte. Es entwickelte sich ein Vertrauensverhältnis, das darauf beruhte, daß die von Plass als vertraulich eingestuften Informationen auch vertraulich behandelt wurden.
Noch in den 1970er und lange Zeit in den 1980er Jahren war Gold ein überschaubarer Markt, auf dem man sich gegenseitig kannte. Es gab nur eine Handvoll von Marktmachern, darunter die drei Schweizer Großbanken, die auf Kosten Londons die südafrikanischen Goldexporte an sich gezogen hatten, und in Frankfurt die Dresdner und die Deutsche Bank. Die Dresdner verursachte bei den regelmäßigen Goldauktionen des US-Schatzamtes und des Internationalen Währungsfonds (IWF) die meisten Schlagzeilen. Sie kaufte im großen Stil, sie räumte ab. Je länger und je mehr die Amerikaner und ihre Helfer vom IWF Gold verkauften, desto größer wurde der Appetit des Marktes. Nachdem das Spiel ausgereizt war, zog sich der Chefgoldhändler der Dresdner Bank nach Südafrika zurück. Er kaufte sich ein Weingut in der Kap-Provinz.
Fritz Plass, der sich lieber im Hintergrund hielt, und seine Deutsche Bank konnten sich den Verdienst zuschreiben, den Krügerrand hierzulande populär gemacht zu haben. Die nach dem Burenpräsidenten benannte Münze wurde zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte. Wer Krügerrand sagte, meinte Goldinvestment.
Die Banken in Frankfurt und in Zürich hatten damals eigene Positionen in Gold in einer Größenordnung, die heute unvorstellbar ist. Immer, wenn ich Rudolf Schriber, den Goldhandelschef der Schweizerischen Kreditanstalt, zum Mittagessen im Orsini traf, versuchte ich aus ihm herauszubekommen, mit wie vielen Tonnen er gerade lang oder kurz war. Schriber sagte nie long oder short, sondern immer nur »lang« oder »kurz«. Er war ein jovialer, listiger Mann, der seine Karten nie ganz aufdeckte.
Und dann war da auch noch der Russe Karnauch, Präsident der Wozchod Bank in Zürich, von der aus es nur ein paar Schritte zur Hummerbar im St. Gotthard waren. Er gehörte zu den großen Spielern am Goldmarkt, er kaufte und verkaufte, während die Zeitungen rätselten, was die Russen als nächstes tun würden. Als der Goldpreis ins Rutschen kam und seine Schieflage größer wurde, präsentierte ich ihm einen mitgebrachten Chart, um ihn vor dem gefährlichen Abwärtstrend zu warnen. »Ich bin jetzt soweit, daß ich nicht mehr auf die Charts schaue«, erwiderte Karnauch und lenkte die Konversation wie so oft auf Puschkin und Tolstoi. Die Bank geriet in Schwierigkeiten, Moskau schickte einen Kommissar, und als der über die Bücher ging, traf ihn der Schlag. Die Schweizer Presse erfuhr nichts, die Russen verfrachteten die Leiche bei Nacht und Nebel auf einem Rückflug nach Moskau.
Damals, in den 1980er Jahren, war der Goldmarkt noch nicht dominiert von Hedge-Fonds und Händlern, die den Preis von allem und den Wert von nichts kennen. Die wirklich großen Investoren konnte man an den Fingern beider Hände abzählen. Einer saß in Monaco, ein anderer in Brasilien, ein paar am Golf, wieder ein anderer – es war ein bekannter Großindustrieller – in Deutschland. Wenn in Zürich oder Frankfurt zu hören war, der Goldpreis könne oder werde um soundsoviel Dollar zulegen oder korrigieren, dann mußte man das ernst nehmen. Denn diese Banken waren es ja, die den Markt machten – bis zu einem gewissen Grad. Daß die Super-Hausse im Januar 1980 enden und dann eine 20jährige Baisse folgen würde, auch wenn diese mehrmals durch sehr lukrative Gegenbewegungen unterbrochen wurde – das ahnte niemand, das konnte niemand ahnen.
Typisch für das Endstadium einer Super-Hausse sind immer die zunehmende Volatilität, d. h. die zunehmende Heftigkeit der Preisausschläge, und die Beschleunigung des Preisanstiegs. Bei den Rohstoffen (normalerweise nicht bei den Anleihen!) enden solche primären Trends gern in einem sogenannten spike, einem Dorn, d. h. in einer fast vertikalen Übertreibung – in einem irrationalen Überschwang, dem manchmal eine Täuschung vorausgeht, bevor der letzte Akt gegeben wird.
So war es auch 1979, als Gold noch eine »Wand der Sorgen« hinaufkletterte. Immerhin war das Metall am 1. Januar mit nur 227,15 Dollar in das neue Jahr gestartet. Das war nicht wesentlich mehr als Ende 1974, als in der Spitze fast 200 Dollar erreicht worden waren, bevor eine mittelfristige Baisse einsetzte, die erst im August 1976 bei 103 Dollar je Unze endete. Da hatten die Investoren wieder einmal jedes Interesse am Gold verloren.
Am 5. Oktober 1979, als ich die Nummer 1 von GOLD&GELD schrieb, wurde Gold nachmittags bei 385 gefixt. Nur zwei Tage zuvor waren es noch 437 Dollar gewesen. Ein drastischer Einbruch, begleitet von wilden Gerüchten über Zentralbankinterventionen und vor dem Hintergrund steigender Inflation und steigender Ölpreise. Am Rande einer IWF-Tagung in Belgrad hatte gerade ein amerikanisches Regierungsmitglied verlauten lassen, Washington behalte sich das Recht auf Änderung seiner Goldpolitik vor, denn die Situation auf den Märkten sei ungesund. Und kurz zuvor hatte der schweizerische Nationalbankpräsident Leutwiler, ein Inbegriff der Seriosität, zu bedenken gegeben, ob die am Gold interessierten Notenbanken nicht für »geordnete Marktverhältnisse« sorgen sollten. Vor allem aber hatte Paul Volcker, der mächtige Chef der amerikanischen Federal Reserve und wahrhaftig kein Freund des Goldes, die Zentralbanken von Frankreich, Italien und der Benelux-Staaten wegen einer Intervention konsultiert und sich in Hamburg mit dem deutschen Bundeskanzler getroffen.
»Seit Hamburg und Belgrad hängt tatsächlich das Damoklesschwert einer offiziellen Intervention über dem Goldmarkt«, schrieb GOLD&GELD in der Oktober-Ausgabe 1979. An die damaligen Vorgänge zu erinnern ist auch heute von Interesse, denn erstens ist Gold nach wie vor eine staatliche Währungsreserve, zweitens bleibt auch das Geschehen am Goldmarkt vor dem Wendejahr 1999 und danach ohne die Rolle der Notenbanken unverständlich, und drittens lehren uns die Ereignisse von 1979, daß der Markt manchmal mächtiger ist als seine größten Teilnehmer – und seien es Zentralbanken.
Nach dem erwähnten Preiseinbruch Anfang Oktober 1979, der den Zweck erfüllte, die Spekulanten zu täuschen und die schwachen Hände aus dem Markt zu vertreiben, stagnierte Gold den ganzen November hindurch unter 400 Dollar. »Sofort kaufen«, empfahl ich meinen Lesern am 17. November. Im Dezember explodierte der Preis, er verdoppelte sich innerhalb weniger Wochen.
Kann sich ein solches Drama am Goldmarkt wiederholen? Selbstverständlich, wenn auch nicht auf demselben Preisniveau. Aber die Atmosphäre, das Sentiment, die Unberechenbarkeit werden ähnlich sein. Nicht anders als die Natur oder die Kunst, hat auch ein Edelmetallmarkt nur eine beschränkte Anzahl von Formen zur Auswahl. Er arbeitet immer mit demselben Material – mit der menschlichen Psyche, mit Investoren und Spielern, deren Wissen und deren Disziplin begrenzt sind, deren Anfälligkeit für Emotionen sich nie ändern wird.
Am Montag, dem 21. Januar 1980, war die Party zu Ende. Beim Vormittagsfixing in London kostete Gold 843 Dollar, nachmittags 850. Der Briefkurs für die Unze Silber wurde in Zürich mit 51 Dollar gemeldet. An der New Yorker Terminbörse COMEX erreichte der nächstliegende Terminkontrakt für kurze Zeit sogar 873. Wieviel zu diesem Preis überhaupt gehandelt wurde, konnte ich nie feststellen.
Immerhin bot der Goldmarkt im Verlauf des Jahres eine zweite Chance, umzudenken und auszusteigen. Bis zum Herbst 1980 erholte sich der Preis wieder auf 700 Dollar. Wenn man bedenkt, daß sich Gold im Januar nur für ein paar Tage, nämlich vom 16. bis zum 22., über 700 gehalten hatte, dann kann man mit Fug und Recht von einer Doppelspitze sprechen. Zu diesem Bild paßten auch die Goldminen-Aktien, die im Herbst sogar höher notierten als im Januar. Entgegen einer weitverbreiteten Meinung prognostizieren die Minen eben nicht immer den Goldpreis. Und sie sind – auch das ist eine Lehre des Jahres 1980 – keineswegs dann am risikoärmsten, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis besonders tief ist. Im Herbst 1980 standen erstklassige Gold-Aktien auf dem Kurszettel, die nur mit dem Zehnfachen des Jahresgewinnes bezahlt wurden!
Im November 1980 war ich wieder in Johannesburg und machte die Beobachtung, daß die Straße vor der Johannesburger Börse vollgeparkt war mit neuen Porsches. Das waren die fahrbaren Untersetzer der Broker. Johannesburg schwamm in Geld. Niemand konnte sich vorstellen, daß auch einmal magere Zeiten anbrechen würden. Auf dem Rückflug nach Zürich ließ ich alles noch einmal Revue passieren und beschloß, in das damals noch kleine Lager der Baissiers zu wechseln. Wer hätte damals gedacht, daß es bis zur finalen Kapitulationsphase zwei Jahrzehnte dauern würde.
Nach zwei Veröffentlichungen, die 1979 und 1984 erschienen, jetzt also noch einmal ein Buch über Gold. Warum? Weil der moderne Goldmarkt in den vier Jahrzehnten, die auf den folgenden Seiten gestreift werden, zum ersten Mal überhaupt einen vollen Zyklus nach oben und unten durchlaufen hat. Weil die Masse der Anleger auch nach den Preissteigerungen seit 2001 Gold immer noch nicht als legitime und normale Anlageform wiederentdeckt hat. Weil in den nächsten Jahren mit ein wenig Glück vielleicht doch noch günstigere Einstiegspreise winken. Und weil einem Portfolio, das angesichts der wachsenden Risiken an den Finanzmärkten auf Gold verzichtet, ganz einfach die Balance fehlt.
Einerseits ist Gold ein einfaches, fast archaisches Investment. Andererseits hat auch der Goldmarkt, wie alle Finanzmärkte, seine Tücken. Nur wer ihn versteht, wer in seine Geheimnisse eindringt, wird auf Dauer Erfolg haben. Dabei soll das vorliegende Buch, in dem drei Jahrzehnte Faszination und praktische Erfahrung stecken, behilflich sein. »Ohne Erfahrung an der Börse«, sagte André Kostolany, »ist es schwer, gute Nerven zu haben.« Wie auch immer, ich habe den Goldmarkt im Laufe der Zeit als hohe Schule des realistischen Denkens und als Gegengift gegen die Versuchungen der Ideologie und der Illusion kennen- und schätzengelernt.
Bruno Bandulet
Bad Kissingen, im Juli 2007
P.S.: Bevor Sie mit der Lektüre beginnen, empfiehlt es sich vielleicht, einen ersten Blick auf die Grafiken am Ende des Buches zu werfen. Soweit wie möglich sind sie in derselben Reihenfolge angeordnet wie die Kapitel. Sie ergänzen und illustrieren den Text. Da das vorliegende Buch kein Ratgeber im üblichen Sinne ist, sondern wenig Bekanntes, Unbekanntes und Hintergründe vermitteln will, wurde auf eine komplette Aufzählung der Produkte, die dem Goldanleger zur Verfügung stehen, verzichtet. Aber es ist im Grunde gleichgültig, ob Sie Barren oder Münzen, den Krügerrand oder den Maple Leaf bevorzugen. Ein ganz anderes Thema sind die Gold-Aktien. Als Investment sind sie schwieriger, volatiler und anspruchsvoller, aber oft auch lohnender als das Metall – und sie erfordern eine kontinuierliche Beobachtung und Informationsbeschaffung, die ein Buch nicht leisten kann. Gold ist Pflicht, die Goldaktien die Kür.
Kapitel I –
Der Mythos lebt
Die Finanzmärkte zwischen Realität und Fiktion – und warum Gold vielseitiger ist als jede andere Anlage
Womit sollen wir unsere Expedition in die Welt des Goldes beginnen? Mit einem Blick in die Geschichte? Mit der Frage nach seinem Wert? Oder, indem wir es mit anderen Vermögensanlagen vergleichen? Am besten mit allen drei Themenbereichen nacheinander, denn das eine läßt sich ohne das andere nicht verstehen.
Gold ist getränkt mit Geschichte: mit Aufstieg und Niedergang großer Kulturen, mit Eroberungen und Kriegen und mit der Stabilität langer Friedensperioden, mit der Sehnsucht der menschlichen Rasse nach Transzendenz und Schönheit. Seit acht oder neun Jahrtausenden kennen und schätzen die Menschen Gold, seit 3000 Jahren wird es als Geld genutzt. Schon die europäische Bronzezeit kannte Goldschmuck. Die Pharaonen Ramses II. und Ramses III. aßen von massivem Goldgeschirr, ihre Throne waren aus purem Gold. Der Historiker Diodorus berichtete von babylonischen Kolossalstatuen aus Gold, die mit den dazugehörigen Altären 143000 Kilogramm wogen. Auch für die Juden, die das Metall wahrscheinlich erst in Ägypten kennenlernten, war Gold das Symbol des göttlichen Lichtes. Der Tempel des Salomon war mit Gold überreich ausgestattet. Die Etrusker waren Meister im Granulieren von Gold und in Filigranarbeiten. Die Germanen führten auf ihren Heerzügen der Völkerwanderungszeit Goldschmuck mit sich. Die mittelalterliche Gotik schuf religiöse Kunstwerke aus Gold von unvergänglicher Schönheit. Die Bibel ist voller Bezüge auf Gold, in ihrer Symbolik bedeutet Gold immer etwas Kostbares. Noch immer gelten die liturgischen Vorschriften der katholischen Kirche, wonach die Geräte, die unmittelbar mit dem Heiligsten in Berührung kommen, aus Gold sein müssen.
Kein anderes Gut, kein anderes Geld ist so tief und so fest im kollektiven Gedächtnis der Menschheit verankert. Alle Erklärungen der jüngsten Zeit, daß Gold tot sei, waren in den Wind gesprochen. Es ist erst ein paar Jahre her, daß Gold als obsolet und nutzlos geschmäht wurde – und doch erwies sich der Mythos als unzerstörbar. Die Schweizerische Kreditanstalt formulierte es in ihrem 1982 erschienenen Goldhandbuch so: »Seit der Morgendämmerung der Geschichte ist Gold als Symbol der Macht und als Wertaufbewahrungsmittel bekannt. In dieser langen Zeit, die das Entstehen und den Niedergang zahlreicher Weltreiche und Kulturen sah, hatte das Gold stets einen Markt und einen Wert. Im Unterschied zu ihm sind alle anderen als Geld benutzten Waren – wie Muscheln, Vieh, Steine, ja selbst das Silber – von der Bildfläche verschwunden oder stark zurückgedrängt. Sogar beim Grund und Boden, einem anderen traditionellen Vehikel der Vermögensanlage, wurden durch Kriege und Rechtsänderungen die Eigentumsverhältnisse wiederholt von Grund auf umgestülpt. Einzig mit dem leicht aufbewahrbaren Gold konnten Vermögen theoretisch aus grauer Vorzeit in die Gegenwart herübergerettet werden.«
Und doch tangiert auch Gold, wie alles im Leben, den Bereich des Fiktiven. Wäre Fort Knox in Wirklichkeit leer, würde das dem Dollar nicht im geringsten schaden, solange die Öffentlichkeit davon überzeugt wäre, daß die amerikanischen Goldreserven dort immer noch liegen. Wäre Gold nie gefunden worden, würde es auch niemand vermissen. Holger Bonus kam in seinem anregenden Buch über das »Unwirkliche in der Ökonomie« zu dem Schluß, daß der hohe Wert des Goldes auf nichts anderem als der allgemeinen Überzeugung beruhe, daß Gold einen hohen Wert habe. Auch die Notenbanken stapelten Zehntausende von Tonnen nur deshalb in ihren Kellern, weil sie wüßten, daß andere Zentralbanken die Barren immer gerne annehmen würden. Bonus spricht von einer »Konvention, das Fiktive für real zu nehmen«. Und diese Konvention sei bei Gold weniger künstlich als etwa bei Anleihen. »Die enorme Wertschätzung von Gold ist offenbar in der menschlichen Psyche tief verwurzelt.« Hinzugefügt werden muß: Sie ist nicht etwa tief verwurzelt durch den Beschluß irgendwelcher Regierungen, sondern durch einen freien gesellschaftlichen Konsens, der Jahrtausende überdauert hat. Auf diesem Konsens über den wirklichen und hohen Wert des Goldes beruht seine Stellung in der Kultur- und Geldgeschichte. Seine Knappheit und seine einzigartigen chemisch-physikalischen und ästhetischen Eigenschaften waren dabei nur die Voraussetzung.
Von Seiten der Goldgegner ist oft zu hören, daß ein Vielfaches der Jahresproduktion in den staatlichen und privaten Tresoren liege und daß Gold keine Zinsen abwerfe. Tatsächlich ist ein großer Teil des jemals geförderten Goldes noch vorhanden. Es wird nicht verbraucht wie andere Rohstoffe, wie Weizen, Zucker oder wie die Industriemetalle. Wie groß die Weltgoldbestände wirklich sind, ist nicht bekannt. Meist wird eine Menge zwischen 130000 Tonnen (das wäre ein Würfel mit einer Kantenlänge von knapp 19 Metern) und 150000 Tonnen genannt. Wie vage diese Angaben sind, geht schon daraus hervor, daß das World Gold Council den Goldbesitz der Inder, die mehr Gold horten als jedes andere Volk, einmal auf 8000 bis 12000 Tonnen schätzte.
Nehmen wir einmal an, alle Notenbanken würden ihre Goldbarren auf einmal auf den Markt werfen. Dann würde der Preis abstürzen, aber nicht ins Bodenlose. Es gäbe genügend Interessenten, die die Gelegenheit nutzen würden, günstig an eine Vermögensanlage zu kommen, die ihnen bisher vielleicht zu teuer erschien. Der Preis würde sich fangen und wieder steigen. Da die Regierenden den Wert des Goldes nie dekretiert haben, können sie ihn auch nicht per Dekret aufheben. Eben dies macht Gold zu einem favorisierten Investment jener Bürger, die die Freiheit über alles schätzen, die sich vom Staat nicht mehr viel erhoffen und die der politischen Klasse grundsätzlich mißtrauen.
Wo liegt schon die Grenze zwischen Fiktion und Realität? Ungedecktes Geld ist ungleich fiktiver als Gold. Zu Zeiten Goethes war es wenigstens noch faßbar. Im Faust ist noch von »Zetteln« die Rede. Die Zettel als gesetzliches Zahlungsmittel, also die bedruckten Geldscheine, kursieren immer noch. Aber der Großteil der gigantischen Geldmengen, die mit jährlichen Wachstumsraten von zuletzt zehn Prozent die Welt überfluten, existiert nur noch elektronisch. Stürzen die Computer ab, sind die Guthaben nicht mehr greifbar. Und selbst die Annahme, daß man jederzeit den Gegenwert seines Kontos bei der Bank bar abheben kann, beruht auf der Bedingung, daß nicht alle Bankkunden dies auf einmal tun. Dann würde sich nämlich herausstellen, daß die vorhandenen Banknoten nicht ausreichen. Solange die Bank solvent ist, kann sie sich neue Noten bei der Zentralbank besorgen. Wenn nicht, muß sie die Schalter schließen.
In seinem Klassiker Geld, Gold und Gottspieler geht Roland Baader einen Schritt weiter, wenn er anmerkt: »Die Tatsache, daß die durch nichts gedeckten Papierscheine, die wir heute (und schon lange) in unseren Taschen herumtragen, durch staatlichen Befehl zu ›Geld‹ erklärt worden sind, muß noch lange nicht bedeuten, daß sie auch tatsächlich Geld sind. Und in der Tat sind sie das nicht. Was wir ›Geld‹ nennen, ist kein Geld.« Baader kommt zu dem Schluß: »Geld ist und bleibt also nur das, was der freie Markt als Geld geschaffen hat, nämlich Gold (und zum Teil Silber).«
Wenn schon Papiergeld fiktiv ist, sind es erst recht Regierungsanleihen, denn das Papiergeld wurde von den Regierungen nachweislich zu dem Zweck eingeführt, Schulden machen zu können. Daß sich Anleihen im Gegensatz zu Gold verzinsen, ist nachvollziehbar. Unqualifiziert argumentieren diejenigen Geldideologen, die im Zins die Quelle allen kapitalistischen Übels sehen und ihn am liebsten abschaffen würden. Wenn ich z. B. einem Unternehmen Geld leihe, gehe ich davon aus, daß die Mittel vernünftig investiert werden, daß sie Gewinne abwerfen und daß mein Darlehen aus diesen Gewinnen bedient und zurückgezahlt werden kann. Ich beteilige mich am unternehmerischen Risiko und erwarte dafür eine Kompensation, eine Art von Gewinnbeteiligung. Wäre der Kredit zinslos, könnte ich das Geld genausogut und ohne Risiko unter die Matratze stecken. Weil Gold keine Forderung an einen Dritten darstellt und logischerweise kein Bonitätsrisiko beinhaltet, wirft es normalerweise keine Zinsen ab – und das ist völlig in Ordnung.
Mit den Staatsanleihen verhält es sich etwas anders als mit Unternehmensanleihen. Hier kommt von Anfang an etwas Betrügerisches ins Spiel. Der Staat bildet mit dem Geld, das ihm seine Bürger oder (im Falle der USA) die Ausländer leihen, kein Produktivvermögen, aus dessen Ertrag die Papiere verzinst und zurückgezahlt werden können. Das Geld wird für andere Zwecke ausgegeben: für die Umverteilung, für den Unterhalt der politischen und bürokratischen Klasse, für die Beeinflussung und Bestechung fremder Regierungen und für Kriege.
Der Staat kann nur so lange neue Schulden machen, als er in der Lage ist, die Zinsen auf die alten zu zahlen. Zu diesem Zweck nimmt er ständig neue Schulden auf. Er wälzt einen immer größeren Schuldenberg vor sich her. Das geht erstaunlich lange gut, weil der Obrigkeit Instrumente zur Verfügung stehen, über die ein Unternehmen nicht gebietet. Sie kann durch Besteuerung, d. h. durch Teilenteignung der Bürger, ihre Einnahmen bis zu einem gewissen Grad willkürlich anheben; sie kann auf Inflation setzen, d. h. auf die Entwertung der Schulden; und sie holt sich einen Teil der Zinsen, die sie ihren Gläubigern zahlt, per Steuer umgehend wieder zurück. So kommt zum Schaden auch noch der Spott.
Am Aktienmarkt ist das Verhältnis zwischen Realität und Fiktion schon günstiger. Der Aktionär ist an einem Unternehmen beteiligt, das Vermögenswerte besitzt, Güter produziert, Dienstleistungen erbringt und – hoffentlich – Gewinne erwirtschaftet. Allerdings ist der Wert der Aktie nur selten identisch mit ihrem Preis. In den Aktienkursen stecken Gewinnerwartungen, menschliche Emotionen, richtige und falsche Informationen. Sie sind der Massenpsychologie ausgesetzt. Im fortgeschrittenen Stadium einer Börsenhausse können sich die Kurse als völlig fiktiv erweisen, sobald diejenigen Aktionäre, die verkaufen wollen, keine oder zu wenige Käufer finden. Dann kommt es zum Crash oder zu einer langen, zermürbenden Baisse, bis die Papiere schließlich weit unter ihrem inneren Wert gehandelt werden.
Je mehr Teilnehmer sich am Aktienmarkt betätigen, die nur an Kursdifferenzen interessiert sind und nicht an einer langfristigen Firmenbeteiligung, desto schwankungsanfälliger sind die Kurse. Daß die Finanzmärkte effizient seien und daß der jeweilige Kurs der richtige sei, ist eine fromme Legende. Finanzmärkte sind vielmehr gerade deswegen interessant, weil Preis und Wert immer wieder divergieren und weil nur diese Differenz günstige Käufe und Verkäufe ermöglicht.
In seinem Buch über den »Großen Crash 1929« schrieb der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler John Kenneth Galbraith: »Natürlich hatte – und hat – nichts, was von der Börse immer wieder erzählt wurde – und wird –, einen Zusammenhang mit der Realität. Zwischen den Menschen gibt es eben eine ganz besondere Art der Verständigung, die nicht auf Wissen beruht, ja nicht einmal auf dem Mangel an Kenntnissen, sondern auf der Unmöglichkeit, das zu erfahren, was man nicht weiß. Genau das traf auf viele Diskussionen über die Börse zu. Beim Lunch, etwa im Zentrum von Scranton, berichtete ein bekannter Arzt vom drohenden Aktiensplit der Western Utility Investors und dessen Auswirkung auf die Kurse. Weder der Doktor noch seine Zuhörer wußten, warum sie gesplittet werden sollten und warum das die Aktienkurse steigern sollte. Sie wußten vermutlich nicht einmal, warum die Western Utility Investors überhaupt einen Wert hatten. Aber weder der Doktor noch seine Zuhörer waren sich klar darüber, daß sie nichts wußten.« Da werden Erinnerungen wach an die Blase des Neuen Marktes in Deutschland, die zu Beginn des Jahrzehnts platzte.
Eine Parallele besteht darin, daß die von den Medien erzeugte Klischeevorstellung, jedermann sei am Börsenboom beteiligt, 2000 ebenso falsch war wie 1929. In der Hausse, die 1929 zusammenbrach, waren von den damals 120 Millionen Amerikanern nur eineinhalb Millionen aktiv an der Börse engagiert. Und davon kaufte die Mehrheit ihre Papiere in bar, nur etwa 600000 spekulierten auf Pump. Und diese 600000 genügten, um einen Exzeß anzuheizen, der in einem beispiellosen Kollaps endete, die reale Wirtschaft mit in die Tiefe riß, die halbe Welt in die Depression stürzte und den Boden für den nächsten Weltkrieg bereitete.
In den Jahren 1929 und 2000 und bei vielen anderen Gelegenheiten wären die Anleger gut beraten gewesen, der Hysterie und der veröffentlichten Meinung zu mißtrauen, abseits zu stehen oder wenigstens das Risiko zu mindern – durch einen Goldanteil im Portfolio. Zu diversifizieren, nicht alle Eier in einen Korb zu legen und Risiken zu verteilen ist für den langfristigen Erfolg einer Vermögensanlage ungleich wichtiger als das richtige Timing, das ohnehin nur manchmal oder nur durch Zufall gelingt. Spekulation ist legitim, so wie sie André Kostolany verstand – als aufmerksames und kritisches Beobachten des monetären, wirtschaftlichen und politischen Umfeldes, aus dem intelligente Schlüsse gezogen und in konkretes Handeln umgesetzt werden. Schließlich kommt »spekulieren« vom lateinischen speculari, und das heißt: beobachten. »Die Spekulation beginnt mit der instinktiven Absicht«, sagte Kostolany einmal, »das eigene Hab und Gut auf Dauer zu erhalten.«
Dabei spielt Gold eine Schlüsselrolle, weil es eine Reihe von Vorzügen aufweist, die sich einzeln auch bei anderen Anlagen finden lassen, nie aber in dieser vollständigen Kombination.
Auch Rohstoffe tragen zwar ein Preisrisiko, aber kein Bonitätsrisiko. Auch Weizen, Zucker, Zink und Kupfer sind wertvoll und unersetzlich. Allerdings lassen sie sich entweder nur für begrenzte Zeit lagern, oder die Lagerhaltung ist für den Investor unvertretbar teuer. Außerdem verhalten sich die Preise zyklischer. Bei hohen Weizen- oder Zuckerpreisen kann die Anbaufläche schon für die nächste Saison erweitert werden. Selbst die Förderung von Industriemetallen (und damit auch die des Nebenproduktes Silber) wird in einem überschaubaren Zeitrahmen auf hohe Preise reagieren. Und die Rohstoffe sind, eben wegen ihrer industriellen Verwendung, stärker vom Wirtschaftszyklus abhängig. Ein anderes Problem besteht in aller Regel darin, daß die Anlage in Agrarprodukten und Metallen nur über die Terminmärkte möglich ist, also nicht zu Kassapreisen wie bei den Edelmetallen. Wenn die Terminpreise über den Kassapreisen liegen (das nennt man Contango), dann wird z. B. ein Weizenzertifikat auch dann ständig weniger wert werden, wenn der Kassapreis für Weizen nur gleich bleibt. Weil Gold wegen der oberirdischen Bestände und auch wegen der Ausleihungen ein großer, liquider Markt ist, werden die Preisausschläge nach oben und unten in der Regel geringer ausfallen als bei anderen Rohstoffen. In jedem Fall ist Gold mobiler und diskreter. Verstecken Sie einmal ein paar Tonnen Kupfer vor den Behörden!
Zu den knappen und inflationsresistenten Sachwerten zählen auch Diamanten. Auch mit Diamanten konnten Menschen, die vor Krieg und Verfolgung flohen, ihr Vermögen retten. Sie sind sogar leichter zu transportieren als Gold. Nachteilig sind die enorme Spanne zwischen An- und Verkauf und die unsichere Bewertung, die freilich weniger subjektiv und weniger Modeströmungen unterworfen ist, als es auf Gemälde und andere Kunstgegenstände zutrifft. In der Deflation allerdings sind Diamanten wenig gefragt und schwer verkäuflich. In der Deflation der 1930er Jahre saß De Beers auf derart großen Beständen, daß ernsthaft überlegt wurde, einen Teil davon in die Nordsee zu kippen, um den Preis zu stabilisieren.
Die zweite Anlageklasse, nämlich Grund und Boden sowie Immobilien, bietet grundsätzlich Schutz gegen Geldentwertung und Währungsreformen, ist jedoch nicht beweglich, kann leichter als Gold enteignet und besteuert werden, trägt ein Länderrisiko, ist von Natur aus nicht diskret und sehr abhängig von der Lage. Geschlossene Immobilienfonds können unabhängig von ihrem inneren Wert zeitweise unverkäuflich sein. Immobilien nutzen sich ab und sind nicht homogen. Trotz allem waren die großen deutschen Vermögen, die das vergangene Jahrhundert überdauert haben, immer auch in Immobilien engagiert. Sie durften nur nicht in Ostdeutschland oder in der Sowjetischen Besatzungszone liegen – dort wurden sie von der Regierung Kohl ein zweites Mal enteignet. Immobilien sind nicht so fungibel wie Gold. Sie lassen sich nicht jederzeit verkaufen, und die Marge zwischen An- und Verkauf kann sehr groß sein. Fungibilität, d. h. Marktgängigkeit, setzt voraus, daß Sachen oder Wertpapiere der gleichen Gattung und Menge jederzeit austauschbar sind. Eine Unze Gold bleibt eine Unze Gold, gleichgültig, ob sie in Südafrika oder Rußland gefördert wurde.
Aktien als dritte Anlageklasse sind wie Gold fungibel, tragen jedoch ein Währungs- und Länderrisiko und können bei Überschuldung des Unternehmens wertlos werden. Auf sehr lange Sicht generieren Qualitätsaktien den höchsten Ertrag aller Anlageklassen.
Anleihen wiederum sind ein schlechtes Geschäft, wenn die Rendite unter dem Inflations- und Steuersatz liegt, und vor allem, wenn sie in einer Periode steigender Inflation gekauft werden. Anleihen sind der Geldwert par excellence. Zumindest im vergangenen Jahrhundert waren sie in Deutschland und in vielen anderen Ländern mehr als einmal das sicherste Rezept, alles zu verlieren. In der Regel steigt das Risiko mit der Höhe des Coupons. Das trifft besonders auch auf die in Deutschland beliebten Fremdwährungsanleihen zu. Entscheidend ist immer die Bonität des Schuldners. Am Ende eines langen Inflationszyklus wie zu Beginn der 1980er Jahre, als die amerikanische Prime Rate bei 20 Prozent lag und der Coupon 20jähriger amerikanischer Staatsanleihen bei 15 Prozent, können Anleihen ein glänzendes Investment sein. Generell jedoch sind ihr Wert und ihre Sicherheit der Willkür der Notenbanken und Regierungen beziehungsweise der wirtschaftlichen Entwicklung eines Unternehmens ausgesetzt.
Das Fazit lautet, daß Gold der einzige effiziente Markt für einen homogenen, fungiblen, mobilen, international akzeptierten, staatenlosen und diskreten Sachwert darstellt – für einen Sachwert mit geldähnlichen Eigenschaften. Gold trägt, um es zu wiederholen, immer ein Preisrisiko, aber nie ein Bonitätsrisiko. Silber mit seinem erheblich kleineren Markt und seiner größeren Volatilität (und dem Nachteil der Mehrwertsteuer in Deutschland) kommt dem Gold noch am nächsten, hat sich aber historisch als weniger wertbeständig erwiesen.
Unsere Überlegungen werden bestätigt von einer ambitiösen Untersuchung (Gold as a Store of Value), die im November 1998, also in einer Zeit tiefer Goldpreise, vom World Gold Council veröffentlicht wurde. (Das World Gold Council mit seinem Hauptquartier in London wird von den großen internationalen Goldminengesellschaften finanziert.) Danach rentierten Aktien in den USA im Zeitraum von 1896 bis 1996 mit 6,10 Prozent im jährlichen Durchschnitt, langfristige Regierungsanleihen mit 0,42 Prozent, Treasury Bills mit 0,21 Prozent und Gold mit 0,60 Prozent. Alle Erträge schließen Zinsen und Dividenden mit ein und sind real, d. h. unter Abzug der Geldentwertung.
Das Resultat kann kaum überraschen. Die Aktien lagen dank wachsender Wirtschaft an erster Stelle – trotz dramatischer Einbrüche wie nach 1929 und trotz der miserablen 1970er Jahre. Die Bonds schnitten, obwohl sie feste Zinsen zahlten, schlechter ab als Gold, und Gold lieferte sogar mehr, als von ihm erwartet werden konnte: Es behielt nicht nur seine Kaufkraft, es konnte sie sogar über 100 Jahre hinweg steigern.
Noch besser schnitt Gold im Zeitraum 1968 bis 1996 ab, als der durchschnittliche jährliche Ertrag 4,21 Prozent ausmachte. Das war mehr als bei den Bonds, und es konnte sich selbst neben dem Aktienertrag (mit 6,29 Prozent jährlich) sehen lassen. Bemerkenswert ist auch, daß bei den Aktien die höchsten Jahresgewinne in der Zeit von 1896 bis 1996 geringer ausfielen als bei Gold und – wichtiger noch – die höchsten Jahresverluste größer. Die besten Jahresrenditen erreichten bei Gold 77,6 Prozent, die schlechtesten minus 28,7 Prozent. Mit anderen Worten: Die maximalen Abweichungen waren bei den Aktien nach oben kleiner und nach unten größer als bei Gold.
Für Deutschland läßt sich der Vergleich in dieser Form wegen der verlorenen Kriege und der Währungsreformen nicht anstellen. Dafür fehlte die Kontinuität. Daß Gold in der untersuchten Periode von 1896 bis 1996 gerade für Deutsche eine ideale langfristige Anlage war, kann kaum überraschen. Von der Einführung des Goldstandards nach der Reichsgründung 1871 bis zum Kriegsausbruch 1914 blieb nicht nur der nominale, sondern auch der reale Goldpreis konstant. 1924, also nach dem Ende der Hyperinflation, lag die Kaufkraft des Metalls wieder fast genau auf dem Niveau von 1918. Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre stieg die Kaufkraft des Goldes auch in Deutschland wegen der Deflation. 1950, nach Gründung der Bundesrepublik, konnte man hierzulande mit Gold sogar mehr kaufen als zum Ende des 19. Jahrhunderts. Dann sank der reale Goldpreis zwei Jahrzehnte lang, weil der offizielle Unzenpreis bei 35 Dollar fixiert blieb, während die allgemeinen Preise erst langsam, dann schneller anstiegen. 1980 erreichten reale und nominale Goldpreise ihren Höhepunkt, bis dann zum Ende der 1990er Jahre wieder die Nähe der historischen Kaufkraftparität erreicht war.
Gold hat sich auch aus deutscher Sicht über mehr als ein Jahrhundert hinweg, in Krieg und Frieden, in Inflation und Deflation, als perfektes Wertaufbewahrungsmittel erwiesen. Es hat alle vier Regimewechsel überdauert. Daß die Bürger in der geordneten, scheinbar unerschütterlichen Welt des Kaiserreichs nicht im entferntesten ahnen konnten, was das Jahrhundert bringen würde, daß es damals offensichtlich keinen Grund gab, Gold zu horten, ist durchaus richtig. Aber das ist gerade der springende Punkt: Wir sehen nicht in die Zukunft. Sicher ist nur der Wandel.
Selten dringen Geschichten an die Öffentlichkeit wie die des ehemaligen DDR-Bürgers F.G., der im Winter 2004 bei dem Münchener Goldhändler pro aurum am Prinzregentenplatz auftauchte und einen Goldschatz einlieferte, den sein Vater 1945 im Garten vergraben hatte, bevor er in den Westen floh. Dort lagen die Goldbarren in der Erde, überstanden ein halbes Jahrhundert Kommunismus, die Wende und selbst das Ende der Deutschen Mark. Als der Sohn die Barren ausgrub, hatten sie ihren Zweck erfüllt: das Vermögen in schweren Zeiten zu erhalten.
Kapitel II –
Der erste Goldkrieg
1968 bis 1980: Der Goldpool wird gesprengt. Der Dollar stürzt ab. Nixon schließt das Goldfenster und startet die größte Goldhausse aller Zeiten
Als der Goldpreis Ende der 1990er Jahre scheinbar nur noch eine Richtung kannte, als der Markt von verkauftem und verliehenem Zentralbankgold überschwemmt wurde, als derselbe Krügerrand, von dem die Deutschen noch 20 Jahre zuvor nicht genug bekommen konnten, massenweise eingeschmolzen werden mußte – da glaubte alle Welt, Gold sei als Investment tot. Die Anleger kehrten ihre Schließfächer aus, selbst die ewig optimistischen Manager der Goldminen verfielen in Depression, Gurus traten auf, die einen Preisverfall bis auf 35 Dollar prophezeiten, und wer sich bei seiner Bank nach Goldanlagen erkundigte, erntete bestenfalls ein mitleidiges Lächeln.
Nur diejenigen, die die Geschichte des Goldes aus den 1960er und 1970er Jahren kannten, widerstanden der Propaganda. Es war alles schon einmal dagewesen: der Antagonismus zwischen Gold und Dollar, die offene und verdeckte Manipulation durch Regierungen und Zentralbanken, die Gehirnwäsche durch die Medien – aber auch die schließliche Renaissance des gelben Metalls.
Wenn wir die Geschichte des ersten Goldkrieges studieren, die im folgenden erzählt wird, verstehen wir besser, welche Konsequenzen das Ende der Bindung des Dollars an das Gold haben mußte, warum die Machthaber in Washington Gold als Provokation empfanden und warum sie es bekämpften, wie das frühere Weltwährungssystem durch eine bis heute bestehende Währungsunordnung ersetzt wurde und welche enormen Risiken die ungezügelte Ausweitung von Schulden und Geldmengen für die Zukunft birgt.
Die Geschichte des ersten Goldkrieges ist auch die Geschichte eines Kampfes gegen die Realität. Und sie erinnert uns daran, daß der moderne Goldmarkt noch sehr jung ist. Er hat erst einen vollen Zyklus durchlaufen: eine Hausse, die für sehr klarsichtige Beobachter bereits Anfang der 1960er Jahre absehbar war und die erst in den 1970er Jahren richtig in Fahrt kam; einen zyklischen Höhepunkt im Januar 1980, als die Feinunze in London bei 850 Dollar gefixt wurde und der Goldpreis fast gleichauf mit dem Börsenbarometer Dow Jones lag; und eine ähnlich lange, 20jährige Baisse, die – mit Unterbrechungen – erst im Herbst 1999 oder Anfang 2001 (je nachdem, wie man rechnet) zu Ende ging.
Die Währungsordnung, die in den Stürmen des ersten Goldkrieges zerbrach, wird meist mit der geographischen Bezeichnung »Bretton Woods« umschrieben, einem Luftkurort im Nordosten der Vereinigten Staaten, wo Präsident Roosevelt 1944 der Welt eine neue Währungsordnung von amerikanischen Gnaden verschrieb.
Der deutsche Wirtschaftsjournalist Rudolf Herlt (Die Zeit) meinte dazu, es sei den Amerikanern damals gelungen, »die Währungsordnung der Nachkriegszeit ganz auf ihre eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden«. Herlt formulierte: »Das Abkommen von Bretton Woods, das den westlichen Industrieländern 20 Jahre lang in beispielloser Weise als Instrument der Wohlstandmehrung diente, war praktisch ein amerikanisches Diktat. Es brachte die offizielle Anerkennung der absoluten Vormachtstellung des in Gold einlösbaren Dollars.«
Den Teilnehmern von Bretton Woods, die dort ein Jahr vor Kriegsende den Internationalen Währungsfonds (IWF) gründeten, dürfte kaum bewußt gewesen sein, welche Tragweite jener unscheinbare Satz in Artikel IV des Abkommens einmal haben würde. »Der Wechselkurs der Währung jedes Mitgliedes«, so hieß es da, »soll ausgedrückt werden in Gold als gemeinsamem Nenner oder in US-Dollar des Gewichtes und Reinheitsgrades, wie sie am 1. Juni 1944 galten.«
Gemeint war damit, daß der amerikanische Dollar damals und noch lange Zeit danach in einem festen Preisverhältnis zum Gold stand. Eine Unze Gold, also 31,1035 Gramm, kostete offiziell und scheinbar unwiderruflich 35 Dollar. Da alle beteiligten Währungen starr an den Dollar gekoppelt waren, der Dollar aber fest an den Goldpreis gebunden war, konnte gleichzeitig auch der Wert jeder beliebigen Währung in Gold angegeben werden. Das galt selbstverständlich auch für die Deutsche Mark. Am 28. September 1949, als die Mark im Jahr nach der Währungsreform abgewertet wurde, kostete ein Dollar 4,20 Mark, und eine Mark entsprach 0,211588 Gramm Feingold. Nach der ersten Aufwertung der Mark am 6. März 1961 kostete der Dollar – bis 1969 – vier Mark, und für die Mark bekam man jetzt etwas mehr Gold, nämlich 0,222168 Gramm.
Der Goldpreis von 35 Dollar, um den sich alles drehte, kam höchst willkürlich zustande.





























