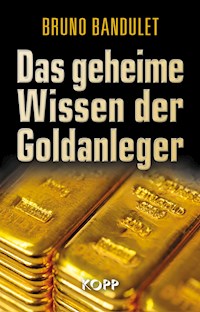4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Dexit - Deutschlands Ausstieg aus dem Euro:Warum er nicht nur machbar, sondern notwendig ist!Bisher wurden Bücher über den Euro geschrieben, die nachwiesen, warum er nicht funktionierte und nicht funktionieren kann: Geschichten, wie die Europa-Verträge gebrochen wurden, wie die EZB illegal Staaten finanzierte, wie die Einheitswährung mit immensen Summen gerettet werden musste, wie Deutschland den Zahlmeister spielte und wie die Sparer mittels Inflation und Nullzinsen schleichend enteignet werden. Alles eine notwendige Bilanz, die auch in diesem Buch gezogen wird.Nur eine Frage wurde nie ernsthaft gestellt und diskutiert: Wenn es stimmt, dass der Euro mehr schadet als nutzt, ist es dann nicht besser, ihn abzuwickeln? Sollte Deutschland austreten? Und, wenn ja, wäre der Dexit überhaupt machbar? Wer wären die Gewinner? Wer die Verlierer? Höchste Zeit, das Tabu zu brechen und die Debatte über den Dexit vorurteilsfrei und schonungslos zu führen.In seinem neuen Buch widerlegt Bruno Bandulet die Legende vom Euro-Profiteur Deutschland. Er beschreibt das ominöse Target-System. Er schildert den schon weit fortgeschrittenen Marsch in die Transferunion und in die große europäische Umverteilung. Er rechnet ab mit Mario Draghi und Angela Merkel. Er erklärt, warum Deutschland Exportweltmeister ist und eurobedingt nichts davon hat. Und er begründet Punkt für Punkt, warum im Dexit der Ausweg aus der europäischen Sackgasse liegt.Die bessere Alternative: die Neue Deutsche Mark (NDM) »Bruno Bandulet ist ausgewiesener Kenner des Geldwesens, zumal des Euros. Sein Stil ist exzellent, leicht, flüssig, leserfreundlich. Dexit ist Pflichtlektüre für Bürger und Investoren, für alle, die mitreden wollen.« Prof. Karl Albrecht Schachtschneider»Bruno Bandulet zeigt in seinem spannenden Euro-Krimi einen plausiblen Ausweg: den Austritt Deutschlands aus der EWU, möglicherweise über eine Parallelwährung.« Prof. Thomas Mayer»Bruno Bandulets Überlegungen und Argumente für einen >Dexit< sind eine große Bereicherung für alle, die konstruktiv darüber nachdenken wollen, wie es mit der Geldordnung in Europa weitergehen soll. Lassen Sie sich Bandulets neues Buch nicht entgehen.« Prof. Thorsten Polleit»Wer Bandulets Buch liest, dem müssen die Augen aufgehen. Ja, so war es und so ist es. Wer wissen will, was in der Währungsunion los ist und warum sie von Krise zu Krise stolpert, muss Bandulets Buch lesen.« Prof. Joachim Starbatty
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
1. Auflage Oktober 2018 Copyright © 2018 bei: Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung, Satz und Layout: Stefanie Beth Lektorat: Renate Oettinger ISBN E-Book 978-3-86445-635-0 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-0 Fax: (07472) 98 06-11Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Kapitel 1
:
Endspiel
»Der Euro wird kommen, aber er wird keinen Bestand haben.«
Der legendäre US-Notenbankchef Alan Greenspan am 2. Mai 1997
Fake News des Jahres: Der Euro ist gerettet
Im Frühjahr 2018 lag trügerische Ruhe über dem Euroraum, einem disparaten Club von neunzehn Nationen, der sich von der arktischen Tundra Finnlands bis zu den Weinbergen Siziliens erstreckte, von der deutsch-polnischen Grenze an der Oder bis zum Cabo de São Vicente am südlichen Ende Portugals.
8 Jahre nach Ausbruch der Euro-Krise, die den Kontinent erschütterte, und fast 2 Jahrzehnte nach der Einführung des Euros als Buchgeld am 1. Januar 1999 sah es so aus, als sei das Schlimmste überstanden, als habe sich Alan Greenspan gründlich geirrt.
Aus seinem Luxemburger Büro, wo er die Rettungsmilliarden verwaltet, verkündete der geschäftsführende Direktor des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), Klaus Regling: »Der Euro ist gerettet.« Und die früher einmal sehr eurokritische, längst aber sehr europhile Süddeutsche Zeitung meldete am 24. Februar 2018: »Für den Aufstieg aus der Asche gibt es handfeste Gründe. Die Euro-Krise mit ihren Sparprogrammen ist verblasst. Fast allen Krisenstaaten geht es wieder gut.«
Tatsächlich wurde 2018 für Euroland insgesamt mit einem vorzeigbaren Wirtschaftswachstum von 2 Prozent gerechnet – für Frankreich 0,2 Prozent weniger, für Italien noch weniger, für Spanien aber mit 2,8 Prozent. Deutschland würde, so die Prognose, mit 2 Prozent wie der Durchschnitt abschneiden, ebenso die Krisenländer Griechenland und Portugal.
Und in Frankreich, einem anderen langjährigen Problemland, versuchte der neue Präsident Emmanuel Macron grundlegende Reformen auf den Weg zu bringen, um endlich zu Deutschland aufzuschließen. Nicht nur das, Frankreich hatte es 2017 erstmals seit Langem geschafft, das Haushaltsdefizit unter die im Maastricht-Vertrag geforderte Obergrenze von 3 Prozent zu drücken.
Leider hatte die Süddeutsche Zeitung, als sie ihr Loblied anstimmte, ein paar wesentliche Tatsachen übersehen. Weder in Italien noch in Griechenland hatte die Industrieproduktion den Stand von 2007 auch nur annähernd wieder erreicht. Innerhalb von nur 10 Jahren hatte Griechenland 45 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes und damit seiner Wirtschaftsleistung eingebüßt! In ganz Südeuropa lag die Arbeitslosigkeit immer noch erschreckend hoch: in Griechenland bei 21 Prozent, in Spanien etwas über 16 Prozent, in Italien bei knapp 11 Prozent und in Frankreich bei knapp 9 Prozent. Deutschland okkupierte in der Eurozone den besten Platz mit 3,5 Prozent.
Dass die Wirtschaft in der Eurozone überhaupt wieder zulegen konnte, war der Nullzinspolitik und der Geldschwemme der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verdanken – Aufputschmittel, die nicht permanent verabreicht werden können, deren Risiken verschwiegen werden und deren Nebenwirkungen bereits sichtbar sind. Während die Schulden – mit Ausnahme des Hochsteuerlandes Deutschland – fast überall weiter wuchsen, hatte die EZB nur Zeit gekauft.
Zeit, die nicht genutzt wurde. Weil die EZB die Zinsen so lange künstlich niedrig hielt und den Leitzins sogar auf null senkte, haben die Euro-Staaten beim Schuldendienst eine runde Billion Euro eingespart. Sie haben diesen Vorteil nur nicht genutzt. 8 Jahre nach Ausbruch der Euro-Krise betrug die italienische Staatsschuld mit gut 130 Prozent der Wirtschaftsleistung immer noch mehr als das Doppelte des erlaubten Volumens. Frankreich erreichte 2018 beinahe die Marke von 100 Prozent. Und der griechische Staat war Ende 2017 mit 326 Milliarden Euro verschuldet und damit um 46 Milliarden höher als nach dem Schuldenschnitt von 2012 – ein hoffnungsloser Fall.
Zombie-Banken, Zombie-Staaten, Zombie-Unternehmen: Die lebenden Toten der Eurozone
Genauso schlimm: Die Banken in Südeuropa wurden auch nicht saniert. 2017 waren unglaubliche 47 Prozent der Kredite, die die griechischen Geschäftsbanken ausgegeben hatten, notleidend. In Zypern waren es 34 Prozent, in Portugal 18 Prozent, in Italien 12 Prozent – in Deutschland aber nur 2 Prozent. Kein Wunder also, dass schon 2017 und noch massiver 2018 von der EU-Kommission, von Frankreich und den Südländern verlangt wurde, dass deutsche Sparer künftig für den Rest der Eurozone mithaften.
Dabei ist nicht einmal sicher, ob diese Angaben über sogenannte Non-performing Loans (NPLs), auch bekannt als notleidende Kredite, überhaupt zuverlässig sind. Definitionsgemäß handelt es sich um Kredite, auf die 90 Tage lang keine Zinsen gezahlt wurden oder die mit der Rückzahlung in Verzug waren. Solche faulen Kredite können versteckt werden, indem die Banken sie verlängern und gutes Geld schlechtem hinterherwerfen. Die EZB selbst kann kein gesteigertes Interesse daran haben, allzu strenge Maßstäbe anzulegen. Mit der Übertragung der Bankenaufsicht an die EZB hat man den Bock zum Gärtner gemacht. Außerdem: Es mag ja sein, dass die Zeitbombe der faulen Kredite langsamer tickt, solange sich die Wirtschaft erholt. In der nächsten Rezession wird sie dafür umso schneller ablaufen.
Was für die Banken gilt, trifft auch auf Unternehmen besonders in den Krisenländern zu – zum einen, weil das billige Geld zu viele marode Firmen über Wasser hält, die besser vom Markt verschwinden sollten, und zum anderen, weil die Tiefzinsen unrentable Investitionen nicht nur ermöglichen, sondern geradezu einen Anreiz dafür schaffen.
Der Leipziger Wirtschaftsprofessor Gunther Schnabl sieht die Eurozone bevölkert von »lebendigen Toten«: »Die Europäische Zentralbank ist von lauter ›Zombies‹ aus Privatwirtschaft und Finanzindustrie umzingelt, die sie selbst am Leben gehalten hat. Steigen die Zinsen, finden die Zombies zwar ihre Ruhe – für Gesellschaft und Politik dürfte aber das Gegenteil gelten.« Mit »Ruhe finden« meint er, dass sie dann wirklich tot sind.
Schnabl nennt die EZB »eine Gefangene der Zombie-Unternehmen, Zombie-Banken und Zombie-Staaten, die sie selbst geschaffen hat«. Damit näherten sich die marktwirtschaftlichen Systeme in Westeuropa den Zuständen an, die in den früheren osteuropäischen Planwirtschaften geherrscht hätten. Weil in den sozialistischen Staaten Bankrotte der staatseigenen Betriebe nicht erwünscht waren, gewährten die Staatsbanken bedingungslose Kredite. »Das Ergebnis war eine trügerische Stabilität: Zwar gab es keine Bankrotte, keine Arbeitslosigkeit und keine Krisen, aber aufgrund des fehlenden Wettbewerbs war die Innovationsfähigkeit der Planwirtschaften gering … Wachsende wirtschaftliche Instabilität bewirkte schließlich den Kollaps.«
Ein vergleichbarer finaler Kollaps steht der Eurozone nicht oder noch nicht bevor, aber die Feststellung ist nicht übertrieben, dass der Euro in Südeuropa immense Schäden angerichtet hat. Auch in Deutschland unterwühlt er die gesellschaftlichen Fundamente. Dass die Produktivität selbst hierzulande kaum noch steigt, dass ein Teil der jungen Generation unter prekären Arbeitsverhältnissen leidet, dass sich der Billiglohnsektor im Vergleich zu D-Mark-Zeiten stark ausgeweitet hat, dass sich Lebensversicherungen nicht mehr rentieren, dass sich Sparen nicht mehr lohnt und die Absicherung für das Alter kaum noch zu leisten ist – das alles hat durchaus mit dem Euro zu tun. Mit der D-Mark wären die Deutschen heute wohlhabender und die Wirtschaft wäre im Kern gesünder.
Für eine falsche Geldpolitik muss eben immer auch ein gesellschaftlicher Preis gezahlt werden. Weil Nullzinsen und die durch den billionenschweren Ankauf von Staatsanleihen produzierte Geldflut die wirtschaftliche Basis der gewohnten Umverteilung zerstören, worauf auch Professor Schnabl hinweist, reagiert die Politik mit sozialstaatlichen Ausgabeprogrammen, die aber den dringend notwendigen Steuersenkungen im Wege stehen, siehe den Koalitionsvertrag und die Praxis der vierten Regierung Merkel.
Negativzinsen und geschönte Inflation: Die schleichende Enteignung
Vermutlich sind sich die meisten Sparer dessen nicht bewusst, aber sie werden längst schon zum höheren Zweck der Euro-Rettung zur Ader gelassen. Sie werden Jahr für Jahr schleichend enteignet, weil die Zinsen auf Tages- und Festgeld weit unter der Inflationsrate liegen und obendrein auch noch besteuert werden.
Nach einer Berechnung der Commerzbank-Tochter Comdirect lag der Realzins (das heißt der Zins auf Spareinlagen nach Abzug der Inflation) im ersten Quartal 2018 bei minus 1,31 Prozent. Da die deutschen Sparer 2,2 Billionen Euro auf Geldkonten geparkt hatten, verloren sie in den ersten 3 Monaten des Jahres 7,16 Milliarden Euro. Seit 2010 hat jeder Deutsche im Durchschnitt 999 Euro verloren – wegen der negativen Realzinsen. Bei einer vierköpfigen Familie waren das fast 4000 Euro. Im zweiten Quartal beschleunigte sich die Inflation. Im Juni 2018 stiegen die Verbraucherpreise in Deutschland um 2,2 Prozent und im Durchschnitt der Eurozone um 2 Prozent.
Und dies ist nur ein Teil der Verluste. In Wirklichkeit büßten die Sparer weitaus mehr ein, und zwar nur deswegen, weil der Euro gerettet werden musste. Würde Mario Draghi die Zinsen nicht künstlich tief halten, um den italienischen Schuldendienst zu entlasten, dann könnten die Anleger in Deutschland einen natürlichen Marktzins von etwa 3 Prozent vereinnahmen.
Als die Direktbank ING-Diba unmittelbar nach Ostern 2018 den Tagesgeldzins um 90 Prozent senkte, nämlich von 0,1 auf 0,01 Prozent per annum, lag die deutsche Inflationsrate bei 1,6 Prozent. Rechnen wir nach: Für eine Einlage von 10 000 Euro bekam der Kunde 1 Euro Zinsen abzüglich Abgeltungsteuer – und er verlor auf das Jahr gerechnet 160 Euro an Kaufkraft. 2008, zum Beginn der Finanzkrise, auf die die Euro-Krise folgte, wurden für Tagesgeld durchschnittlich noch über 3 Prozent gezahlt.
Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass die für die Eurozone ermittelte Inflation von Anfang an geschönt war – einmal abgesehen davon, dass der zugrunde liegende Warenkorb immer willkürlich sein muss. Bezieher niedriger Einkommen und Rentner sind ohnehin mit einer höheren Geldentwertung konfrontiert, weil ihr Warenkorb vom Durchschnitt abweicht.
Dazu kommt, dass wegen der »hedonischen« Berechnungsmethode von den Statistikern Preissenkungen unterstellt werden, die es in Wirklichkeit nie gegeben hat. Begründet wird dies damit, dass sich die Qualität der Produkte angeblich verbessert hat. Umgekehrt wird die rückläufige Lebensdauer vieler Gebrauchsgüter, auch wegen eingebauter Obsoleszenzen, nicht berücksichtigt. Die aber kostet auch Kaufkraft und treibt die Geldentwertung voran.
Martin Hochstein von Allianz Global Investors hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 3. April 2018 einen anderen Trick aufgedeckt. Danach sind die Aufwendungen für selbst genutztes Wohneigentum im europäischen Warenkorb des Statistikamtes Eurostat überhaupt nicht enthalten, im amerikanischen Warenkorb hingegen mit knapp 24 Prozent. Eurostat tut so, als verursache die eigene Wohnung oder das eigene Haus keine Kosten. Gerade hier aber war die Teuerung im Frühjahr 2018 mit mehr als 3 Prozent im Euroraum besonders hoch. In Deutschland dürfte sie sogar darüber gelegen haben.
Wenn aber die Inflation sowohl in der Eurozone als auch in Deutschland ständig zu tief ausgewiesen wird …
… dann müssen die kumulierten Realverluste der Sparer höher sein, als bisher angenommen wurde;
… dann stimmen die Zahlen für das reale Wirtschaftswachstum nicht, denn dieses muss schwächer sein, als dem Publikum vorgegaukelt wird;
… dann fallen alle Zahlungen, die an die offizielle Inflationsrate gekoppelt sind, zu niedrig aus;
… dann beruht die ganze Euro-Erfolgsgeschichte zumindest zum Teil auf Einbildung und zurechtgebogenen Statistiken.
Wenn der Euro tatsächlich gerettet wäre, wie der Rettungsfondsmanager Klaus Regling behauptet …
… dann könnte er doch seinen zwecks Rettung gegründeten Fonds ESM auslaufen lassen und abwickeln;
… dann bräuchte es keine neuen Subventionen, Kreditfazilitäten und Töpfe, um ihn bei Bedarf noch einmal zu retten;
… dann begreift kein Mensch, warum seit dem Machtwechsel in Frankreich und seit der Installation der neuesten Merkel-Koalition der Ruf nach einer Euro-Transferunion lauter ertönt als jemals zuvor.
Die Erklärung dafür, dass mitten im Währungsfrieden für den Krieg gerüstet werden soll, ist vielschichtiger, als man vermuten könnte. Der naheliegende Grund ist natürlich der, dass die Machthaber der Euro-Schattenregierung mit ihrem Zentrum im Frankfurter EZB-Tower genau wissen, dass die Geburtsfehler des Euros auch nach 20 Jahren nicht behoben sind und dass das Geflecht von Schulden, die jahrelang zwischen Regierungen, Geschäftsbanken, Rettungsagenturen und der EZB hin- und hergeschoben wurden, im Sturm der nächsten Finanzkrise zu zerreißen droht.
In mancher Hinsicht ist die Eurozone heute noch labiler und verletzlicher als 2010, als die erste große Krise ausbrach. Das gilt insbesondere für die drittgrößte Volkswirtschaft der Währungsunion und das schwächste Glied der Kette, nämlich Italien – ein Thema für ein späteres Kapitel dieses Buches.
In dieser Situation bieten sich grundsätzlich zwei Lösungen an, um den Währungsverbund zu stabilisieren und sturmfest zu machen.
Entweder die Rückkehr zur deutschen Philosophie und damit zu den Prinzipien der Deutschen Bundesbank, was darauf hinauslaufen würde, dass jeder sein eigenes Haus in Ordnung bringt, dass die EZB ihre Rechte und Pflichten wieder ernst nimmt, dass jeder für seine Schulden wieder selbst haftet, kurz: dass das Regelwerk des im Dezember 1991 vereinbarten Vertrages von Maastricht wieder respektiert wird.
Oder aber – das wäre die andere Lösung – die Schulden und Verantwortlichkeiten werden komplett vergemeinschaftet. Dann würde die Euro-Konstruktion auf absehbare Zeit halten, jedenfalls so lange, wie das Ankerland Deutschland zahlungskräftig und zahlungswillig bleibt.
Wir sehen auf den ersten Blick, dass die zweite Lösung für die Mehrheit der neunzehn Euro-Mitglieder die attraktivere, weil bequemere sein muss. Damit steht der Club Med gegen den Club Net: die Schuldenländer im Süden gegen die EU-Nettozahler im Norden – ein Frontverlauf, der zusätzlich dadurch kompliziert wird, dass im Club Net mittelgroße Länder wie die Niederlande und Österreich sich von der zahlungswilligen deutschen Regierung abzusetzen beginnen und dass Frankreich sich zum Fürsprecher des Club Med macht, aber nicht wirklich dazugehören will, weil dies den Stolz der Grande Nation verletzen würde.
Mächtige Frauen: Christine Lagarde belehrt die Deutschen
Wenn wir noch tiefer bohren, stoßen wir auf eine Schicht, die die Wahrheit offenlegt, nämlich, dass der Euro nicht etwa ein Projekt der Völker Europas ist, sondern der finanzkapitalistischen, supranationalen und bürokratischen Eliten. Das war er von Anfang an: ein Projekt der herrschenden Klasse, das gegen das Selbstbestimmungsrecht der Nationen gerichtet ist. Das Schuldenregime der Eurozone ist aus dieser Sicht kein Konstruktionsfehler, der behoben werden müsste, sondern notwendiger Zement der Macht. Insofern ist der Marsch in die totale Transferunion mehr als ein notwendiges Übel, um den Euro unumkehrbar zu machen. Er dient dem Machterhalt und der verschärften Machtkonzentration.
Dass dies so ist, lässt sich sehr schön an der Person von Christine Lagarde veranschaulichen, einer idealtypischen Exponentin der politisch-finanziellen Kaste, die im Westen die Fäden zieht. Dass sich bei ihr Internationalismus mit einer gewissen Portion von französischem Nationalismus mischt, überrascht nicht. Sie ist schließlich Französin. Sie operiert im Dreieck zwischen Brüssel, Paris und Washington – eine elegante, selbst- und machtbewusste Frau, die vom US-Magazin Forbes zur achtmächtigsten Frau der Welt gekürt wurde, weit vor der EU-»Außenministerin« Federica Mogherini oder auch der Königin Elizabeth II.
Für die drittmächtigste Frau hält Forbes übrigens Melinda Gates, für die zweitmächtigste Theresa May und für die mächtigste Angela Merkel. Anders als bei Lagarde sind bei Letzterer Zweifel angebracht. Wenn Macht darin besteht, anderen den eigenen Willen aufzwingen zu können, dann besitzt Merkel diese Macht nur nach innen – und auch dies nur in abnehmendem Maß. In der Außen- und Europapolitik hingegen reagiert sie in der Regel, anstatt zu agieren. Im Verlauf der Euro-Krise 2010 bestimmten die Regierung in Paris, die EZB in Frankfurt, der Apparat in Brüssel, zeitweise auch das Weiße Haus unter Obama den Kurs – und Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds.
Ihre Karriere ist ein einziges Curriculum der Vernetzung: ab 1981 Mitarbeiterin und ab 2004 Vorsitzende des Global Strategy Committee bei Baker & McKenzie, einer in siebzig Ländern vertretenen US-Wirtschaftskanzlei; in dieser Zeit zudem Mitglied der Denkfabrik Center for Strategic and International Studies, wo sie zusammen mit dem US-Vordenker und Russland-Feind Zbigniew Brzeziński in einer Arbeitsgruppe namens »Rüstungsindustrie USA-Polen« saß; dann in den Jahren 2005 bis 2011 dreimal Ministerin in einem französischen Kabinett, wo sie sich um die Verschlechterung der französischen Staatsfinanzen verdient machte; und schließlich ab Juli 2011 geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), der bei Kriegsende zusammen mit der Weltbank als Instrument der Dollar-Hegemonie eingerichtet wurde.
Dass sie die Aufnahmeprüfung für die elitäre ENA, die École Nationale d’Administration, mehrmals nicht schaffte, schadete ihrer Bilderbuchkarriere ebenso wenig wie die Verurteilung wegen fahrlässigen Umgangs mit öffentlichen Geldern durch den Gerichtshof der Republik am 19. Dezember 2016. Es ging um 403 Millionen Euro, die sie als französische Wirtschaftsministerin dem früheren Adidas-Eigentümer Bernard Tapie zugeschoben hatte – ein Schuldspruch, bei dem das Gericht darauf verzichtete, eine Strafe zu verhängen.
Am 26. März 2018 hatte Lagarde ihren großen Auftritt in Berlin im Haus der Hertie School of Governance, überschwänglich begrüßt vom Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Marcel Fratzscher, der Besucher seiner Homepage wissen lässt, er sei ein »europäischer Bürger«, der in Deutschland »aufgewachsen« sei. Will sagen: kein engstirniger, rückwärtsgewandter gewöhnlicher Deutscher. Rainer Hank von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nannte ihn einen »SPD-Claqueur«.
Christine Lagarde, wie immer tief gebräunt und edel gekleidet, war nach Berlin gekommen, um den Deutschen mitzuteilen, was sie als Nächstes zu tun hätten. Um die Geburtsfehler des Euros zu beheben und künftige »Schieflagen« auszuschließen, forderte sie eine Euro-Fiskalunion mit einem eigenständigen Haushalt. In den solle jedes Euroland pro Jahr 0,35 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes einzahlen. Das wären über 11 Milliarden zulasten der deutschen Steuerzahler – und umso mehr, je besser sich die deutsche Wirtschaft entwickelt.
Keiner der andächtig lauschenden Zuhörer stellte sich die Frage, was sie eigentlich dazu legitimierte, den Deutschen in ihrer Hauptstadt eine Rechnung zu präsentieren. Aber sie hatte ihr Mandat als Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) schon früher überschritten, als sie IWF-Mittel fahrlässig für die Griechenland-Rettung lockermachte – fahrlässig, weil die IWF-Satzung nur Devisenhilfen bei einer Zahlungsbilanzkrise vorsieht, die in Griechenland nicht gegeben war. Mit Vertragsbrüchen hatte sie schon früher kein Problem. Als der erste Euro-Rettungsfonds EFSF gebastelt wurde, erklärte sie offenherzig: »Wir haben den Maastricht-Vertrag verletzt.« Damit wäre sie geeignet für die Nachfolge von Jean-Claude Juncker, der 2019 als Kommissionspräsident zurücktreten muss. Falls sie den Posten bekommt, werden sich die Deutschen noch wundern.
Markus C. Kerber, Professor für Finanzwirtschaft und Wirtschaftspolitik an der TU Berlin, ENA-Absolvent und Gastprofessor in Frankreich und Polen, mokierte sich auf www.achgut.com über die »Berliner Verkaufsveranstaltung« mit Christine Lagarde. Sie habe die Öffentlichkeit bearbeiten wollen mit dem Ziel, die Deutschen gefügig zu machen, damit sie der Eurozone mehr Transfergelder zur Verfügung stellen. Kerber sprach von einer Arbeitsteilung zwischen Lagarde, dem Pariser Machthaber Macron und der »expansiv-dekadenten Führung« der EU-Kommission. »Paris–Washington–Brüssel, dieser Trust, will die Deutschen einkreisen.«
Ähnlich kritisch bewertete Professor Hans-Werner Sinn den Berliner Auftritt der IWF-Chefin. Sie wolle den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker beerben, dessen Amtszeit 2019 abläuft. Lagarde habe nicht das europäische Gemeinwohl im Auge, sondern betreibe »eine harte Politik in französischem Interesse«. Sinn weiter: »Jemanden, der zu Vertragsbrüchen bereit ist, brauchen wir nicht an der Spitze der EU.«
Märchenstunde: Warum die Geschichte vom Euro-Gewinner Deutschland nicht stimmt
Schon ein Großmeister seines Fachs wie Joseph Goebbels wusste, dass das Geheimnis erfolgreicher Propaganda in der ständigen Wiederholung liegt. Der amerikanische Nobelpreisträger für Wirtschaft, Daniel Kahneman, hat genauer untersucht, wie das dauernde Wiederholen von Behauptungen unseren Denkapparat überlisten kann – und seien sie noch so offenkundig falsch. In einem seiner Experimente wurden die Probanden mit falschen Informationen über die Körpertemperatur von Hühnern so lange traktiert, bis die meisten von ihnen glaubten, diese betrage 51 Grad.
Warum also sollen wir nicht auch davon überzeugt sein, dass der Euro ein fantastisches Geschäft für Deutschland ist? Wir bekommen es ja ständig zu hören: Kein Land habe so viel durch die EU gewonnen wie Deutschland, erklärte der seit einer gefühlten Ewigkeit im Europaparlament sitzende Elmar Brok schon am 4. Oktober 2010. »Deutschland ist eindeutig ein Gewinner des Euros«, war zum Beispiel am 9. September 2012 von Wolfgang Schäuble zu hören. Und wie oft Theo Waigel die Litanei vom »Hauptprofiteur« heruntergebetet hat, lässt sich kaum aufzählen. Dabei braucht es nur ein paar Zahlen sowie einen Blick in die deutsche Zahlungsbilanz und auf das deutsche Auslandsvermögen, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen.
Erstens hat die Deutsche Bundesbank wegen der Währungsunion den sogenannten Münzgewinn, auch Seigniorage genannt, verloren. Allein die Banknoten, die zu D-Mark-Zeiten in einer Größenordnung zwischen 65 und 90 Milliarden Mark im Ausland umliefen, bescherten der Bundesbank einen jährlichen Zinsertrag zwischen 5 und 6 Milliarden Mark. Seit 1999 fließen alle Geldschöpfungsgewinne dem Eurosystem zu, und die Bundesbank erhält davon nur knapp 26 Prozent in Höhe ihres Kapitalanteils an der EZB. In absoluten Zahlen ist das viel weniger, als die internationale Reservewährung D-Mark einspielte. Frankreich hingegen stellt sich erheblich besser als vor 1999. Den Barwert der so entgangenen Bundesbankgewinne schätzte Professor Sinn einmal auf 50 Milliarden Euro. Dementsprechend schrumpfte der Bilanzgewinn der Bundesbank. 2017 waren es 1,9 Milliarden, 2016 nur 399 Millionen. Folge: Die Bundesbank kann weniger Gewinne an den Bundeshaushalt überweisen.
Zweitens sind die Sparer sowie die Inhaber von Lebensversicherungen die großen Euro-Verlierer, worauf bereits hingewiesen wurde. Es stimmt, dass der Staat beim Schuldendienst von den niedrigen Euro-Zinsen profitiert hat – jedoch weniger, als die Sparer verloren. Unter dem Strich kommen die Nullzinsen der EZB logischerweise den Schuldnerländern zugute, weniger den Gläubigerländern. »Die These, Deutschland habe wegen der niedrigen Zinsen auf deutsche Staatsanleihen von der Euro-Krise profitiert, ist nicht haltbar«, so auch Clemens Fuest, der Chef des ifo-Instituts.
Drittens hat sich die Erwartung nicht erfüllt, dass die Währungsunion die Arbeitsteilung innerhalb der EU und den Handel untereinander verbessern und erhöhen würde. Der Anteil der deutschen Exporte, die in die Eurozone gehen, ist seit dem Euro-Start 1999 stark gesunken – auf nur noch 37 Prozent. Das Europäische Währungssystem mit seinen anpassungsfähigen Wechselkursen war dem Eurosystem überlegen.
Viertens liegen die deutschen Einkommen und Vermögen nur im europäischen Mittelfeld, die Steuern hingegen an der Spitze. In Italien oder Spanien billig Urlaub zu machen ist nicht mehr möglich. Der schwache Euro verteuert die Importe und kostet Kaufkraft. Deutschland exportiert zu billig. Die »Terms of Trade« haben sich verschlechtert. Von der Blase am Immobilienmarkt, einer direkten Folge der Nullzinsen Draghis, profitieren die Reichen, nicht der Mann auf der Straße. In vielen Großstädten ist die eigene Wohnung selbst für Familien, die gut verdienen, kaum noch erschwinglich. Und die Immobilienpreise ziehen die Mieten mit nach oben. Draghis Politik lässt die Schere zwischen Reich und Arm weiter auseinanderklaffen. Sie verteilt um – von unten nach oben. In seinen Auswirkungen ist der Euro zutiefst unsozial.
Und fünftens sind die Exporterfolge der vergangenen Jahre ein gemischter Segen. Der aus deutscher Sicht unterbewertete Euro ist der Hauptgrund für die extrem hohen Exportüberschüsse. Gewinner sind die Exportfirmen im DAX beziehungsweise ihre ausländischen Anteilseigner, die dort die Mehrheit halten. Dass die deutsche Wirtschaft auf Kosten des Binnenmarktes derart exportlastig ist, macht sie besonders anfällig für eine weltweite Rezession. Ausfuhrrekorde, die auf billigem Geld und einer billigen Währung beruhen und noch dazu subventioniert werden, sind nicht nachhaltig. Sie machen träge. Dass die Produktivitätssteigerungen auch in Deutschland seit Jahren in Richtung null tendieren, ist ein Warnzeichen.
Nun zu meinem Haupteinwand gegen die Legende vom Euro-Gewinner Deutschland. Dazu betrachten wir zunächst die Leistungsbilanz der Bundesrepublik mit ihrem größten Posten, dem Warenhandel. 2017 erwirtschaftete Deutschland im Handel mit dem Euroraum einen Überschuss von 90,1 Milliarden. 41,1 Milliarden davon entfielen auf Frankreich, 21,7 Milliarden auf Österreich, 11,4 Milliarden auf Spanien und 9,5 Milliarden auf Italien. Mit den USA ergab sich ein Überschuss von 50,3 Milliarden, mit China ein Defizit von 14,5 Milliarden Euro. Der Leistungsbilanzüberschuss insgesamt überstieg schon 2014 die Marke von 200 Milliarden. 2017 erreichte er einen Stand von 262,4 Milliarden.
Wenn derartige Überschüsse Jahr für Jahr erwirtschaftet werden, müssten sie sich im Auslandsvermögen niederschlagen. Denn für dieses sind sie – wie auch die Bundesbank in ihrem Monatsbericht April 2018 anmerkt – die treibende Kraft. Das tun sie aber nicht. Die Lücke ist riesengroß. Im Zeitraum 2007 bis 2017 summierten sich die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse auf 2173 Milliarden Euro. Das Netto-Auslandsvermögen aber, bei dem Forderungen und Verbindlichkeiten saldiert werden, stieg nur um 716 Milliarden. Die Bundesbank macht dafür auch Wechselkurs- und Bewertungseffekte verantwortlich. Dies ist allerdings nur ein kleiner Teil der Erklärung. So gehen große Verluste auf die Immobilienblase in den USA zurück, als die deutschen Banken Spargelder ihrer Kunden in die dort grassierende Spekulation steckten. Sie wurden vernichtet, als die Blase platzte.