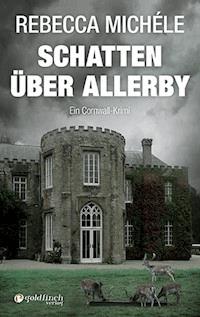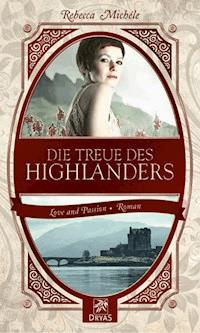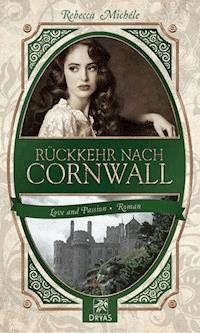9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ägypten 1921: Eine mutige Frau auf der Suche nach ihrem Vater Die junge Cleopatra Vanson lebt in Cornwall bei ihrer Tante, während sich ihr verwitweter Vater als Archäologe in Ägypten der Entdeckung alter Pharaonengräber verschrieben hat. Cleo träumt davon, ihn eines Tages auf seine Expeditionen begleiten zu können. Nach einem schweren Schicksalsschlag wird Cleo von der reichen Familie Tredennick aufgenommen. Als ihr Vater dann auf mysteriöse Weise verschwindet, begibt sich Cleo, gerade noch unmündig, mit den Geschwistern Tredennick auf die Reise in das ferne Ägypten. Noch ahnt sie nicht, in welch gefährliches Abenteuer sie verwickelt werden wird und dass der Skarabäus-Armreif – ein Geschenk ihres Vaters und geliebter Talisman – ein dunkles Geheimnis in sich trägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Rebecca Michéle
Das Geheimnis des blauen Skarabäus
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für meine Mutter,
die diesen Roman mit Freude gelesen hätte.
Prolog
Luxor, Ägypten 1913
Die Stadt lag unter einer Glocke aus Staub. Seit zwei Tagen blies der Westwind den Wüstensand nach Luxor, legte sich auf die Straßen, überzog Eselskarren, Automobile und auch die Menschen mit einer feinen, gelben Schicht.
Das Taschentuch fest vor Mund und Nase gepresst, eilte Alexander Vanson durch die von Menschen überfüllten Straßen. Der Sand setzte sich in jede Pore seines Körpers, kroch unter die Kleidung und knirschte zwischen den Zähnen. Selbst sein schütteres Haar war hellgelb, obwohl er einen Hut trug.
Er nahm sein Taschentuch und tupfte sich den Schweiß von der Stirn. Die ägyptische Sonne brannte erbarmungslos. Über einhundert Grad Fahrenheit zeigte das Thermometer, dabei war es noch nicht einmal Mittagszeit und erst Anfang des Jahres. Im Sommer würden die Temperaturen deutlich ansteigen und machten einen Aufenthalt im Tal der Könige nahezu unmöglich.
Die vielfältigen Gerüche eines nahe gelegenen Basars drangen in seine Nase. Der Duft von erlesenen Gewürzen, kandierten Nüssen und in Honig gerösteten Mandeln ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. Vanson verzichtete jedoch auf eine der süßen Leckereien, denn er war sehr durstig.
In der Vorfreude auf ein kühles Bier trat Vanson in die Lobby des Queen’s Hotels, in dem er ein Zimmer bewohnte. Das Haus war Ende des letzten Jahrhunderts im britischen Kolonialstil erbaut worden und bot den Gästen allerlei Annehmlichkeiten. An der Bar bestellte er sich ein Pint Lager und trank das Glas bis zur Neige.
»Ober, noch eines!«, rief er und wischte sich mit dem Ärmel über die Lippen.
»Darf ich Sie auf einen Drink einladen, Mr Vanson?«
Vanson drehte sich um. Vor ihm stand ein jüngerer Mann, einen Kopf größer als er, mit hellen Augen und einem markanten Kinn. Er trug einen altmodischen Backenbart, der nicht seiner Jugend entsprach, sein dreiteiliger Anzug hingegen war nach der aktuellen Mode geschneidert. Den leichten Strohhut trug er lässig auf seinem gewellten, blonden Haar.
Durch und durch ein Gentleman, dachte Vanson und fragte: »Kennen wir uns?«
»Wir sind uns bisher noch nicht begegnet, Mr Vanson«, sagte der Fremde mit einer angenehmen dunklen Stimme. »Ich bin erst vor wenigen Tagen in Luxor eingetroffen und wollte unbedingt Ihre Bekanntschaft machen.«
»Aus welchem Grund?« Auch wenn der Fremde einen guten Eindruck machte, blieb Vanson skeptisch. In seinen Kreisen wurde man einander vorgestellt oder von einem gemeinsamen Bekannten eingeführt.
Der Mann lächelte gewinnend. »Mr Vanson, Ihr Ruf als Archäologe und Kenner von Land und Leuten eilt Ihnen voraus. An der Arbeit von Howard Carter bin ich sehr interessiert, da mich das Alte Ägypten seit vielen Jahren fasziniert. In England hatte ich das Vergnügen, Lord Carnarvon vorgestellt zu werden. Wir verplauderten einige interessante und vergnügliche Stunden. Er erzählte mir von der großen Sache, die er finanziert und die Mr Carter für ihn ausführen soll.«
Er brach ab, da der Barmann zwei Gläser vor die Herren stellte, nahm einen langen Schluck und stieß ein erleichtertes »Ah!« aus. »Welche Wohltat an diesem heißen Tag!«
»Sie sind zum ersten Mal in Ägypten?«, fragte Vanson. Sein Gegenüber nickte, und Vanson fuhr fort: »Es dauert einige Zeit, bis man sich an die Hitze, den Staub und den Sand gewöhnt hat. Sie können mir glauben, die Temperaturen werden noch weiter ansteigen.«
»Größer könnte der Gegensatz zu meiner Heimat Surrey nicht sein«, erwiderte der Fremde und setzte sich auf den Barhocker neben Vanson, ohne von diesem dazu aufgefordert worden zu sein. »Trotzdem ist Ägypten das faszinierendste Land, das ich jemals bereist habe. Das quirlige Leben, die karge Schönheit der Wüste, im Gegensatz dazu das üppige Grün der Ufer des Nils, die rege Betriebsamkeit der Menschen … Ach, ich habe mich schon jetzt in all das verliebt!«
Die Bemerkung entlockte Vanson ein Lächeln. Es waren die Worte eines Jünglings, der leicht von etwas zu begeistern war und die Schattenseiten des Landes noch nicht kennengelernt hatte.
»Wollen Sie mir nicht sagen, wer Sie sind?«, fragte Vanson ungeduldig. Auf seinem Schreibtisch wartete jede Menge Arbeit.
Der Mann nahm seinen Hut ab und deutete eine Verbeugung an. »Sam Miller aus London.«
»Sagten Sie nicht, Ihre Heimat sei Surrey?«
»Dort wurde ich geboren, genau genommen in Redhill, ich lebe aber schon seit mehreren Jahren in der Hauptstadt.«
»Sie wollen mit mir sprechen?«, fragte Vanson zurückhaltend. »In welcher Angelegenheit?«
Miller beugte sich vor. »In einer sehr brisanten, Mr Vanson.« Er flüsterte, obwohl ihnen der Barmann keine Beachtung schenkte und auch sonst niemand in der Nähe war, der ihr Gespräch mitanhören konnte. »Ich habe von einer Grabstätte erfahren, die bisher in keiner Aufzeichnung genannt worden ist. Es soll sich um keine große Persönlichkeit aus der Vergangenheit handeln, allerdings um einen einst äußerst vermögenden Mann. Ergo ist zu vermuten, dass dieses Grab noch nicht geplündert wurde und voller Schätze ist.«
»Wer ist Ihre Quelle?«
Miller schüttelte den Kopf. »Sie werden verstehen, dass ich diese nicht preisgeben kann, bevor wir uns nicht einig geworden sind, Mr Vanson.«
Alexander Vanson runzelte die Stirn und fragte: »Warum kommen Sie zu mir, Mr Miller? Wenn Sie tatsächlich mit Lord Carnarvon bekannt sind, kann dieser Sie unterstützen, sich an die Behörden wenden und die notwendigen Schritte einleiten. Wenn Sie allerdings auf eigene Faust das Grab finden, es öffnen und die Beigaben für sich behalten wollen: Warum weihen Sie mich, einen Fremden, ein?«
»Tatsächlich möchte ich Lord Carnarvon aus der Angelegenheit heraushalten. Ich selbst verfüge über keine Beziehungen, um eine Grabungslizenz zu erhalten. Sie wissen, dass die offiziellen Stellen nur Gelder für Grabungen bereitstellen, wenn Aussicht auf Erfolg besteht oder es sich zumindest um einen großen König handelt. Sie jedoch, Mr Vanson, haben alle Genehmigungen und das Wissen, wie am besten vorzugehen ist. Wenn wir erfolgreich sind, werde ich Sie zu einem reichen Mann machen.«
»Schlagen Sie vor, wir sollen uns, bei einem eventuellen Erfolg, den Gewinn teilen?«, fragte Vanson skeptisch, auch wenn Millers Argumentation schlüssig war. »Wenn Sie sich über mich erkundigt haben, werden Sie wissen, dass ich stets für einen Auftraggeber arbeite. Ich sehe mich in der Pflicht, die Schätze der Vergangenheit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und nicht sie meistbietend zu verhökern und mich persönlich an ihnen zu bereichern.«
»Das ist mir bekannt.« Aus der Innentasche seiner Jacke nahm er ein silbernes Etui, bot Vanson eine Zigarette an, die dieser ablehnte, zündete sie sich dann in aller Ruhe selbst an und inhalierte tief, bevor er sagte: »Sollte unsere Mission zum Erfolg führen, teilen wir den Ertrag. Es steht Ihnen frei, mit Ihrem Anteil zu machen, was Sie für richtig halten, und ihn den Behörden oder Museen zu übergeben. Wie ich eingangs erklärte: Ich halte mich zum ersten Mal in diesem Land auf, bin mit den Einheimischen und ihren Gepflogenheiten nicht vertraut, nicht mit der Situation in der Wüste, und es fehlt mir zugegebenermaßen auch an Geld. Wenn Sie allerdings kein Interesse zeigen …« Miller zuckte mit den Schultern und drückte die Kippe im Aschenbecher aus. »Ich glaube, es wird sich ein anderer britischer Gentleman finden lassen.« Er rutschte vom Barhocker.
»Warten Sie, Mr Miller!«, sagte Vanson schnell. »Geben Sie mir ein paar Tage Zeit, um über Ihren Vorschlag nachzudenken. Ich bin aber nicht bereit, etwas Illegales zu tun!«
»Mr Vanson, ich versichere, dass alles nach Recht und Gesetz ist.«
»Wo kann ich Sie erreichen, Mr Miller?«
Sam Miller lächelte und wirkte auf Vanson wie ein verwöhnter, reicher Jüngling, der gewohnt war, immer zu erreichen, was er sich in den Kopf gesetzt hatte. »Ich gebe Ihnen eine Woche, dann werde ich Sie wieder aufsuchen. Glauben Sie mir, Mr Vanson, Sie werden es nicht bereuen, wenn Sie auf mein Angebot eingehen.«
Er setzte sich den Hut auf, tippte an die Krempe und wandte sich ab. Plötzlich zögerte er und drehte sich noch einmal zu Vanson um. »Ich hätte da noch etwas für Sie.« Aus der Innentasche seines hellen Jacketts zog er einen in ein Taschentuch gewickelten Gegenstand. Bevor er diesen Vanson reichte, sah sich Miller um. Immer noch wurden die Männer von niemandem beachtet, trotzdem senkte Miller die Stimme. »Vielleicht möchten Sie mir dieses Kleinod abkaufen?«
In dem Tuch befand sich ein silberfarbener Armreif, etwa drei Finger breit, mit einem blauen Skarabäus, gefasst von roten und grünen Steinchen. Auf den ersten Blick konnte Vanson nicht einschätzen, ob es sich um Silber und echte Steine handelte. Er drehte ihn zwischen seinen Fingern und fragte skeptisch: »Woher haben Sie das Stück?«
»Das spielt keine Rolle«, erwiderte Miller. »Für hundert Pfund gehört er Ihnen.« Erneut sah er über seine Schulter und wirkte auf Vanson, als würde er sich vor etwas fürchten. Von Millers vorheriger Selbstsicherheit war plötzlich nichts mehr zu bemerken.
Vanson legte den Armreif auf den Tresen und sagte: »Der Reif könnte aus Silber und der Skarabäus aus Lapislazuli gefertigt sein, der Preis ist jedoch völlig übertrieben! Solche Schmuckstücke bekomme ich auf den Basaren für ein paar Schillinge.«
»Der Armreif ist alt«, sagte Miller. »Sehen Sie nur die Gravierungen.«
Vanson kniff die Augen zusammen. Tatsächlich waren auf der Innenseite eine Anzahl von Hieroglyphen und zwei kleine Symbole eingeritzt.
»Können Sie die Inschrift entziffern?«
Vanson schüttelte den Kopf. »Die Zeichen sind zerschlagen und zerkratzt.« Er sah Miller offen an. »Vielleicht ist der Reif wirklich Tausende von Jahren alt, vielleicht ist er aber auch nur eine Replik aus jüngerer Zeit. Womöglich ein Geschenk eines Mannes an eine Frau, seine Schwester oder Mutter. Ohne eine eingehende Untersuchung lassen sich weder die Materialien noch das genaue Alter feststellen, daher habe ich kein Interesse an Ihrem Angebot, Mr Miller.«
»Fünfzig Pfund?« Millers Blick wurde flehend. Als er merkte, dass Vanson auch darauf nicht reagierte, stieß er geräuschvoll die Luft aus und sagte: »Also gut, für dreißig englische Pfund gehört er Ihnen. Ich gebe zu, ich benötige das Geld.«
Für Vanson wurde das Verhalten seines Gegenübers immer suspekter. Miller konnte durchaus recht haben, und der Armreif stammte aus dem alten Ägypten. Schmuckstücke mit dem Abbild des einst heiligen Pillendrehers, wie der Skarabäus auch genannt wurde, gab es im Land jedoch zu Tausenden. Sie galten als Glücksbringer, die besonders bei den englischen Damen beliebt waren. Vanson bezweifelte, dass der Reif aus einem Königsgrab stammte, dafür war er zu unauffällig gearbeitet.
Er wollte erneut ablehnen, als ihm das Bild seiner Tochter in Erinnerung kam. In drei Wochen würde sie zwölf Jahre alt werden. Für Alexander Vanson war es ausgeschlossen, nach England zu reisen, worüber das Kind bestimmt enttäuscht sein würde. Da käme ein kleines Geschenk gerade richtig. Der Reif war zwar breit, in der Spange aber schmal gearbeitet, gerade passend für ein schlankes Handgelenk.
»Zehn Pfund, und keinen Schilling mehr«, sagte er bestimmt. »Das ist immer noch eine Menge Geld für ein Stück Blech mit einem blauen Käfer.«
Miller zögerte nicht. Schnell steckte er das Geld, das Vanson ihm zuschob, in die Innentasche seines Jacketts. »Sie hören wieder von mir, Mr Vanson«, sagte er und eilte dann so hastig davon, dass Vanson den Eindruck hatte, Miller würde vor etwas flüchten. Vielleicht enthielten Millers Worte etwas Wahres, vielleicht war er auch nur ein junges Großmaul.
Alexander Vanson entschied, sich weitere Informationen von Miller zumindest anzuhören. Sofern sich der Gentleman überhaupt wieder bei ihm melden würde.
In seinem Zimmer klemmte sich Vanson das Vergrößerungsglas ins rechte Auge, trat ans Fenster und begutachtete den Armreif kritisch. Die Hieroglyphen konnte er nicht vollständig entziffern. Auch eine Silberpunze war nicht zu erkennen, bei einem alten Stück war das ohnehin nicht zu erwarten. Vanson war sich allerdings sicher, dass der Reif aus Silber und der Körper des Skarabäus aus Lapislazuli gearbeitet war. Bei dem schmückenden Beiwerk vermutete Vanson einfache Glassteine. Keinesfalls war das Schmuckstück eine Grabbeigabe eines Pharaos oder einer anderen hochgestellten Persönlichkeit. Selbst wenn es mehrere Tausend Jahre alt war, war sein Wert gering. Die zehn Pfund waren entschieden zu viel gewesen. Er hätte das Geld lieber für etwas anderes ausgeben sollen.
Vanson setzte sich und verfasste einen Brief an seine Tochter. In knappen Sätzen erklärte er, warum er nicht reisen konnte, und schrieb, er vermisse sie und würde an sie denken. Zum Armreif erfand Vanson eine Geschichte: Der Reif sei einst ein Geschenk eines Mannes an seine Geliebte gewesen, das Paar hatte aber nie zusammenkommen können. Er wusste, seiner Tochter würde diese Erklärung gefallen.
Eine Woche später kehrte Alexander Vanson von der Grabungsstätte vor den Toren Luxors zurück. Mit Staub und Schmutz bedeckt, klebten Hemd und Hose an seinem schweißnassen Körper. Als er die Lobby betrat, erhoben sich zwei Männer aus den Sesseln und kamen ihm entgegen. Sie waren Engländer, schlicht gekleidet, die Mienen ernst.
»Mr Vanson?«, fragte der Jüngere. »Mr Alexander Vanson?«
»Das bin ich.« Vanson wusste sofort, dass es sich um Polizeibeamte handelte, dafür brauchten sie sich nicht vorzustellen. »Gibt es Probleme mit der Grabungslizenz? Ich versichere Ihnen, alles ist amtlich fixiert, die entsprechenden Unterlagen befinden sich in meinem Zimmer, und ich …«
»Wir kommen nicht wegen Ihrer Lizenz, Mr Vanson.« Der Ältere zog eine Fotografie aus der Innentasche seiner Jacke und hielt sie Vanson hin. »Kennen Sie diesen Mann?«
Vanson erkannte ihn sofort wieder, ebenfalls dass der Mann tot war.
»Sam Miller«, murmelte er.
»Diesen Namen hat er Ihnen genannt?«, fragte der Polizist.
Vanson nickte. »Was ist passiert? Hatte er einen Unfall?«
»Heute Morgen wurde seine Leiche zwischen den Säulen des Karnak-Tempels gefunden«, antwortete der jüngere Polizist. »In der Brust eine Pistolenkugel.«
Vanson erbleichte und schluckte. »Ich habe den Mann einmal getroffen und nur wenige Worte mit ihm gewechselt. Warum kommen Sie zu mir?«
»In seiner Jackentasche fanden wir eine handschriftliche Notiz mit Ihrem Namen und der Anschrift dieses Hotels«, erklärte der ältere Beamte. »Der Tote führte keine Ausweisdokumente und keinen Hinweis bei sich, wo er in Luxor wohnte, ob er überhaupt in der Stadt logierte und woher er kam, daher sind Sie unser einziger Informant. Sie sagten, er nannte Ihnen den Namen Sam Miller?«
Vanson erzählte den Beamten, was Miller ihm über sich gesagt hatte, und verschwieg auch nicht, dass der junge Engländer an der Ausgrabung eines angeblich geheimen Pharaonengrabes interessiert gewesen sei und ihn um seine Unterstützung gebeten hatte.
»Das klingt sehr mysteriös«, sagte der Polizist mit gerunzelter Stirn. »Haben Sie Miller Ihre Hilfe zugesagt, Mr Vanson?«
»Ich sagte ihm, dass ich nichts tun werde, das gegen das Gesetz verstößt«, antwortete Vanson wahrheitsgemäß. »Miller wollte sich wieder bei mir melden, was er seitdem nicht mehr getan hat.«
Der ältere Beamte forderte Vanson auf, die Stadt nicht zu verlassen und sich der Polizei zur Verfügung zu halten. »Vielleicht sind Sie, Mr Vanson, der Letzte, der Miller lebend gesehen hat.«
»Sie irren sich, der Letzte war der, der Miller erschossen hat.« Eine Hand legte sich schwer auf Vansons Schulter. »Mr Vanson war es sicher nicht, ich verbürge mich für diesen Mann.«
Erleichtert atmete Vanson auf. Er hatte nicht bemerkt, dass sich Lord Cherringham ihnen genähert und zumindest den letzten Teil des Gesprächs mitangehört hatte.
»Selbstverständlich, Mylord.« Die beiden Polizisten zeigten sich sofort freundlicher, denn es war allgemein bekannt, dass Cherringham ein einflussreicher Mann war und mit seinem Geld zahlreiche Grabungen finanzierte. »Sie werden verstehen, dass wir die Identität des Toten klären müssen.«
»Dann tun Sie das, meine Herren«, brummte Cherringham. »Wenn Sie neue Erkenntnisse haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ich denke, im Moment ist das alles, nicht wahr?«
Er nahm Vanson am Arm, gemeinsam kehrten sie den Beamten den Rücken zu und verließen die Lobby.
»Danke, Mylord«, sagte Vanson erleichtert, als sie auf der rückwärtigen Terrasse standen. »Es war so, wie ich gesagt habe. Über Sam Miller weiß ich wirklich nicht mehr, auch nicht wo sich das angebliche Grab, das er zu finden hoffte, befindet.«
»Daran zweifle ich nicht«, antwortete Cherringham. »Trotzdem ist es ungünstig, mit einem Mordfall in Verbindung gebracht zu werden.«
»Ich versichere Ihnen, Sir …«
Cherringham winkte ab. »Dieser Miller wird ein junger Abenteurer gewesen sein, sich nicht bewusst, wie vorsichtig wir in diesem Land agieren müssen. Vielleicht ist er mit einem Einheimischen in Streit geraten. Sie wissen, Vanson, wie aufbrausend diese sein können, besonders wenn es sich um die Schätze der Pharaonen handelt. Machen Sie sich frisch, ich erwarte Sie in einer halben Stunde beim Dinner, danach besprechen wir die morgigen Pläne.«
Vanson nickte und sah Cherringham nach, als dieser davonging. Ihm fiel der in den Armreif eingefasste Skarabäus ein. Gegenüber den Polizeibeamten hatte er ihn nicht erwähnt. Nicht absichtlich, er hatte einfach nicht mehr daran gedacht. Vanson erinnerte sich an seinen Eindruck, dass Miller das Schmuckstück unbedingt hatte loswerden wollen. Er überlegte, ob er den Beamten nachgehen und es ihnen erzählen sollte. Allerdings befand sich der Reif seit fünf Tagen auf dem Postschiff in Richtung England. Er war von geringem Wert, und es war kaum anzunehmen, dass er mit Millers Ermordung in Zusammenhang stand.
1
Penzance, Cornwall 1913
Sie saß auf der niedrigen Mauer, die den Vorgarten des Cottages umschloss, ihre Beine baumelten in der Luft. Erwartungsvoll sah sie zur Ecke am Ende der Gasse, als könne sie so das Erscheinen der Person, die sie ungeduldig erwartete, heraufbeschwören.
»Cleo, zieh deinen Mantel an!« Sie hörte den Ruf aus dem geöffneten Fenster, reagierte aber nicht. Sogleich folgte ein weiterer, diesmal lauter und schärfer: »Cleopatra Vanson, wenn du dich nicht sofort zum Aufbruch bereit machst, gehe ich ohne dich. Dann nehme ich dich aber nie wieder mit!«
Diese Worte erreichten das Mädchen, und sie rutschte von der Mauer. Wenn Tante Elsie sie bei ihrem Taufnamen rief, war es besser, unverzüglich zu gehorchen. Seit sie wusste, welche Persönlichkeit die Königin Cleopatra gewesen war, war sie auf diesen Namen sehr stolz, obwohl sie in der Regel Cleo genannt wurde. Sie war sicher, ihr Vater hatte diesen klangvollen Namen für sie gewählt, denn er war Archäologe und Ägyptologe. Ein großer Bewunderer der Königin Cleopatra, deren Schönheit legendär und der sogar ein römischer Kaiser verfallen war. Angeblich soll Cleopatra in Eselsmilch gebadet und dieser ihre einzigartige zarte Haut zu verdanken haben.
»Cleo, beeile dich! Wir sind spät dran.« Die Hände in die Seiten gestemmt, stand Tante Elsie vor ihr und musterte sie kritisch. »Warum sitzt du mit deinem guten Kleid auf der schmutzigen Mauer? Dreh dich um, damit ich dich säubern kann.«
Cleo musste es sich gefallen lassen, dass die Tante mit kräftigen Hieben auf ihr Hinterteil den Staub von ihrem blauen Rock klopfte.
»Der Briefzusteller war heute noch nicht da.«
Tante Elsie erwiderte: »Er wird auch nicht früher kommen, wenn du auf ihn wartest. Wenn dein Vater geschrieben hat, wirst du seinen Brief noch früh genug erhalten.«
»Es sind vier Monate seit seiner letzten Nachricht vergangen. Warum schreibt er nicht?«
»Er hat zu arbeiten, und der Weg eines Briefes von Ägypten nach Cornwall ist weit.« Tante Elsie kniff ihre grauen Augen zusammen. »Holst du jetzt endlich deinen Mantel? Ich gebe dir so lange Zeit, bis ich bis zwanzig gezählt habe, dann gehe ich los, du bleibst hier und kümmerst dich um die schmutzige Wäsche.«
Zwei Stufen auf einmal nehmend rannte Cleo in die Dachkammer hinauf, schlüpfte in ihren staubgrauen Mantel und setzte sich den Strohhut auf ihr schulterlanges, glattes Haar. Bereits wieder an der Tür, zögerte sie, kehrte noch einmal zurück, nahm aus einer Schublade einen Reif und streifte ihn über ihr linkes Handgelenk. Der Ärmel ihres Kleides verdeckte ihn. Tante Elsie meinte, es zieme sich nicht für ein junges Mädchen, Schmuck zu tragen. Im Frühjahr hatte Cleos Vater ihr den Armreif mit dem auffallenden, blauen Skarabäus zum Geburtstag geschenkt, schon deswegen hatte er für sie eine besondere Bedeutung. Heute würde sie zum ersten Mal ein wahrhaft herrschaftliches Haus betreten, da war eine kleine Zierde durchaus angebracht.
Pünktlich, als die Tante »neunzehn« sagte, war Cleo wieder an ihrer Seite.
»Warum kommt Lady Tredennick nicht wie deine anderen Kundinnen zu dir ins Haus?«, fragte Cleo, während sie neben ihrer Tante durch die Straßen der Stadt Penzance eilte.
»Weil sie die Lady von Tredennick Manor ist«, antwortete die Tante mit einem Gesichtsausdruck, als erkläre dies alles.
Nun kribbelte es in Cleos Bauch. Zum ersten Mal durfte sie Tante Elsie nach Tredennick Manor begleiten. Das Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert lag auf einem Hügel über der Stadt und war die Heimat von Generationen der Tredennicks, eine der vermögendsten und einflussreichsten Familien im Westen Cornwalls. Ihr Geld hatte die Familie zunächst mit dem Handel nach Übersee, dann mit dem Zinn- und Kupferbergbau gemacht. Die Vorfahren hatten das Haus immer wieder um- und angebaut und dabei seinen ursprünglichen Charakter bewahrt. Personen, die Tredennick Manor besuchten, schwärmten von seiner interessanten Architektur, der eleganten Ausstattung und nicht zuletzt von den prächtigen Gartenanlagen mit Pflanzen aus der ganzen Welt.
Tante Elsie verdiente ihren und Cleos Lebensunterhalt mit Näharbeiten, Lady Tredennick war ihre beste Kundin. Bisher hatte Cleo zu Hause bleiben müssen, wenn die Tante ins Herrenhaus bestellt wurde. Jetzt war sie zwölf Jahre alt. Auch wenn sie noch zwei Jahre zur Schule gehen würde, hielt es die Tante für angebracht, Cleo in ihre Arbeit einzuführen.
»Die Schneiderei ist kein aussterbendes Gewerbe«, erklärte Tante Elsie. »Die Menschen werden immer schöne Kleider wollen. Sorgfältige Näharbeiten können nicht durch Maschinen ersetzt werden. Wenn du eine gute Schneiderin bist, Cleo, wirst du niemals Hunger leiden müssen.«
»Ich möchte aber Archäologin werden«, hatte Cleo gesagt, woraufhin die Tante gelacht hatte, und es schwang eine Spur von Bitterkeit in ihrer Stimme, als sie antwortete:
»Dafür müsstest du einen höheren Schulabschluss ablegen, danach an einer Universität studieren. Dafür haben wir kein Geld. Das wenige, das dein Vater schickt, wenn er sich mal wieder daran erinnert, dass er eine Tochter hat, und der Lohn, den ich erhalte, reichen gerade aus, um ein bescheidenes Leben zu führen. Wir können von Glück sagen, dass das Haus ihm gehört und keine Miete anfällt. Ich habe Sophia gewarnt, diesen Mann zu heiraten, aber meine kleine Schwester hat wie üblich nicht auf mich gehört. Nun liegt sie auf dem Friedhof …«
Immer wenn von Cleos Mutter die Rede war, schniefte die Tante und tupfte sich mit einem Taschentuch die Augenwinkel. Sophia Martyn war vierzehn Jahre jünger als ihre Schwester Elsie gewesen. Die Mutter der Mädchen war nach Sophias Geburt im Kindbett gestorben. Der Vater hatte in den nahe gelegenen Zinnminen geschuftet, um die Schwestern ernähren zu können. Für Sophia war Elsie mehr eine Mutter als eine Schwester gewesen. Auch äußerlich hatte wenig Ähnlichkeit zwischen den Mädchen bestanden. Elsie war groß, mit einem knochigen Körperbau, einer langen, schmalen Nase, und ihr Haar war von einem undefinierbaren Braun. Sophia hingegen hatte früh eine frauliche Figur bekommen, das Haar und die Augen waren goldbraun gewesen. Eitelkeit war Sophia indes fremd gewesen. Mit ihrer Schönheit hatte sie nie kokettiert. Elsie hatte nicht verhindern können, dass Sophia mit zwanzig Jahren den älteren Alexander Vanson heiratete. Vanson war kein schöner Mann, aber ein Mensch, der mit beiden Beinen im Leben stand, der wusste, was er wollte, und ganz besonders, was er nicht wollte. Seit er ein kleiner Junge gewesen war, war er von den Pharaonen und dem Land im fernen Afrika fasziniert gewesen und hatte Archäologie studiert. Das Schicksal von Sophias und Elsies Mutter wiederholte sich. Kaum hatte Sophia ihrer Tochter Cleopatra das Leben geschenkt, schloss sie für immer die Augen.
»Da dein Vater im Aufbruch nach Ägypten war, kam ich zu euch ins Haus.« Cleo konnte nicht mehr zählen, wie oft Tante Elsie diese Geschichte schon erzählt hatte. »Was hätte Alexander mit dir, armes, kleines Würmchen, sonst tun sollen? Hier gab es für ihn keine Arbeit, und einen Säugling konnte er auf seine Reisen nicht mitnehmen. Im Herzen deines Vaters stand Ägypten immer an erster Stelle, womit ich keineswegs sagen will, dass er dich nicht liebt. Oh, er vergöttert dich, Cleo, ebenso wie er eine dreitausend Jahre alte Mumie vergöttert. Ich bin deine einzige Verwandte, mein Kind, und es war meine christliche Pflicht, mich deiner anzunehmen. Ob ich in Truro, wo ich zuvor gelebt hatte, für die Damen Kleider nähe oder in Penzance, spielte keine Rolle.«
Cleo war dankbar, dass sich Tante Elsie um sie kümmerte, sonst wäre für sie wohl nur das Waisenhaus geblieben. Dementsprechend gespalten waren Cleos Gefühle für ihren Vater. Er hatte sein eigenes Fleisch und Blut verlassen, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Einerseits wollte sie ihm nacheifern, auch damit er stolz auf sie war, allerdings war ihm Ägypten immer wichtiger als sein einziges Kind gewesen. Daran hatte sich bis heute nichts geändert.
Einmal hatte Cleo gefragt, warum die Tante nie geheiratet und eigene Kinder bekommen hatte. Elsie hatte sie ernst angesehen und leise gesagt: »Du bist meine Familie, das ist mir mehr als genug.«
Bei einem seiner seltenen Besuche hatte Cleo ihren Vater gebeten, er möge sie in das Land der Pyramiden, der Wüste und des großen Flusses mitnehmen. Alexander Vanson hatte ihr mit dem Finger einen zärtlichen Stups an die Nase gegeben und gemeint: »Wenn du erwachsen bist, begleitest du mich als meine Assistentin. Bis dahin musst du fleißig lernen und immer das tun, was Tante Elsie dir sagt. Nach Ägypten können nämlich nur gebildete Frauen reisen.«
Damals hatte Cleo nicht gewusst, dass es so lange dauerte, bis man erwachsen wurde. Immer wieder vergingen viele Monate, oft auch Jahre, bis Alexander Vanson wieder nach Cornwall kam. Auch seine Briefe waren unregelmäßig und mit knappem Wortlaut. Cleo hingegen schrieb häufig und ausführlich. Seit dem letzten Jahr fragte sie sich, ob es den Vater überhaupt interessierte, wenn der Sommer in einen milden Herbst überging, oder dass die geschwätzige Bäckerin vorne an der Ecke zum vierten Mal Großmutter geworden war. Auf solche Ereignisse ging er in seinen Antworten nie ein, allerdings betonte er, er würde sie, Cleo, vermissen und oft an sie denken. Sein Brief und der Armreif mit dem Skarabäus hatten Cleo damit versöhnt, dass er sie an ihrem Geburtstag allein gelassen hatte. Je älter sie wurde, desto mehr begann sie zu verstehen, was es für einen Menschen bedeutete, jahrtausendealte Relikte zu finden, in den Händen zu halten und sich vorzustellen, welchem Zweck sie gedient und wem sie einst gehört hatten.
Den Wunsch, an der Seite des Vaters nach uralten Artefakten zu suchen, hegte Cleo nach wie vor. Gleichzeitig fügte sie sich Tante Elsies Anweisung, sich von ihr im Schneiderhandwerk unterweisen zu lassen. Cleo war keine Träumerin, wie ihr Vater sah sie das Leben realistisch. Nicht nur charakterlich war Cleo ein Abbild von ihm. Von der Schönheit ihrer Mutter hatte sie nur die Augenfarbe geerbt, ansonsten war sie zwar nicht dick, aber von einem stämmigen Körperbau. Ihr Haar war mausbraun, ihr Kinn zu kantig und ihre Nase zu spitz, um dem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen. Sie war aber noch jung und machte sich keine Gedanken über ihr Äußeres.
Der große Erfolg war Alexander Vanson bisher verwehrt geblieben. Derzeit war er Teil einer Expedition unter der Leitung eines englischen Gentlemans, Howard Carter, der im Auftrag von Lord Carnarvon, einem Mitglied der englischen Hocharistokratie, verschiedene Grabungen leitete. Über die näheren Umstände hatte sich Cleos Vater im letzten Brief nicht ausgelassen. Zwischen den Zeilen hatte Cleo jedoch gelesen, dass es sich um eine wichtige Angelegenheit handelte.
»Wir sind da.« Tante Elsie stupste Cleo in den Rücken und riss sie aus ihren Gedanken. »Zeig mir deine Hände. Sind deine Fingernägel sauber? Binde deine Hutbänder neu, sie sind unordentlich.« Sicherheitshalber klopfte die Tante Cleos Mantel ab. »Denk daran, was ich dir gesagt habe: Du hältst den Kopf gesenkt, siehst niemandem in die Augen, sprichst nur, wenn eine Frage an dich gerichtet wird, was aber kaum der Fall sein wird, und fasst nichts an. Hast du das verstanden?«
»Natürlich, Tante Elsie, du hast es mir ja bestimmt schon zehnmal gesagt«, antwortete Cleo. »Warum müssen wir uns vor den Leuten von Tredennick so verhalten? Das sind doch ganz normale Menschen wie wir auch …«
»Also wirklich!« Tante Elsie keuchte, ihr Gesicht wurde krebsrot. »Die Tredennicks sind eine sehr alte Familie. Es heißt, deren Vorfahren wären mit Wilhelm dem Eroberer aus der Normandie nach England gekommen. Sie beherrschen die ganze Gegend, die halbe Stadt Penzance ist von ihrem Wohlwollen abhängig. Ebenso wie wir. Ohne die regelmäßigen Aufträge von Lady Tredennick und ihrer Tochter Miss Miranda wüsste ich oft nicht, wovon ich das nächste Essen auf den Tisch bringen und dein Schulgeld bezahlen sollte.«
»So schlimm ist es?« Cleo starrte ihre Tante fassungslos an. »Ich weiß, dass Vater wenig Geld schickt, du hast aber noch andere Kunden …«
»Die meistens nicht mit Bargeld bezahlen«, schnitt die Tante Cleo das Wort ab. »Oft besteht mein Lohn aus einem frisch gefangenen Fisch aus Newlyn, auch mal aus einem Suppenhuhn oder etwas Gemüse. Die Frau des Schusters bezahlt grundsätzlich damit, dass wir unsere Schuhe bei ihrem Mann neu besohlen lassen können. Jetzt genug geredet, Kind, und vergiss nicht, was ich dir gesagt habe.«
Das Herrenhaus war ein dreistöckiger, rechteckiger Bau aus dem grauen Stein der Gegend. Das Eingangsportal wurde von zwei zinnenbewehrten Erkervorbauten mit bodentiefen Fenstern flankiert. Tante Elsie ging nicht auf den Haupteingang zu. Sie umrundete das Haus auf der östlichen Seite, dort zog sie bei einer eisernen Tür an der Klingelschnur. Es wurde sogleich geöffnet. Eine ganz in schwarze Seide gekleidete, grauhaarige Frau sagte anstelle einer Begrüßung: »Sie sind zu spät, Ms Martyn. Mylady ist es nicht gewöhnt, zu warten.«
»Es tut mir leid, Mrs Ross«, erwiderte Elsie. »Heute begleitet mich meine Nichte.«
Cleo streifte ein kurzer, desinteressierter Blick. Wie von der Tante angewiesen, hielt sie den Kopf gesenkt, sah sich aus den Augenwinkeln aber verstohlen um, während sie der Haushälterin durch den geräumigen Dienstbotentrakt folgten. Sie stiegen eine Steintreppe in das erste Stockwerk hinauf, traten in einen Korridor mit holzgetäfelten Wänden und einem dunkelblauen Teppich. Mrs Ross klopfte an eine Tür, öffnete diese und sagte: »Die Schneiderin ist jetzt da, Mylady.«
»Das wurde auch Zeit«, hörte Cleo eine raue Stimme sagen. »Sie soll hereinkommen.«
Cleo blieb dicht hinter ihrer Tante, als sie in einen kleinen Salon traten, den Blick fest auf den rostbraunen Teppich gerichtet, bemerkte aber, dass Tante Elsie knickste.
»Verzeihen Sie meine Verspätung, Mylady.«
Lady Tredennick runzelte die Stirn, ging auf Elsies Entschuldigung nicht ein, deutete auf Cleo und fragte: »Wer ist das?«
»Meine Nichte Cleopatra«, erklärte Tante Elsie. »Sie wird das Schneiderhandwerk erlernen. Deswegen habe ich sie mitgebracht, sie wird mir beim Ausmessen behilflich sein.«
»Cleopatra?« Die Lady kräuselte die Nase. »Was für ein absonderlicher Name.«
»Mein Vater gab ihn mir. Er ist ein berühmter Archäologe und leitet wichtige Grabungen in Ägypten, aber alle nennen mich Cleo.« Die Worte waren Cleo entschlüpft, bevor sie nachgedacht hatte. Tante Elsie warf ihr einen ärgerlichen Blick zu.
»Da ich noch nie von diesem Mann gehört habe, kann er wohl nicht bedeutend sein«, erwiderte Lady Tredennick mit einem abfälligen Unterton. »Können wir uns jetzt endlich dem Zweck Ihres Kommens zuwenden, Ms Martyn?«
Elsie nickte, nervöse rote Flecken auf den Wangen. Ein Mädchen, das Cleo bisher nicht bemerkt hatte, sprang aus einem Sessel auf, musterte Cleo von oben bis unten und sagte: »Cleo passt viel besser zu dir. Wie die ägyptische Königin siehst du nicht aus. Die soll nämlich unglaublich schön gewesen sein.«
Obwohl Cleo wusste, dass sie die Augen niederschlagen sollte, klebte ihr Blick an dem Mädchen. Nie zuvor hatte sie eine so hübsche junge Frau gesehen. Das schwarze, lockige Haar schmiegte sich um ein herzförmiges Gesicht mit einer schmalen, wohlgeformten Nase und vollen Lippen. Am schönsten waren jedoch ihre veilchenblauen Augen. Das musste Miranda Tredennick sein, dachte Cleo, die Tochter der Familie.
»Was starrst du mich so an?«, fragte das Mädchen. »Habe ich grüne Flecken im Gesicht, oder was?«
Cleo errötete und neigte den Kopf.
»Miranda, bitte!« Lady Tredennick runzelte unwillig die Stirn. »Lass das Kind in Frieden, es kümmert uns nicht. Stell dich ruhig hin, damit wir endlich anfangen können. Du willst doch ein neues Sonntagskleid haben, nicht wahr?«
»Ja, Mama, natürlich.«
Routiniert nahm Elsie die Maße des Mädchens und diktierte sie Cleo, die sie mit einem Bleistift in ihrer steilen, eckigen Schrift in das Auftragsbuch eintrug. Auf einem Beistelltisch lag ein aufgeschlagenes Buch mit Stoffmustern. Mirandas neues Kleid wurde aus roséfarbener Seide und zartem Chiffon gefertigt. Tante Elsie hatte den Stoff bei einem Händler in Plymouth bestellt und zusammen mit Lady Tredennick das Modell skizziert: Über der Brust gerafft, der Rock ab der Taille glockenförmig ausgestellt, zweilagig aus Chiffon, darüber Seide, einen mit heller Spitze gesäumten, dezenten Ausschnitt und halblange Ärmel, die ab den Ellenbogen wie eine Wasserkaskade aufsprangen. Lady Tredennick hatte von einem »Sonntagskleid« für ihre Tochter gesprochen, und Cleo fragte sich, wie dann wohl ein Ballkleid für Miranda aussehen würde und aus welchen edlen Stoffen es gearbeitet sein müsste. Sie selbst besaß zwei gute Kleider, die sie nur für den sonntäglichen Kirchgang trug. Für den Winter eines aus dunkelgrauem Tweed, für wärmere Tage das schlichte, schmucklose blaue Baumwollkleid, das sie heute trug. Lediglich der Kragen und die Manschetten waren mit einer schmalen, elfenbeinfarbenen Spitze verziert.
Als Mirandas Maße ausgemessen waren und Cleo das Notizbuch neben den Stoffmustern auf dem Beistelltisch ablegte, rutschte der Ärmel ihres Mantels nach oben.
Blitzschnell packte Miranda Cleo am Handgelenk und rief: »Was ist das? So einen seltsamen Armreif habe ich noch nie gesehen.«
»Ein Geschenk meines Vaters aus Ägypten«, murmelte Cleo mit hochrotem Kopf. Sie wagte nicht, zu ihrer Tante zu sehen.
»Ich habe dir wohl ein Dutzend Mal gesagt, du sollst das Ding nicht tragen!«, brauste Tante Elsie auf, und an Lady Charlotte gewandt: »Verzeihen Sie vielmals, Mylady! Meine Nichte weiß, dass ich solchen Tand nicht schätze.«
»Was das Kind trägt und was es tut, ist mir gleichgültig«, erwiderte Lady Charlotte. »Allerdings finde ich es äußerst unangebracht, sich an einem Werktag derart zu schmücken.«
»Ich finde den Reif hübsch«, sagte Miranda und streckte fordernd die Hand aus. »Gib ihn mir!« Cleo blieb nichts anderes übrig, als der Aufforderung nachzukommen. Miranda betrachtete den Schmuck aufmerksam und fragte: »Was sind das für seltsame Einritzungen?«
»Man nennt sie Hieroglyphen«, erklärte Cleo. »Das ist die Schrift der alten Ägypter. Mein Vater sagt, es sei die Botschaft von einem Mann an eine Frau, die er nicht habe heiraten dürfen.«
»Dann ist der Reif alt?« Wie selbstverständlich streifte sich Miranda das Schmuckstück über ihr Handgelenk. »Er steht mir gut, nicht wahr? Der blaue Käfer hat die gleiche Farbe wie meine Augen.«
Cleo schluckte. Sie befürchtete, Miranda würde ihr den Armreif nicht mehr zurückgeben.
»Deine Augen sind viel leuchtender als der billige Stein, Tochter«, sagte Lady Charlotte mit einem stolzen Blick auf Miranda. »Gib dem Mädchen das Ding zurück«, fügte sie zu Cleos Erleichterung an. »Du hast eine ganze Schatulle mit schönem und wertvollem Schmuck.«
»Ich muss ihn Angwin zeigen«, rief Miranda, ohne den Reif abzulegen. »Vielleicht kann er diese Hürodingsbums entziffern.«
Zu Cleos Überraschung nickte Lady Tredennick wohlwollend. »Tu das, mein Kind. Deine Maße sind abgenommen, du kannst uns jetzt allein lassen.«
»Komm mit!«
Miranda zog Cleo am Ärmel hinter sich her. Am Gesichtsausdruck ihrer Tante erkannte Cleo, wie sehr sie es missbilligte, dass Cleo Miranda begleiten sollte. Elsie wagte aber keinen Widerspruch. Cleo folgte Miranda erst durch einen langen Korridor, dann eine mit dunkelrotem, weichem Teppich ausgelegte Treppe hinauf. Oben angekommen, passierten die Mädchen einen weiteren Korridor, an dessen Ende Miranda schließlich an eine Tür klopfte. Sie wartete die Aufforderung, einzutreten, nicht ab, sondern öffnete die Tür und rief: »Angwin, du musst dir unbedingt was ansehen!«
»Miranda? Hast du jetzt nicht Anprobe für ein neues Kleid?«, fragte eine tiefe männliche Stimme aus dem hinteren Bereich des Raums.
»Ich bin schon fertig.«
Miranda trat in ein quadratisches Zimmer. Die Wände waren holzgetäfelt, ein dunkelgrüner Teppich und gleichfarbige Gardinen schmückten den Raum. Abwartend blieb Cleo unter dem Türsturz stehen. Der Anblick des Raumes nahm sie gefangen. Ehrfürchtig schweifte ihr Blick über die deckenhohen Regale aus dunklem Holz. In ihnen standen mehr Bücher, als Cleo je zuvor gesehen hatte. Die meisten in Leder gebunden, dazwischen auch modernere Literatur mit Rücken aus Stoff. In der Luft lag der unverwechselbare Geruch nach Pergament und Druckerschwärze, wie sie nur Büchern anhaftete.
Ob die Bücher alle gelesen worden sind?, fragte sich Cleo und wünschte sich, ein paar Stunden, ach nein, am liebsten tagelang in diesem Zimmer eingeschlossen zu werden, in den Schätzen stöbern und lesen zu können.
»Was gibt es denn so Dringendes, Miranda?«
Cleos Aufmerksamkeit wurde jetzt auf den hochgewachsenen jungen Mann gelenkt. Die Beine lässig übereinandergeschlagen, in den Händen ein aufgeschlagenes Buch, saß er in einem der zwei Sessel vor dem Kamin. Sein kurzes, glattes Haar war noch eine Spur dunkler als das seiner Schwester.
Miranda trat zu ihm, streifte sich den Armreif ab und reichte ihn ihrem Bruder.
»Sieh mal, Angwin. Kann das Schmuckstück aus Ägypten stammen?«
Er legte das Buch zur Seite, nahm den Armreif und betrachtete ihn interessiert. »Das kann durchaus sein, auf jeden Fall ist es eine sehr hübsche Arbeit. Woher hast du den Reif?«
»Ist doch egal«, wiegelte Miranda ab. »Kannst du lesen, was eingraviert ist? Vielleicht ein Liebesschwur?«
Angwin schüttelte den Kopf. »Mit dem Studium der Ägyptologie habe ich erst begonnen. Meine Kenntnisse reichen noch nicht aus, um Hieroglyphen entziffern zu können.«
»Wie schade.« Enttäuschung schwang in Mirandas Stimme. Sie nahm den Armreif wieder entgegen. »Ich habe gehofft, dass wenigstens eine interessante Geschichte eingraviert worden ist, wenn schon so ein ekliger Käfer darauf prangt.«
Schmunzelnd erwiderte Angwin: »Der Skarabäus gilt in Ägypten auch heute noch als Heiligtum. Er stellt ein Symbol der Schöpferkraft dar, da die Käfer das kommende Nilhochwasser vorzeitig spüren, vom Ufer fort in die Wohnhäuser wandern und den Menschen so das Zeichen geben, dass der Fluss über seine Ufer treten wird.«
»Sehr interessant«, sagte Miranda langgezogen und verdrehte die Augen. Die Geschichte langweilte sie offensichtlich, während Cleo jedes Wort interessiert verfolgt hatte. Sie wusste um die Bedeutung des heiligen Pillendrehers, war jedoch überrascht, diese Kenntnisse bei Mirandas Bruder vorzufinden.
»Ausgesprochen wertvoll scheint der Reif nicht zu sein«, fuhr Angwin fort, der das Desinteresse seiner Schwester nicht zu bemerken schien. »Relikte dieser Art gibt es zuhauf, selbst aus den alten Zeiten. Jede Grabstätte, nicht nur die der Pharaonen, sondern auch von niedrig gestellten Personen, wurde mit zahlreichen Artefakten und Glücksbringern ausgestattet, um den Toten bei der Widerauferstehung das gleiche Leben wie zuvor zu sichern.«
»Sie sind doch nicht wirklich wieder auferstanden?«
Cleo hörte einen bangen Unterton in Mirandas Stimme. Angwin lachte schallend.
»Natürlich nicht! In jeder Religion gibt es den Glauben an ein Leben nach dem Tod. Wir Christen glauben an den Einzug ins Himmelreich, wo wir unsterblich sein werden.«
»Ich nicht! Wenn man tot ist, ist man tot. So wie Vater.«
»Vater lebt in unseren Herzen weiter. Solange wir ihn und seine Güte nicht vergessen, hat er uns nicht verlassen.« Sanft strich Angwin seiner Schwester übers Haar. »Der Totenkult im alten Ägypten ist faszinierend! Ich lese gerade eine interessante wissenschaftliche Studie über die Konservierung von Mumien. Das Verfahren änderte sich im Laufe der Jahrhunderte. Als der Brauch der Einbalsamierung aufkam, verblieben die Innereien des Toten in seinem Körper. Erst später begann man, die Gehirne und inneren Organe zu verflüssigen und zu entfernen. Dann wurden die Körper wieder zugenäht, sodass keine Spuren der Entnahme zu sehen waren. Ist es nicht beeindruckend, über welche Kenntnisse die Ägypter verfügten?«
»Hör auf, Angwin!« Miranda presste sich die Hände auf die Ohren. »Deine Faszination an solch ekelhaften Dingen kann ich nicht verstehen. Wir gehen jetzt wieder, bevor mir übel wird.«
Sie wandte sich ab. Zum ersten Mal sah Angwin zur Tür. Eine seiner buschigen, schwarzen Augenbrauen hob sich, seine Augen musterten Cleo von oben bis unten.
»Wer ist denn dieses hässliche Kind?«
Cleo zuckte zusammen, als hätte sie einen Schlag in die Magengrube erhalten.
»Nur die Tochter der Schneiderin«, erklärte Miranda beiläufig und ließ unerwähnt, dass der Armreif Cleos Eigentum war. Sie packte Cleo am Arm, zog sie mit sich und warf die Tür lauter als nötig hinter sich ins Schloss. »Gehirne verflüssigen«, murmelte sie immer noch fassungslos. »Die alten Ägypter waren Barbaren!«
»Es geschah aus religiösen Gründen«, erwiderte Cleo. »Mein Vater hat mir davon erzählt. Übrigens: Elsie Martyn ist meine Tante, die Schwester meiner Mutter, und die ist tot.«
»Was?«
»Du hast gesagt, ich sei die Tochter der Schneiderin«, versuchte Cleo zu erklären, aber Miranda winkte ab.
»Meinen Bruder interessiert es nicht, wer du bist«, sagte sie. »In Oxford studiert er Ägyptologie. Er wird ein berühmter Archäologe werden und Gräber finden, randvoll mit Gold und Juwelen, die ihn reich und berühmt machen werden.«
Cleo dachte, dass die Familie Tredennick bereits jetzt unermesslich reich war, auf jeden Fall hatten sie mehr Geld als sonst jemand, den sie kannte. Sie sagte Miranda nicht, dass ihr Vater der Meinung war, in Ägypten gäbe es keine Grabkammer, die nicht schon geplündert worden war. Nicht nur in jüngerer Zeit, schon früher machten sich Grabräuber bereits kurz nach der Beisetzung über die Schätze her.
»Bekomme ich meinen Armreif wieder?«, fragte Cleo.
»Ach so, ja, natürlich.« Miranda streifte den Reif ab und reichte ihn Cleo. »Du hast es ja gehört: Er ist nichts wert, und ob wirklich was Interessantes draufsteht, bezweifelt Angwin sehr. Ich verstehe nicht, wie man einen ekligen Käfer mit sich herumtragen kann.« Sie schüttelte sich wie ein junger Hund.
So hatte es Mirandas Bruder zwar nicht ausgedrückt, Cleo wollte aber nicht länger darüber sprechen, sondern so schnell wie möglich das Haus verlassen. Hoffentlich forderte Tante Elsie sie nie wieder auf, sie in das Herrenhaus zu begleiten. Mit diesen Leuten wollte Cleo nichts zu tun haben. Noch nie hatte jemand gesagt, sie sei hässlich!
Als Cleo in der Halle auf ihre Tante traf, unterdrückte sie ihre Tränen. Tante Elsie durfte nicht merken, wie verletzt sie war.
»Da bist du ja endlich«, rief die Tante. »Ich hoffe, du bist niemandem zur Last gefallen.«
»Keine Sorge, Ms Martyn«, antwortete Miranda. »Cleo ist zwar ein seltsames Mädchen, aber ich hoffe, sie wiederzusehen. Cleo könnte durchaus interessant sein.«
Cleo fragte nicht, was Miranda damit ausdrücken wollte. Sie war froh, als sie und Tante Elsie Tredennick Manor verließen und den Weg nach Hause antraten, ebenso dass die Tante ihr keine Vorwürfe machte, den Armreif angelegt zu haben.
Als sie im Causeway Head, der Einkaufsstraße von Penzance, ein Geschäft mit einem bodentiefen Schaufenster passierten, blieb Cleo stehen und betrachtete sich in der Scheibe.
»Bin ich sehr hässlich, Tante?«
»Was sagst du da?« Elsie Martyn sah Cleo verständnislos an.
»Ich weiß, dass ich nicht so hübsch bin wie Miranda Tredennick. Bin ich aber wirklich hässlich?«
Elsie schüttelte verwundert den Kopf. »Mit solchen Leuten darfst du dich nicht vergleichen, Cleo. Hässlich bist du nicht gerade, aber …« Sie seufzte. »Du kommst eben mehr nach deinem Vater als nach meiner Schwester. Aber du bist gut so, wie du bist. Vor Gottes Angesicht sind alle Menschen gleich, egal wie sie aussehen. Schlussendlich zählt nicht ein hübsches Gesicht, sondern ein reiner, ehrenhafter Geist.«
Die Worte trösteten Cleo nicht, im Gegenteil. Die Tante hatte Angwins Äußerung nicht widersprochen oder ihr etwas Nettes gesagt. Obwohl es Cleo gleichgültig sein konnte, ob der junge Lord Tredennick sie hübsch oder hässlich fand, steckten seine Worte wie ein Widerhaken in ihrem Herz. Wie Miranda war auch Angwin einer der schönsten Menschen, denen Cleo je begegnet war. Nein, mit diesen Leuten konnte sie sich wahrlich nicht messen.
Sie nahmen den Weg durch die Anlage des Morab Gardens. Der botanische Garten war eine Perle der Stadt und für die Öffentlichkeit zugänglich. Hier wuchsen Pflanzen aus nahezu der ganzen Welt und jede Menge Palmen. Aufgrund der geschützten Lage in der Mount’s Bay und dem Golfstrom herrschte in Penzance ein mildes Klima. Während des Winters waren Schnee oder Frost selten und die Sommer nicht zu heiß, aber regenreich. Das war ein perfektes Klima für Palmen, Rhododendren, Hortensien und eine Vielzahl an exotischen Gewächsen. Cleo hielt sich gern im Morab Garden auf, der nur einen Steinwurf von ihrem Cottage entfernt war. Sie saß dann auf einer der grün lackierten Bänke, Insekten schwirrten um ihren Kopf, Vögel zwitscherten im Geäst, und sie träumte sich in die fernen Welten, aus denen die Pflanzen nach Cornwall gekommen waren. Vielleicht kamen einige sogar aus Ägypten? Ihr Vater sagte jedoch, dass das Land in Afrika fast nur aus Wüste bestand, lediglich an den Ufern des Nils gab es Vegetation. Ach, wäre sie doch endlich erwachsen und könnte zu ihrem Vater reisen!
»Was seufzt du, als läge der Kummer der ganzen Welt auf deinen Schultern?«, riss Tante Elsie Cleo aus ihren Gedanken. »Ich gebe dir einen guten Rat: Vergiss Miranda Tredennick ganz schnell wieder! Das Mädchen wird dich nicht zur Freundin nehmen, dafür wird schon ihre Mutter sorgen. Für Ms Miranda bist du vielleicht interessant, weil du anders als sie bist. Aber mit uns Bürgerlichen verkehrt eine Familie wie die Tredennicks nicht.«
»Ich dachte nicht an Miranda, sondern an Vater«, murmelte Cleo.
Die Tante hörte ihr nicht länger zu, sondern beschleunigte ihre Schritte, da urplötzlich eine schwarze Wolke aufgezogen war und ein Regenschauer vom Himmel prasselte.
Sie bogen in die South Folly Lane ein, Cleo konnte ihr Cottage bereits sehen. Unter dem schmalen Vordach stand ein Mann, den Rücken an die Fassade gepresst, um sich vor dem Regen zu schützen. Als er die Frauen sah, kam er ihnen mit weit ausholenden Schritten entgegen. Cleo glaubte, ihren Augen nicht zu trauen.
»Vater!« Sie rannte los und stürzte sich in seine ausgebreiteten Arme. Fest schmiegte Cleo ihr Gesicht an den rauen Stoff seines Mantels.
»So, so, Alexander Vanson, du lässt dich also auch mal wieder blicken«, sagte Elsie kühl. »Du hast deinen Besuch nicht angekündigt.«
»Muss ich ein Telegramm schicken, wenn ich nach Hause komme?«, fragte Alexander. »Ich hatte Sehnsucht nach meiner Tochter, und auch dich, Schwägerin, wollte ich wiedersehen.«
Elsie Martyn runzelte die Stirn. Ihre Freude, den Schwager wiederzusehen, hielt sich in Grenzen. »Lasst uns hineingehen, sonst werden wir bis auf die Knochen durchnässt.«
Während Elsie eine Kanne Tee und Sandwiches zubereitete, begleitete Cleo ihren Vater in sein Zimmer in den ersten Stock hinauf. Der lange, schmale Raum verfügte über ein Fenster zum Garten hinaus, diente Alexander Vanson gleichzeitig als Arbeits- und Schlafzimmer und war voller kleinerer Artefakte, die er von seinen Reisen mit nach Cornwall gebracht hatte. Kleine Steinbüsten, Fragmente von Tempel- und Grabanlagen, Werkzeuge und angestoßene Amphoren und Teller. Nichts Wertvolles, aber lieb gewonnene Erinnerungsstücke an seine zahlreichen Grabungen, die er außer Landes hatte bringen dürfen. Wenn der Vater nicht zu Hause war, hielt sich Cleo oft in dem Zimmer auf, blätterte durch die Bücher und betrachtete und befühlte die Gegenstände. Oft schloss sie die Augen, fühlte sich ihrem Vater nah und stellte sich vor, unter welchen Bedingungen er die Vase oder den Teller gefunden hatte.
Er hatte nur eine kleine Reisetasche bei sich, seine Sachen waren schnell ausgepackt und in der Kommode neben dem schmalen Bett an der linken Wand verstaut.
»Wie lange wirst du bleiben?«, fragte Cleo bang.
»Den restlichen Sommer über«, antwortete ihr Vater. »Vor Oktober ist es im Tal der Könige viel zu heiß, um die Grabungen fortzusetzen. Lord Cherringham ist nach Hause gefahren, um die Finanzierung für die nächste Saison zu sichern. Das wird nicht einfach sein, da wir kaum etwas vorzuweisen haben. Der Gönner von Cherringham möchte bald Ergebnisse sehen.« Alexander stockte, sah Cleo an. »Das verstehst du aber alles nicht.«
»Ich würde es gern verstehen, Vater«, erwiderte Cleo ernst. »Ich möchte alles über deine Arbeit, die Pharaonen und über die Gräber wissen.«
Lachend strich er über ihr Haar. »Du bist groß geworden, Kind, und siehst gesund und kräftig aus. Es mangelt dir doch an nichts?«
»Es geht mir sehr gut, Vater.« Cleo wollte ihm nicht sagen, dass der einzige Mangel, den sie litt, seine Abwesenheit war. Dass das Geld oft knapp war, ließ sie ebenfalls unerwähnt. Darüber würde Tante Elsie mit Vater sprechen, und irgendwie kamen sie immer über die Runden.
»Tante Elsie will, dass ich Schneiderin werde.«
»Ein guter, aussichtsreicher Beruf für ein Mädchen.« Alexander nickte wohlwollend. »Du kannst von Elsie viel lernen. Ein solides Handwerk ist das Beste für eine Frau, die sich ihren Lebensunterhalt verdienen muss.«
»Ich will nicht nähen, sondern studieren und an deiner Seite arbeiten!« Ihre Enttäuschung über seine Worte konnte Cleo nicht verbergen. »Du hast gesagt, dass die Universitäten auch Frauen zulassen!«
Alexander schluckte trocken. Ausweichend antwortete er: »Erst musst du die Schule beenden. Die Zukunft wird zeigen, wohin dein Weg dich führen wird, Cleopatra Vanson.«
Dass er sie mit ihrem Taufnamen ansprach, sagte Cleo, sie solle das Thema jetzt besser ruhen lassen. Eines war jedoch sicher: Alexander Vanson war nicht nach Cornwall gekommen, um sie nach Ägypten mitzunehmen. Sein Blick fiel auf den Armreif, den Cleo immer noch am Handgelenk trug. Er lächelte.
»Hat dir mein Geschenk gefallen?«
»Nie zuvor habe ich etwas Schöneres besessen!«, rief Cleo. »Auch wenn alle sagen, es wären nur Blech und Glassteine – mir ist der Reif mehr wert als alles Gold der Welt.«
»Wer sagt denn so was?«, fragte Alexander. »Der Skarabäus ist aus echtem Lapislazuli gearbeitet. Seit Jahrtausenden wird der Stein in Zentralasien abgebaut und zu Schmuck verarbeitet. Du glaubst mir doch, dass der Reif viele Tausende von Jahren alt ist und aus einem Grab stammt?«
»Natürlich, Vater. Ich halte ihn in Ehren, und der Skarabäus wird mir immer Glück bringen.«
»Deswegen habe ich ihn dir geschenkt. Wer weiß – vielleicht hilft er dir dabei, dass deine Träume eines Tages Realität werden und du zu mir nach Ägypten kommen kannst.«
Nichts mehr wünsche ich mir, dachte Cleo.
Alexander zog seine Taschenuhr hervor und ließ den Deckel aufspringen. Die Uhr war ein Geschenk von Cleos Mutter gewesen. Das Gehäuse war zwar nur vergoldet, sie hatte aber ihre beiden Namen und das Datum ihrer Eheschließung eingravieren lassen.
»Es ist Zeit für den Tee«, sagte er. »Lass uns hinuntergehen. Deine Tante legt großen Wert auf Pünktlichkeit.«
Elsie Martyn bot ihrem Schwager ein Glas von ihrem selbst angesetzten Holunderblütenwein an. Sie saßen sich im Wohnzimmer gegenüber, im Kamin brannte das Feuer, denn der Sommerabend war kühl. Cleo war ins Bett geschickt worden. Sie war nur unwillig gefolgt, sagte sich dann aber, dass der Vater einige Wochen zu Hause sein und sie viel Zeit miteinander verbringen würden.
»Ich nehme nicht an, dass du Geld mitgebracht hast?«
»Im Moment bin ich etwas klamm«, musste Alexander zugeben und unterbrach das Stopfen seiner Pfeife.
»Im Moment?«, fragte Elsie spöttisch.
Er ging auf ihre Bemerkung nicht ein und fuhr fort: »Du weißt, Elsie, dass ich nicht in meine eigene Tasche wirtschafte, so wie einige meiner Kollegen. Mein Auftraggeber ist Lord Cherringham, bei ihm stehe ich in Lohn und Brot. Zusätzlich finanziert er mir einen durchaus vornehmen Aufenthalt in einem Hotel in Luxor. Würde ich versuchen, mich an Fundstücken zu bereichern, wäre das mein Ende in Ägypten.« Alexander lachte bitter. »Unter den hohen Herrschaften ist das jedoch üblich, obwohl niemand offen darüber spricht. Sie sind der Meinung, wenn sie ihr Geld in die Projekte stecken, haben sie auch Anspruch auf die Ergebnisse. Dass die Kulturgüter für die Museen bestimmt sind, wo sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, vergessen die Lords und Earls leider nur zu gern.«
Ein Funken Bewunderung glomm in Elsies Augen. So hatte sie ihren Schwager noch nie sprechen hören. Er war eine ehrliche Haut, sein Herz schlug für das Alte Ägypten. Nichts würde ihn abhalten, wieder in das heiße, trockene Land zurückzukehren.
»Cleo ist in einem Alter, in dem sie ihren Vater braucht«, sagte Elsie leise. »Sie lässt sich von dem aufrührerischen Gedankengut, das sich unter den Frauen in den Großstädten wie ein Flächenbrand verbreitet, anstecken. Nicht nur Cleos Wunsch, zu studieren und sich ihren Lebensunterhalt als Archäologin zu verdienen, anstatt zu heiraten und eine Familie zu gründen, wie es jeder normalen Frau ansteht, bereitet mir Sorgen. Deine Tochter stellt die Autorität der Menschen infrage, von denen wir abhängig sind.«
»Ich verstehe nicht, Elsie …«
»Heute sagte Cleo, sie fände es nicht richtig, dass ich zu Lady Tredennick ins Herrenhaus gehe. Die Dame solle zu mir kommen, wenn sie etwas von mir wolle.«
»Das ist meine Tochter!« Alexander lächelte stolz. »Es stellt sich wirklich die Frage, was den Reichen das Recht gibt, uns derart herumzukommandieren.«
»Die seit Jahrhunderten bestehende Ordnung«, erwiderte Elsie mit einem kräftigen Nicken. »In Frankreich hat man gesehen, wohin es führt, wenn sich das einfache Volk anmaßt, ein Land besser regieren zu können als ein von Gott eingesetzter Herrscher.«
»Ich glaube, ich bin heute zu müde, um über Politik zu diskutieren.« Alexanders Nase kräuselte sich. Es gab vieles, was er seiner Schwägerin hätte antworten können, er schwieg jedoch. Nicht nur weil er sich nach seinem Bett sehnte, in erster Linie weil er Elsie Martyns fest verwurzelte royalistische Einstellung kannte. Rigoros lehnte sie Veränderungen und Abweichungen von der bestehenden Ordnung ab.
»Auch du bist von Lord Cherringham abhängig.« Elsie war nicht gewillt, das Thema fallenzulassen. »Es ist sein Einfluss und sein Geld, das dir ermöglicht, im Dreck nach Gräbern zu wühlen und die Ruhe der Verstorbenen zu stören.«
»Ich bin wirklich erschöpft, Elsie.« Alexander erhob sich aus dem Sessel.
»Du bist also nicht gewillt, deiner Tochter zuliebe für längere Zeit in Cornwall zu bleiben«, sagte Elsie mit versteinerter Miene. »Eine Frage noch, Alexander: Stammt der Armreif, den du Cleo geschenkt hast, wirklich aus einem Grab, oder hast du ihn auf einem Basar gekauft?«
»Das Schmuckstück könnte alt sein.« Alexander setzte sich wieder. So schnell würde Elsie ihn nicht gehen lassen. »Ich habe ihn nicht selbst gefunden, sondern erwarb ihn auf legalem Weg und wollte Cleo eine kleine Freude bereiten.«
Alexander verschwieg, dass der frühere Besitzer des Schmuckstückes ermordet worden war, ebenso, wie vehement Miller den Armreif hatte loswerden wollen. Inzwischen waren Monate vergangen und der Mordfall Sam Miller längst ungeklärt zu den Akten gelegt worden.
»Wenn Lord Cherringham die nächste Grabungssaison finanziert bekommt«, wechselte Alexander das Thema, »dann werden wir fündig werden, dessen bin ich sicher. Wir sind ganz nah dran …«
»Erspar mir deine Fantastereien«, schnitt Elsie ihm das Wort ab. »Seit Jahren höre ich nichts anderes, als dass du kurz vor einer bahnbrechenden Entdeckung bist, die dich zum berühmten Mann machen wird. Alles nur heiße Luft. Warum konnte Sophia nicht einem normalen Mann begegnen?«
»Du wirst mir nie verzeihen, dass ich deine Schwester geheiratet habe«, sagte Alexander bitter. »Und dass Sophia heute noch leben könnte, hätte sie Cleo nicht bekommen. Lässt du das Kind deine Abneigung spüren?«
»Ich liebe Cleo wie eine eigene Tochter«, empörte sich Elsie. »Allerdings bin ich nicht gewillt, ihre unrealistischen Wunschträume zu unterstützen. Das Mädchen ist alt genug, um einzusehen, dass sie weder studieren noch jemals nach Ägypten reisen wird.«
»Warum eigentlich nicht, Elsie?«, fragte Alexander nachdenklich. »Immer mehr Frauen interessieren sich für die Archäologie. An der Universität in Oxford sind Frauen für den Studiengang der Ägyptologie zugelassen.«
»Wovon soll ich das bezahlen?«, rief Elsie aufgebracht. »Ich nähe mir jetzt schon die Finger wund, um deiner Tochter ein anständiges Leben zu ermöglichen. Sie hat ein dichtes Dach über dem Kopf, immer gefüllte Teller und ordentliche Kleidung. Darüber hinaus darf sie noch zwei Jahre zur Schule gehen. Ein Großteil ihrer Altersgenossinnen ist gezwungen, sich eine Stellung zu suchen, oft als schlecht bezahlte Küchenmädchen in einem herrschaftlichen Haushalt.« Elsie beugte sich vor, ihr Blick bohrte sich in Alexanders Augen. »Hat sich Cleo bei dir beschwert? Hat sie gesagt, dass sie mir nicht beim Schneidern helfen will?«
»Cleo hat kein einziges schlechtes Wort gesagt, im Gegenteil«, versicherte Alexander. »Was ein Studium angeht: Auch Frauen erhalten Stipendien. In den nächsten Wochen werde ich mit Cleo Zeit verbringen und ihr viel von meinem Wissen vermitteln. Ich hoffe auf deine Unterstützung, dem Mädchen die Chance zu geben, so viel wie möglich lernen zu können. Wir haben jede Menge unterschiedliche Ansichten, Elsie, dass Cleo aber die Möglichkeit erhalten sollte, die Zukunft nach ihren Vorstellungen gestalten zu können – darüber sind wir uns doch einig, nicht wahr?«
Elsie nickte zögerlich. Es war ihr anzusehen, wie wenig es ihr passte, auf Cleos Hilfe in der Schneiderei zu verzichten. Alexander war aber Cleos Vater, und er liebte das Kind ebenso wie das Mädchen ihn. Elsie glaubte jedoch nicht daran, dass Cleos Träume jemals Wirklichkeit werden würden. Auch wenn Alexanders Ansatz vielleicht wohlwollend gemeint war, in ein paar Wochen reiste er dennoch wieder ab. Dann würde sie, Elsie, ausreichend damit zu tun haben, das Mädchen zu trösten und die Flausen, die Alexander in den Kopf seiner Tochter gesetzt hatte, wieder auszutreiben. Wie so häufig zuvor.
2
Penzance, Cornwall 1915
Cleo stach die Nähnadel mit so viel Kraft durch den dicken Stoff, dass die Nadel in der Mitte entzweibrach, sich die Spitze in Cleos Fingerkuppe bohrte und stecken blieb.
»Aua!«
Mit zwei Fingern der anderen Hand zog Cleo die Nadel aus ihrem Fleisch, presste ein sauberes Taschentuch auf die kleine Wunde und wartete, bis die Blutung aufhörte. Sie seufzte und blinzelte mehrmals hintereinander. Seit fünf Stunden saß sie nun schon an der Näharbeit, und ihre trockenen Augen brannten. Obwohl es erst früher Nachmittag war, hatte sie die Lampen bereits anzünden müssen. Kaum ein Tag in den letzten drei Wochen, an dem es richtig hell geworden war. Auch heute lag der Nebel dicht und schwer über der Stadt.
Cleo stand auf, streckte ihre Glieder und öffnete das Fenster. Feuchte Kälte strömte herein. Sie beklagte sich nicht über die viele Arbeit, die ihr seit Monaten kaum Freizeit bescherte. Es war selbstverständlich, dass sie Tante Elsie half. Aber sie wünschte sich, ans Meer gehen zu können, raschen Schrittes bis nach Newlyn, vielleicht sogar weiter bis nach Mousehole. Die Bewegung würde ihre Kopfschmerzen, die sie seit Tagen begleiteten, vertreiben. Nebel, Nieselregen und kalter Westwind schreckten Cleo nicht ab. Der November in Cornwall war meistens trüb, neblig und regnerisch, in der Regel besserte sich das Wetter erst im Dezember. Cleo erinnerte sich an Weihnachtsfeste, an denen es wärmer und sonniger gewesen war als im Sommer. Auch die Träume ihrer Kindheit von dem heißen Land am Nil hatte Cleo nicht vergessen. Vor einem Jahr war die Welt jedoch in ein Chaos aus Hass und Blut gestürzt worden. Die Menschen lebten nun in einer Zeit, in der kaum noch Raum für Fantasien blieb.
»Die Regierung zahlt gut für diese Arbeit«, hatte Tante Elsie gesagt. »Mit dem Ausbessern der Uniformen verdienen wir mehr als mit Kleidern, Blusen und Röcken. Den meisten Frauen steht nicht der Sinn nach eleganter Kleidung, wenn ihre Männer, Väter und Söhne in den Schützengräben sterben.«
Auch wenn Cornwall von den Kriegshandlungen nicht direkt betroffen war, gab es in der Stadt kaum eine Familie, die keinen Verlust eines geliebten Mannes zu beklagen hatte. Seit dem Eintritt Englands in einen Krieg, der in Europa schrecklicher und grausamer als jemals einer zuvor tobte, hatte sich Penzance verändert. Auf der Promenade, wo einst die Leute flanierten und sich zu einem Plausch getroffen hatten, standen nun schwere Geschütze. Tag und Nacht wimmelte es von Soldaten, für Zivilisten war die Promenade zum Sperrgebiet erklärt worden. Das städtische Hospital war überfüllt, viele Privathäuser nahmen zusätzlich verwundete Soldaten auf.
Auch Tredennick Manor war zu einem Lazarett geworden. Lady Charlotte hatte einen Flügel des Herrenhauses zur Verfügung gestellt, in dem sich die Soldaten, bei denen keine akute Lebensgefahr bestand, erholen konnten – bis sie als neues Kanonenfutter wieder an die Fronten geschickt wurden. Die Lady selbst kümmerte sich um die an Leib und Seele traumatisierten Männer. Dafür wurde ihr großer Respekt von Seiten der Bevölkerung gezollt. Miranda hingegen …
Cleo schmunzelte, als sie an das Mädchen dachte. Seit ihrer ersten Begegnung im Sommer vor zwei Jahren hatten sich Cleo und Miranda häufig getroffen. Es Freundschaft zu nennen, wäre übertrieben, aber trotz des Standesunterschiedes war Miranda nicht davon abzubringen, Cleos Gesellschaft zu suchen. Regelmäßig kam sie in das Cottage in der Stadt. Dann brühte Cleo Tee auf, manchmal hatte sie auch einen Kuchen gebacken, und sie saßen wie zwei ebenbürtige Mädchen beisammen. Miranda wollte von Cleo alles wissen: über deren Vergangenheit, deren Gegenwart, wie es war, in einem Cottage ohne Dienstboten zu leben, sich das Essen selbst kochen und die Wäsche waschen zu müssen. Im Gegenzug erzählte Miranda von ihrem Leben, den Erzieherinnen und Gouvernanten, die sie unterrichtet hatten. Eine öffentliche Schule hatte Miranda nie besucht. Sie konnte weder kochen noch nähen, in der Anfertigung von feinen Stickarbeiten hatte man sie jedoch unterrichtet, ebenso in Gesang und Tanz. Miranda spielte auch leidlich Klavier, fand am Musizieren aber nur wenig Gefallen.
»Meine Mutter legt Wert darauf, dass ich mich in Gesellschaft zu bewegen weiß«, hatte Miranda erklärt. »Keine Namen verwechsle, weiß, wer mit wem nicht zurechtkommt und mit wem ich eine leichte, in der Regel seichte Unterhaltung führen kann.«
Cleo gewann den Eindruck, dass Mirandas Leben zwar von Luxus, feinen Kleidern und gutem Essen geprägt, deswegen aber nicht glücklicher als das ihrige war. Tante Elsie schrieb Cleo auch vor, was sie zu tun hatte, ihre eigene Meinung durfte Cleo trotzdem äußern. Miranda hingegen wurde dahingehend