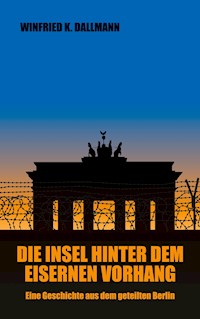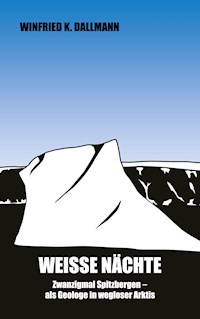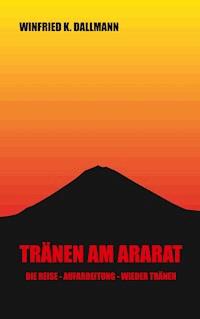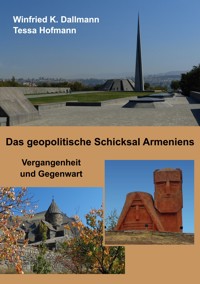
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Vertreibung der armenischen Bevölkerung von Bergkarabach im Herbst 2023 sorgte nur kurzzeitig für internationale Schlagzeilen. In den deutschsprachigen Massenmedien wurden die historischen, politischen und völkerrechtlichen Hintergründe kaum berücksichtigt. Man beschränkte sich weitgehend auf die mantraartig wiederholte Phrase, Bergkarabach gehöre völkerrechtlich zu Aserbaidschan, sei aber überwiegend von Armeniern bewohnt. Es wurde der Eindruck erweckt, Aserbaidschan hole sich nur sein widerrechtlich besetztes Territorium zurück. Das kriegerische Vorgehen wurde zwar zunehmend gerügt, aber aus wirtschaftlichen Interessen nicht mit Sanktionen verbunden. Der Karabachkonflikt begann nicht erst mit der Auflösung der Sowjetunion 1991, sondern besitzt eine lange Vorgeschichte. Dazu gehören die zahlreichen Bevölkerungsverschiebungen im Zuge der osmanisch-persisch-russischen Vormachtkämpfe der vergangenen Jahrhunderte, der osmanische Völkermord an den Armeniern und anderen indigenen Christen während des Ersten Weltkriegs sowie die kriegerischen Auseinandersetzungen im Südkaukasus im Gefolge des Weltkriegs. Auch die wankelmütige Haltung der regionalen Hegemone und westlichen Großmächte trägt bis heute erheblich zur Eskalation bei. Die Verfolgung von Minoritäten in der modernen Türkei während des 20. Jahrhunderts und die stark diskriminierende Bevölkerungspolitik in der Sowjetunion bilden weitere Aspekte. Das Ergebnis ist eine wesentlich differenziertere Sicht auf die Hintergründe der Ereignisse. Dieses Buch schließt die Lücken in der Südkaukasus- bzw. Armenienberichterstattung. Es schildert den Karabachkonflikt im größeren Zusammenhang der armenischen Geschichte und der in Armenien immer wieder kollidierenden Großmachtinteressen. Zugleich zeigt es die Schwierigkeiten einer auf Aussöhnung und Selbstbestimmung basierten Friedenspolitik in der Region.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Umschlagbilder:
Die Gedenkstätte für die Opfer des Genozids von 1915-16 auf dem Hügel Zizernakaberd („Schwalbenfestung“) in Jerewan (Foto: Winfried K. Dallmann)
Das tausendjährige armenische Kloster Worotnawank in Sjunik (Foto: Winfried K. Dallmann)
Das Denkmal „Wir sind unsere Berge“ (1967, volkstümlich „Tatik u Papik“ – „Großmütterchen und Großväterchen“) gilt als Wahrzeichen Arzachs. Es spielt auf die Abwanderung der arbeitsfähigen Bevölkerung infolge der armenierfeindlichen Wirtschaftspolitik Sowjetaserbaidschans an. (Foto: Gerayer Koutcharian)
Inhalt
KARTENÜBERSICHT
ÜBER DIESES BUCH
ÜBER DIE AUTOREN
VORWORT
Aktuelle Anlässe
Hintergründe
“Fake News“ und falsche Ausgewogenheit
Doppelmoral und Geopolitik
TEIL I: Armenische Geschichte
1. Von der Frühgeschichte bis zum 18. Jahrhundert
1.1. Der Ursprung
1.2. Die frühen Staatsgebilde: Hajassa, Nairi, Urartu (15.-6. Jh. v.u.Z.)
1.3. Armenien zwischen Seleukiden, Römern und iranischen Dynastien (6. Jh. v.u.Z. bis Anf. 5. Jh.)
1.4. Christianisierung (4. Jh.)
1.5. Armenien zwischen Byzantinern und Persern (Anfang 5. bis Mitte 7. Jh.)
1.6. Armenien unter den arabischen Kalifen (Mitte 7. bis Ende 9. Jh.)
1.7. Die Zeit der armenischen Königreiche (Ende 9. bis Mitte 11. Jh.)
1.8. Unter dem Joch von Seldschuken, Mongolen und Turkmenen; georgisches Intermezzo (Mitte 11.-15. Jh.)
1.9. Kilikien (spätes 11. bis 15. Jh.)
1.10. Zwischen Osmanen und iranischen Dynastien (16. bis 19. Jh.)
1.11. Armenische Handelskolonien in Russland und russische Einflussnahme bis zum 18. Jh.
2. Russland und Armenien 1828-1914
2.1. Russische Eroberung des Transkaukasus
2.2. Gebietseinteilungen bis zum 1. Weltkrieg
2.3. Russifizierung, politische Organisation und ethnische Spannungen
2.4. Bevölkerungsentwicklung
2.5. Armenisches Kulturleben in Russland
3. Armenier im Osmanischen Reich
3.1. Das osmanische
millet
-System und die Rechtsstellung der Nicht-Muslime
3.2. Demografie und Berufsbild
3.3. Bildung und Literatur
3.4. Reformansätze im 19. Jahrhundert
3.5. Abdülhamit II. und die Massaker von 1894-96
3.6. Die jungtürkische Revolution und der Pantürkismus
4. Der Erste Weltkrieg und der Völkermord im Osmanischen Reich
4.1. Auftakt
4.2. Griechisches Vorspiel
4.3. Im Schatten des Ersten Weltkriegs
4.4. Der Nordwestiranische Feldzug
4.5. Der Elitizid
4.6. Schaffung von Vorwänden
4.7. Die Todesmärsche
4.8. Widerstand
4.9. Die Vertreibung und Ermordung der Syro-Aramäer
4.10. Fortgesetzte Vertreibung und Ermordung von Griechen
4.11. Zwangsislamisierung
4.12. Das Schicksal der Frauen
4.13. Das Schicksal der Waisen
4.14. Beraubung der Opfer
5. Der Völkermord: Bilanz und Aufarbeitung
5.1. Die Zahl der Opfer
5.2. Die Unionistenprozesse
5.3. Racheakte und der „Prozess Talat Pascha”
6. Der Völkermord: Begriffsanwendung, Anerkennung und Verleugnung
6.1. Der Begriff des Völkermords
6.2. Begriffsanwendung auf die osmanischen Verbrechen
6.3. Internationale Stellungnahmen
6.4. Anerkennungsprozess am Beispiel Deutschlands
6.5. Nichtanerkennung am Beispiel Norwegens
7. Der erbarmungslose Weg zum Frieden
7.1. Der Südkaukasus im Zeichen der Oktoberrevolution
7.2. Der osmanische Südkaukasus-Feldzug 1918
7.3. Das Massaker von Trabzon 1918
7.4. Die kemalistische Machtübernahme 1919-1920
7.5. Die Erste Republik Armenien
7.6. Der Frieden von Sèvres
7.7. Der kemalistische Überfall auf Armenien 1920
7.8. Kilikien 1919-1922
7.9. Die kemalistische Verfolgung der Griechen
7.10. Der Große Brand von Smyrna
7.11. Der Vertrag von Lausanne
8. Armenien unter sowjetischer Herrschaft
8.1. Die sowjetische Machtübernahme
8.2. Nachitschewan und Arzach
8.3. Kulturelle, soziale, wirtschaftliche und politische Entwicklung
8.4.
Perestrojka
in Armenien
9. Nationalismus und Minderheitenpolitik in der Türkei seit 1923
9.1. Geschichtliche Zusammenfassung
9.2. Kemalismus und Nationalismus
9.3. Ausschreitungen gegen Nicht-Türken
9.4. Geschichtsverfälschung
9.5. Diskriminierung und Repressalien ab 1975
9.6. Zerstörung von Kulturdenkmälern
9.7. Die Ablösung der Kemalisten
9.8. Aussicht
10. Armenische Diaspora
10.1. Die historische Diaspora
10.2. Die neuzeitliche Diaspora
10.3. Armenier im Iran
10.4. Besonderheiten der Diaspora-Armenier
TEIL II: DIE REPUBLIK ARMENIEN UND DER KARA-BACHKONFLIKT
11. Die Republik Armenien seit 1991
11.1. Geografie und Geologie
11.2. Bevölkerung und Demografie
11.3. Wirtschaft und Industrie
11.4. Unabhängigkeit und Kriegsjahre
11.5. Innenpolitische Entwicklung
11.6. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
11.7. Außenpolitische Verhältnisse
12. Die Republik Arzach seit 1991
12.1. Geografie und Geologie
12.2. Bevölkerung und Demografie
12.3. Die Unabhängigkeit Bergkarabachs
12.4. Die
Minsker Gruppe
und die Karabach-Resolutionen
12.5. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung
12.6. Staat und Regierung
13. Hintergründe des Karabachkonflikts und völkerrechtliche Situation
13.1. Geschichtliche Bevölkerungsentwicklung
13.2. Stalins Gebietszuordnungen
13.3. Der bedrohliche Hintergrund
13.4. Völkerrechtliche Beurteilung
14. Von
Miazum
(1988) zum Ersten Karabachkrieg (1991-1994)
14.1. Das
Karabach-Komitee
und die
Miazum-
Bewegung
14.2. Das Sumgait-Massaker (27.-29. Februar 1988)
14.3. Panzer in Jerewan
14.4. Das Kirowabad-Massaker (21.-27. November 1988)
14.5. Das Spitak-Erdbeben (7. Dezember 1988)
14.6. Das Baku-Massaker (13.-19. Januar 1990)
14.7. Die Operation Ring
14.8. Unabhängigkeit und Kriegsbeginn
14.9. Chodschali (26. Februar) und Maragha (10. April 1992)
14.10. Kriegsverlauf
15. Grenzgefechte (seit 1994) und Zweiter Karabachkrieg (2020)
15.1. Grenzgefechte seit 1994
15.2. Der Viertagekrieg (April 2016)
15.3. Gefechte an der armenischen Grenze (Juli 2020)
15.4. Der Zweite Karabachkrieg (September-November 2020)
15.5. Das Waffenstillstandsabkommen vom 10. November 2020
16. Das Ende der Republik Arzach (2021-2023)
16.1. Das Erbe des Krieges
16.2. Angriffe auf die Republik Armenien (ab Mai 2021)
16.3. Internationale Verhandlungen, Aktionen und Reaktionen
16.4. Die Blockade von Arzach (Dez. 2022 – Sept. 2023)
16.5. Der Exodus
16.6. Nach dem Exodus
17. Methoden der Eliminierung armenischer Geschichte und Gegenwart
17.1. Militärisch Fakten schaffen
17.2. Kriegsverbrechen
17.3. Kriegsgefangene
17.4. Armenophobie
17.5. Geschichtsverfälschung und kulturelle Aneignung
17.6. Eliminierung und „Albanisierung” von Kulturdenkmälern
17.7. Lobbyismus, Bestechungen und Verleumdungen
18. Änderung der Machtverhältnisse im Südkaukasus
18.1. Die Turanisierung des armenischen Siedlungsraumes
18.2. Postsowjetische Entfremdung: Das armenisch-russische Verhältnis
18.3. Armenien und der Iran
18.4. Neue Allianzen und neues Dilemma
18.5. Westliche Doppelmoral
Post Scriptum:
Neue Aspekte der Friedensverhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan
NACHWORT
BIBLIOGRAPHIE
QUELLENVERZEICHNIS
Kartenübersicht
Karte 01: Urartu, 900-700 v.u.Z
.
Karte 02: Armenien/Kleinasien, ca. 300 v.u.Z
.
Karte 03: Armenien/Kleinasien, 66-95 v.u.Z
.
Karte 04: Armenien/Kleinasien, nach 64 u.Z
.
Karte 05: Armenien/Kleinasien, nach 395
Karte 06: Armenien/Kleinasien, um 700
Karte 07: Armenische Königreiche, um 950
Karte 08: Armenien/Kleinasien, ca. 1140
Karte 09: Armenien/Kleinasien, nach 1261
Karte 10: Armenisches Königreich Kilikien, 13. Jh
.
Karte 11: Armenien/Kleinasien, 1300-1700
Karte 12: Ost- und Westarmenien, ca. 1700
Karte 13: Russische Übernahme, 1828-1878
Karte 14: Die Massaker unter Abdülhamit II, 1894-96
Karte 15: Kleinasien und Kaukasus, 1914
Karte 16: Der osmanische Genozid an den Armeniern 1915-1922
Karte 17: Grenzverläufe, 1917-1919
Karte 18: Vertrag von Sèvres, 10.8.1920
Karte 19: Grenzverläufe, 1920-1921
Karte 20: Französisch-Kilikien, 1919-1922
Karte 21: Kleinasien und Kaukasus, 1923-91
Karte 22: Post-sowjetische Staaten, Südkaukasus, 1991
Karte 23: Bevölkerung Transkaukasiens, 1880
Karte 24: 1. Karabachkrieg, 1988-1994
Karte 25: 2. Karabachkrieg, 2020
Karte 26: Bergkarabach/Arzach – Orts- und Bezirksnamen
ÜBER DIESES BUCH
Dieses Buch beinhaltet eine Übersicht der Geschichte des armenischen Siedlungsraums im Südkaukasus und in Kleinasien bis zu den aktuellsten Geschehnissen. Teil 1 enthält einen komprimierten Abriss der Frühgeschichte bis zur Neuzeit, mit einer genaueren Darstellung der Ereignisse ab dem 19. Jahrhundert bis zur Spätphase der Sowjetunion Ende der 1980er Jahre. Der Zeitraum schließt den Ersten Weltkrieg ein, in dessen Verlauf die Armenier und andere orientalische Christen Opfer eines umfassenden Völkermords wurden. Teil 2 des Buches behandelt im Detail die Zeit seit der Auflösung der Sowjetunion bis Ende 2023.
Neben der ausführlichen Beschreibung der geschichtlichen und aktuellen Ereignisse sind zentrale Themen:
die Dokumentation des Völkermordes im Osmanischen Reich,
die Erörterung völkerrechtlicher Fragen in Bezug auf die Unabhängigkeit Arzachs/Bergkarabachs,
die Widerlegung der aserbaidschanischen Behauptungen über die Bevölkerungsentwicklung im Südkaukasus,
das Aufzeigen turanistischer Bestrebungen und angewandter Methoden zur systematischen Eliminierung armenischer Siedlungsgebiete.
Da das Buch sowohl in Deutschland, als auch Norwegen erscheint, wurden für die Behandlung aktueller Themen vorwiegend mediale Beispiele aus diesen beiden Ländern herangezogen.
Ein wesentlicher Teil der historischen Kapitel 1, 2 und 3 sowie Teile der Kapitel 5(2-3), 8, 11(4-7) und 12(3-6) sind aus dem Buch „Annäherung an Armenien“ (Hofmann 2006) zusammengefasst. Für das vorliegende Buch hat Tessa Hofmann diese Informationen bearbeitet, erweitert und aktualisiert.
ÜBER DIE AUTOREN
Winfried Dallmann (Tromsø) promovierte 1987 an der Universität Oslo in Geologie und war bis zu seinem Ruhestand hauptberuflich mit geologischer Kartierung, Forschung und Lehre in Norwegen beschäftigt. Nebenbei befasste er sich seit seiner Jugend mit den Problemen ethnischer Minderheiten und indigener Völker, beginnend mit einer Reise in die östliche Türkei im Jahre 1976, wo er nach den Spuren des osmanischen Völkermordes an den Armeniern von 1915-1922 suchte und sich ein Bild vom derzeitigen Schicksal der Armenier in der Türkei machte. Später verbrachte er viel Zeit mit Untersuchungen und Berichterstattungen über indigene Völker der Arktis, insbesondere nach der Selbstauflösung der Sowjetunion den in Russland ansässigen Indigenen. Die Ereignisse der letzten Jahre in Armenien und Arzach (Bergkarabach) ließen in ihm den Wunsch aufkommen, die in Norwegen unzureichend vermittelten Hintergründe des Konflikts zusammenfassend und aktualisiert in einem Buch darzustellen. In enger Zusammenarbeit mit Tessa Hofmann konnte dies realisiert werden.
Tessa Hofmann (Berlin) hat in Slawistik und Soziologie promoviert und arbeitete anschließend 33 Jahre als wissenschaftliche Dokumentatorin und Forschungsassistentin am Osteuropa-Institut der Freien Universität. Sie ist außerdem seit 1979 als wissenschaftliche Autorin tätig und hat zahlreiche Bücher, Buchbeiträge und Artikel zur Geschichte und Gegenwartssituation Armeniens und seiner Diaspora publiziert. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der Genozidforschung liegt auf dem osmanischen Genozid; als einer der ersten Wissenschaftlerinnen hat sie darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht nur um ein Verbrechen an Armenierinnen und Armeniern handelt, sondern immer wieder auf die griechisch-orthodoxen sowie syrischen bzw. aramäischen, assyrischen und chaldäischen Mitopfer hingewiesen. Sie ist Mitherausgeberin und -autorin des ersten wissenschaftlichen Sammelbandes in englischer Sprache zum Genozid an den Griechen. Ferner ist sie wissenschaftliche Redakteurin der Webseite „Virtual Genocide Memorial”, die den Genozid an allen hier genannten Opfergruppen dokumentiert.
Seit 1979 ist Hofmann ehrenamtlich als Menschenrechtlerin für Minderheiten im Nahen Osten, insbesondere in der Türkei, sowie im Südkaukasus aktiv. Sie ist Ehrenmitglied der Gesellschaft für bedrohte Völker und Mitgründerin sowie Vorsitzende der Menschenrechtsorganisationen Arbeitsgruppe Anerkennung – Gegen Genozid, für Völkerverständigung sowie Vorstandssprecherin der Fördergemeinschaft für eine Ökumenische Gedenkstätte für Genozidopfer im Osmanischen Reich (FÖGG). Ihr publizistisches, wissenschaftliches und menschenrechtliches Engagement wurde mit zahlreichen Ehrungen und Preisen ausgezeichnet. So erhielt sie unter anderem 2013 den Preis des Präsidenten der Republik Armenien und stiftete das Preisgeld der FÖGG. 2015 verlieh ihr die Staatsuniversität Jerewan den Ehrentitel einer Professorin.
Die Regeln sind ganz einfach:
Sie belügen uns,
wir wissen, dass sie lügen,
sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen,
aber trotzdem lügen sie weiter,
und wir tun weiter so, als würden wir ihnen glauben.
Aus „Goodbye Leningrad“ von Elena Gorokhova
VORWORT
Aktuelle Anlässe
Der völkerrechtswidrige Angriff Aserbaidschans auf die De-Facto-Republik Arzach – seit der Sowjetzeit als Bergkarabach bekannt – im Herbst 2020 und 2023 sowie die seit 2016 immer wieder auch gegen die Republik Armenien gerichteten Angriffe Aserbaidschans haben diesen seit über hundert Jahren gärenden Konflikt erneut aktualisiert und Ende September 2023 durch die Vertreibung von über 100.000 Einwohnern aus Arzach vorerst in dramatischer Weise beendet. Das wirft Fragen nach den Ursachen, dem Verlauf und vor allem nach eventuellen Auswegen auf. Die politische Bewertung der Geschehnisse sowie die mediale Berichterstattung sind leider keinesfalls objektiv oder ausgewogen.
Im Schatten des Ukraine- und mehr noch des Gaza-Kriegs hört man wenig über zeitgleiche Völkerrechtsverstöße im Südkaukasus, geschweige denn über die Hintergründe des Karabachkonflikts. Will man sich dazu eine Meinung bilden, muss man aktiv Nachforschungen betreiben. Man kann dabei vieles im Internet finden, Wahres, Unwahres und propagandistisch Gefärbtes.
Seit August 2022 warnen wissenschaftliche Einrichtungen wie das Lemkin Institute for Genocide Prevention sowie die International Association of Genocide Scholars (IAGS) vor der „erheblichen Genozidgefahr”, die Armeniern im Südkaukasus droht. Das Lemkin Institute hat seither mehrmals einen „Red Flag Alert” veröffentlicht (Lemkin Institute 2022). In seiner Stellungnahme vom 24. Oktober 2022 rief der Vorstand der IAGS, der weltweit größten Berufsvereinigung von Genozidwissenschaftlern, die internationale Gemeinschaft auf, „das autoritäre Regime des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew für das Verbrechen der Aggression (Verbrechen gegen den Frieden) zur Rechenschaft zu ziehen, für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit, die seit September 2020 gegen Armenien und Armenier begangen werden.”(IAGS 2022) Luis Moreno Ocampo, 2003-2012 erster Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, stufte im August sowie Dezember 2023 die Maßnahmen Aserbaidschans gegen die Republik Arzach als Genozid ein.
Auch davon hört man in den etablierten Medien im Westen wenig – zum einen sicherlich, weil der Ukraine- und Gaza-Krieg die Berichterstattung beherrschen, und zum anderen vermutlich, weil Armenien aus Sicht westlicher Kommentatoren auf der falschen Seite steht: Es ist Mitglied des post-sowjetischen Verteidigungsbündnisses Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) und unterhält positive Beziehungen zum Iran – bislang eine Notwendigkeit, um sich gegen die immer wiederkehrende Feindseligkeit seiner türkischen Nachbarstaaten (Türkei und Aserbaidschan) behaupten zu können. Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnet die Beziehungen seines Landes sowohl zu Armenien als auch Aserbaidschan jeweils als „strategische Partnerschaft”.
Allerdings geriet diese geopolitische Konstellation spätestens nach dem Zweiten Karabachkrieg (Herbst 2020) ins Wanken. Russland, militärischer Hauptgarant der OVKS, verschwendet seine Kräfte in der Ukraine und kam seinen Verpflichtungen als Garantiemacht in Armenien und Bergkarabach immer weniger nach (Frankfurter Allgemeine 2022).
Hintergründe
Die Kriege um Arzach und Angriffe auf das Territorium der heutigen Republik Armenien besitzen historische Hintergründe, die bis zur Invasion der Turkvölker in die Kaukasusgebiete und nach Kleinasien im 11. Jahrhundert zurückreichen. Dort bestand bereits seit Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends ein armenischer Siedlungsraum. Das nordöstliche Kleinasien mit der halbmythischen Region Hajassa wurde zum Schauplatz der Ethnogenese der Armenier, die ihre Heimat bis heute Hajastan und ihren mythischen Vorfahren Hajk nennen. Im Altarmenischen bezeichnete Hajk zugleich den Plural des Ethnonyms „haj” (Armenier).
Der armenische Siedlungsraum war seit der Antike zwischen rivalisierenden Großmächten im Osten und Westen umkämpft: Römer und ihre Nachfolger – Byzantiner sowie Osmanen – im Westen, im Osten die Großreiche iranischer Völker (Parther und Perser) sowie ab dem 19. Jahrhundert Russland wetteiferten und kämpften bis zur Entvölkerung der Region um das verkehrsgünstig gelegene zentrale Hochland. Im Mittelalter wurde Armenien für drei Jahrhunderte vom islamischen Kalifenreich und später für wenige Jahrzehnte von den Mongolen vereinnahmt, mit denen sich armenische Herrscher gegen die Muslime verbündeten. Die Einbeziehung der nordöstlichen Teile des armenischen Siedlungsraums in das Russische Reich seit dem frühen 19. Jahrhundert und seit Ende 1920 in den sowjetischen Machtbereich bilden entscheidende Wendepunkte in der neueren Regionalgeschichte.
Aber die Ausbreitung des türkisch-muslimischen Kulturkreises in christliche Siedlungsgebiete (Armenier, griechisch-orthodoxe, syro-aramäische1 Regionen) und ihre von den osmanischen Sultanen geförderte Besiedlung durch Kurden und andere muslimische Immigranten besaß die weitaus größte Auswirkung auf das Konfliktniveau. (Nansen 1928; Brentjes 1973)
Das einschneidendste Kapitel in der neuarmenischen Geschichte war der Völkermord im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs. Obwohl dieser von vielen – zumeist im Ergebnis türkischen Drucks oder schlicht aus Unkenntnis – nicht als solcher anerkannt bzw. verurteilt wurde2, bewirkte er, dass große Gebiete Kleinasiens, Nordmesopotamiens und des Armenischen Hochlands ihre indigene christliche Bevölkerung dauerhaft verloren.
Doch damit nicht genug. Armenier wurden in neuerer Zeit nicht nur einmal Opfer genozidaler Verbrechen. Zur Sowjetzeit, während der „Großen Säuberung” (1936-39), kam es ein weiteres Mal, wie schon 1915, zu einem Elitizid, also zur gezielten Vernichtung der geistigen und geistlichen armenischen Führungsschicht. Gegenwärtig betreibt das postsowjetische Nachbarland Aserbaidschan mit Unterstützung seines türkischen „Brudervolks” die genozidale Entvölkerung der letzten verbliebenen Reste des einst 300.000 km2 umfassenden Armenischen Hochlands.
Diese Bestrebungen in der Türkei und Aserbaidschan entspringen unter anderem dem Motiv, im Geiste des Pan-Turanismus (Pan-Türkismus) alle türkischen Mehrheitsgebiete zwischen Kleinasien und Mittelasien zu vereinen. Die nicht-türkische Brücke vom Südkaukasus über Georgien und Armenien zum Iran hin steht diesen Zielen physisch im Weg.
„Fake News” und falsche Ausgewogenheit
Information fließt heute wie nie zuvor massenhaft durch den Äther und die Fiberkabel und wird von 4G- und 5G-Antennen, Wifi-Modems, sowohl wie Fernsehsendern unseren Empfangsgeräten zur Verfügung gestellt. Aber längst nicht alle Informationen entsprechen der Wahrheit. Abgesehen von unterschiedlichen, oft kontroversen Deutungen realer Tatsachen gibt es auch bewusste und unbewusste Absichten, die Wahrheit zu modifizieren oder Lügen zu verbreiten.
Alle haben wir von „Fake News” bzw. Falschnachrichten gehört und wissen, dass solche vielseitig verbreitet werden, um wirtschaftliche oder politische Ziele durchzusetzen, Verbündete für zweifelhafte Aktionen zu finden oder eigene Handlungen, die einer Überprüfung nicht standhalten, zu rechtfertigen.
Oft sind wir unsicher, ob die verbreiteten Informationen stimmen. In erster Linie gilt das für Themen, mit denen wir uns wenig oder gar nicht befasst haben. Dann glauben wir am ehesten alles, was in unsere eigene Weltanschauung passt, und tun abweichende Behauptungen als „Fake News” ab. Anschauliche Beispiele dafür gibt es derzeit im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, zu dem man im Westen gerne alles glaubt, was Russland die alleinige Schuld zuschiebt, während wir Informationen aus Russland grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen. Es gibt gute Gründe dafür, muss aber nicht unbedingt richtig sein, wenn es um Einzelheiten geht.
Das gleiche gilt auch für die journalistische Berichterstattung und Kommentierung, die von den politischen Neigungen des jeweiligen Gesellschaftssystems abhängig sind, aber auch von den persönlichen Überzeugungen der Berichterstatter oder Kommentatoren. Eine vollkommen „neutrale” oder „objektive” Berichterstattung ist zudem eine Fiktion. Wir alle betrachten diese Welt durch die Brille unserer eigenen Erfahrungen, Prägungen und Überzeugungen. Die Frage ist, ob wir uns dieser Subjektivität bewusst sind und wie wir mit abweichenden Ansichten umgehen.
In demokratischen Staaten, in denen freie Meinungsäußerung de jure und de facto geschützt wird, ist die Journalistik zudem vielseitiger als in Autokratien oder gar Diktaturen mit staatskontrollierten Medien und harten Strafen für Äußerungen, die als staatsfeindlich gelten. Will man also wissen, aus welchem Lager die meisten „Fake News” zu erwarten sind, so kann man sich die Indexe für Demokratie und Pressefreiheit der entsprechenden Staaten anschauen und bekommt zumindest eine grobe Vorstellung von der jeweiligen Meinungs- und Pressefreiheit.
Dennoch lässt sich selbst in Demokratien gerade in Krisenzeiten ein wachsender medialer Konformitätsdruck beobachten. Diese subtileren Formen eingeschränkter Meinungs- und Medienfreiheit sind möglicherweise sogar die wirksameren. Es ist in Demokratien zwar schwieriger, direkte Lügen zu verbreiten, weil diese schneller und straffrei entlarvt werden können. Daher wird zu anderen Mitteln gegriffen, wenn man die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung lenken will. Entweder, man lässt bekannte Informationen fort – willentlich oder weil man sie auf Grund der eigenen Wertvorstellung für „Fake News” hält – oder aber man greift zu sogenannter „falscher Ausgewogenheit”.
Falsche Ausgewogenheit, im Englischen als „false balance” oder „bothsidesism” bezeichnet, ist eine Tendenz, kontroverse politische Themen oder Debatten so zu behandeln, als ob die gegnerischen Seiten gleich starke Argumente vorbringen, gleichermaßen Gültigkeit besitzen, obwohl das von keinerlei Beweisen unterstützt wird. Das kann dann, gewollt oder ungewollt, zu verzerrten Meinungsbildern führen – und damit zu fehlender Unterstützung von Opfern, fehlender Verurteilung von Schuldigen und letztendlich zu politischen Vorteilen für Aggressoren.
Im Einzelfall lässt sich schwer beurteilen, ob solche Konsequenzen im Sinne des Nachrichtenverbreiters lagen, oder ob falsche Ausgewogenheit in der Nachrichtenvermittlung auf Unwissenheit oder Unsicherheit beruht. Im Großen und Ganzen spiegelt sie aber die allgemeine politische Situation einer Gesellschaft wider. Damit bewegt man sich auf eine geopolitisch motivierte Doppelmoral zu.
Doppelmoral und Geopolitik
Schaut man sich die Berichterstattung in den westlichen Demokratien über den Ukraine-Krieg an, so sind die Sympathien vollständig auf der ukrainischen Seite, während Russland als Aggressor verurteilt wird. Russische Argumente werden von vornherein als Narrative abgetan. Debattanten, die die Situation politisch analysieren wollen, werden als „Putin-Versteher” in den Hintergrund geschoben und als unglaubwürdig abgestempelt. So äußerte die Leiterin des norwegischen Auslands- und Verteidigungskomitees nach Russlands Invasion in der Ukraine im Fernsehen: „Jetzt ist nicht die Zeit zu verstehen, sondern zu verurteilen.”(Høyre 2022)
Ganz anders beim Zweiten Karabachkrieg im Herbst 2020. Anstatt herausfinden zu wollen, wer hier der offenkundige Aggressor war, hielt man sich in den Nachrichten und von politischer Seite her im Westen an falsche Ausgewogenheit: „Beide Seiten beschuldigen einander, die Feindseligkeiten begonnen zu haben” und „Beide Seiten werden aufgefordert, sich zu besinnen”(NRK 2020). Dabei gab es genügend Fachleute in westeuropäischen Ländern, die genau wussten, was ablief, und die sowohl von Politikern als auch von Nachrichtenvermittlern hätten konsultiert werden können. Es gab auch eine Reihe recht guter Debattenartikel und Chroniken von Privatpersonen in den Zeitungen, die dann aber oft mit aserbaidschanischen Gegendarstellungen „neutralisiert” wurden. Es erfolgten jedoch keine offiziellen Stellungnahmen geschweige denn Schuldzuweisungen. Folglich blieben Leser, die sich auf die Schnelle ein Bild machen wollten, im Unklaren.
Man hätte sich den Demokratie- und Pressefreiheits-Index von Armenien und Aserbaidschan anschauen können, um zu beurteilen, woher die „Fake News” kamen. Nach und nach beschuldigten dann einige wenige Staaten, wie z.B. Frankreich (wo etwa eine halbe Million Armenier lebt), offiziell Aserbaidschan der Aggression (Armenpress 2020). Zwei Jahre später gab der aserbaidschanische Präsident Alijew endlich zu, den Krieg begonnen zu haben (OC Media 2022a), wahrscheinlich in der Annahme, dass es inzwischen sowieso jeder wüsste oder es keine Rolle mehr spielte. Das hielt ihn dann aber später nicht davon ab, weitere Lügen zu verbreiten, was in den folgenden Kapiteln dokumentiert wird.
Über Russland verhängte der Westen nach der Invasion der Ukraine zahlreiche Sanktionen. Mit Aserbaidschan jedoch schloss die Europäische Union Verträge über Gaslieferungen und kritisierte dessen aggressive Haltung gegenüber allem Armenischen mit keinem Wort (Focus online 2022). Zwar erhoben sich auch im Europa-Parlament Einzelstimmen, die Aserbaidschans Aggression verurteilten und mit der russischen gleichsetzten (RedaktionsNetzwerk Deutschland 2022), aber diese wurden geflissentlich überhört.
Eine andere Variante der Doppelmoral ist die situationsabhängige, uneinheitliche Auslegung des Völkerrechts. Während des Zweiten Karabachkrieges wiederholten westliche Politiker und Medien gebetsmühlenartig den Satz „Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan”. Diese Behauptung hält bis heute an. Damit bewertet man die willkürliche Gebietseinteilung Stalins unter dem Druck der Türkei höher als das Selbstbestimmungsrecht der indigenen Bevölkerung und die drohende Gefahr, die armenische Bevölkerungsmehrheit erneuten Gräueltaten auszusetzen.
Ganz anders verfuhren westliche Staaten mit dem Kosovo. Das Selbstbestimmungsrecht der albanischen Bevölkerungsmehrheit wurde angesichts von Massenvertreibungen und drohenden Gräueltaten als Anlass genommen, Kosovo 2008 aus dem serbischen Staatsverband zu lösen – vorangetrieben von denselben westlichen Regierungen und Organisationen, die Arzach das gleiche Recht verweigern – und dies angesichts mehrerer Genozid-Warnungen durch kompetente Organisationen.
Die Anwendung des Völkerrechts ist also keineswegs so einheitlich und universell, wie man immer wieder zu hören bekommt. Es sind die Machtverhältnisse zwischen den Staaten und ihre geopolitischen Interessen, die seine jeweilige Deutung und Anwendung bestimmen.
Wäre Armenien nicht zufällig im russischen, sondern im westlichen Einflussbereich gelegen und hätte es westliche Verbündete bzw. Schutzmächte gehabt, würde man das Völkerrecht vermutlich, ähnlich wie bei Kosovo, im Sinne Armeniens auslegen.
Die Armenier sind seit drei Jahrtausenden eine Bauernfigur im Machtspiel ihrer militärisch überlegenen Nachbarn. Durch Invasion, Fremdherrschaft, Kriege und Völkermord wurden ihnen von den mächtigeren Nachbarstaaten große Teile ihres ursprünglichen Lebensraums geraubt. Wenn sie sich zu wehren versuchten, wurden sie jedes Mal dafür bestraft. Gegenwärtig versteckt man sich hinter einer einseitigen Auslegung des Völkerrechts, verbunden mit geopolitischen Eigeninteressen, um den Rest des armenischen Siedlungsgebiets zu liquidieren.
Winfried Dallmann und Tessa Hofmann
Tromsø/Berlin, 2024
1 Syro-aramäische Christen bezeichnen sich je nach Konfession und politischer Überzeugung in Fremdsprachen als Aramäer, Chaldäer, Assyrer. Der Namensstreit entzweit sie seit Jahrzehnten. „Syro-Aramäer” oder im Englischen „syriacs”, im Aramäischen „suryoye”, ist ein halbwegs neutraler Versuch eines Oberbegriffs. Die meisten Syro-Aramäer in Deutschland bzw. Mitteleuropa lehnen die Bezeichnung „Assyrer” vehement ab, unter anderem, weil sie historisch unzutreffend ist. In Schweden allerdings hat sich die assyrische Fraktion durchgesetzt.
2 Seit 1965 haben 32 nationale Gesetzgeber die Vernichtung der Armenier durch den osmanischen Staat in Resolutionen, Beschlüssen oder Gesetzen – oftmals mehrfach – als Genozid entsprechend der UN-Völkermordkonvention von 1948 bewertet; vgl. „Was bedeutet ‚Anerkennung‘ von Völkermord?” (AGA 2023)
TEIL I: Armenische Geschichte
Die Armenier blicken auf eine über dreitausendjährige Geschichte zurück. Sie waren „so oft Zeugen des Aufstiegs und Verfalls von Reichen, ja ganzen Völkern, dass sie dem Machtanspruch gegenwärtiger Herrscher gelassen begegnen, wissend, dass auch deren Tage gezählt sind und die Geschichte das Wort ‚ewig‘ nicht kennt. […] Zum Gradmesser für die Beurteilung wurde das Überleben, allerdings nicht um jeden Preis, zumindest nicht um den der Erniedrigung. Bis in die Gegenwart hinein haben sich Armenier allzu großem Druck und allzu starker Unterdrückung stets widersetzt. Darum ist armenische Geschichtsschreibung weniger eine Aufzählung von glänzenden Siegen als eine Chronik des Widerstands und des Opfermuts.”(Hofmann 1993, 16)