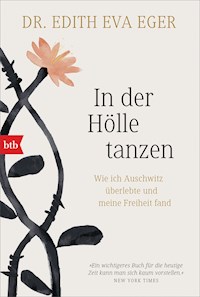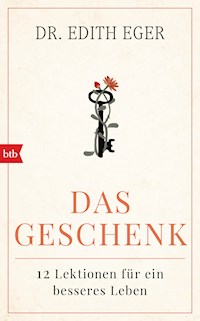
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir alle sind mit Leid konfrontiert: Trauer, Verlust, Angst, Versagen, Einsamkeit. Aber wir haben es selbst in der Hand, ob wir angesichts von Trauma und Problemen den Mut verlieren oder versuchen, jeden Moment als ein Geschenk des Lebens zu verstehen.
Dr. Edith Eger, Holocaust-Überlebende, erfolgreiche Therapeutin und gefeierte internationale Bestsellerautorin, gibt uns mit ihrem neuen Buch DAS GESCHENK einen Leitfaden in die Hand, wie wir das Gefängnis unserer Gedanken und unser destruktives Verhalten überwinden können. In 12 Kapiteln zeigt sie uns anhand ihrer Lebensgeschichte, anhand von Beispielen aus ihrer therapeutischen Praxis und ganz konkret, wie wir lernen können, aus unseren dunkelsten und schwierigsten Momenten gestärkt hervorzugehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Wir alle sind mit Leid konfrontiert: Trauer, Verlust, Angst, Versagen, Einsamkeit. Aber wir haben es selbst in der Hand, ob wir angesichts von Trauma und Problemen den Mut verlieren oder versuchen, jeden Moment als ein Geschenk des Lebens zu verstehen.
Dr. Edith Eva Eger, Holocaust-Überlebende, erfolgreiche Therapeutin und gefeierte internationale Bestsellerautorin, gibt uns mit ihrem neuen Buch DAS GESCHENK einen Leitfaden in die Hand, wie wir das Gefängnis unserer Gedanken und unser destruktives Verhalten überwinden können. In 14 Kapiteln – die Taschenbuchausgabe wurde um zwei von der der Autorin neu geschriebene Kapitel und wunderbare Familien-Rezepte ergänzt –, zeigt sie uns anhand ihrer Lebensgeschichte, anhand von Beispielen aus ihrer therapeutischen Praxis und ganz konkret, wie wir lernen können, aus unseren dunkelsten und schwierigsten Momenten gestärkt hervorzugehen.
Autorin
DR. EDITH EVA EGER ist Psychologin und Therapeutin mit einer Praxis in La Jolla, Kalifornien. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf posttraumatischen Belastungsstörungen. Eger unterrichtet an der University of California, San Diego und ist national und international eine gefragte Rednerin. Sie ist Mutter, Großmutter und Urgroßmutter und lebt in La Jolla.
Dr. Edith Eva Eger
mit Esmé Schwall Weigand
Das Geschenk
14 Lektionen für ein besseres Leben
Aus dem Englischen von Liselotte Prugger
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »The Gift« bei Scribner, An Imprint Simon & Schuster, Inc., New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Genehmigte Lizenzausgabe August 2023
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
© 2020, 2022 by Dr. Edith Eva Eger
© der deutschsprachigen Ausgabe 2021,2023 by btb Verlag
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © iStock/blackred; © Shutterstock/Mona Monash; © Illustration von Two Associates
MK ∙ Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-26277-8V003
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für meine Patienten. Sie sind meine Lehrer. Sie gaben mir den Mut, nach Auschwitz zurückzukehren und meine Reise in Richtung Vergebung und Freiheit zu beginnen. Mit Ihrer Ehrlichkeit und Ihrem Mut inspirieren Sie mich immer wieder aufs Neue.
INHALT
Einführung UNSERE MENTALEN GEFÄNGNISSE AUFSCHLIESSEN
Ich habe gelernt, in einem Todeslager zu leben
Kapitel 1 WAS JETZT?
Das Gefängnis der Opferrolle
Kapitel 2 KEINE ANTIDEPRESSIVA IN AUSCHWITZ
Das Gefängnis des Vermeidens
Kapitel 3 ALLE ANDEREN BEZIEHUNGEN WERDEN ENDEN
Das Gefängnis der Selbstvernachlässigung
Kapitel 4 EIN HINTERN, ZWEI STÜHLE
Das Gefängnis der Geheimnisse
Kapitel 5 NIEMAND WEIST SIE ZURÜCK, AUSSER SIE SELBST
Das Gefängnis von Schuld und Scham
Kapitel 6 WAS NICHT GESCHEHEN IST
Das Gefängnis der unbewältigten Trauer
Kapitel 7 NICHTS ZU BEWEISEN
Das Gefängnis der Starrheit
Kapitel 8 MÖCHTEN SIE MIT SICH VERHEIRATET SEIN?
Das Gefängnis der Ressentiments
Kapitel 9 ENTWICKELN SIE SICH WEITER ODER DREHEN SIE SICH IM KREIS?
Das Gefängnis der lähmenden Angst
Kapitel 10 DER NAZI IN UNS
Das Gefängnis der Wertungen
Kapitel 11 WENN ICH HEUTE ÜBERLEBE, WERDE ICH MORGEN FREI SEIN
Das Gefängnis der Hoffnungslosigkeit
Kapitel 12 OHNE WUT GIBT ES KEINE VERGEBUNG
Das Gefängnis, nicht verzeihen zu können
Kapitel 13 DAS GESCHENK UNSERER ZEIT
Kapitel 14 DAS GESCHENK DES ESSENS
Zum Schluss DAS GESCHENK
Danksagung
Einführung UNSERE MENTALEN GEFÄNGNISSE AUFSCHLIESSEN
Ich habe gelernt, in einem Todeslager zu leben
Im Frühling 1944 war ich sechzehn Jahre alt und lebte mit meinen Eltern und zwei älteren Schwestern in Kassa, Ungarn. Um uns herum gab es überall Spuren von Krieg und Vorurteilen: die gelben Sterne, die wir an unsere Mäntel geheftet trugen. Die nyilas, die ungarischen Nazis, die sich unserer früheren Wohnung bemächtigt hatten. Die Zeitungsberichte über das Frontgeschehen und die deutsche Besatzung, die sich über ganz Europa ausbreitete. Die besorgten Blicke, die meine Eltern am Tisch austauschten. Der schreckliche Tag, an dem ich aus der olympischen Mannschaft der Kunstturner flog, weil ich Jüdin war. Aber meine Gedanken drehten sich vorwiegend um die üblichen Befindlichkeiten im Leben eines Teenagers. Ich war verliebt in Eric, meinen ersten Freund, den hochgewachsenen, intelligenten Jungen, den ich im Buchclub kennengelernt hatte. Immer wieder ließ ich unseren ersten Kuss Revue passieren und war hingerissen von meinem neuen blauen Seidenkleid, das mein Vater für mich geschneidert hatte. Ich registrierte meine Fortschritte im Ballett- und Gymnastikstudio und alberte mit Magda herum, meiner schönen ältesten Schwester, und mit Klara , die in einem Konservatorium in Budapest Geige studierte.
Und dann änderte sich alles.
An einem kalten Morgen im April wurden die Juden von Kassa zusammengetrieben und in einer alten Ziegelei am Stadtrand interniert. Ein paar Wochen später pferchte man Magda, meine Eltern und mich in einen Viehwaggon nach Auschwitz. Meine Eltern wurden am Tag unserer Ankunft in den Gaskammern ermordet.
In meiner ersten Nacht in Auschwitz wurde ich gezwungen, für SS-Obersturmführer Josef Mengele zu tanzen, den Todesengel, den Mann, der die Neuankömmlinge in der Selektionsschlange inspiziert hatte, durch die wir an jenem Tag geschleust worden waren, und der meine Mutter in den Tod schickte. »Tanz für mich!«, befahl er, und starr vor Angst stellte ich mich auf den kalten Betonfußboden der Baracke. Draußen begann das Lagerorchester einen Walzer zu spielen: »An der schönen blauen Donau.« Ich dachte an den Rat meiner Mutter – Niemand kann dir das wegnehmen, was du in deinen Kopf hineingetan hast –, schloss die Augen und zog mich in eine innere Welt zurück. Dort war ich nicht mehr in einem Todeslager eingesperrt, mir war nicht mehr kalt, ich war nicht mehr hungrig und von Verlust zerbrochen. Ich war auf der Bühne der Budapester Oper und tanzte die Rolle der Julia im Ballett von Tschaikowsky. Aus diesem persönlichen Zufluchtsort heraus zwang ich meine Arme, sich zu heben, und meine Beine, herumzuwirbeln. Ich bot meine ganze Kraft dafür auf, um mein Leben zu tanzen.
Jeder Augenblick in Auschwitz war die Hölle auf Erden. Auschwitz war auch meine beste Schule. Verlust, Folter, Hunger und ständiger Todesgefahr ausgesetzt, entdeckte ich die Instrumente, die ich für mein Überleben und für die Freiheit brauchte und die ich auch jetzt noch Tag für Tag in meiner Tätigkeit als klinische Psychologin und in meinem eigenen Leben anwende.
Im Herbst 2019, als ich diese Einführung schreibe, bin ich zweiundneunzig Jahre alt. 1978 erlangte ich meinen Doktorgrad in klinischer Psychologie und behandle nun seit über zweiundvierzig Jahren Patienten in einem therapeutischen Umfeld. Ich habe mit Kriegsveteranen und Missbrauchsopfern gearbeitet, mit Studenten, Kommunalpolitikern und CEOs; mit Menschen, die gegen ihre Drogensucht kämpfen, und anderen, die sich mit Ängsten und Depressionen herumschlagen; mit Paaren, die gegen Ressentiments kämpfen, und anderen, die ihre einstige Nähe und Intimität wiederfinden wollen; mit Eltern und Kindern, die lernen, wie sie zusammenleben, und anderen, die gerade entdecken, wie sie getrennt leben können. Als Psychologin, als Mutter, Großmutter und Urgroßmutter, als Beobachterin meines eigenen Verhaltens und des Verhaltens anderer und als Auschwitz-Überlebende sage ich Ihnen hier und jetzt, dass das schlimmste Gefängnis nicht das ist, in das mich die Nazis geworfen haben. Das schlimmste Gefängnis ist das, welches ich für mich selbst gebaut habe.
Auch wenn Ihr Leben und das meine wahrscheinlich sehr unterschiedlich verlaufen sind, wissen Sie vielleicht, was ich meine. Viele von uns haben das Gefühl, im eigenen Kopf gefangen zu sein. Unsere Gedanken und Überzeugungen bestimmen und begrenzen oft, wie wir uns fühlen, was wir tun und was wir für möglich halten. Auch wenn unsere Überzeugungen, die uns gefangen halten, auf individuelle Weise auftreten und ablaufen, habe ich im Laufe meiner Arbeit entdeckt, dass es doch einige gemeinsame mentale Gefängnisse gibt, die zum Leid beitragen. Dieses Buch ist ein praktischer Leitfaden, der uns helfen soll, unsere mentalen Gefängnisse zu identifizieren und die notwendigen Instrumente zu entwickeln, uns daraus zu befreien.
Das Fundament der Freiheit ist die Fähigkeit, frei zu wählen. In den letzten Kriegsjahren hatte ich sehr wenige Wahlmöglichkeiten und keine Chance zu entkommen. Ungarische Juden waren in Europa unter den letzten, die in Todeslager deportiert wurden, und nach acht Monaten in Auschwitz, kurz bevor die russische Armee Deutschland besiegte, wurden meine Schwester und ich sowie hundert weitere Gefangene aus Auschwitz evakuiert und auf den langen Marsch von Polen über Deutschland nach Österreich gezwungen. Unterwegs verrichteten wir Sklavenarbeit in Fabriken und saßen auf den Dächern von Zügen, die deutsche Munition transportierten. Unsere Körper wurden als Schutzschilde benutzt, um die Ladung vor britischen Bomben zu schützen. (Die Briten bombardierten die Züge trotzdem.)
Als meine Schwester und ich im Mai 1945, knapp über ein Jahr nach unserer Gefangennahme, aus Gunskirchen – einem Konzentrationslager in Österreich – befreit wurden, waren meine Eltern und fast alle Menschen, die ich gekannt hatte, tot. Mein Rücken war von der ständigen körperlichen Misshandlung gebrochen. Ich war am Verhungern, von Wunden übersät und schaffte es kaum, mich von dem Leichenstapel herunterzubewegen, auf dem ich lag; von Menschen, die krank waren, die am Verhungern waren wie ich und deren Körper kapituliert hatten. Was man mir angetan hatte, konnte ich nicht ungeschehen machen. Ich konnte nicht beeinflussen, wie viele Menschen die Nazis in die Viehwaggons oder die Krematorien getrieben hatten, als sie versuchten, so viele Juden und »unerwünschte Elemente« wie möglich auszurotten, bevor der Krieg zu Ende war. Ich konnte die systematische Entmenschlichung und das Abschlachten der über sechs Millionen Unschuldigen, die in den Lagern starben, nicht ändern. Alles, was ich tun konnte, war, mich zu entscheiden, wie ich auf Terror und Hoffnungslosigkeit reagierte. Irgendwie entdeckte ich es in mir selbst, dass ich mich für Hoffnung entschied.
Doch Auschwitz zu überleben war nur die erste Etappe meiner Reise in die Freiheit. Viele Jahrzehnte lang blieb ich eine Gefangene der Vergangenheit. Oberflächlich gesehen ging es mir gut, ich ließ mein Trauma hinter mir und schaute nach vorn. Ich heiratete Béla, den Sohn einer prominenten Familie aus Prešov, der im Krieg Partisan gewesen war und in den Bergwäldern der Slowakei gegen die Nazis gekämpft hatte. Ich wurde Mutter, floh vor den Kommunisten in der Tschechoslowakei, immigrierte nach Amerika, lebte von der Hand in den Mund, überwand die Armut, ging mit über vierzig aufs College, wurde Lehrerin an der Highschool und kehrte dann an die Uni zurück, um meinen Master in pädagogischer Psychologie und einen Doktortitel in klinischer Psychologie zu erlangen. Auch gegen Ende meiner Ausbildung, als ich mich der Aufgabe verschrieb, anderen auf ihrem Weg der Heilung zu helfen, und mir während meiner klinischen Praktika die kniffligsten Fälle anvertraut wurden, spielte ich noch immer Verstecken: Ich lief vor der Vergangenheit davon, verleugnete meine Trauer und mein Trauma, verstellte mich, bagatellisierte, wollte allen gefallen und alles perfekt erledigen, gab Béla die Schuld für meine chronische Verbitterung und Enttäuschung und jagte Erfolgen nach, als könnte ich damit alles wettmachen, was ich verloren hatte.
Eines Tages kam ich im William Beaumont Army Medical Center in Fort Bliss, Texas, an, wo ich ein anspruchsvolles klinisches Praktikum absolvierte, und schlüpfte in meinen weißen Mantel mit dem Namensschild: Dr. Eger, Abteilung für Psychiatrie. Doch einen Sekundenbruchteil lang verschwammen die Wörter, und ich meinte zu lesen: Dr. Eger, Hochstaplerin. Da wusste ich, dass ich andere erst dann bei ihrer Heilung würde unterstützen können, wenn ich mich selbst heilte.
Mein therapeutischer Ansatz ist umfassend und intuitiv, eine Mischung aus kognitiv orientierten Theorien und Techniken und auf Einsicht abzielenden Praktiken. Ich nenne das Auswahltherapie, da es bei Freiheit fundamental um Wahlmöglichkeit geht. Während Leid unausweichlich und universell ist, können wir immer wählen, wie wir reagieren, und ich trachte danach, die Wahlfreiheit meiner Patienten herauszustellen und es ihnen zu ermöglichen, diese zu nutzen, um eine positive Veränderung in ihrem Leben zu bewirken.
Meine Arbeit fußt auf vier psychologischen Kernprinzipien:
Erstens auf Martin Seligman und der positiven Psychologie, dem Konzept der »erlernten Hilflosigkeit«, dass wir am meisten leiden, wenn wir glauben, dass wir in unserem Leben keine Wirksamkeit haben, dass nichts von dem, was wir tun, das Ergebnis verbessern kann. Wir sind erfolgreich, wenn wir uns den »gelernten Optimismus« zunutze machen, die Stärke, die Belastbarkeit und die Fähigkeit, den Sinn und die Richtung unseres Lebens hervorzubringen.
Zweitens auf der kognitiven Verhaltenstherapie und dem Verständnis, dass es unsere Gedanken sind, die unsere Gefühle und unser Verhalten hervorbringen. Um schädliche, dysfunktionale oder selbstzerstörerische Verhaltensweisen zu ändern, verändern wir unsere Gedanken. Wir ersetzen unsere negativen Überzeugungen durch solche, die unserem Wachstum dienen und es unterstützen.
Drittens auf Carl Rogers, einem meiner einflussreichsten Mentoren, und der Bedeutung bedingungsloser positiver Selbstachtung. Ein Großteil unseres Leidens basiert auf unserer Fehleinschätzung, dass wir nicht gleichzeitig geliebt werden und authentisch sein können – dass wir, wenn wir die Anerkennung und Zustimmung anderer gewinnen wollen, unser wahres Selbst verleugnen oder verbergen müssen. In meiner Arbeit strebe ich danach, meinen Patienten bedingungslose Zuneigung entgegenzubringen und sie entdecken zu lassen, dass wir frei werden, wenn wir unsere Masken ablegen, wenn wir aufhören, die Rollen und Erwartungen zu erfüllen, die andere uns auferlegen, und wenn wir beginnen, uns selbst bedingungslos zu lieben.
Und schließlich arbeite ich, ausgehend von dem Verständnis, das ich mit meinem hochverehrten Mentor, Freund und Mitüberlebenden von Auschwitz Viktor Frankl teile, daran, dass unsere schlimmsten Erfahrungen unsere besten Lehrer sein können, die unvorhergesehene Entdeckungen katalysieren und uns neue Möglichkeiten und Perspektiven eröffnen. Heilung, Erfüllung und Freiheit ergeben sich aus unserer Fähigkeit, allem, was wir erfahren – insbesondere unserem Leiden –, einen Sinn zu geben und daraus einen Zweck abzuleiten.
Freiheit ist eine lebenslange Übung – eine Entscheidung, die wir jeden Tag aufs Neue treffen müssen. Letztendlich braucht Freiheit Hoffnung, die ich auf zwei Arten definiere: das Bewusstsein, dass Leiden, wie schrecklich es auch sein mag, temporär ist, und dann die Neugier herauszufinden, was als Nächstes geschieht. Hoffnung gibt uns die Möglichkeit, in der Gegenwart zu leben statt in der Vergangenheit und die Türen unseres mentalen Gefängnisses aufzuschließen.
Ein Dreivierteljahrhundert nach der Befreiung habe ich noch immer Albträume. Ich leide unter Flashbacks. Bis zum Tag, an dem ich sterbe, werde ich den Verlust meiner Eltern betrauern, die nicht die Möglichkeit hatten, vier Generationen aus der Asche ihres Todes aufsteigen zu sehen. Das Grauen ist immer noch bei mir. Es gibt keine Freiheit, die das Geschehene bagatellisieren oder vergessen kann.
Doch Erinnern und Ehren sind etwas ganz anderes, als in Schuldgefühlen, Scham, Wut, Verbitterung oder Furcht über die Vergangenheit stecken zu bleiben. Ich kann mich der Realität des Geschehenen stellen und mich darauf besinnen, dass ich, obwohl ich Verluste erlitten habe, nie aufgehört habe, Liebe und Hoffnung zu wählen. Das wahre Geschenk, das ich aus meiner Zeit in Auschwitz auch inmitten von so viel Leid und Ohnmacht mitgenommen habe, ist die Fähigkeit, zu wählen.
Es mag sich falsch anhören, irgendetwas, was aus den Todeslagern gekommen ist, als Geschenk zu bezeichnen. Wie konnte aus der Hölle jemals etwas Gutes kommen? Da war die ständige Angst, ich könnte jeden Augenblick aus der Selektionsreihe oder der Baracke geholt und in die Gaskammer geschickt werden, von deren Kaminen der dunkle Rauch als allgegenwärtige Erinnerung all dessen aufstieg, was ich verloren hatte und womöglich noch verlieren könnte. Ich hatte keine Kontrolle über die sinnlosen, quälenden Umstände. Aber ich konnte mich auf das konzentrieren, was ich in meinem Kopf bewahrte. Ich konnte eine Antwort geben, statt zu reagieren. Auschwitz gab mir die Gelegenheit, meine innere Stärke zu entdecken, und die Macht, eine Wahl zu treffen. Ich lernte, auf Dinge in mir zu bauen, von denen ich sonst nicht einmal gewusst hätte, dass es sie gab.
Wir alle haben diese Fähigkeit, zu wählen. Wenn von außen nichts Hilfreiches oder Bereicherndes kommt, ist genau das der Augenblick, in dem wir die Chance haben herauszufinden, wer wir wirklich sind. Am wichtigsten ist nicht das, was uns zustößt, sondern das, was wir mit unseren Erfahrungen machen.
Wenn wir aus unseren mentalen Gefängnissen ausbrechen, befreien wir uns nicht nur von dem, was uns zurückgehalten hat, sondern wir werden auch frei, unseren eigenen freien Willen auszuüben. Zum ersten Mal wurde mir der Unterschied zwischen negativer und positiver Freiheit am Tag der Befreiung in Gunskirchen im Mai 1945 bewusst, als ich siebzehn Jahre alt war. Ich lag auf dem aufgeweichten Boden auf einem Stapel von Toten und Sterbenden, als die Einundsiebzigste Infanterie anrollte und das Lager befreite. Ich erinnere mich an den Schock in den Augen der Soldaten, an die Tücher, die sie sich vors Gesicht gebunden hatten, um den Verwesungsgestank zu lindern. In jenen ersten Stunden der Freiheit beobachtete ich meine ehemaligen Mitgefangenen – diejenigen, die noch laufen konnten –, die durch die Gefängnistore hinausgingen. Augenblicke später kamen sie wieder zurück und setzten sich apathisch ins feuchte Gras oder auf den nackten Fußboden der Baracke. Sie konnten nicht mehr weitergehen. Viktor Frankl beobachtete das gleiche Phänomen, als Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit wurde. Wir waren nicht mehr im Gefängnis, doch viele von uns waren physisch oder mental noch nicht so weit, dass wir unsere Freiheit begreifen konnten. Wir waren von Krankheit, Hunger und Trauma so ausgehöhlt, dass wir nicht in der Lage waren, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Wir konnten uns ja kaum noch daran erinnern, wie es ist, wir selbst zu sein.
Wir waren endlich von den Nazis befreit worden. Aber wir waren noch nicht frei.
Heute weiß ich, dass sich das schädlichste Gefängnis in unserem Kopf befindet und der Schlüssel dazu in unserer Tasche steckt. Egal, wie groß unser Leiden ist oder wie stabil die Gitterstäbe sind: Es ist möglich, sich von allem zu befreien, was uns zurückhält.
Es ist nicht einfach. Aber es lohnt sich so sehr.
In meinem Buch Ich bin hier, und alles ist jetzt erzählte ich die Geschichte meiner Reise von der Gefangenschaft zur Befreiung und weiter zur wahren Freiheit. Ich war verblüfft und tief berührt vom weltweiten Zuspruch und auch von all den Lesern, die mich an ihren Geschichten teilhaben ließen, in denen sie sich ihrer persönlichen Vergangenheit gestellt und alles darangesetzt haben, ihren Kummer zu heilen. Manchmal konnten wir uns persönlich, manchmal über E-Mail, soziale Netzwerke oder Videotelefonate austauschen, und viele der Geschichten, die ich gehört habe, sind in diesem Buch enthalten. (Namen und andere personenbezogene Einzelheiten habe ich verändert, um die Anonymität zu wahren.)
Wie ich schon in meinem Buch Ich bin hier, und alles ist jetzt geschrieben habe, möchte ich nicht, dass man meine Geschichte liest und denkt: »Meine eigene Leidensgeschichte ist doch überhaupt nicht mit der ihren zu vergleichen.« Ich möchte vielmehr, dass man meine Geschichte hört und denkt: »Wenn sie das schafft, dann schaffe ich es auch!« Viele haben mich um eine praktische Anleitung dazu gebeten, wie mir die Heilung in meinem eigenen Leben und im Leben meiner Patienten in meiner klinischen Arbeit gelungen ist. Das Geschenk. 12 Lektionen für ein besseres Leben ist dieses Buch.
WIR VERÄNDERN UNS ERST, WENN WIR BEREIT SIND.
In jedem Kapitel erforsche ich ein alltägliches Gefängnis in unserem Kopf, veranschauliche dessen Auswirkungen und Herausforderungen mit Geschichten aus meinem Leben und aus meiner klinischen Arbeit und beende die Kapitel mit Lösungsansätzen, sogenannten Schlüsseln, um uns aus diesem mentalen Gefängnis zu befreien. Bei einigen dieser Schlüssel handelt es sich um Fragen, die Sie als Erinnerungshilfen oder im Gespräch mit einem guten Freund oder einem Therapeuten nutzen können; andere sind gut umsetzbare Schritte, die Sie jetzt sofort ausführen können, um Ihr Leben und Ihre Beziehungen zu verbessern. Auch wenn die Heilung kein linearer Prozess ist, habe ich die Kapitel absichtlich so angeordnet, dass sie den Bogen meiner eigenen Reise in die Freiheit wiedergeben. Natürlich können die Kapitel auch für sich alleine stehen oder in jeder beliebigen Reihenfolge gelesen werden. Sie sind Ihr eigener Reiseleiter. Ich lade Sie ein, das Buch so zu benutzen, wie es Ihnen am besten dient.
Und zum Start auf Ihrem Weg in die Freiheit stelle ich Ihnen drei erste Wegweiser zur Verfügung.
Wir verändern uns erst, wenn wir bereit sind. Manchmal sind es schwierige Umstände – vielleicht eine Scheidung, ein Unfall, eine Krankheit oder der Tod –, die uns zwingen, uns dem zu stellen, was nicht funktioniert, und etwas anderes zu versuchen.
Manchmal wird unser innerer Schmerz oder unsere unerfüllte Sehnsucht so laut und beharrlich, dass wir keinen Augenblick länger darüber hinwegsehen können. Aber die Bereitschaft dazu kommt nicht von außen, und sie kann nicht überstürzt oder erzwungen werden. Sie sind bereit, wenn Sie bereit sind, wenn sich etwas in Ihnen verlagert und Sie beschließen: Bis jetzt habe ich das gemacht. Nun werde ich etwas anderes tun. Veränderung heißt, die Gewohnheiten und Muster zu durchbrechen, die uns nicht mehr dienlich sind. Wenn Sie Ihr Leben auf sinnvolle Weise verändern wollen, legen Sie nicht einfach nur eine untaugliche Gewohnheit oder Überzeugung ab; Sie tauschen sie vielmehr gegen eine aus, die für Sie zuträglich ist. Sie wählen, welche Richtung Sie einschlagen. Sie finden einen Wegweiser und folgen ihm.
VERÄNDERUNG HEISST, DIE GEWOHNHEITEN UND MUSTER ZU DURCHBRECHEN, DIE UNS NICHT MEHR DIENLICH SIND.
Veränderung heißt, die Gewohnheiten und Muster zu durchbrechen, die uns nicht mehr dienlich sind. Wenn Sie Ihre Reise beginnen, ist es wichtig, nicht nur darüber nachzudenken, wovon Sie sich befreien wollen, sondern auch darüber, weshalb Sie frei sein wollen, um etwas zu tun oder zu werden.
Und schließlich: Wenn Sie Ihr Leben ändern, geht es nicht darum, Ihr neues Selbst zu werden. Es geht darum, Ihr wahres Selbst zu werden – dieser einzigartige Diamant, den es nur einmal gibt und der durch nichts ersetzt werden kann.
WENN SIE IHR LEBEN ÄNDERN, GEHT ES DARUM, IHR WAHRES SELBST ZU WERDEN.
Alles, was Ihnen widerfahren ist – all die Entscheidungen, die Sie bislang getroffen haben, alles, was Sie versucht haben, um damit zurechtzukommen: All das ist wichtig, all das ist nützlich. Sie brauchen nicht alles wegzuwerfen und ganz von vorn anzufangen. Das, was immer Sie gemacht haben, hat Sie dorthin gebracht, wo Sie jetzt in diesem Augenblick sind.
Der ultimative Schlüssel zur Freiheit ist, die Person zu werden, die Sie wirklich sind.
Kapitel 1 WAS JETZT?
Das Gefängnis der Opferrolle
Meiner Erfahrung nach fragen Opfer: »Warum ich?« Kämpfernaturen fragen: »Was jetzt?«
Leiden ist universell. Aber die Opferrolle ist optional. Es gibt keine Möglichkeit, Menschen oder Umständen zu entkommen, die uns verletzen oder unterdrücken. Die einzige Garantie besteht darin, dass wir, egal, wie freundlich wir sind oder wie schwer wir arbeiten, Schmerz empfinden werden. Wir werden von Umwelt- oder genetischen Faktoren beeinflusst werden, über die wir wenig oder gar keine Kontrolle haben. Aber wir alle haben die Wahl, ob wir in der Opferrolle bleiben oder nicht. Wir können nicht auswählen, was uns widerfährt, aber wir können sehr wohl wählen, wie wir mit unserer Erfahrung umgehen.
Viele von uns bleiben in dem Gefängnis der Opferrolle, weil wir es unbewusst für sicherer halten. Wir fragen immer wieder »Warum?« und glauben, dass der Schmerz nachlassen wird, wenn wir nur den Grund dafür finden. Warum habe ich Krebs bekommen? Warum habe ich meinen Job verloren? Warum hatte mein Partner eine Affäre? Wir suchen nach Antworten, wollen verstehen, als gäbe es eine logische Erklärung dafür, warum es so und nicht anders gelaufen ist. Doch wenn wir nach dem Warum fragen, verbeißen wir uns in die Suche nach jemandem oder nach etwas, dem wir die Schuld zuschieben können – einschließlich uns selbst.
Warum ist das ausgerechnet mir zugestoßen?
Nun, warum nicht Ihnen?
Vielleicht bin ich ja nach Auschwitz gekommen und habe überlebt, damit ich jetzt mit Ihnen sprechen und ein lebendes Beispiel einer Kämpfernatur und nicht eines Opfers sein kann. Wenn ich frage: »Was jetzt?« statt »Warum ich?«, konzentriere ich mich nicht mehr darauf, warum diese schlimme Sache passiert ist oder noch passiert, sondern fange an, mich damit zu befassen, was ich mit meiner Erfahrung anstellen kann. Ich suche weder nach einem Heiland noch nach einem Sündenbock. Stattdessen sehe ich mich nach Wahlmöglichkeiten und Chancen um.
Meine Eltern hatten keine Wahl, wie ihr Leben endete. Aber ich habe viele Optionen. Ich kann mich schuldig fühlen, dass ich überlebt habe, während so viele Millionen, auch meine Mutter und mein Vater, umgekommen sind. Oder ich habe die Wahl zu leben, zu arbeiten und Heilung dadurch zu finden, dass ich mich aus dem Griff der Vergangenheit befreie. Ich kann mich über meine Stärke und meine Freiheit freuen.
Ein Opfer zu sein, ist gleichbedeutend mit einer Totenstarre des Geistes. Sich als Opfer zu fühlen bedeutet, sich in der Vergangenheit zu verbeißen, sich im Schmerz zu verbeißen und in den Verlusten und Defiziten dessen, was ich nicht tun kann und was ich nicht habe.
Dies ist mein erstes Instrument, mit dem Sie aus Ihrer Opferrolle herauskommen können: Begegnen Sie allem, was geschieht, mit sanftem Wohlwollen. Das heißt nicht, dass Sie mögen müssen, was geschieht. Aber wenn Sie aufhören zu kämpfen und sich zu wehren, haben Sie mehr Energie und Kreativität zur Verfügung, um herauszufinden: »Was jetzt?« Um sich nach vorn zu orientieren, statt nirgendwohin. Um zu entdecken, was Sie in diesem Augenblick wollen und brauchen und wohin Sie sich von hier aus orientieren wollen.
Jedes Verhalten befriedigt ein Bedürfnis. Viele von uns beschließen, in der Opferrolle zu verharren, denn das gibt uns den Freibrief, überhaupt nichts für uns selbst zu tun. Freiheit hat einen Preis. Wir sind aufgerufen, Rechenschaft für unser Verhalten abzulegen und Verantwortung sogar für Situationen zu übernehmen, die wir weder verursacht noch selbst gewählt haben.
Das Leben ist voller Überraschungen.
Ein paar Wochen vor Weihnachten setzte sich Emily, fünfundvierzig, Mutter zweier Kinder, seit elf Jahren glücklich verheiratet, mit ihrem Mann zusammen, nachdem die Kinder im Bett waren. Sie wollte gerade vorschlagen, noch einen Film anzugucken, als er sie ansah und ruhig die Worte sprach, die ihr Leben auf den Kopf stellen sollten.
»Ich habe jemanden kennengelernt«, sagte er. »Wir lieben uns. Ich glaube nicht, dass wir beide unsere Ehe weiterführen sollten.«
Emily war am Boden zerstört. Sie wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Dann kam der nächste Schock. Sie hatte Brustkrebs, einen großen Tumor, der augenblicklich eine aggressive Chemotherapie notwendig machte. In den ersten Wochen der Behandlung war sie wie gelähmt. Ihr Mann vertagte die Auseinandersetzungen über den Zustand ihrer Ehe und stand ihr während ihrer monatelangen Chemotherapie zur Seite, doch Emily lebte wie im Nebel.
»Ich glaubte, dass mein ganzes Leben vorüber wäre«, sagte sie. »Ich glaubte, dass ich dem Tod geweiht war.«
Aber als ich acht Monate nach ihrer Diagnose mit ihr sprach, war sie gerade operiert worden und erfuhr weitere, überraschende Neuigkeiten: Die Ärzte hatten eine vollkommene Remission festgestellt.
»Die Ärzte hatten das nie auf dem Schirm gehabt«, sagte sie. »Es ist wirklich ein Wunder.«
Ihr Krebs ist verschwunden. Aber ihr Ehemann ebenfalls. Nachdem die Chemotherapie abgesetzt worden war, sagte er, dass er seine Entscheidung getroffen habe. Er hatte eine Wohnung gemietet. Er wollte die Scheidung.
»Ich hatte solche Angst zu sterben«, erzählte mir Emily. »Nun muss ich lernen zu leben.«
Sie wird so sehr verzehrt von der Sorge um ihre Kinder, vom Schmerz, dass sie betrogen wurde, von finanziellen Ängsten und von Einsamkeit, dass sie das Gefühl hat, als sei sie in ein tiefes Loch gestürzt.
»Es fällt mir noch immer so schwer, mein Leben anzunehmen«, erzählte sie.
Die Scheidung hatte ihre schlimmsten Befürchtungen wahr gemacht, tiefsitzende Verlassensängste, die sie seit ihrem vierten Lebensjahr plagten, als ihre Mutter an einer Depression erkrankte. Ihr Vater verstummte, wenn es um die Krankheit ihrer Mutter ging, flüchtete sich in die Arbeit und überließ es Emily, damit fertigzuwerden. Als ihre Mutter später Selbstmord beging, war das die Bestätigung der Realität, die sie kannte, die sie aber dennoch vermeiden wollte, dass nämlich die Menschen, die man liebt, verschwinden.
»Seit ich fünfzehn war, hatte ich immer eine Beziehung«, sagte sie. »Ich habe nie gelernt, allein glücklich zu sein, mit mir glücklich zu sein, mich zu lieben.« Ihre Stimme bricht, als sie die Worte ausspricht: mich zu lieben.
Ich sage oft, dass wir unseren Kindern Wurzeln und Flügel verleihen müssen. Dasselbe müssen wir für uns tun. Der einzige Mensch, den Sie haben, sind Sie selbst. Sie kommen allein auf die Welt. Sie sterben allein. Fangen Sie also morgens damit an, dass Sie aufstehen und sich vor den Spiegel stellen. Schauen Sie sich in die Augen und sagen Sie: »Ich liebe dich.« Sagen Sie: »Ich werde dich nie verlassen.« Umarmen Sie sich. Geben Sie sich einen Kuss. Versuchen Sie es!
Und dann wiederholen Sie das jeden Tag, alle Tage, nur für sich allein.
»Aber wie soll ich mit meinem Mann umgehen?«, fragte Emily. »Wenn wir uns treffen, macht er einen vollkommen ruhigen und entspannten Eindruck. Er ist glücklich mit seiner Entscheidung. Aber bei mir kochen alle Emotionen hoch. Ich fange zu weinen an. Ich kann mich einfach nicht beherrschen, wenn ich ihn sehe.«
»Wenn Sie es wollen, schaffen Sie es«, sagte ich zu ihr. »Aber Sie müssen es wollen, und dazu kann ich Sie nicht bringen. Diese Macht habe ich nicht. Das können nur Sie. Treffen Sie eine Entscheidung. Vielleicht ist Ihnen eher nach Schreien und Weinen zumute. Aber tun Sie das nicht, wenn es nicht in Ihrem ureigensten Interesse ist.«
Manchmal genügt ein einziger Satz, um den Weg aus der Opferrolle zu finden: Ist es gut für mich?
Ist es gut für mich, mit einem verheirateten Mann zu schlafen? Ist es gut für mich, ein Stück Schokoladenkuchen zu essen? Ist es gut für mich, meinem Mann, der mich betrügt, mit Fäusten auf die Brust zu schlagen? Ist es gut für mich, tanzen zu gehen? Einem Freund zu helfen? Laugt es mich aus oder stärkt es mich?
Ein weiteres Instrument, sich aus der Opferrolle zu verabschieden, ist zu lernen, mit der Einsamkeit zurechtzukommen. Davor fürchten sich die meisten von uns mehr als vor allem anderen. Aber wenn Sie sich selbst lieben, dann ist allein sein nicht gleichbedeutend mit einsam sein.
»Sich selbst zu lieben, ist auch gut für Ihre Kinder«, sagte ich zu Emily. »Wenn Sie ihnen zeigen, dass Sie sich nie verlieren werden, dann zeigen Sie Ihren Kindern, dass sie Sie ebenfalls nie verlieren werden. Dass Sie jetzt hier sind. Dann können Sie Ihr Leben leben, statt dass Sie sich um Ihre Kinder und Ihre Kinder sich um Sie Sorgen machen und alle sich ständig umeinander Sorgen machen. Ihren Kindern und sich selbst sagen Sie: ›Ich bin hier. Ich bin für euch da.‹ Sie geben ihnen und sich selbst das, was Sie nie hatten: eine gesunde Mutter.«
Wenn wir beginnen, uns selbst zu lieben, beginnen wir, die Löcher in unserem Herzen zu flicken, die klaffenden Wunden, die scheinbar nie gefüllt werden können. Und wir beginnen, Entdeckungen zu machen. »Aha!«, lernen wir zu sagen: »So habe ich das noch nie gesehen.« Ich fragte Emily, welche Entdeckungen sie in den vergangenen acht Monaten des Umbruchs gemacht hatte. Ihre Augen leuchteten auf.
»Ich habe entdeckt, wie viele wunderbare Menschen ich um mich herum habe. Meine Familie, Freunde, Leute, die ich vorher noch nicht gekannt hatte, die während meiner Therapie zu Freunden geworden sind. Als der Arzt mir eröffnete, dass ich Krebs habe, dachte ich, mein Leben wäre vorbei. Und jetzt habe ich so viele Leute kennengelernt. Ich habe gelernt, dass ich kämpfen kann, dass ich leistungsfähig bin. Es hat fünfundvierzig Jahre gebraucht, bis ich das gelernt habe, aber zum Glück weiß ich es jetzt. Mein neues Leben hat schon angefangen.«
Wir alle können Stärke und Freiheit selbst in schrecklichen Lebenssituationen finden. Darling, Sie sind für sich selbst verantwortlich, also übernehmen Sie Verantwortung. Spielen Sie nicht das Aschenputtel, das in der Küche hockt und auf einen Kerl mit einem Fußfetisch wartet. Prinzen oder Prinzessinnen gibt es nicht. Die ganze Liebe und die Leistungskraft, die Sie brauchen, tragen Sie in sich. Schreiben Sie also auf, was Sie erreichen wollen, welches Leben Sie führen wollen, was für einen Partner Sie haben wollen. Wenn Sie ausgehen, machen Sie sich schick. Schließen Sie sich einer Gruppe von Leuten an, die ähnliche Kämpfe ausfechten, einer Gruppe, in der sich alle umeinander kümmern und sich gemeinsam für etwas Größeres engagieren, als der eigene Horizont hergibt. Und werden Sie neugierig. Was kommt als Nächstes? Wie wird es sich entwickeln?
Unser Geist wartet mit einer Menge brillanter Methoden auf, um uns zu schützen. Die Opferrolle ist ein verführerischer Schild, denn sie macht uns glauben, dass unser Kummer weniger schmerzt, wenn wir uns schuldlos machen. Solange Emily sich als Opfer definierte, konnte sie alle Schuld und Verantwortung für ihr Wohlbefinden auf ihren Ex-Mann schieben. Die Opferrolle gibt uns eine falsche Verschnaufpause, denn sie verzögert und vertagt das Wachstum. Je länger wir in ihr verharren, umso schwieriger wird es, sie zu verlassen.
»Sie sind kein Opfer«, sagte ich zu Emily. »Es geht nicht darum, wer Sie sind, sondern darum, was Ihnen angetan worden ist.«
Wir können verwundet sein und verantwortlich. Haftbar und unschuldig. Wir können die sekundären Vorteile der Opferrolle zugunsten der primären Vorteile des Wachsens und Gesundens aufgeben und nach vorn schauen.
Der einzige Grund, aus der Opferrolle auszusteigen, ist der, dass wir in unser restliches Leben einsteigen können. Diesen Dreh- und Angelpunkt versuchte Barbara in die Tat umzusetzen, als sie mich ein Jahr nach dem Tod ihrer Mutter kontaktierte. Für ihre vierundsechzig Jahre wirkte sie jung: glatte Haut, Strähnchen in den langen blonden Haaren. Doch offenbar lastete eine schwere Bürde auf ihr, und aus ihren großen blauen Augen sprach tiefe Trauer.
DER EINZIGE GRUND, AUS DER OPFERROLLE AUSZUSTEIGEN, IST DER, DASS WIR IN UNSER RESTLICHES LEBEN EINSTEIGEN KÖNNEN.
Barbaras Verhältnis zu ihrer Mutter war kompliziert gewesen, und so war auch ihre Trauer kompliziert. Anspruchsvoll und dominant, wie ihre Mutter gewesen war, hatte sie Barbaras Opferrolle manchmal explizit verstärkt, sich auf Probleme wie schlechte Zensuren und gescheiterte Beziehungen fixiert und so Barbaras Überzeugung geschürt, fehlerbehaftet und hilflos zu sein und es nie zu etwas bringen zu können. In gewisser Weise war es eine Erleichterung gewesen, nun von der verzerrten und kritischen Perspektive ihrer Mutter befreit zu sein. Aber sie fühlte sich auch ruhelos und unsicher. Wegen einer Rückenverletzung, die sie sich erst kürzlich zugezogen hatte, konnte sie ihrem geliebten Job in dem kleinen Café nicht nachgehen, und nachts konnte sie nicht einschlafen, da sie sich ständig mit Problemen herumschlug: Ist meine Zeit bald abgelaufen? Wobei habe ich versagt? Was habe ich getan, woran man sich erinnern wird? Was ist das Fazit meines Lebens?
»Ich bin traurig, ängstlich und unsicher«, sagte sie. »Ich kann einfach keinen Frieden finden.«
Das erlebe ich oft bei Frauen mittleren Alters, die ihre Mutter verloren haben. Die unbewältigte emotionale Beziehungsgeschichte lebt weiter – und der Tod macht es scheinbar unmöglich, jemals damit abzuschließen.
»Haben Sie Ihre Mutter aus der Vergangenheit entlassen?«, fragte ich.
Barbara schüttelte mit Tränen in den Augen den Kopf.
Tränen sind gut. Sie bedeuten, dass eine wichtige emotionale Wahrheit zu uns durchgedrungen ist. Wenn ich eine Frage stelle, die einen Patienten zum Weinen bringt, bin ich quasi auf eine Goldader gestoßen. Wir haben etwas Entscheidendes gefunden. Doch der Moment, in dem die Schleusen geöffnet werden, ist so vulnerabel wie tiefgreifend. Ich war ganz Ohr, ganz konzentriert auf den Augenblick.
Barbara wischte sich übers Gesicht und tat einen tiefen, rasselnden Atemzug. »Ich möchte Sie etwas fragen«, sagte sie. »Mir geht ständig eine Kindheitserinnerung im Kopf herum.«
Ich bat sie, die Augen zu schließen und mir den Vorfall in der Gegenwartsform zu erzählen, so, als würde sie ihn gerade jetzt erleben.
»Ich bin drei«, begann sie. »Wir sind alle in der Küche. Mein Dad sitzt am Frühstückstisch. Meine Mom steht vor mir und meinem älteren Bruder. Sie ist wütend. Sie stellt uns nebeneinander hin und fragt: ›Wen mögt ihr am liebsten? Mich oder euren Vater?‹ Mein Dad beobachtet, was sie macht, und er beginnt zu weinen. Er sagt: ›Tu das nicht. Tu das den Kindern nicht an.‹ Ich will sagen, dass ich meinen Vater am liebsten mag; ich will zu ihm gehen, mich auf seinen Schoß setzen und ihn umarmen. Aber das kann ich nicht machen. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn liebhabe, weil ich sonst meine Mutter wütend mache. Dann gibt’s Ärger. Also sage ich, dass ich meine Mom am liebsten mag. Und jetzt …« Ihre Stimme brach, und Tränen rollten über ihre Wangen. »Jetzt wünsche ich mir, dass ich es zurücknehmen könnte.«
»Sie waren eine gute Kämpferin«, sagte ich zu ihr. »Ein schlaues Köpfchen. Sie haben das getan, was notwendig war, um zu überleben.«
»Warum tut es dann so weh?«, fragte sie. »Warum kann ich es einfach nicht loslassen?«
»Weil dieses kleine Mädchen nicht weiß, dass es jetzt in Sicherheit ist. Nehmen Sie mich mit zu ihr in die Küche«, sagte ich. »Sagen Sie mir, was Sie sehen.«
Sie beschrieb das Fenster, das zum Garten hinausging, die gelben Blumen auf den Griffen der Schranktüren und dass die Schaltknöpfe am Herd genau auf Augenhöhe waren.
»Sprechen Sie mit dem kleinen Mädchen. Wie geht es ihm jetzt?«
»Ich liebe meinen Dad. Aber ich darf das nicht sagen.«
»Sie sind hilflos.«
Tränen tropften von den Wangen auf ihr Kinn. Sie wischte sie weg und barg dann ihr Gesicht in den Händen.
»Damals waren Sie ein Kind«, sagte ich. »Jetzt sind Sie erwachsen. Gehen Sie zu dem liebenswerten, einzigartigen kleinen Mädchen hinüber. Seien Sie jetzt seine Mutter. Nehmen Sie es an der Hand und sagen Sie zu ihm: ›Ich hole dich jetzt hier heraus.‹«
Barbaras Augen waren noch immer geschlossen. Sie wiegte sich hin und her.
»Halten Sie sie an der Hand«, fuhr ich fort. »Gehen Sie mit ihr zur Tür, die Eingangstreppe hinunter und hinaus auf den Gehweg. Gehen Sie mit ihr den Block entlang. Biegen Sie um die Ecke. Sagen Sie dem kleinen Mädchen: ›Du steckst nicht mehr dort fest.‹«
Das Gefängnis der Opferrolle wird oft in der Kindheit angelegt, und selbst wenn wir erwachsen sind, können wir uns immer noch so hilflos fühlen wie damals, als wir jung waren. Wir können uns aus der Opferrolle befreien, indem wir jenem inneren Kind helfen, sich sicher zu fühlen, und es die Welt mit der Autonomie eines Erwachsenen erfahren lassen.
Ich leitete Barbara an, die Hand des verwundeten Kindes weiterhin zu halten. Mit ihm spazieren zu gehen. Ihm die Blumen im Park zu zeigen. Es zu verwöhnen und zu knuddeln. Ihm ein Eis oder einen kuscheligen Teddy zu kaufen, den es drücken konnte – was immer es wollte, um sich sicher zu fühlen. »Und dann gehen Sie mit ihm zum Strand hinunter«, sagte ich. »Zeigen Sie ihm, wie man den Sand mit den Füßen aufwirbelt. Sagen Sie zu ihm: ›Ich bin hier, und wir werden jetzt richtig wütend.‹ Wirbeln Sie gemeinsam mit dem Kind den Sand mit den Füßen auf. Brüllen und schreien Sie. Und dann begleiten Sie es wieder nach Hause. Nicht in die Küche, sondern dorthin, wo Sie jetzt wohnen. An den Ort, an dem Sie immer wieder auftauchen werden, um nach ihm zu sehen.«
Barbaras Augen waren noch immer geschlossen, Mund und Wangen entspannter. Aber zwischen den Augen gab es immer noch eine Falte, die auf Anspannung hindeutete.