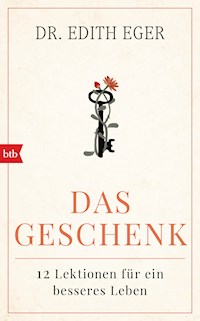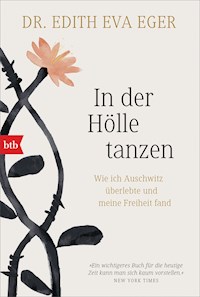8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der internationale Bestseller »In der Hölle tanzen« jetzt als Ausgabe für junge Leser*innen
»Ich möchte mein fast hundertjähriges Leben und meine Erfahrung nutzen, euch zu ermutigen, um Krisen, Schmerz und Kämpfe besser zu bewältigen und euer Leben so zu leben, wie ihr es für euch gut ist.« Edith Eva Eger im Vorwort zu »Die Ballerina von Auschwitz«
Edie ist eine talentierte Tänzerin und Turnerin, die sich Hoffnungen macht, in die Olympiamannschaft aufgenommen zu werden. Zwischen strengem Training und ihrem Kampf, ihren Platz in der Familie zu finden, in der sie als »die mit Köpfchen« gilt und ihre Schwester Magda als »die Hübsche«, bleibt Edie keine Zeit, sich mit dem Zustand der Welt zu befassen. Doch für ein jüdisches Mädchen ist das Leben in Ungarn im Jahr 1943 gefährlich.
Als Edie sich zum ersten Mal verliebt, tobt in Europa der Krieg, und Edies bisheriges Leben zerbricht. Ihre Familie wird in einen Zug gezwungen, der sie ins Konzentrationslager Auschwitz bringt. Aber selbst in diesen dunkelsten Momenten schöpft sie Kraft aus Erics Liebe. „Ich werde deine Augen nie vergessen“, sagt er ihr durch die Gitterstäbe des Viehwaggons. Auschwitz ist das Grauen, doch trotz des Hungers und der unvorstellbaren Schrecken findet Edie Kraft in ihrer Liebe zu Eric und der Hoffnung, ihn irgendwann wiederzusehen. Allen Widrigkeiten zum Trotz überleben Edie und ihre Schwester Magda, dank ihrer engen Verbundenheit und ihrem ungeheuren Mut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ungarn, 1944. Edie ist eine talentierte Tänzerin und Ausnahmeturnerin, die sich Hoffnungen macht, in die Olympiamannschaft aufgenommen zu werden. Zwischen strengem Training und ihrem Kampf, ihren Platz in der Familie zu finden, in der sie als »die mit Köpfchen« gilt und ihre Schwester Magda als »die Hübsche«, bleibt Edie keine Zeit, sich mit dem Zustand der Welt zu befassen. Doch für ein jüdisches Mädchen ist das Leben gefährlich.
Denn als Edie sich in Eric verliebt, den klugen Jungen mit Sommersprossen und rotem Haar, tobt in Europa der Krieg und ihre bisherige Welt ist für immer zerstört. »Ich werde deine Augen nie vergessen«, sind Erics letzte Worte, bevor Edie und ihre Familie in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert werden. Auschwitz ist das Grauen, doch trotz des Hungers und der unvorstellbaren Schrecken findet Edie Kraft in ihrer Liebe zu Eric und der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder zusammen sein werden. Allen Widrigkeiten zum Trotz überleben Edie und ihre Schwester Magda, dank ihrer engen Verbundenheit und ihrem ungeheuren Mut.
Dr. Edith Eva Eger ist Psychologin und Therapeutin mit einer Praxis in La Jolla, Kalifornien. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf posttraumatischen Belastungsstörungen. Eger unterrichtet an der University of California, San Diego und ist national und international eine gefragte Rednerin. Sie ist Mutter, Großmutter und Urgroßmutter und lebt in La Jolla.
https://dreditheger.com
Dr. Edith Eva Eger
mit Esmé Schwall
Die Ballerina von Auschwitz
Eine wahre Geschichte
Aus dem Englischenvon Meredith Barth
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »The Ballerina of Auschwitz« bei Atheneum, An imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Diese Ausgabe für junge Leser:innen basiert auf:»Ich bin hier und alles ist jetzt« (btb HC)»In der Hölle tanzen« (btb TB)
Ich möchte meinem Enkelsohn Jordan Engle von Herzen danken. Er half mir, meinen Wunsch zu verwirklichen, ein Buch für ein junges Publikum zu schreiben, betreute und begleitete dieses Projekt und unterstützt mein Werk und mein Vermächtnis.
Deutsche Erstausgabe September 2025
Copyright © der Originalausgabe 2017, 2024 by Dr. Edith Eger
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Covergestaltung: semper smile, München, nach einer Vorlage von Debra Sfetsios-Conover und unter Verwendung von Bildmaterial von Christopher Silas Neal
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MK · Herstellung: han
978-3-641-33000-2
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für die fünf Generationen meiner Familie:
für meinen Vater, Lajos, der mir beibrachte zu lachen;
für meine Mutter, Ilona, die half, in meinem Inneren das zu finden, was ich brauche;
für meine wunderbaren und unglaublichen Schwestern Magda und Klara;
für meine Kinder: Marianna, Audrey und John;
und für ihre Kinder: Lindsey, Jordan, Rachel, David und Ashley;
sowie für deren Kinder: Silas, Graham, Hale, Noah, Dylan, Marcus und Rafael.
Anmerkung der Autorin
Liebe Leserinnen und Leser, ich habe dieses Buch beinahe achtzig Jahre lang geschrieben. Als ich sechzehn war und am eigenen Leib die Schrecken des Holocausts erlitt; als ich miterlebte, wie meine Kinder – und dann meine Enkelkinder und Urenkelkinder – erwachsen wurden; als ich Schüler:innen der Highschool unterrichtete und Psychologin wurde, die sich auf die Behandlung von Traumata spezialisierte; als ich mich mit meinen zahlreichen geschätzten Patient:innen und meinem Publikum auf der ganzen Welt verband – schon damals schrieb ich in Gedanken für euch. Ich wünschte mir, euch die Werkzeuge an die Hand geben zu können, die mir halfen, das Unvorstellbare zu überleben. Ich wünschte mir, euch vermitteln zu können, dass eine Geschichte über die Fähigkeit der Menschen zum Bösen auch eine Geschichte über unsere unzerstörbare Fähigkeit zur Hoffnung ist.
Ich sehe es als meine Verantwortung, meine Geschichte zu erzählen. Die Wahrheit darüber zu erzählen, was geschehen ist, damit wir es niemals vergessen – aber auch ein Vermächtnis der Hoffnung und der Lebensfreude zu teilen, damit meine Eltern und Millionen anderer nicht umsonst starben. Ich will, dass der Triumph und die Feier des Lebens alles überdauern.
Nun scheint der richtige Moment gekommen zu sein, endlich meine Geschichte mit euch zu teilen. Vor knapp einem Jahr starb meine Schwester Magda – wenige Wochen nach ihrem hundertsten Geburtstag. Mir wurde bewusst, dass ich meine Chance verpassen könnte, wenn ich jetzt nicht das Buch für euch schreibe. Mich motiviert also meine eigene Sterblichkeit.
Mich motiviert aber auch euer Leben. Ich sehe die großen Herausforderungen, denen ihr in der heutigen Welt gegenübersteht: beunruhigende Fakten wie Waffengewalt, Cybermobbing, Klimawandel, eine globale Pandemie, schockierend hohe Raten an Angststörungen, Depressionen, Verzweiflung, Suizid. Ich möchte meine sechsundneunzig Jahre auf diesem Planeten nutzen, mein beinahe ein Jahrhundert dauerndes Leben, meine Entwicklung und meine Heilung, um euch als Cheerleaderin und Fürsprecherin zur Seite zu stehen. Ich möchte euch einen emotionalen und spirituellen Weg aufzeigen, um mit dem unvermeidlichen Leid und den Kämpfen, die euch begegnen werden, besser zurechtzukommen. Und ich möchte euch etwas geben, das speziell für euch in dieser Phase eures Lebens geschrieben wurde, damit ihr akzeptieren könnt, was ihr erbt und ertragt. Um eure Stärke und Persönlichkeit anzunehmen und euch dafür zu entscheiden, euer Leben so zu leben, wie ihr es euch wünscht.
Dankbar biete ich euch dieses Buch an, in der Hoffnung, dass ihr meine Geschichte lesen und dabei spüren werdet, dass ihr nicht allein seid bei dieser herausfordernden Aufgabe, ein Mensch zu sein. In der Hoffnung, dass ihr meine Geschichte lesen und denken werdet: Wenn sie es schaffen kann, dann kann ich es auch! Ich biete euch dieses Buch an, damit ihr das Opfersein überwinden und euch dafür entscheiden könnt, durchs Leben zu tanzen, selbst unter höllischen Bedingungen. Ich gebe euch meine Geschichte, um euch darin zu stärken, Botschafter:innen des Friedens zu werden und bewusste Entscheidungen für euer Leben zu treffen. Ich gebe euch dieses Buch, damit ihr so leben könnt, wie ihr in Wahrheit seid: einzigartig und frei.
In Liebe
Edie
Oktober 2024
Prolog
Müsste ich mein gesamtes Leben in einem einzigen Moment festhalten, in einem Standbild, dann wäre es das: Drei Frauen in dunklen Wollmänteln warten, untergehakt, auf einem unwirtlichen Platz. Sie sind erschöpft. Sie haben Staub auf den Schuhen. Sie stehen in einer langen Schlange.
Die drei Frauen sind meine Mutter, meine Schwester Magda und ich. Es ist unser letzter gemeinsamer Augenblick. Aber das wissen wir nicht. Wir weigern uns, es in Betracht zu ziehen. Oder wir sind zu geschwächt, um darüber nachzudenken, was vor uns liegt. Es ist ein Moment des Trennens – der Mutter von den Töchtern, des Lebens, wie es war, von dem, wie es sein wird. Doch erst in der Rückschau bekommt er diese Bedeutung.
Ich sehe uns drei von hinten, als ob ich als Nächste an der Reihe wäre. Warum schenkt mir die Erinnerung den Hinterkopf meiner Mutter und nicht ihr Gesicht? Ihre langen Haare sind aufwendig geflochten und hochgesteckt. Magdas hellbraune Wellen berühren ihre Schultern. Meine dunklen Haare sind unter einem Schal verborgen. Meine Mutter steht in der Mitte, Magda und ich lehnen an ihr. Es ist unmöglich zu erkennen, ob wir diejenigen sind, die meine Mutter aufrecht halten, oder ob es umgekehrt ist, ob ihre Stärke die Stütze ist, die Magda und mich trägt.
Dieser Augenblick ist die Schwelle zu den größten Verlusten meines Lebens. Seit acht Jahrzehnten kehre ich wieder und wieder zu diesem einen Bild von uns dreien zurück. Ich studiere es, als ob ich bei genauester Prüfung etwas Wertvolles entdecken könnte. Als ob ich das Leben, das diesem Moment vorausging, wiedergewinnen könnte, das Leben, das dem Verlust vorausging. Als ob ich in diese Zeit zurückkehren könnte, als sich unsere Arme untergehakt hatten und wir zueinander gehörten. Ich sehe unsere gebeugten Schultern. Den Staub, der sich am Saum unserer Mäntel festgesetzt hat. Meine Mutter. Meine Schwester. Mich.
KAPITEL 1 Die Kleine
Sie wollten einen Jungen, doch sie bekamen mich.
Ein Mädchen. Eine dritte Tochter, der Kümmerling der Familie.
»Ich bin froh, dass du Verstand hast, denn Schönheit hast du jedenfalls nicht«, erklärt mir meine Mutter immer wieder. Vielleicht will sie mir damit sagen, dass ich auch nie schön sein werde. Oder vielleicht ist dieses Kompliment, unter Kritik verborgen, ihre Art, mich zu ermutigen, fleißig zu lernen. Motivation in Gestalt einer Warnung. Vielleicht gibt es ein unsichtbares Schicksal, das sie mir ersparen will. Vielleicht versucht sie, mir eine bessere Vorstellung von dem zu vermitteln, was ich werden könnte. »Du kannst ein anderes Mal kochen lernen«, sagte sie, als ich sie bat, mir beizubringen, wie man Challa flechtet oder Hühnchen brät oder die Kirschmarmelade kocht, die sie immer im Sommer macht und für das restliche Jahr aufbewahrt. »Geh wieder lernen.«
Heute stehe ich vor dem Spiegel im Badezimmer unserer Wohnung, putze die Zähne und mache mich bereit für die Schule. Ich mustere mein Spiegelbild. Stimmt es, dass ich nichts Attraktives an mir habe? Ich bin Tänzerin und Turnerin, mein Körper ist schlank und sehnig. Ich mag meine Kraft. Ich mag meine gewellten braunen Haare – wobei Magda, meine älteste Schwester, eigentlich die Hübsche ist. Doch wenn ich meine Augen im Spiegel betrachte, wenn ich mich in dieses geheimnisvolle und vertraute Blaugrün versenke, kann ich nicht verstehen, was ich da erblicke. Es scheint, als würde ich mein Leben von außen und mich selbst als Figur in einem Roman sehen, deren Schicksal unbekannt ist und deren Herz und Selbst noch dabei sind, sich zu entfalten.
Ich habe gerade einen der Romane meiner Mutter zu Ende gelesen – Emile Zolas Nana, aus ihrem Buchregal stibitzt und heimlich verschlungen. Die letzte Szene geht mir nicht aus dem Kopf. Nana, die schöne, elegante Protagonistin, die im Laufe der Geschichte von so vielen Männern begehrt wurde, liegt nun gebrochen da, tot, ihr Körper übersät von Pockennarben. Zolas Schilderung ihres Körpers hat etwas zutiefst Erschreckendes. Selbst vor den Pocken, als sie noch wunderschön und betörend war, strahlte ihr Körper eine Gefahr aus. Wie eine Waffe. Bedrohlich – etwas, wovor man sich in Acht nehmen musste.
Und dennoch war sie begehrt. Ich sehne mich nach solcher Liebe. Gesehen und geschätzt zu werden wie etwas Kostbares. Mit Zuneigung überschüttet zu werden, genossen wie ein Fest.
Stattdessen warnt man mich.
»Sich waschen funktioniert wie der Abwasch in der Küche«, erklärt mir meine Mutter einmal. »Man beginnt mit den Gläsern und arbeitet sich hinunter bis zu den Töpfen und Pfannen.« Heb das Schmutzigste bis zum Schluss auf. Selbst mein Körper ist verdächtig.
Magda hämmert an die Badezimmertür. Sie hat keine Lust mehr, noch länger zu warten.
»Hör mit der Trödelei auf, Dicuka«, beschwert sie sich. Sie benutzt den Kosenamen, den mir meine Mutter gegeben hat. Diese sinnlos aneinandergereihten Silben bedeuten gewöhnlich Wärme und Zuneigung für mich. Heute jedoch klingen sie harsch und scheppernd.
Ich eile an meiner verärgerten Schwester vorbei in unser gemeinsames Zimmer, wo ich mich anziehe, während ich an das Mädchen im Spiegel denke – das Mädchen, das sich nach Liebe sehnt. Vielleicht ist die Art von Liebe, die ich mir wünsche, unmöglich. Ich habe dreizehn Jahre damit verbracht, meine Erinnerungen und Erfahrungen zu einer Geschichte zusammenzuweben, die erzählt, wer ich bin – eine Geschichte, die zu zeigen scheint, dass ich schadhaft bin, dass man mich nicht will, dass ich nicht dazugehöre.
Wie an jenem Abend, als ich sieben Jahre alt war und meine Eltern ein Abendessen gaben. Sie schickten mich aus dem Zimmer, um den Wasserkrug nachzufüllen, und aus der Küche hörte ich, wie sie scherzten: »Die hätten wir uns sparen können.« Damit meinten sie, dass sie bereits als Familie komplett gewesen waren, bevor ich kam. Sie hatten Magda, die Klavier spielte, und Klara, das Wunderkind an der Geige. Ich steuerte nichts Neues bei. Ich war unnötig, nicht gut genug. Es gab keinen Platz für mich.
Mit acht stellte ich diese Theorie auf die Probe und beschloss, wegzulaufen. So wollte ich erfahren, ob meine Eltern überhaupt bemerken würden, dass ich verschwunden war. Statt in die Schule zu gehen, fuhr ich mit der Straßenbahn zum Haus meiner Großeltern. Ich vertraute meinen Großeltern – der Vater meiner Mutter und ihre Stiefmutter – und wusste, dass sie mich nicht verraten würden. Sie befanden sich wegen Magda in ständigem Streit mit meiner Mutter und versteckten Kekse für meine Schwester in ihrer Kommodenschublade. Für mich bedeuteten meine Großeltern Sicherheit. Sie hielten Händchen – etwas, das meine Eltern nie taten. Sie waren Trost und Geborgenheit – der Duft von Braten und gebackenen Bohnen, von Hefezopf, von Tscholent, einem reichhaltigen Eintopf, den meine Großmutter in die Bäckerei brachte, um ihn am Sabbat kochen zu lassen, wenn es ihr die orthodoxen Regeln nicht erlaubten, ihren eigenen Ofen zu benutzen.
Meine Großeltern freuten sich, mich zu sehen. Für ihre Liebe, ihre Wertschätzung musste ich nichts leisten. Sie gaben sie freimütig und wir verbrachten einen wunderbaren Vormittag in der Küche, wo wir zusammen Nusszopf aßen. Irgendwann klingelte es an der Haustür. Mein Großvater ging, sie zu öffnen. Einen Moment später rannte er in die Küche. Er war schwerhörig und sprach seine Warnung deshalb zu laut aus. »Versteck dich, Dicuka!«, rief er. »Deine Mutter ist hier!« Indem er mich zu beschützen versuchte, verriet er mich.
Was mich am meisten quälte, war der Ausdruck im Gesicht meiner Mutter, als sie mich in der Küche meiner Großeltern entdeckte. Sie war nicht nur verblüfft, mich hier vorzufinden – es war vielmehr so, als würde sie die bloße Tatsache meiner Existenz überraschen. Als ob ich nicht diejenige wäre, die sie wollte oder erwartete.
Und dennoch bin ich oft ihre Gefährtin und sitze bei ihr in der Küche, wenn mein Vater auf Geschäftsreise in Paris ist, wo er seine Koffer mit Seiden für die Schneiderei füllt. Meine Mutter wirkt starr und wachsam, wenn er zurückkehrt, voller Sorge, dass er zu viel Geld ausgegeben haben könnte. Sie lädt keine Freunde zu uns nach Hause ein. Im Wohnzimmer gibt es keine müßigen Plaudereien, keine Gespräche über Bücher oder Politik. Ich bin es, der meine Mutter ihre Geheimnisse anvertraut. Und ich liebe die Stunden, die ich mit ihr allein verbringen darf.
Eines Abends, als ich neun Jahre alt war, saßen wir wieder einmal allein in der Küche. Sie bereitete gerade einen Strudel aus Resten, für den sie den Teig ausgerollt und wie schweres Leinen über den Tisch im Esszimmer gelegt hatte. »Lies mir etwas vor«, sagte sie und ich holte das abgegriffene Exemplar von Vom Winde verweht von ihrem Nachtkästchen. Wir hatten es bereits einmal ganz gelesen und hatten es vor Kurzem noch einmal von vorn begonnen. Ich hielt bei der geheimnisvollen Widmung inne, die auf Englisch auf der Titelseite des übersetzten Buchs stand. Es war die Schrift eines Mannes, jedoch nicht die meines Vaters. Meine Mutter verriet mir nur, dass es das Geschenk eines Mannes war, den sie kennengelernt hatte, als sie noch im Außenministerium gearbeitet hatte – damals, bevor sie meinem Vater begegnete.
Wir saßen auf Stühlen mit aufrechten Lehnen in der Nähe des Holzofens. Wenn wir zusammen ein Buch lasen, musste ich sie mir mit niemandem teilen. Ich versank in den Worten, in der Geschichte und in dem Gefühl, allein mit ihr auf der Welt zu sein. Scarlett kehrt am Ende des Kriegs nach Tara zurück, wo sie erfährt, dass ihre Mutter tot ist und ihr Vater vor Trauer dem Wahnsinn verfällt. »Gott ist mein Zeuge«, sagt Scarlett, »ich werde niemals mehr Hunger leiden.« Meine Mutter schloss die Augen und lehnte ihren Kopf an die Lehne. Ich wollte ihr auf den Schoß klettern. Ich wollte meinen Kopf an ihre Brust legen. Ich wollte, dass sie meine Haare mit ihren Lippen berührt.
»Tara …«, sagte sie. »Amerika … Das ist ein Ort, den ich gerne einmal sehen würde.« Ich wünschte mir, sie würde meinen Namen mit der gleichen Zärtlichkeit aussprechen, die sie für ein Land empfand, in dem sie nie gewesen war. Die köstlichen Gerüche aus der Küche meiner Mutter vermischten sich in diesem Moment für mich mit dem Drama um Hunger und Festessen – wobei es selbst bei den Festen diese Sehnsucht nach etwas anderem zu geben schien. Ich wusste nicht, ob es ihre Sehnsucht war oder meine, oder etwas, das wir miteinander teilten.
Wir saßen da, der Ofen bullerte.
»Als ich in deinem Alter war …«, begann sie.
Endlich redete sie mit mir. Ich wagte kaum, mich zu rühren, aus Angst, dass sie dann nicht weitersprechen würde.
»Als ich in deinem Alter war, schliefen die jüngeren Geschwister zusammen und ich teilte mir ein Bett mit unserer Mutter. Eines Morgens wachte ich auf, weil mich mein Vater rief: ›Ilonka, weck deine Mutter. Sie hat mir noch kein Frühstück gemacht und keine Kleider herausgelegt.‹ Ich drehte mich zu meiner Mutter um, die neben mir unter der Bettdecke lag. Aber sie rührte sich nicht. Sie war tot.«
Ich wollte jede Einzelheit über diesen Moment erfahren, über den Moment, in dem eine Tochter neben einer Mutter aufwacht, die sie bereits verloren hat. Gleichzeitig wollte ich nicht hinsehen. Es war zu schrecklich, sich so etwas vorzustellen.
»Als man sie am selben Nachmittag begrub, dachte ich, man würde sie lebendig in die Erde legen. An jenem Abend sagte mein Vater, ich solle das Essen machen. Und das war es, was ich gemacht habe.«
Ich wartete auf den Rest der Geschichte. Ich wartete auf die Lektion am Ende oder auf etwas Beruhigendes.
»Schlafenszeit«, war alles, was meine Mutter sagte. Sie beugte sich vor, um die Asche unten den Ofen zu kehren.
Schritte stapften durch den Gang draußen vor unserer Tür. Ich konnte den Tabakgeruch meines Vaters riechen, noch ehe ich das Klappern seiner Schlüssel vernahm.
»Meine Damen«, rief er. »Seid ihr noch wach?« Er kam mit glänzenden Schuhen, elegantem Anzug und einem breiten Grinsen in die Küche. In der Hand hielt er einen kleinen Beutel, den er mir mit einem schmatzenden Kuss auf die Stirn überreichte. »Ich habe wieder gewonnen«, strahlte er. Jedes Mal, wenn er mit seinen Freunden Karten oder Billard spielte, teilte er seinen Gewinn mit mir. An jenem Abend hatte er ein Petit Four mitgebracht, mit rosa Zuckerguss überzogen. Wäre ich meine Schwester Magda, hätte mir meine Mutter, stets um Magdas Gewicht besorgt, die Süßigkeit entrissen. Aber mir nickte sie nur zu und gab mir die Erlaubnis, das Kuchenstückchen zu essen.
Sie stand auf und trat zum Spülbecken. Mein Vater hielt sie auf und nahm ihre Hand, um sie durch den Raum zu wirbeln. Steif und ohne ein Lächeln ließ sie es mit sich geschehen. Er zog sie an sich, umarmte sie, eine Hand auf ihrem Rücken, die andere neckend auf ihrer Brust. Meine Mutter schüttelte ihn ab.
»Ich bin für deine Mutter eine Enttäuschung«, flüsterte mir mein Vater halblaut zu, als wir die Küche verließen. Wollte er, dass sie ihn hörte, oder war das ein Geheimnis, das er nur mir anvertraute? In jedem Fall war es etwas, das ich mir merken wollte, um später darüber nachzudenken. Die Bitterkeit in seiner Stimme verängstigte mich. »Sie möchte jeden Abend in die Oper gehen, ein schickes Leben führen. Aber ich bin nur ein kleiner Schneider. Ein Schneider und ein Billardspieler.«
Der niedergeschlagene Tonfall meines Vaters verwirrt mich. Er ist in der Stadt bekannt und beliebt. Ausgelassen und oft lächelnd, wirkt er immer entspannt, lebhaft und gilt als jemand, mit dem man Spaß hat. Oft geht er mit seinen vielen Freunden aus. Er liebt Essen – vor allem den Schinken, den er manchmal in unser Haus schmuggelt und den er über dem Zeitungsblatt isst, in das er gewickelt war. Zwischendurch schiebt mein Vater immer wieder ein Stückchen des verbotenen Schweinefleischs in meinen Mund und erträgt dabei stoisch die Anschuldigungen meiner Mutter, ein schlechtes Vorbild zu sein. Sein Schneidersalon wurde mit zwei Goldmedaillen ausgezeichnet. Er vermag nicht nur gerade Nähte und gleichmäßige Säume zu fabrizieren, er ist vor allem ein Meister der Couture. So lernte er auch meine Mutter kennen. Sie kam in sein Geschäft, weil sie ein Kleid brauchte und er ihr wegen seiner Kunstfertigkeit empfohlen worden war. Doch mein Vater wäre lieber Arzt geworden und kein Schneider, ein Traum, den sein Vater ihm ausgeredet hatte; ab und zu brach die Enttäuschung darüber in ihm durch.
»Du bist nicht nur ein Schneider, Papa«, versicherte ich ihm. »Du bist berühmt für deine Entwürfe!«
»Und du wirst eines Tages die am besten gekleidete junge Dame von ganz Košice sein«, antwortete er und streichelte mir über den Kopf. »Du hast die perfekte Figur dafür.«
Er hatte seine Enttäuschung zurück in sein tiefstes Innerstes verbannt. Wir standen zusammen im Flur, doch noch war keiner von uns bereit, sich zu trennen.
»Ich wollte damals unbedingt, dass du ein Junge wirst, weißt du«, sagte mein Vater. »Als du auf die Welt gekommen bist, habe ich vor Wut die Tür zugeschlagen. Ich war so zornig, dass wir noch ein Mädchen bekommen haben. Aber jetzt bist du die Einzige, mit der ich reden kann.« Er küsste mich auf die Stirn.
Ich liebe es, wenn mir mein Vater seine Aufmerksamkeit schenkt. Wie bei meiner Mutter ist sie etwas Kostbares … und nichts, worauf ich mich verlassen kann. Als läge der Grund dafür, mich ihrer Liebe als würdig zu erweisen, weniger in mir selbst als in ihrer jeweiligen Einsamkeit. Als ob meine Identität nicht daran geknüpft ist, was ich bin oder was ich habe, sondern als ob sie nur ein Maßstab dessen wäre, was meinen beiden Eltern am anderen fehlt.
Ich setze mich zu meiner Familie an den Frühstückstisch, und meine beiden älteren Schwestern begrüßen mich mit einem Lied, das sie für mich gedichtet haben, als ich drei Jahre alt war und nach einem schief gelaufenen medizinischen Eingriff auf einem Auge zu schielen begann. »Du bist so hässlich, du bist so mickrig«, singen sie. »Einen Mann, einen Mann wirst du niemals finden.«
Jahrelang richtete ich beim Gehen den Blick immer nur auf den Boden, damit niemand mein schiefes Gesicht sehen konnte. Mit zehn wurde ich schließlich operiert, um das schielende Auge zu korrigieren, und jetzt sollte ich eigentlich in der Lage sein, aufzuschauen und zu lächeln, wenn ich Fremden begegnete. Doch meine Unsicherheit bleibt und wird durch das ständige Hänseln meiner Schwestern noch verstärkt.
Magda ist neunzehn, mit sinnlichen Lippen und welligem Haar. Sie ist der Spaßvogel der Familie. Als wir noch jünger waren, zeigte sie mir, wie man Weintrauben aus unserem Zimmerfenster in die Kaffeetassen der Gäste fallen lassen konnte, die unten auf der Terrasse im Café saßen. Klara, die Mittlere von uns, die Geigenvirtuosin, meisterte bereits im Alter von fünf Jahren Mendelssohns Violinkonzert.
Ich bin es gewöhnt, die stumme Schwester zu sein, die unsichtbare. Da ich derart von meiner Minderwertigkeit überzeugt bin, stelle ich mich selten mit meinem Namen vor. »Ich bin Klaras Schwester«, sage ich. Es kommt mir nicht in den Sinn, dass Magda es leid sein könnte, immer der Clown zu sein, oder dass es Klara vielleicht hasst, als Wunderkind zu gelten. Sie kann nicht aufhören, außergewöhnlich zu sein, nicht eine Sekunde lang, sonst könnte ihr alles genommen werden: die Bewunderung, an die sie gewöhnt ist, ihr Selbstverständnis. Magda und ich müssen uns bemühen, etwas zu bekommen, von dem wir uns sicher sind, dass es nie genug davon geben wird. Klara hingegen quält sich mit der Sorge, dass sie jeden Moment einen fatalen Fehler begehen und alles verlieren könnte. Klara hat mein ganzes Leben lang Geige gespielt, sie spielt, seit sie drei ist. Oft steht sie vor dem offenen Fenster, um zu üben, als könnte sie ihr schöpferisches Genie nur dann ganz genießen, wenn sich ein Publikum aus zufällig vorübergehenden Passanten einfindet. Für sie scheint Liebe nichts Endloses zu sein, sie ist an eine Bedingung geknüpft – eine Belohnung für einen Auftritt, eine Abfindung. Es gibt einen Preis dafür, geliebt zu werden: Die Anstrengung, akzeptiert und bewundert zu sein, bedeutet letztlich eine Art von Verschwinden.
Wir essen Brötchen aus der Bäckerei in unserer Straße, dick bestrichen mit Butter und der Aprikosenmarmelade meiner Mutter. Meine Mutter schenkt uns Kaffee ein und reicht das Essen herum. Meinem Vater hängt bereits ein Maßband um den Hals und in seiner Brusttasche steckt ein Stück Kreide, um die Stoffe markieren zu können. Magda wartet darauf, dass meine Mutter ein zweites Mal Brötchen anbietet. »Nimm es. Ich esse es«, drängt sie mich jedes Mal, wenn ich ablehnen will. Klara räuspert sich und alle wenden den Kopf in ihre Richtung, um zu hören, was sie zu sagen hat.
»Ich muss dem Professor antworten, der mich zum Studium nach New York eingeladen hat«, erklärt sie, während sie mit dem Messer die weiche Butter über das warme Brötchen streicht.
»Wir haben Familie in New York«, überlegt mein Vater und rührt in seinem Kaffee. Er meint seine Schwester Matilda, die an einem Ort wohnt, der die Bronx heißt, in einem Viertel mit jüdischen Immigranten.
»Nein«, entgegnet meine Mutter. »Wir haben schon darüber gesprochen. Amerika ist zu weit weg.«
Ich denke an den noch nicht lange zurückliegenden Abend in der Küche, als sie mit großer Sehnsucht von Amerika sprach. Vielleicht ist das Leben so – ein ständiges Schwanken zwischen den Dingen, die wir nicht haben, uns aber wünschen, und jenen, die wir haben, von denen wir uns aber wünschen, wir hätten sie nicht.
Klara schiebt ihr Kinn vor. »Wenn New York nicht geht«, sagt sie, »dann Budapest.«
Meine Mutter lässt den Kopf sinken, während sie den Tisch abräumt. Die Karriere ihres Lieblingskindes zu unterstützen, bedeutet, dieses Kind zu verlieren. Oder vielleicht ist es auch nicht die Vorstellung, dass Klarie weggeht, die sie traurig macht; vielleicht ist es ihre eigene Unnachgiebigkeit. Vielleicht ist sie wütend auf sich selbst, weil sie Nein sagt, auch wenn sie in Wahrheit lieber Ja sagen würde.
Mein chronisch gut gelaunter Vater ist durch Klaras Entscheidung oder die Sorgen, die meine Mutter mit sich herumträgt, nicht aus der Ruhe zu bringen.
»Wir reden noch darüber«, sagt er und löst damit die düstere Stimmung auf, die sich wieder einmal über den Tisch der Familie gelegt hatte. Dann wendet er sich an mich. »Dicuka«, sagt er und reicht mir einen Briefumschlag. »Bring das zur Schule. Das Schulgeld ist fällig.«
Ich halte den Umschlag in meiner Hand. Ich bin mir der Bedeutung dieses Vertrauensbeweises bewusst und gleichzeitig ist das Übergeben dieser Verantwortung auch ein Vorwurf an mich. Ein Hinweis darauf, wie viel ich die Familie koste. Eine noch unbeantwortete Frage über den Wert, den ich bringe. Ich halte den Umschlag mit dem Geld fest in der Hand, während ich meine Schulsachen zusammensuche – als ob mein fester Griff helfen könnte, mir genau zu zeigen, wie viel ich bedeute und wie viel nicht, als ob er mir helfen könnte, eine Landkarte mit den Dimensionen und Grenzen meines Werts zu zeichnen.
Ich bin am glücklichsten, wenn ich allein bin, wenn ich mich in meine innere Welt zurückziehen kann, und der Weg in die private jüdische Schule, in die ich gehe, schenkt mir Zeit, die ich schätze. Ich übe die Schritte zu Die blaue Donau, die meine Ballettklasse bei einer Festveranstaltung am Fluss bald vorführen wird.
Ich denke an meinen Ballettmeister und seine Frau, an das Gefühl, das mich erfüllt, wenn ich, zwei oder drei Stufen auf einmal nehmend, zur Schule hinaufsteige, dort meine Schulkleidung ausziehe und stattdessen in mein Trikot und meine Strumpfhose schlüpfe. Im Alter von fünf habe ich mit dem Ballettunterricht begonnen, als meine Mutter ahnte, dass ich keine Musikerin sein würde, sondern andere Begabungen haben musste. (Meine Eltern hatten versucht, mir mit Klaras alter Violine das Geigespielen beizubringen, aber es dauerte nicht lange, bis meine Mutter mir das Instrument aus den Händen nahm und sagte: »Das reicht.«) Ballett hingegen – das liebte ich von Anfang an. Meine Tante und mein Onkel schenkten mir ein Tutu, das ich zu meiner ersten Stunde trug. Aus irgendeinem Grund empfand ich in der Ballettschule keine Schüchternheit. Ich ging direkt zum Klavierspieler, der die Klasse auf seinem Instrument begleitete, und fragte, welche Stücke er zu spielen gedenke. »Geh einfach tanzen, Kleines«, erwiderte er. »Und lass das Klavier meine Sorge sein.«
Seitdem ich acht bin, gehe ich dreimal die Woche zum Ballettunterricht. Ich mochte es, etwas zu tun, das allein mir gehörte, etwas anderes als meine Schwestern. Und ich mochte es, ganz in meinem Körper zu sein. Ich übte gern Spagat. Unser Ballettmeister erinnerte uns immer wieder daran, dass Kraft und Flexibilität nicht voneinander zu trennen sind. Damit sich ein Muskel zusammenzieht, muss sich ein anderer dehnen; um Ausdauer und Biegsamkeit zu erreichen, müssen wir unseren Kern stärken. Ich dachte an seine Anweisungen wie an ein Gebet. Mit geradem Rücken ließ ich mich langsam nach unten sinken, die Bauchmuskeln gespannt, die Beine weit gespreizt. Ich wusste, dass ich atmen musste, vor allem wenn ich stecken zu bleiben drohte. Ich stellte mir vor, dass sich mein Körper ausdehnte wie die Saiten der Geige meiner Schwester, auf der Suche nach jener perfekten Anspannung, die das ganze Instrument zum Schwingen bringen würde. Dann war ich unten. Ich war da. In einem vollen Spagat. »Bravo!« Mein Ballettmeister klatschte in die Hände. »Bleib genau so, wie du bist.« Er hob mich vom Boden hoch und über seinen Kopf. Es war schwierig, meine Beine komplett ausgestreckt zu halten, ohne den Boden unter mir zu haben, gegen den ich mich abdrücken konnte; doch für einen Moment fühlte ich mich wie ein Geschenk. Ich fühlte mich wie reines Licht. »Editke«, sagt mein Lehrer, »all deine Freude im Leben wird aus deinem Inneren kommen.« Noch verstehe ich nicht ganz, was er damit meint. Aber ich weiß, dass ich atmen, mich drehen, die Beine von mir schleudern und mich beugen kann. Dass jede Bewegung, jede Pose, während sich meine Muskeln dehnen und zusammenziehen, laut zu rufen scheinen: Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ich. Ich bin jemand.
Die Fantasie übernimmt das Ruder und ich entfliehe in Gedanken in einen neuen Tanz, den ich mir ausdenke und in dem ich mir das Kennenlernen meiner Eltern vorstelle. Ich tanze beide Rollen. Mein Vater vollführt eine slapstickartige Stummfilmnummer, als er meine Mutter beim Betreten des Raums erblickt. Meine Mutter dreht sich schneller und springt höher. Ich biege meinen ganzen Körper zu einem freudigen Lachen. Nie habe ich meine Mutter ausgelassen erlebt, nie aus vollem Herzen lachen hören, doch in meinem Körper spüre ich diese nicht versiegte Quelle ihrer Fröhlichkeit.
Als ich in der Schule eintreffe, ist das Schuldgeld für ein ganzes Vierteljahr verschwunden, das mir mein Vater mitgegeben hat. Irgendwie muss ich es im Eifer des Tanzens verloren haben. Ich sehe in jeder Tasche, in jeder Falte meiner Kleidung nach, aber es ist nicht mehr da. Den ganzen Tag brennt in mir die Angst vor jenem Moment, wenn ich es meinem Vater gestehen muss, wie ein schwerer Eisklumpen im Magen.
Abends warte ich, bis das Essen vorbei ist und ich endlich den Mut finde, meinem Vater zu erzählen, was ich getan habe. Er vermag mich nicht anzusehen, während er die Faust reckt, in der sein Gürtel steckt. Es ist das erste Mal, dass er mich oder eine meiner Schwestern schlägt. Als er fertig ist, spricht er kein Wort mit mir.
Ich krieche früh ins Bett, noch ehe ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Mein Rücken und mein Po brennen. Was jedoch mehr schmerzt als die frischen Striemen auf meiner Haut ist das Gefühl, dass etwas mit mir nicht stimmt. Bald werde ich verstehen, dass der tief verborgene Ort, den ich in meiner Einsamkeit aufsuche, ein Gewinn ist, eine wichtige Überlebenstechnik, aber in dieser Nacht kommt mir meine Fantasie wie etwas Abnormales vor. Ein schrecklicher Makel.
Ich ziehe meine Puppe zu mir unter die Decken. Ich nenne sie »die Kleine«. Sie hat lange, wellige, dunkle Haare und grüne Augen, die sich öffnen und schließen lassen. Grüne Augen wie die meines Vaters. Es ist eine hübsche Puppe, das mir Liebste, was ich besitze. Ich flüstere ihr ins makellose Porzellanohr.
»Ich wünschte, ich wäre tot – damit er dafür leiden muss, was er mir angetan hat«, sage ich, die Augen in der Dunkelheit fest zusammengekniffen.
Die Kleine schweigt, als ob sie über diese brennende Wut nachdenken müsste, die ich für meinen Vater empfinde – und für mich selbst. Ich lasse den Zorn in mir lodern, befeure ihn immer mehr. Es liegt eine Art Befriedigung darin, die schlimmstmöglichen Dinge auszusprechen.
»Nein«, flüstere ich meiner Puppe zu, meine Stimme heiser vor Tränen. »Ich wünschte …« Ich lasse das Crescendo in mir wachsen. »Ich wünschte …« Ich werde das Schlimmste, das Grausamste laut aussprechen, das mir einfällt. Einen Satz, der so furchtbar ist, dass ich ihn nie mehr zurücknehmen kann, der mich – was ich noch nicht weiß – in viel schlimmeren Nächten, in viel dunkleren Zeiten verfolgen wird, an den ich immer wieder denken werde. »Ich wünschte, mein Vater wäre tot«, sage ich.
In dieser Nacht antwortet mir die Kleine nicht. Ihre Augen sind geschlossen, ein Vorhang wird rasch über die Bühne gezogen.