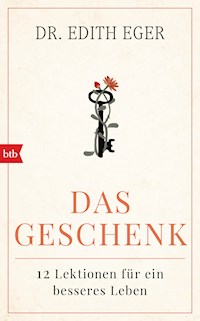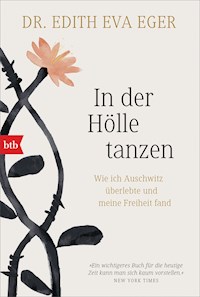
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Alter von 16 Jahren wurde Edith Eger 1944 aus ihrem Heimatland Ungarn nach Auschwitz verschleppt. Dort sah sie ihre Mutter in die Gaskammer gehen und musste vor Josef Mengele um ihr Leben tanzen. Es grenzt an ein Wunder, dass Edith die Grauen der Lager überlebte. In den USA baute sie sich ein neues Leben auf und wurde erfolgreiche Psychologin und Therapeutin. Ihr lebensbejahendes Buch ist mehr als die außerordentliche Geschichte einer Holocaust-Überlebenden. Wie Victor E. Frankl in »…trotzdem Ja zum Leben sagen« weist uns Edith Eger durch ihr persönliches Schicksal und anhand von Beispielen aus ihrer therapeutischen Praxis den Weg: Wir haben immer die Wahl zu lieben oder zu hassen.
Das btb-Hardcover ist unter dem Titel »Ich bin hier, und alles ist jetzt« erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Im Alter von 16 Jahren wurde Edith Eger 1944 aus ihrem Heimatland Ungarn nach Auschwitz verschleppt. Dort sah sie ihre Mutter in die Gaskammer gehen und musste vor Josef Mengele um ihr Leben tanzen. Es grenzt an ein Wunder, dass Edith die Grauen der Lager überlebte. In den USA baute sie sich ein neues Leben auf und wurde erfolgreiche Psychologin und Therapeutin. Ihr lebensbejahendes Buch ist mehr als die außerordentliche Geschichte einer Holocaust-Überlebenden.
Wie Victor E. Frankl in »… trotzdem Ja zum Leben sagen« weist uns Edith Eger durch ihr persönliches Schicksal und anhand von Beispielen aus ihrer therapeutischen Praxis den Weg, wie wir uns aus unserem inneren Gefängnis befreien können: Wir haben immer die Wahl zu lieben oder zu hassen.
Zur Autorin
DR EDITH EVA EGER ist Psychologin und Therapeutin mit einer Praxis in La Jolla, Kalifornien. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf posttraumatischen Belastungsstörungen. Eger unterrichtet an der University of California, San Diego und ist national und international eine gefragte Rednerin. Sie ist Mutter, Großmutter und Urgroßmutter und lebt in La Jolla.https://dreditheger.com/
Dr. Edith Eva Eger
mit Esmé Schwall Weigand
In der Hölle tanzen
Wie ich Auschwitz überlebte und meine Freiheit fand
Aus dem Englischenvon Liselotte Prugger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »The Choice: Embrace the Possible« bei Scribner, An Imprint of Simon & Schuster, Inc., New York. Die deutsche Hardcoverausgabe ist unter dem Titel »Ich bin hier, und alles ist jetzt« bei btb erschienen. Copyright © 2017 by Dr. Edith Eger
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München, nach einem Entwurf
und unter Verwendung einer Illustration von Two Associates
Covermotiv: © Two Associates
MK · Herstellung: sc
Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN 978-3-641-25425-4 V002 www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für die fünf Generationen meiner Familie:meinen Vater Lajos, der mich lachen lehrte;meine Mutter Ilona, die mir finden half, was ich innerlich brauchte;meine wunderbaren und unglaublichen Schwestern Magda und Klara;meine Kinder Marianne, Audrey und Johnund deren Kinder Lindsey, Jordan, Rachel, David und Ashleyund deren Kindeskinder: Silas, Graham und Hale
Inhalt
Vorwort
TEIL I – GEFÄNGNIS
EINFÜHRUNG – Ich hatte mein Geheimnis, und mein Geheimnis hatte mich
KAPITEL 1 – Die vier Fragen
KAPITEL 2 – Was du in deinen Kopf hineintust
KAPITEL 3 – In der Hölle tanzen
KAPITEL 4 – Ein Rad schlagen
KAPITEL 5 – Die Todesstiege
KAPITEL 6 – Einen Grashalm aussuchen
TEIL II – FLUCHT
KAPITEL 7 – Mein Befreier, mein Angreifer
KAPITEL 8 – Durch ein Fenster hinein
KAPITEL 9 – Nächstes Jahr in Jerusalem
KAPITEL 10 – Flucht
TEIL III – FREIHEIT
KAPITEL 11 – Tag der Immigration
KAPITEL 12 – Greener
KAPITEL 13 – Sie waren dort?
KAPITEL 14 – Von einem Überlebenden zum anderen
KAPITEL 15 – Was das Leben erwartete
KAPITEL 16 – Die Entscheidung
KAPITEL 17 – Dann gewann Hitler
KAPITEL 18 – Goebbels’ Bett
KAPITEL 19 – Einen Stein hinlegen
TEIL IV – HEILEN
KAPITEL 20 – Der Tanz der Freiheit
KAPITEL 21 – Das Mädchen ohne Hände
KAPITEL 22 – Irgendwie teilt sich das Meer
KAPITEL 23 – Der Tag der Befreiung
Danksagung
Personenregister
Ortsregister
Über die Autorin
Vorwort
VON PHILIP ZIMBARDO, PHD
An einem Tag im Frühling bestieg Dr. Edith Eva Eger auf Einladung des Chefpsychiaters der U.S. Marine einen fensterlosen Kampfjet, der sie auf eines der weltgrößten Kriegsschiffe, den vor der kalifornischen Küste liegenden Flugzeugträger USS Nimitz brachte. Der Jet stieß auf eine winzige, nicht einmal zweihundert Meter lange Rollbahn hinunter und landete mit einem Ruck, als sein Fanghaken das Bremsseil erfasste, das verhindert, dass der Jet ins Meer schlittert. Dr. Eger, die einzige Frau auf dem Schiff, wurde zu ihrer Kajüte in der Kabine des Kapitäns begleitet. Was war ihre Mission? Sie war gekommen, um fünftausend jungen Marinesoldaten zu zeigen, wie sie mit den Widrigkeiten, dem Trauma und dem Chaos in Kriegen umgehen.
Bei zahllosen Gelegenheiten war Dr. Eger die klinische Expertin, die hinzugezogen wurde, um Soldaten, darunter auch Sondereinsatzkräfte, zu behandeln, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung und traumatischen Hirnverletzungen leiden. Wie konnte es sein, dass diese sanfte Großmutter so vielen Militärangehörigen half, Heilung von der seelischen Brutalität des Krieges zu finden?
Bevor ich Dr. Eger persönlich traf, rief ich sie an und lud sie ein, einen Gastvortrag in meinem Psychology of Mind Control-Seminar in Stanford zu halten. Angesichts ihres fortgeschrittenen Alters und ihres Akzents hatte ich sie mir als eine Babuschka der alten Welt mit unter dem Kinn gebundenem Kopftuch vorgestellt. Als sie zu meinen Studenten sprach, spürte auch ich ihre heilenden Kräfte. Mit ihrem strahlenden Lächeln, den funkelnden Ohrringen, dem glänzenden, goldblonden Haar, von Kopf bis Fuß in Chanel gekleidet (wie ich später von meiner Frau erfuhr), stand sie auf dem Podium und erzählte von den schrecklichen und grauenhaften Erinnerungen an ihren Überlebenskampf in den Nazi-Todeslagern mit Humor, mit ihrer optimistischen und quirligen Art und mit einer Präsenz und Wärme, die ich nur als reines Licht beschreiben kann.
In Dr. Egers Leben gab es unendlich viele dunkle Phasen. Sie wurde in Auschwitz interniert, als sie noch ein Teenager war. Trotz Folter, Hunger und der ständig drohenden Gefahr der Vernichtung bewahrte sie sich ihre mentale und spirituelle Freiheit. Sie zerbrach nicht an dem Grauen, das sie erlebte; sie ging daraus vielmehr ermutigt und gestärkt hervor. Ihre Weisheit gründet tief in diesen schrecklichsten Episoden ihres Lebens.
Sie kann anderen helfen, Heilung zu finden, denn sie selbst hat den Weg von Trauma zu Triumph zurückgelegt. Sie hat entdeckt, wie sie ihre Erfahrungen mit der menschlichen Grausamkeit nutzen kann, um vielen anderen Menschen Kraft zu geben – angefangen bei Armeeangehörigen, wie jenen an Bord der USSNimitz, über Paare, die darum kämpfen, ihre Vertrautheit wiederzuerlangen, und jene, die vernachlässigt oder misshandelt wurden, bis hin zu jenen, die an Sucht oder Krankheit leiden. Von jenen, die geliebte Menschen verloren haben, bis hin zu jenen, die die Hoffnung verloren haben. Und uns alle, die wir an den alltäglichen Enttäuschungen und Herausforderungen des Lebens leiden, ermutigt ihre Botschaft, selbst Entscheidungen zu treffen, um uns von unseren Qualen zu befreien – um unser eigenes inneres Licht zu finden.
Als sie ihre Vorlesung beendet hatte, sprangen sämtliche meiner dreihundert Studenten zu einer spontanen Standing Ovation von ihren Sitzen. Danach stürmten mindestens hundert junge Männer und Frauen die kleine Bühne und reihten sich ein, um dieser außergewöhnlichen Frau zu danken und sie zu umarmen. In den vielen Jahrzehnten, die ich nun schon lehre, habe ich noch nie eine so begeisterte Studentengruppe erlebt wie an jenem Tag.
In den zwanzig Jahren, die Edie und ich nun schon zusammen arbeiten und reisen, habe ich gelernt, diese Reaktion von jedem Publikum auf der Welt zu erwarten, vor dem sie spricht. Das gilt für den »runden Tisch für Helden«, dem Hero Round Table in Flint, Michigan, wo wir vor einer Gruppe junger Menschen in einer Stadt sprachen, die mit großer Armut, fünfzig Prozent Arbeitslosigkeit und wachsenden Rassenkonflikten kämpft. Und das gilt auch für Budapest, die Stadt, in der viele von Edies Verwandten ums Leben gekommen sind und wo sie vor Hunderten Menschen sprach und versuchte, auf einer schwer belasteten Vergangenheit wieder aufzubauen. Ich habe es immer wieder erlebt: In Edies Anwesenheit werden die Menschen verwandelt.
Im vorliegenden Buch verwebt Dr. Eger die Geschichten über die Verwandlung ihrer Patienten mit ihrer eigenen, unvergessenen Geschichte als Auschwitz-Überlebende. Während die Geschichte ihres Überlebens genauso packend und dramatisch ist wie alle Berichte, die dazu schon geschrieben wurden, ist es nicht nur ihre Geschichte, die meine Leidenschaft geweckt hat, dieses Buch in der Welt bekannt zu machen. Es ist die Tatsache, dass Edie ihre Erfahrungen dazu benutzt, so vielen Menschen dabei zu helfen, wirkliche Freiheit zu entdecken. Und deshalb ist ihr Buch viel mehr als eine weitere Erinnerung an die Shoah, so wichtig solche Dokumente für die Vergangenheitsbewältigung auch sind. Ihr Ziel ist nichts Geringeres, als uns allen zu helfen, aus den Kerkern unserer eigenen Köpfe auszubrechen. Auf die eine oder andere Art sind wir alle mental gefangen, und Edies Mission ist es, uns zu der Erkenntnis zu verhelfen, dass wir genauso, wie wir als unsere eigenen Kerkermeister agieren, auch unsere eigenen Befreier sein können.
Wenn Edie jungen Zuhörern vorgestellt wird, nennen die Leute sie oft »die Anne Frank, die nicht gestorben ist«, denn Edie und Anne waren etwa im gleichen Alter und kamen aus ähnlichen Verhältnissen, als sie in die Lager deportiert wurden. Beide junge Frauen bewahrten ihre Unschuld und ihr Mitgefühl, die sie trotz der Grausamkeit und der Verfolgung, die sie erleben mussten, an das grundsätzlich Gute im Menschen glauben ließen. Natürlich hatte Anne Frank, als sie ihr Tagebuch schrieb, das unsägliche Elend in den Lagern noch vor sich, und das macht Edies Erkenntnisse als Überlebende und als Klinikerin (sowie als Urgroßmutter!) besonders bewegend und fesselnd.
Dr. Egers Buch enthüllt sowohl die dunkelste Seite des Bösen als auch die unbeugsame Stärke des menschlichen Geistes im Angesicht des Bösen. Aber es macht auch noch etwas anderes. Am besten lässt sich Edies Buch vielleicht mit einer anderen Erinnerung an die Shoah vergleichen: Mit Viktor Frankls brillantem Klassiker …trotzdem Ja zum Leben sagen. Dr. Eger teilt Frankls Profundität und sein tiefes Wissen über Humanität, fügt dem aber noch die Wärme und Vertrautheit einer langjährigen Klinikärztin hinzu. Viktor Frankl stellt die Psychologie von Gefangenen vor, die mit ihm in Auschwitz waren. Dr. Eger bringt uns die Psychologie der Freiheit nahe.
Im Rahmen meiner eigenen Arbeit habe ich mich ausführlich mit den psychologischen Grundlagen negativer Arten gesellschaftlicher Einflussnahme beschäftigt. Ich wollte die Mechanismen verstehen, aufgrund derer wir uns anpassen und gehorchen und selbst dann in Situationen ausharren, wenn wir Frieden und Gerechtigkeit nur erlangen können, wenn wir einen anderen Weg wählen: wenn wir heldenhaft handeln. Edie hat mir geholfen zu erkennen, dass Heldentum nicht nur das Vorrecht derjenigen ist, die außerordentliche Taten vollbringen oder impulsiv Risiken auf sich nehmen, um sich selbst oder andere zu beschützen – obgleich Edie beides getan hat. Heldentum ist vielmehr eine Geisteshaltung oder ein Akkumulieren unserer persönlichen und sozialen Gewohnheiten. Es ist eine Art zu sein. Und es ist eine besondere Art, uns zu sehen. Um ein Held zu sein, ist es notwendig, an wichtigen Kreuzungspunkten unseres Lebens aktiv den Versuch zu unternehmen, Ungerechtigkeiten zu thematisieren oder einen positiven Wandel auf der Welt herbeizuführen. Um ein Held zu sein, bedarf es großen, moralischen Mutes. Und in jedem von uns wohnt ein Held, der nur darauf wartet, in Aktion zu treten. Wir sind alle »Helden in Ausbildung«. Unsere Ausbildung zum Helden ist das Leben, sind die täglichen Begebenheiten, die es uns ermöglichen, das zu tun, was einen Helden ausmacht: täglich gute Taten vollbringen; Mitgefühl ausstrahlen, was mit Selbstmitgefühl beginnt; das Beste aus anderen und aus uns herausholen; Liebe bewahren, auch in unseren schwierigsten Beziehungen; die Kraft unserer mentalen Freiheit loben und ausüben. Edie ist eine Heldin – und noch mehr als das, denn sie lehrt jeden von uns, zu wachsen und sinnvolle und anhaltende Veränderungen in uns selbst zu bewirken, in unseren Beziehungen und in unserer Welt.
Vor zwei Jahren reisten Edie und ich zusammen nach Budapest, in die Stadt, in der ihre Schwester lebte, als die Nazis begannen, ungarische Juden zusammenzutreiben. Wir besuchten eine jüdische Synagoge, deren Innenhof ein Denkmal für den Holocaust ist, an den Wänden Fotos aus der Zeit vor, während und nach dem Krieg. Wir besuchten das Denkmal »Schuhe am Donauufer« zum Gedenken an die Menschen – darunter auch Familienmitglieder von Edie –, die im Zweiten Weltkrieg von den Militaristen der faschistischen Pfeilkreuzler ermordet wurden: Man hat sie gezwungen, sich ans Ufer zu stellen und die Schuhe auszuziehen. Dann wurden sie erschossen, ihre Körper fielen ins Wasser und wurden von der Strömung davongetragen. Die Vergangenheit war fühlbar an diesem Ort.
Im Lauf des Tages wurde Edie immer stiller. Ich fragte mich, ob es nach dieser emotionalen Reise, die mit Sicherheit schmerzliche Erinnerungen heraufbeschworen hatte, für sie schwierig sein würde, am selben Abend vor sechshundert Zuhörern zu sprechen. Aber als sie auf die Bühne kam, leitete sie ihren Vortrag nicht mit einer Geschichte über Angst, Trauma oder Entsetzen ein, dem Thema, das unser Besuch für sie vermutlich allzu deutlich hatte aufleben lassen. Sie begann mit einer Geschichte über Freundlichkeit, über eine alltägliche Heldentat, die es, wie sie uns erinnerte, sogar in der Hölle gab. »Ist es nicht erstaunlich?«, sagte sie. »Das Schlimmste fördert das Beste in uns zutage.«
Am Ende ihrer Rede, die sie wie nach jedem Vortrag mit einem hohen Kick beendete, rief Edie ins Publikum: »Und nun lasst uns alle tanzen!« Alle Zuschauer erhoben sich. Hunderte Menschen liefen auf die Bühne. Es gab keine Musik. Aber wir tanzten. Wir tanzten, sangen, lachten, umarmten uns und feierten das unvergleichliche Fest des Lebens.
Dr. Eger gehört zur schwindenden Zahl von Überlebenden, die noch aus erster Hand Zeugnis über das Grauen in Konzentrationslagern ablegen können. Ihr Buch erzählt von der Hölle und von Traumata, die sie und andere Überlebende während des Krieges und danach durchgestanden haben. Und es ist eine weltumspannende Botschaft der Hoffnung und der Chancen für alle, die versuchen, sich von Qualen und von Leid zu befreien. Ob gefangen in schlechten Ehen, zerstörerischen Familien oder ungeliebten Jobs oder mental eingesperrt im Stacheldrahtkäfig selbstlimitierender Überzeugungen, werden Leser aus diesem Buch lernen, dass sie sich unabhängig von ihren persönlichen Lebensumständen für Lebensfreude und Freiheit entscheiden können.
Ich bin hier, und alles ist jetzt ist eine außergewöhnliche Chronik des Heldentums und der Heilung, der Widerstandskraft und des Mitgefühls, des Überlebens mit Würde, der mentalen Belastbarkeit und moralischen Courage. Wir alle können aus Dr. Egers beeindruckenden Fällen und aus ihrer packenden persönlichen Geschichte lernen, Heilung für unser eigenes Leben zu finden.
San Francisco, Kalifornien
Januar 2017
Phil Zimbardo, Psychologe und emeritierter Professor an der Stanford University, hat das berühmte Stanford-Gefängnis-Experiment durchgeführt (1971) und ist Autor vieler beachtenswerter Bücher, unter ihnen Der Luzifer Effekt: Die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen (2007), New-York-Times-Bestseller und Gewinner des William-James-Preises. Er ist Gründer und Vorsitzender des Heroic Imagination Projects.
TEIL IGEFÄNGNIS
EINFÜHRUNG Ich hatte mein Geheimnis, und mein Geheimnis hatte mich
Ich wusste nichts von der geladenen Waffe unter seinem Hemd, aber in dem Moment, in dem Hauptmann Jason Fuller an einem Tag im Sommer 1980 meine Praxis in El Paso betrat, spürte ich einen Kloß im Hals und ein Kribbeln im Nacken. Im Krieg hatte ich gelernt, Gefahren zu erahnen, noch bevor ich erklären konnte, was der Grund für mein mulmiges Gefühl war.
Jason war hochgewachsen, mit der sehnigen Figur eines Athleten, doch sein Körper war so steif, dass er eher marionettenhaft als menschlich wirkte. Seine blauen Augen waren abwesend, sein Kinn wie festgezurrt, und er wollte – oder konnte – nichts sagen. Ich steuerte ihn zur weißen Couch in meiner Praxis. Er saß angespannt da und presste die Fäuste auf die Knie. Ich hatte Jason noch nie gesehen und keine Vorstellung, was seinen katatonischen Zustand ausgelöst hatte. Er saß kaum eine Armlänge von mir entfernt, seine Seelenqual war offensichtlich, und doch war er weit weg, verloren. Anscheinend bemerkte er nicht einmal meinen silbernen Königspudel Tess, der wachsam neben meinem Schreibtisch stand – die zweite lebende Statue im Raum.
Ich holte tief Luft und überlegte, wie ich beginnen sollte. Manchmal beginne ich eine erste Sitzung damit, dass ich mich vorstelle und kurz über meine Vergangenheit und meine Herangehensweise spreche. Manchmal komme ich direkt auf den Punkt und identifiziere und untersuche die Gefühle, die den Patienten in meine Praxis geführt haben. Bei Jason hielt ich es für wichtig, ihn nicht mit zu vielen Informationen zu überfordern oder ihn zu bitten, sich zu schnell zu öffnen. Er hatte vollkommen dichtgemacht. Ich musste einen Weg finden, ihm die Sicherheit und die Zugewandtheit zu vermitteln, die er brauchte, um das Risiko einzugehen, mir das zu zeigen, was er so sorgsam verborgen hielt. Und ich musste auf die Warnsignale meines Körpers achten, ohne zuzulassen, dass mein siebenter Sinn für Gefahr meine Fähigkeit zu helfen überlagerte.
»Wie kann ich Ihnen von Nutzen sein?«, fragte ich.
Er gab keine Antwort. Er blinzelte nicht einmal. Er erinnerte mich an eine zu Stein verwandelte Figur in einer Sage oder einem Volksmärchen. Welcher Zauberspruch konnte ihn wohl erlösen?
»Warum jetzt?«, fragte ich. Das war meine Geheimwaffe. Die Frage, die ich meinen Patienten bei ihrem ersten Besuch immer stelle. Ich muss wissen, was sie motiviert, sich zu ändern. Warum wollen sie ausgerechnet heute mit mir zu arbeiten anfangen? Warum ist heute anders als gestern oder letzte Woche oder letztes Jahr? Warum ist heute anders als morgen? Manchmal schieben uns unsere Seelenqualen, und manchmal zieht uns unsere Hoffnung. Mit »Warum jetzt?« stellen wir nicht nur eine Frage – wir fragen nach allem.
Eines seiner Augen zuckte und schloss sich kurz. Aber er sagte nichts.
»Erzählen Sie mir, weshalb Sie hier sind«, ermunterte ich ihn abermals.
Er sagte immer noch nichts.
Mein Körper spannte sich an, als eine Welle der Ungewissheit über ihn hinwegrollte und ich mir des heiklen und wichtigen Scheidewegs bewusst wurde, an dem wir uns befanden: zwei Menschen, die einander gegenübersaßen, beide angreifbar, beide bereit zum Risiko, eine Seelenqual zu benennen und einen Weg zur Heilung zu finden. Jason war nicht auf dem üblichen Weg zu mir überwiesen worden. Anscheinend hatte er sich aus eigenem Antrieb entschlossen, meine Praxis aufzusuchen. Aber ich wusste aus meiner eigenen klinischen und persönlichen Erfahrung, dass selbst dann, wenn jemand sich entschließt, Heilung zu finden, es sein kann, dass die Blockade sich noch über Jahre hinzieht.
Falls es mir nicht gelingen sollte, zu ihm durchzudringen, hatte ich angesichts der ernsten Symptome, die er aufwies, nur die Wahl, ihn an meinen Kollegen Dr. Harold Kolmer, Chefpsychiater am William Beaumont Army Medical Center, zu verweisen, wo ich meine Doktorarbeit gemacht hatte. Er würde Jasons Katatonie diagnostizieren, ihn stationär aufnehmen und ihm vermutlich Haldol oder ein anderes antipsychotisches Medikament verabreichen. Ich stellte mir Jason mit immer noch glasigen Augen in einem Krankenhauskittel vor, sein Körper nun vollends von Muskelkrämpfen blockiert und geplagt, die oft als Folge der gegen Psychosen eingesetzten Medikamente auftreten. Ich vertraue der Expertise meiner Kollegen in der Psychiatrie voll und ganz, und ich bin für die medikamentöse Behandlung dankbar, die Leben rettet. Aber ich wehre mich gegen eine voreilige stationäre Behandlung, solange noch die Chance auf eine erfolgreiche therapeutische Intervention besteht. Hätte ich Jason einen stationären Aufenthalt mit medizinischer Behandlung empfohlen, ohne vorher andere Optionen erwogen zu haben, stand zu befürchten, dass er die eine Starre gegen eine andere eintauschte, starre Gliedmaßen gegen unwillkürliche Dyskinäsie-Bewegungen – unkoordinierte, ruckartige Abläufe wiederkehrender Tics und Bewegungen, wenn das Nervensystems das Signal an den Körper schickt, sich zu bewegen, ohne dass das Gehirn den Befehl dazu gibt. Seine Qualen, was immer sie ausgelöst haben mochte, konnten von den Medikamenten stummgeschaltet, aber nicht behoben werden. Er mochte sich besser fühlen oder auch weniger empfinden – was wir oft als Besserung missverstehen –, aber er wäre nicht geheilt.
Was jetzt?, fragte ich mich, während die Minuten sich endlos dahinschleppten und Jason stocksteif auf meiner Couch saß – freiwillig zwar, aber immer noch eingekerkert. Ich hatte nur eine Stunde zur Verfügung. Nur eine Chance. Konnte ich zu ihm durchdringen? Konnte ich ihm helfen, sein Potenzial für Gewalt aufzulösen, die Gewalt, die ich so deutlich spürte wie die Luft der Klimaanlage auf meiner Haut? Konnte ich ihm helfen zu erkennen, dass er unabhängig von seinem Problem oder seiner Qual den Schlüssel zu seiner eigenen Freiheit bereits in Händen hielt? Damals konnte ich noch nicht wissen, dass Jason, falls ich an ebenjenem Tag nicht zu ihm durchgedrungen wäre, ein viel schlimmeres Schicksal als ein Krankenzimmer ereilt hätte – ein Leben in einem wirklichen Gefängnis und dort vermutlich im Todestrakt. Damals wusste ich nur, dass ich es versuchen musste.
Als ich Jason betrachtete, war mir klar, dass ich keine gefühlsbetonte Sprache wählen durfte, wenn ich ihn erreichen wollte; ich musste eine Sprache wählen, die einem Armeeangehörigen angenehmer und vertrauter ist. Ich würde Befehle erteilen. Ich spürte, dass es nur eine Hoffnung gab, seine Sperre zu lösen: Ich musste seinen Kreislauf in Schwung bringen.
»Wir gehen spazieren«, sagte ich. Ich fragte nicht. Ich gab ihm den Befehl. »Wir werden mit Tess in den Park gehen, Hauptmann Fuller. Jetzt sofort.«
Panik huschte über sein Gesicht. Da war eine Frau, eine Fremde mit ausgeprägtem ungarischen Akzent, die ihm sagte, was er zu tun hatte. Ich sah, wie er um sich blickte und sich fragte: »Wie komme ich hier raus?« Aber er war ein guter Soldat. Er stand auf.
»Ja, Ma’am«, sagte er. »Ja, Ma’am.«
Schon bald sollte ich den Ursprung von Jasons Trauma entdecken, und er sollte entdecken, dass wir trotz unserer offensichtlichen Unterschiede auch vieles gemeinsam hatten. Wir hatten beide Gewalterfahrung. Und wir wussten beide, wie es sich anfühlte zu erstarren. Auch ich trug eine Wunde mit mir herum, einen Schmerz, so abgrundtief, dass ich viele Jahre überhaupt nicht darüber sprechen konnte. Mit niemandem.
Meine Vergangenheit verfolgte mich noch immer; ein banges, benommenes Gefühl, immer, wenn ich Sirenen hörte, schwere Schritte oder laute Männerstimmen. Das ist ein Trauma, hatte ich gelernt: ein fast ständiges Gefühl im Bauch, dass etwas nicht stimmt oder dass gleich etwas Schreckliches passiert, automatische Angstreaktionen in meinem Körper, die mich auffordern, wegzurennen, Schutz zu suchen oder mich vor der allgegenwärtigen Gefahr zu verstecken. Mein Trauma kann bei alltäglichen Ereignissen immer noch aufleben. Ein plötzlicher Anblick, ein bestimmter Geruch kann mich in die Vergangenheit versetzen. An dem Tag, an dem ich Hauptmann Fuller kennenlernte, war es mehr als dreißig Jahre her, seit ich aus dem Konzentrationslager des Holocaust befreit worden war. Heute sind mehr als siebzig Jahre vergangen. Was geschehen ist, kann niemals vergessen und niemals geändert werden. Aber im Lauf der Zeit habe ich gelernt, dass ich selbst entscheiden kann, wie ich auf die Vergangenheit reagiere. Ich kann mich elend fühlen, oder ich kann hoffnungsvoll sein – ich kann niedergeschlagen sein oder glücklich. Diese Wahl haben wir immer, diese Möglichkeit der Kontrolle. Ich bin hier, und alles ist jetzt, das habe ich gelernt, mir immer wieder vorzusagen, bis das panische Gefühl allmählich abebbt.
Immer wieder stoße ich auf Ratschläge wie diesen: Wenn dich etwas stört oder ängstigt, dann sieh nicht hin. Beschäftige dich nicht damit. Geh ihm aus dem Weg. Und so verweigern wir uns vergangenen Verletzungen und Entbehrungen oder aktuellen Unannehmlichkeiten und Konflikten. Einen großen Teil meines Erwachsenenlebens war ich davon ausgegangen, dass ich die Gegenwart nur durchstehen konnte, wenn ich die Vergangenheit und ihre Schrecknisse unter Verschluss hielt. In meinen ersten Jahren als Immigrantin in Baltimore in den 1950er-Jahren wusste ich nicht einmal, wie man Auschwitz auf Englisch ausspricht. Und selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich nicht erzählen wollen, dass ich dort gewesen bin. Ich wollte kein Mitleid. Ich wollte nicht, dass jemand es wusste.
Ich wollte nichts weiter als ein waschechter Yankee sein. Und akzentfrei Englisch sprechen. Und die Vergangenheit totschweigen. Aus meiner Sehnsucht heraus, dazuzugehören, aus meiner Angst heraus, die Vergangenheit könnte mich überwältigen, setzte ich alles daran, meine schlimmen Erlebnisse unter Verschluss zu halten. Ich hatte noch nicht erkannt, dass mein Schweigen und meine Sehnsucht nach Akzeptanz – beides gegründet auf Furcht – eine Art Flucht vor mir selbst waren. Und dadurch, dass ich beschlossen hatte, mich nicht mit der Vergangenheit und mit mir selbst auseinanderzusetzen, hatte ich auch Jahrzehnte nach meiner eigentlichen Befreiung beschlossen, immer noch nicht frei zu sein. Ich hatte mein Geheimnis, und mein Geheimnis hatte mich.
Der katatonische Armeeangehörige, der unbeweglich auf meiner Couch saß, erinnerte mich an das, was ich irgendwann entdeckt hatte: Wenn wir unsere Wahrheiten und Geschichten dazu verdammen, verborgen zu bleiben, dann können unsere Geheimnisse selbst zum Trauma, zu unserem Gefängnis werden. Denn statt unsere Qualen zu verringern, geschieht Folgendes: Wenn wir uns die Möglichkeit versagen, anzunehmen, was immer es sein mag, dann wird es sich als genauso ausbruchssicher wie Gefängnismauern und stählerne Gitter erweisen. Wenn wir uns nicht zugestehen, unsere Verluste, Wunden und Enttäuschungen zu betrauern, sind wir dazu verurteilt, sie immer neu zu durchleben.
Freiheit finden wir nur, wenn wir lernen, das Geschehene anzunehmen. Freiheit bedeutet, dass wir den Mut aufbringen müssen, das Gefängnis Stein für Stein abzureißen. Schlimme Dinge, das ist leider so, passieren jedem von uns. Das ist nicht zu ändern. Wenn Sie Ihre Geburtsurkunde ansehen: Steht da etwa, dass Ihr Leben einfach sein wird? Nein. Aber so viele von uns verheddern sich in einem Trauma oder einer Trauer, unfähig, das Leben in seiner Fülle zu genießen. Das können wir ändern.
Kürzlich wartete ich am Kennedy Airport auf meinen Heimflug nach San Diego und studierte die Gesichter aller Vorbeikommenden. Das, was ich sah, bewegte mich tief. Ich sah Langeweile, Wut, Anspannung, Sorge, Verwirrung, Entmutigung, Enttäuschung, Traurigkeit und, was mich am meisten beunruhigte: Leere. So wenig Freude und lachende Gesichter zu sehen, machte mich traurig. Selbst die langweiligsten Augenblicke in unserem Leben sind Gelegenheiten, Hoffnung, Auftrieb, Glück zu erfahren. Alltagsleben ist auch Leben. Und auch qualvolles und anstrengendes Leben ist Leben. Warum strengen wir uns so oft an, uns lebendig zu fühlen, oder weigern uns, das Leben in seiner Fülle zu spüren? Warum ist es eine solche Herausforderung, Leben ins Leben zu bringen?
Sollten Sie mich nach der häufigsten Diagnose bei den Menschen, die ich behandle, fragen, würde ich nicht Depression oder Posttraumatische Belastungsstörung an die erste Stelle setzen. Obgleich diese Beschwerden unter den Patienten, die ich kennenlernte, die ich mochte und denen ich den Weg in die Freiheit wies, nur allzu üblich sind. Nein, ich würde sagen, es ist Hunger. Wir sind hungrig. Wir sind hungrig nach Anerkennung, Zuwendung, Zuneigung. Wir sind hungrig nach der Freiheit, das Leben anzunehmen, hungrig danach, uns wirklich zu kennen und wir selbst zu sein.
Meine eigene Suche nach Freiheit und meine jahrelange Erfahrung als approbierte klinische Psychologin haben mich gelehrt, dass Leid universell ist. Aber unsere Opferrolle ist selbstgemacht. Es gibt einen Unterschied zwischen Viktimisierung und Opferrolle. Im Lauf unseres Lebens ist es gut möglich, dass wir alle auf die eine oder andere Weise viktimisiert werden. Irgendwann werden wir aufgrund von Begleitumständen, Menschen oder Institutionen, über die wir wenig oder keine Kontrolle haben, an einem Kummer, einem Schicksalsschlag oder an einem Missstand leiden. Das ist das Leben. Und das ist Viktimisierung. Sie kommt von außen. Es ist der Rüpel aus der Nachbarschaft, der Chef, der tobt, der Ehepartner, der schlägt, der geliebte Mensch, der betrügt, das diskriminierende Gesetz oder der Unfall, der uns ins Krankenhaus bringt.
Im Gegensatz dazu kommt die Opferrolle von innen. Niemand außer Ihnen selbst kann Sie zu einem Opfer machen. Wir werden zum Opfer nicht durch das, was uns passiert, sondern dann, wenn wir an unserer Viktimisierung festhalten. Wir entwickeln eine Opfermentalität – eine Art, zu denken und zu sein, die unbeugsam ist, anklagend, pessimistisch, in der Vergangenheit festgefahren, unversöhnlich, strafend und ohne gesunde Beschränkungen oder Grenzen. Wenn wir beschließen, in den Mauern unserer Opfermentalität zu bleiben, werden wir zu unserem eigenen Kerkermeister.
Eines möchte ich unbedingt klarstellen: Wenn ich über Opfer und Kämpfernaturen spreche, schiebe ich den Opfern keine Schuld zu, denn so viele von ihnen hatten nie eine Chance. Ich könnte niemals diejenigen Menschen beschuldigen, die auf direktem Weg in die Gaskammern geschickt wurden oder die auf ihrer Pritsche starben, auch nicht diejenigen, die sich in die elektrisch geladenen Stacheldrahtzäune warfen. Ich trauere um alle Menschen, die dazu verurteilt sind, in einer Welt von Gewalt und Zerstörung zu leben. Ich lebe dafür, anderen angesichts der unterschiedlichsten Schicksalsschläge den Rücken zu stärken.
Ich möchte auch sagen, dass Leiden nicht hierarchisch eingeordnet werden kann. Es gibt nichts, was mein Leid schlechter oder besser macht als ein anderes, kein Diagramm, mit dem wir die relative Bedeutung eines Kummers versus eines anderen darstellen könnten. Manchmal höre ich: »Momentan setzt mir mein Leben ziemlich zu, aber ich darf mich nicht beklagen: Es ist nicht Auschwitz.« Ein solcher Vergleich kann uns dazu bringen, unseren eigenen Kummer zu bagatellisieren oder kleinzureden. Um eine Kämpfernatur, ein starker Mensch zu sein, ist es erforderlich, das, was war, und das, was ist, ohne Wenn und Aber zu akzeptieren. Wenn wir unsere Seelenqualen schmälern oder uns dafür bestrafen, dass wir uns verloren oder isoliert fühlen, oder wenn wir uns vor den Herausforderungen in unserem Leben ängstigen, egal, wie marginal diese Herausforderungen anderen auch erscheinen mögen, dann treffen wir immer noch die Wahl, Opfer zu sein. Wir erkennen unsere Alternativen nicht. Wir richten über uns. Ich möchte nicht, dass Sie meine Geschichte hören und sagen: »Mein eigener Kummer ist weniger bedeutend.« Ich möchte, dass Sie meine Geschichte hören und sagen: »Wenn sie das schafft, dann schaffe ich das auch!«
Einmal hatte ich an einem Vormittag direkt hintereinander zwei Patientinnen, beide Mütter in den Vierzigern. Die erste Frau hatte eine Tochter, die an Hämophilie litt und im Sterben lag. Die Mutter weinte fast die ganze Sitzung lang und fragte mich, wie Gott ihr nur das Leben ihres Kindes nehmen konnte. Mir tat die Frau unendlich leid – sie widmete ihr Leben ausschließlich der Pflege ihrer Tochter, und der bevorstehende Verlust setzte ihr schrecklich zu. Sie war wütend, sie trauerte, und sie wusste nicht, ob sie diesen Schicksalsschlag würde ertragen können.
Meine nächste Patientin kam direkt aus dem Country Club, nicht aus dem Krankenhaus. Auch sie weinte fast die ganze Stunde lang. Sie ärgerte sich, weil ihr soeben gelieferter Cadillac nicht den richtigen Gelbton hatte. Oberflächlich betrachtet, schien ihr Problem lächerlich, besonders im Vergleich zu den Seelenqualen, die meine vorhergehende Patientin wegen ihres sterbenden Kindes litt. Aber ich wusste genug von meiner Patientin, um zu verstehen, dass die Tränen der Enttäuschung ob der Farbe ihres Autos in Wahrheit Tränen der Enttäuschung über andere, wichtigere Dinge waren, die sich in ihrem Leben nicht wie erhofft entwickelt hatten: eine einsame Ehe, ein Sohn, der zum wiederholten Mal von einer Schule verwiesen wurde, die Erwartungen an eine Karriere, die sie aufgegeben hatte, um mehr Zeit für ihren Ehemann und ihr Kind zu haben. Oft stehen die kleinen Ärgernisse in unserem Leben symbolisch für die größeren Enttäuschungen. Die scheinbar unbedeutenden Sorgen stehen stellvertretend für größere Seelenqualen.
An jenem Tag wurde mir klar, wie viel meine beiden Patientinnen, die auf den ersten Blick so unterschiedlich erschienen, miteinander und mit allen Menschen gemeinsam hatten. Beide Frauen reagierten auf eine Situation, die sie nicht kontrollieren konnten, in der ihre Erwartungen auf den Kopf gestellt wurden. Beide haderten und litten, weil etwas nicht so war, wie sie es sich wünschten oder erwarteten; sie versuchten das, was war, mit dem in Einklang zu bringen, was hätte sein sollen. Die Qualen, die beide Frauen litten, waren echt. Beide Frauen waren in der menschlichen Tragödie verstrickt, dass wir uns in Situationen wiederfinden, die wir nicht haben kommen sehen, in denen wir uns nun überfordert fühlen und mit denen wir nicht umgehen können. Beide Frauen verdienten mein Mitgefühl. Beide hatten das Potenzial, Heilung zu finden. Beide Frauen hatten die Wahl – wie wir alle –, sich für Sichtweisen und Aktionen zu entscheiden, die sie von einem Opfer zu einem Kämpfer machen würden, selbst wenn die Begleitumstände, mit denen sie umgehen mussten, sich nicht änderten. Menschen, die Schicksalsschläge überwunden haben, haben nicht die Zeit, zu fragen: »Warum ich?« Für sie ist die einzig relevante Frage: »Was jetzt?«
Ob Sie sich im Frühling, im Sommer oder im Spätherbst Ihres Lebens befinden, ob Sie tiefes Leid gesehen haben oder sich gerade erst jetzt damit auseinandersetzen müssen, ob sie sich zum ersten Mal verlieben oder im Alter Ihren Lebenspartner verlieren, ob Sie sich gerade von einem tiefen Einschnitt in Ihrem Leben erholen oder einfach hier und da etwas ändern wollen, um mehr Freude in Ihr Leben zu bringen: Ich würde Ihnen gerne helfen, einen Weg zu finden, aus dem Konzentrationslager in Ihrem Kopf auszubrechen und die Person zu werden, die Sie sein möchten. Ich würde Ihnen sehr gern helfen, sich von der Vergangenheit zu befreien, von Misserfolgen und Ängsten, von Wut und Fehlern, von Reue und unverarbeiteter Trauer – und frei zu sein, das rauschende Fest des Lebens in vollen Zügen zu genießen. Wir können uns kein Leben ohne Leid aussuchen. Aber wir können uns aussuchen, dass wir frei sein wollen, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen, egal, was uns zustößt, und dass wir das Mögliche wagen. Ich lade Sie ein, die Entscheidung zu treffen, frei zu sein.
Wie die challah, das Brot, das meine Mutter immer zum Sabbatmahl gebacken hat, enthält auch dieses Buch drei Stränge: die Geschichte meines Überlebens, die Geschichte meiner eigenen Heilung und die Geschichten über die wunderbaren Menschen, denen ich den Weg in die Freiheit weisen durfte. Die dabei gemachten Erfahrungen habe ich so wiedergegeben, wie ich sie am besten erinnere. Die Patientengeschichten sind insofern detailgenau, als sie den Kern der Erlebnisse betreffen, doch habe ich alle Namen und Details, die auf einzelne Personen hinweisen könnten, verändert und in manchen Fällen Patientengeschichten zusammengefasst, in denen ähnliche Herausforderungen zu bewältigen waren. Was folgt, ist die Geschichte von Wahlmöglichkeiten, von großen und kleinen, die uns vom Trauma zum Triumph führen können, von Dunkelheit zum Licht, von Gefangenschaft zur Freiheit.
KAPITEL 1Die vier Fragen
Wenn ich mein ganzes Leben zu einem Moment destillieren könnte, zu einem einzigen Standbild, dann wäre es dieses: drei Frauen in dunklen Wollmänteln warten Arm in Arm in einem tristen Hof. Sie sind erschöpft. Ihre Schuhe sind staubbedeckt. Sie stehen in einer langen Kolonne.
Die drei Frauen sind meine Mutter, meine Schwester Magda und ich. Dies ist unser letzter gemeinsamer Augenblick. Das wissen wir nicht. Wir weigern uns, an so etwas zu denken. Oder wir sind zu ausgelaugt, um überhaupt darüber nachzudenken, was auf uns wartet. Es ist ein Augenblick der Trennung – der Mutter von den Töchtern, von dem Leben, wie es gewesen ist, von all dem, was danach kommen wird. Und doch kann nur der Rückblick ihm diese Bedeutung beimessen.
Ich sehe uns drei von hinten, so, als stünde ich direkt hinter uns in der Kolonne. Warum zeigt mir die Erinnerung den Hinterkopf meiner Mutter, nicht aber ihr Gesicht? Ihr langes Haar ist sorgfältig zu Zöpfen geflochten und auf dem Kopf festgesteckt. Magdas hellbraune Wellen berühren ihre Schulter. Mein dunkles Haar ist unter einem Tuch verborgen. Meine Mutter steht in der Mitte, und Magda und ich lehnen uns beide zu ihr. Es ist unmöglich zu erkennen, ob wir es sind, die unsere Mutter stützen, oder umgekehrt, ob ihre Kraft die Säule ist, die Magda und mich stützt.
Dieser Augenblick markiert eine Schwelle zu den größten Verlusten meines Lebens. Sieben Jahrzehnte lang bin ich immer wieder zu diesem Bild von uns dreien zurückgekehrt. Ich habe es genau studiert, als könnte ich, wenn ich nur genau genug hinsähe, etwas Kostbares wiederentdecken. Als könnte ich das Leben wiedergewinnen, das diesem Moment vorausgeht, das Leben, das vor dem Verlust war. Als ob es so etwas gäbe.
Ich bin zurückgekommen, damit ich ein wenig länger in dieser Zeit verweilen kann, in der unsere Arme untergehakt sind und wir zueinander gehören. Ich sehe unsere abfallenden Schultern. Den Staub, der an den Säumen unserer Mäntel haftet. Meine Mutter. Meine Schwester. Mich. Unsere Kindheitserinnerungen sind oft Fragmente, kurze Augenblicke oder Begebenheiten, die zusammengenommen das Tagebuch unseres Lebens bilden. Sie sind alles, was uns geblieben ist, um die Geschichte zu verstehen, die wir uns jetzt darüber erzählen, wer wir sind.
Schon vor dem Augenblick unserer Trennung ist meine intimste Erinnerung an meine Mutter von Kummer und Verlust gezeichnet, obwohl ich sie in Ehren halte. Wir sind allein in der Küche, in der sie den übrig gebliebenen Strudel verpackt, den sie aus dem Teig gebacken hat, den sie mit der Hand geschnitten und wie ein schweres Tuch auf dem Esstisch ausgezogen hat. »Lies mir vor«, sagt sie, und ich hole das abgegriffene Exemplar von Vom Winde verweht von ihrem Nachtkästchen. Wir sind schon einmal ganz durch damit. Jetzt haben wir wieder von vorn angefangen. Ich halte über der geheimnisvollen Inschrift in englischer Sprache auf der Titelseite des übersetzten Buches inne. Es ist die Handschrift eines Mannes, jedoch nicht die meines Vaters. Alles, was meine Mutter dazu sagen will, ist, dass das Buch ein Geschenk von einem Mann ist, den sie vor meinem Vater gekannt hatte, als sie im Außenministerium arbeitete.
Wir sitzen neben dem Holzofen auf Stühlen mit geraden Lehnen. Ich lese diesen Erwachsenenroman flüssig, obwohl ich erst neun bin. »Ich bin froh, dass du wenigstens Köpfchen hast, wenn du schon nach nichts aussiehst«, hat sie mir mehr als einmal gesagt – ein Kompliment mit eingebauter Kritik. Sie kann manchmal sehr grob zu mir sein. Aber ich genieße diese Zeit. Wenn wir gemeinsam lesen, brauche ich sie nicht mit jemand anderem zu teilen. Ich versenke mich in die Worte und die Geschichte und das Gefühl, mit ihr allein auf der Welt zu sein. Scarlett kehrt bei Kriegsende nach Tara zurück, nur um dort zu erfahren, dass ihre Mutter tot und ihr Vater vor Kummer verwirrt ist. »So wahr Gott mein Zeuge ist«, sagt Scarlett, »ich werde nie wieder Hunger leiden.« Meine Mutter hat die Augen geschlossen und lehnt den Kopf an die Stuhllehne. Ich möchte auf ihren Schoß krabbeln. Ich möchte meinen Kopf an ihre Brust lehnen. Ich möchte, dass sie mein Haar mit den Lippen berührt.
»Tara …«, sagt sie. »Amerika, ja, das ist ein Land, das ich gern sehen würde.« Ich wünschte, sie spräche meinen Namen mit derselben Zärtlichkeit aus, die sie für ein Land empfindet, in dem sie noch nie gewesen ist. Alle Gerüche in der Küche meiner Mutter sind für mich mit dem Drama von Hunger und Festessen vermischt – immer, sogar beim Festessen, diese Sehnsucht. Ich weiß nicht, ob die Sehnsucht ihre Sehnsucht ist oder die meine oder eine, die wir beide empfinden.
Wir sitzen zusammen, der Ofen bullert.
»Als ich in deinem Alter war …«, beginnt sie.
Jetzt, da sie spricht, will ich mich nicht bewegen, aus Angst, sie könnte nicht mehr weitererzählen.
»Als ich in deinem Alter war, schliefen die Babys zusammen, und meine Mutter und ich schliefen in einem Bett. Eines Morgens wachte ich auf, als mein Vater rief: ›Ilonka, weck deine Mutter auf, sie hat kein Frühstück gemacht, und meine Sachen zum Anziehen hat sie auch nicht herausgelegt.‹ Ich habe mich zu Mutter umgedreht, die neben mir unter der Bettdecke lag. Aber sie hat sich nicht bewegt. Sie war tot.«
Sie hat mir das noch nie erzählt. Ich möchte jede Einzelheit dieses Augenblicks erfahren, als eine Tochter neben einer Mutter aufwachte, die sie bereits verloren hatte. Ich möchte auch nicht hinsehen. Es ist zu schrecklich, darüber nachzudenken.
»Als sie an jenem Nachmittag beerdigt wurde, dachte ich, sie hätten sie bei lebendigem Leib in die Erde gelegt. An jenem Abend verlangte mein Vater von mir, das Abendessen für die Familie zu machen. Was ich dann auch tat.«
Ich warte auf den Rest der Geschichte. Ich warte auf die Lektion am Ende oder darauf, dass sie mich beruhigt.
»Zeit zum Schlafengehen«, das ist alles, was meine Mutter sagt. Sie bückt sich und kehrt die Asche unter den Ofen.
Schritte dröhnen über den Korridor. Ich rieche den Tabak meines Vaters, noch ehe ich die Schlüssel rasseln höre.
»Hallo, Ladys«, ruft er, »seid ihr noch wach?« Er kommt mit seinen blitzenden Schuhen, dem eleganten Anzug, seinem breiten Grinsen in die Küche, eine kleine Tüte in der Hand, die er mir mit einem Schmatz auf die Stirn überreicht. »Ich habe wieder gewonnen«, prahlt er. Immer, wenn er mit seinen Freunden Karten oder Billard spielt, teilt er den Gewinn mit mir. Heute Abend hat er ein Petit Four mit rosa Zuckerguss mitgebracht. Wäre ich meine Schwester Magda, würde meine Mutter mir die Leckerei bestimmt wegnehmen, da sie ständig um Magdas Gewicht besorgt ist, aber sie nickt mir zu, erlaubt mir, es zu essen.
Nun steht sie auf und geht vom Ofen zur Spüle. Mein Vater stellt sich ihr in den Weg, nimmt ihre Hand, will sie im Zimmer herumwirbeln. Widerwillig, und ohne zu lächeln, lässt sie es geschehen. Er zieht sie an sich, umarmt sie, eine Hand liegt auf ihrem Rücken, die andere kitzelt ihre Brust. Meine Mutter schüttelt ihn ab.
»Ich bin eine Enttäuschung für deine Mutter«, raunt mein Vater mir zu, als wir aus der Küche gehen. Will er, dass sie es hört, oder ist es ein Geheimnis, das er nur mit mir teilt? Egal, erst einmal lasse ich es so stehen und will mich später damit beschäftigen. Doch die Bitterkeit in seiner Stimme macht mir Angst. »Sie will jeden Abend in die Oper gehen und schick und kosmopolitisch leben. Aber ich bin nur ein Schneider. Ein Schneider und ein Billardspieler.«
Ich bin verwirrt von dem niedergeschlagenen Ton in seiner Stimme. Er ist in unserer Stadt bekannt und beliebt. Mit seinem verspielten Wesen und seiner guten Laune macht er stets einen zufriedenen und lebensfrohen Eindruck. Er ist ein gern gesehener Gast. Er geht mit seinen vielen Freunden aus. Er liebt das Essen. (Ganz besonders den Schinken, den er manchmal in unseren koscheren Haushalt schmuggelt und dann direkt aus dem Zeitungspapier schnabuliert, in das er eingewickelt war, immer wieder schiebt er mir Bissen von dem verbotenen Schweinefleisch in den Mund und muss sich die Vorwürfe meiner Mutter anhören, ein schlechtes Vorbild zu sein.) Seine Schneiderei wurde mit zwei Goldmedaillen ausgezeichnet. Er kann nicht nur gleichmäßige Nähte und gerade Säume nähen. Er ist ein Couture-Experte. Darüber lernte er meine Mutter kennen – sie kam in seinen Laden, weil sie ein Kleid brauchte und er ihr wärmstens empfohlen worden war. Aber eigentlich hatte er Arzt werden wollen und kein Schneider – ein Traum, den ihm sein Vater ausgeredet hatte, und ab und zu bricht die Enttäuschung bei ihm durch.
»Du bist nicht nur ein Schneider, Papa«, versichere ich ihm. »Du bist der allerbeste Schneider!«
»Und du wirst einmal die bestangezogene Lady in Košice sein«, sagt er zu mir und tätschelt mir den Kopf. »Du hast die ideale Mannequinfigur.«
Er hat sich anscheinend wieder im Griff. Er hat seine Enttäuschung wieder versteckt. Wir kommen zur Tür des Zimmers, das ich mit Magda und unserer mittleren Schwester Klara teile. Ich stelle mir vor, dass Magda gerade so tut, als säße sie über ihren Hausaufgaben, und Klara gerade Geigenharzstaub von ihrer Geige wischt. Mein Vater und ich stehen einen Augenblick länger an der Tür; keiner von uns will sich schon verabschieden.
»Ich wollte eigentlich, dass du ein Junge wirst«, sagt mein Vater. »Als du auf die Welt gekommen bist, habe ich die Tür zugeknallt. Ich war so wütend, dass wir noch ein Mädchen bekommen haben. Aber jetzt bist du die Einzige, mit der ich reden kann.« Er gibt mir einen Kuss auf die Stirn.
Ich liebe die Zuwendung meines Vaters. Wie die Zuwendung meiner Mutter ist sie kostbar … und gefährlich. Als habe die Tatsache, dass sie mich ihrer Liebe für würdig befanden, weniger mit mir als mit ihrer Einsamkeit zu tun. Als sei meine Identität nicht etwas, was ich bin oder habe, sondern nur ein Maß dafür, was jeder meiner Eltern vermisst.
»Gute Nacht, Dicuka«, sagt mein Vater schließlich. Er spricht mich mit dem Kosenamen an, den sich meine Mutter für mich ausgedacht hat. Ditzu-ka. Diese unsinnigen Silben bedeuten für mich Geborgenheit. »Sag deinen Schwestern, dass jetzt Schlafenszeit ist.«
Als ich ins Zimmer komme, begrüßen Magda und Klara mich mit dem Lied, das sie für mich gedichtet haben. Sie haben es komponiert, als ich drei war und nach einem misslungenen medizinischen Eingriff auf einem Auge schielte. »Du bist so hässlich, du bist so mickrig«, singen sie. »Du findest nie ’nen Mann.« Seit dem Vorfall halte ich immer den Kopf gesenkt, wenn ich auf der Straße gehe, damit ich nicht sehen muss, wie die Leute mein schiefes Gesicht anstarren. Ich habe noch nicht gelernt, dass das Problem nicht darin besteht, dass meine Schwestern mich mit einem fiesen Lied verspotten; das Problem besteht darin, dass ich ihnen glaube. Ich bin so überzeugt davon, minderwertig zu sein, dass ich mich niemals mit meinem Namen vorstelle. Ich sage nie zu den Leuten: »Ich bin Edie.« Klara ist ein Wunderkind an der Geige. Schon mit fünf Jahren konnte sie das Violinkonzert von Mendelssohn spielen. »Ich bin Klaras Schwester«, sage ich.
Aber heute Abend weiß ich etwas, was sie nicht wissen. »Mamas Mama war genauso alt wie ich, als sie gestorben ist«, verrate ich ihnen. Ich bin mir der besonderen Bedeutung, des Privilegs dieser Information so sicher, dass mir überhaupt nicht in den Sinn kommt, dass es für meine Schwestern Schnee von gestern sein könnte und ich nicht die Erste, sondern die Letzte bin, die es erfahren hat.
»Was du nicht sagst«, sagt Magda mit einem so offensichtlichen Sarkasmus, dass es sogar mir auffällt. Sie ist fünfzehn, vollbusig, mit sinnlichen Lippen, welligem Haar. Sie ist der Spaßvogel in unserer Familie. Als wir jünger waren, zeigte sie mir, wie man Weintrauben aus unserem Schlafzimmerfenster direkt in die Kaffeetassen der Gäste fallen lassen konnte, die unten auf der Terrasse saßen. Ich werde es ihr bald nachmachen und meine eigenen Spiele erfinden; bis es aber so weit ist, wird es um andere Einsätze gehen. Meine Freundin und ich werden uns in der Schule oder auf der Straße an die Jungs ranmachen: »Treffen wir uns um vier an der Uhr auf dem Platz?«, werden wir flöten und mit den Wimpern klimpern. Sie werden kommen, sie kommen immer, manchmal aufgeregt, manchmal schüchtern, immer in siegessicherer Erwartung. Im Schutz meines Zimmers werden meine Freundin und ich uns dann ans Fenster stellen und zusehen, wie die Jungs nach und nach eintrudeln.
»Hör auf, sie ständig aufzuziehen«, blafft Klara jetzt Magda an. Sie ist jünger als Magda, aber sie will mir beistehen, mich beschützen. »Du kennst doch das Foto über dem Piano, oder?«, sagt sie zu mir. »Das, mit dem Mama immer redet? Das ist ihre Mutter.« Ich kenne das Bild, von dem sie spricht. An jedem Tag meines Lebens gehe ich daran vorbei. »Hilf mir, hilf mir«, klagt unsere Mutter immer vor dem Foto, wenn sie das Piano abstaubt oder den Boden fegt. Es ist mir peinlich, dass ich meine Mutter – oder sonst jemanden – nie gefragt habe, wer das auf dem Foto ist. Und ich bin enttäuscht, dass meine Information mir bei meinen Schwestern keinen besonderen Stellenwert einträgt.
Ich bin daran gewöhnt, die stille Schwester zu sein, die unsichtbare. Es kommt mir nicht in den Sinn, dass Magda keine Lust mehr haben könnte, den Clown zu spielen, dass Klara es hassen könnte, das Wunderkind zu sein. Sie kann es sich einfach nicht leisten, auch nur eine Sekunde lang nicht außergewöhnlich zu sein, wenn sie nicht alles verlieren will – die Bewunderung, an die sie sich gewöhnt hat, jenes ausgeprägte Selbstwertgefühl. Magda und ich müssen daran arbeiten, etwas zu bekommen, wovon es unserer Überzeugung nach immer zu wenig gibt. Klara muss befürchten, dass sie jederzeit einen schrecklichen Fehler machen könnte und dann alles verliert.
Seit ich auf der Welt bin, spielt Klara schon Geige – seit sie drei ist. Erst viel später wird mir bewusst, welchen Preis sie für ihr außerordentliches Talent bezahlt hat: Sie hat aufgegeben, ein Kind zu sein. Ich habe sie nie mit Puppen spielen sehen. Stattdessen stand sie vor einem geöffneten Fenster, übte Geige und konnte ihr kreatives Genie erst richtig genießen, wenn sich unter dem Fenster ein Publikum versammelte, das ihr Spiel miterleben durfte.
»Liebt die Mama den Papa eigentlich?«, frage ich jetzt meine Schwestern. Die Distanz zwischen meinen Eltern, die traurigen Geschichten, die beide mir gebeichtet haben, erinnern mich daran, dass ich nie gesehen hatte, dass sie schick zurechtgemacht zusammen ausgegangen wären.
»Was für eine Frage«, sagt Klara. Obwohl sie meine Bedenken von sich weist, glaube ich, in ihren Augen eine Bestätigung zu erkennen. Wir werden dieses Thema nie wieder anschneiden, obwohl ich es versuchen werde. Ich werde Jahre brauchen, um zu lernen, was meine Schwestern bereits wissen müssen, dass das, was wir Liebe nennen, oft viel weniger romantisch daherkommt – als eine Belohnung für eine Leistung, als etwas, womit man sich zufriedengibt.
Als wir in unsere Nachthemden schlüpfen und uns schlafen legen, verbanne ich die Sorgen um meine Eltern und denke stattdessen an meinen Ballettmeister und seine Frau, an das Gefühl, das sich einstellt, wenn ich drei Stufen auf einmal die Treppe zum Studio hinaufrenne, meine Schulklamotten in eine Ecke pfeffere und die Strumpfhose und mein Trikot anziehe. Ich lerne Ballett, seit ich fünf Jahre alt bin, seit meine Mutter instinktiv erkannt hat, dass ich keine Musikerin bin, dass ich über andere Begabungen verfüge. Heute haben wir gerade den Spagat geübt. Unser Ballettmeister erinnerte uns daran, dass Kraft und Flexibilität untrennbar sind – für einen Muskel, der angespannt wird, muss ein anderer sich lockern; um Länge und Gelenkigkeit zu erreichen, müssen wir unsere Körpermitte kräftigen.
Seine Anweisungen bewahre ich wie ein Gebet in meinem Gedächtnis. Ab auf den Boden, die Wirbelsäule gestreckt, die Bauchmuskeln fest, die Beine spreizen sich. Ich weiß, wie ich atmen muss, besonders dann, wenn ich meine, dass es nicht mehr weitergeht. Ich stelle mir vor, wie sich mein Körper dehnt wie die Saiten der Geige meiner Schwester und sich an genau der richtigen Stelle anspannt, um das ganze Instrument zum Klingen zu bringen. Und dann bin ich unten. Ich bin angekommen. Im Spagat. »Brava!« Mein Ballettmeister klatscht. »Bleib genau so, wie du jetzt bist.« Er hebt mich vom Boden hoch und über den Kopf. Es ist schwierig, meine Beine ohne den Widerstand des Fußbodens vollkommen gespreizt zu halten, aber einen Augenblick lang komme ich mir vor wie eine Opfergabe. Ich fühle mich wie reines Licht. »Editke«, sagt mein Lehrer, »deine ganze Begeisterung im Leben wird von innen kommen.« Ich werde Jahre brauchen, bis ich wirklich verstehe, was er meint. Im Moment weiß ich nur, dass ich atmen kann, herumwirbeln, springen und mich biegen. In dem Maß, in dem meine Muskeln sich dehnen und kräftigen, kommt es mir vor, als riefe jede Bewegung, jede Pose mir zu: Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin ich. Ich bin jemand.
* * *
Die Erinnerung ist geheiligter Boden. Aber sie ist auch verflucht. Es ist der Ort, an dem meine Wut, mein Schuldgefühl und meine Trauer einander umkreisen wie hungrige Vögel, die an den gleichen Knochen picken. Es ist der Ort, an dem ich mich auf die Suche nach der Antwort auf die unbeantwortbare Frage mache: Warum habe ich überlebt?
Ich bin sieben Jahre alt, und meine Eltern geben eine Dinnerparty. Sie schicken mich aus dem Zimmer. Ich soll den Wasserkrug wieder auffüllen. Von der Küche aus höre ich sie scherzen. »Die hätten wir uns sparen können.« Ich glaube, sie meinen, dass sie ja schon eine komplette Familie waren, bevor ich dazukam. Sie hatten eine Tochter, die Klavier spielt, und eine Tochter, die Violine spielt. Ich bin überflüssig, ich bin nicht gut genug, es ist kein Platz für mich, glaube ich. Das ist die Art und Weise, wie wir die Fakten unseres Lebens fehlinterpretieren, die Art und Weise, wie wir etwas unterstellen, nicht nachprüfen. Die Art und Weise, wie wir eine Geschichte erfinden, um sie uns selbst zu erzählen, und damit genau das in uns verstärken, woran wir bereits glauben.
An einem Tag, da bin ich acht, beschließe ich, davonzulaufen. Ich werde die Theorie austesten, überflüssig, ja unsichtbar zu sein. Ich will herausfinden, ob meine Eltern überhaupt merken, dass ich fort bin. Statt zur Schule zu gehen, nehme ich die Straßenbahn zum Haus meiner Großeltern. Ich vertraue meinen Großeltern – dem Vater und der Stiefmutter meiner Mutter –, dass sie mich decken werden. Sie sind wegen Magda im ständigen Krieg mit meiner Mutter, verstecken Kekse in der Schublade von Magdas Frisierkommode. Sie bedeuten Sicherheit für mich, und doch sanktionieren sie das Verbotene. Sie halten einander an der Hand, was meine Eltern nie tun. Bei ihnen muss ich nicht um ihre Liebe buhlen, ich muss ihnen nichts vorspielen, um akzeptiert zu werden. Sie verkörpern Behaglichkeit – der Duft von Kalbsbrust und Bohnen, von süßem Brot, von cholent, einem sättigenden Eintopf, den meine Großmutter am Sabbat in der Bäckerei schmoren lässt, wenn das orthodoxe Ritual ihr verbietet, ihren eigenen Ofen zu benutzen.
Meine Großeltern freuen sich, mich zu sehen. Es ist ein wundervoller Morgen. Ich sitze in der Küche und esse Nussschnecken. Aber dann klingelt es an der Haustür. Mein Großvater geht aufmachen. Einen Augenblick später stürzt er in die Küche. Er ist schwerhörig, und er warnt mich zu laut. »Versteck dich, Dicuka«, brüllt er. »Deine Mutter ist da!« Im Versuch, mich zu beschützen, verrät er mich.
Was mich am meisten ärgert, ist Mutters Gesichtsausdruck, als sie mich in der Küche meiner Großeltern sieht. Nicht nur, dass sie überrascht scheint, mich hier zu sehen – es ist, als sei sie überrascht, dass ich überhaupt existiere. Als sei ich nicht die, die sie will oder die zu sein sie erwartet.
Ich werde niemals schön sein – das hat meine Mutter klipp und klar gesagt –, aber in dem Jahr, in dem ich zehn werde, versichert sie mir, dass ich mein Gesicht nicht mehr zu verstecken brauchen werde. Dr. Klein in Budapest wird mein schielendes Auge in Ordnung bringen. Im Zug nach Budapest esse ich Schokolade und genieße die ungeteilte Aufmerksamkeit meiner Mutter. Dr. Klein ist eine Berühmtheit, sagt meine Mutter, der Erste, der Augenoperationen ohne Narkose macht. Ich schwelge zu sehr in dem Märchen der Reise, in dem Privileg, meine Mutter ganz für mich zu haben, um zu realisieren, dass sie mich vorwarnt. Ich hätte nie gedacht, dass die Operation schmerzhaft sein wird. Jedenfalls nicht, bis die Schmerzen mich überwältigen. Meine Mutter und ihre Verwandten, die uns mit dem berühmten Dr. Klein in Kontakt gebracht haben, halten meinen um sich schlagenden Körper auf dem Tisch fest. Schlimmer als der Schmerz, der riesig ist und grenzenlos, ist das Gefühl, von den Menschen, die mich lieben, gewaltsam festgehalten zu werden, damit ich mich nicht bewegen kann. Erst später, lange nachdem sich die Operation als erfolgreich herausgestellt hat, kann ich den Vorfall vom Standpunkt meiner Mutter aus betrachten und erkennen, wie sehr sie selbst unter meinen Schmerzen gelitten haben muss.
Ich bin am glücklichsten, wenn ich allein bin, wenn ich mich in meine innere Welt zurückziehen kann. Als ich an einem Morgen mit dreizehn auf dem Weg zur Schule bin, einem privaten Gymnasium, übe ich die Tanzschritte zu »An der schönen blauen Donau«, die meine Ballettklasse auf einem Fest am Fluss aufführen wird. Dann geht die Fantasie mit mir durch, und ich verliere mich in einem neuen, von mir erfundenen Tanz, in dem ich mir vorstelle, wie meine Eltern sich kennenlernen. Ich tanze beide Rollen. Mein Vater macht eine Stummfilm-Nummer mit doppeltem Hingucker, als er meine Mutter ins Zimmer kommen sieht. Meine Mutter dreht sich schneller, springt höher. Ich biege meinen ganzen Körper zu einem freudigen Jauchzen. Ich habe meine Mutter nie jubeln sehen, sie nie aus vollem Herzen lachen gehört, doch in meinem Körper spüre ich den versiegten Brunnen ihrer Fröhlichkeit.
Als ich in der Schule ankomme, ist das Schulgeld für ein volles Vierteljahr verschwunden, das mein Vater mir mitgegeben hat. Ich muss es im Taumel des Tanzens verloren haben. Ich wühle jede Tasche und Falte meiner Kleidung durch, aber es ist weg. Den ganzen Tag brennt die Furcht, es meinem Vater zu erzählen, wie Eis in meinem Bauch. Zu Hause kann er mich nicht ansehen, als er die Fäuste hebt. Es ist das erste Mal, dass er mich oder eine meiner Schwestern schlägt. Er sagt kein Wort zu mir, als er von mir ablässt. In jener Nacht im Bett möchte ich sterben, damit mein Vater bereut, was er mir angetan hat. Und dann wünsche ich mir meinen Vater tot.
Geben mir diese Erinnerungen ein Bild von meiner Stärke? Oder von dem Schaden, den ich davongetragen habe? Vielleicht ist jede Kindheit das Terrain, auf dem wir zu ergründen suchen, wie bedeutend wir sind und wie wenig bedeutend wir sind, eine Landkarte, auf der wir die Ausdehnung und die Grenzen unserer Wertigkeit erforschen.
Vielleicht ist jedes Leben ein Lernprozess hinsichtlich dessen, was wir nicht haben, aber gern hätten, und dessen, was wir haben, aber lieber nicht hätten.
Es hat viele Jahrzehnte gebraucht, bis ich entdeckt habe, dass ich eine andere Frage an mein Leben stellen könnte. Nicht: Warum habe ich gelebt? Sondern: Inwieweit liegt es an mir, was ich aus dem Leben mache, das mir gegeben wurde?
Die ganz gewöhnlichen, menschlichen Dramen in meiner Familie wurden durch Grenzen, durch Kriege verkompliziert. Vor dem Ersten Weltkrieg gehörte die Region Slowakei, wo ich geboren und aufgewachsen bin, zu Österreich-Ungarn, doch ein Jahrzehnt vor meiner Geburt zeichnete der Versailler Friedensvertrag von 1918 die Landkarte von Europa neu und schuf einen neuen Staat. Die Tschechoslowakei wurde aus verschiedenen Regionen zusammengeschustert: aus der landwirtschaftlich geprägten Slowakei, der Region meiner Familie, die ethnisch gesehen ungarisch und slowakisch war; aus den höher industrialisierten Regionen von Mähren und Böhmen, die ethnisch gesehen tschechisch waren, und aus der Karpatenukraine, einer Region, die mittlerweile zur Ukraine gehört. Mit der Entstehung der Tschechoslowakei wurde meine Heimatstadt Kassa, Ungarn, zu Košice, Tschechoslowakei. Und meine Familie wurde in zweifacher Hinsicht zu einer Minorität. Ethnisch gesehen, waren wir Ungarn, die in einem vorwiegend tschechischen Land lebten, und außerdem waren wir Juden.
Obwohl Juden seit dem elften Jahrhundert in der Slowakei gelebt hatten, erhielten sie erst 1840 die Erlaubnis, sich in Kassa niederzulassen. Selbst dann machten die Behörden, unterstützt von christlichen Handelsgilden, den jüdischen Familien dort das Leben schwer. Doch zur Jahrhundertwende war Kassa eine der größten europäischen jüdischen Gemeinden. Anders als in anderen osteuropäischen Ländern, wie etwa Polen, wurden ungarische Juden nicht ghettoisiert (weshalb meine Familie ausschließlich Ungarisch sprach und nicht Jiddisch). Wir wurden nicht ausgegrenzt und hatten Zugang zu Bildung, Berufswelt und Kultur. Aber wir stießen dennoch auf unterschwellige oder explizite Vorurteile. Antisemitismus war keine Erfindung der Nazis. Als ich aufwuchs, verinnerlichte ich ein Gefühl von Minderwertigkeit und glaubte, es wäre sicherer, nicht zuzugeben, dass ich Jüdin war, es wäre sicherer, sich zu integrieren, sich anzupassen, und nur ja nicht aufzufallen. Es war schwierig, ein Gefühl von Identität und Zugehörigkeit zu finden. Dann, im November 1938, annektierte Ungarn Košice abermals, und für uns war es, als wäre unser Zuhause auch unsere Heimat geworden.
Meine Mutter steht auf unserem Balkon im Andrássy-Palast, einem alten Gebäude, das in einzelne Wohnungen für Familien aufgeteilt worden ist. Sie hat einen Perserteppich über das Balkongeländer gelegt. Sie putzt nicht; sie feiert. Admiral Miklós Horthy, Seine Durchlaucht, der Herrscher des Königreichs Ungarn, kommt heute, um unsere Stadt offiziell in Ungarn zu begrüßen. Ich verstehe die Begeisterung und den Stolz meiner Eltern. Wir gehören dazu! Auch ich heiße Horthy an diesem Tag willkommen. Ich führe einen Tanz auf. Ich trage ein ungarisches Kostüm: kräftige, florale Stickereien auf der leuchtend bunten Wollweste und dem Rock, weiße Bluse mit bauschigen Ärmeln, Bänder, Spitze, rote Stiefel. Als ich den hohen Kick am Fluss springe, applaudiert Horthy. Er umarmt die Tänzer. Er umarmt mich.
»Dicuka, ich wünschte, wir wären so blond wie Klara«, flüstert Magda mir zu, als wir zu Bett gehen.
Wir sind noch Jahre entfernt von Ausgehverboten und diskriminierenden Gesetzen, aber Horthys Festumzug markiert den Beginn all dessen, was kommen wird. Die ungarische Staatsbürgerschaft hat zwar einerseits Zugehörigkeit gebracht, andererseits aber auch Ausschluss. Wir sind so glücklich, dass wir unsere Muttersprache sprechen können, als Ungarn anerkannt zu sein – doch diese Anerkennung hängt davon ab, wie wir uns assimilieren. Nachbarn argumentieren, dass nur ethnische Ungarn, die keine Juden sind, die traditionellen Trachten tragen dürfen.
»Es ist am besten, wenn du dir nicht anmerken lässt, dass du Jüdin bist«, warnt mich meine Schwester Magda. »Sonst bringst du nur andere Leute dazu, dass sie dir deine schönen Sachen wegnehmen wollen.«
Magda ist die Erstgeborene; sie berichtet mir von der Welt. Sie erzählt mir Einzelheiten, oft verstörende Einzelheiten, die ich lernen und über die ich nachdenken soll. 1939, in dem Jahr, in dem Nazideutschland in Polen einfällt, besetzen die ungarischen Nazis – die nyilas