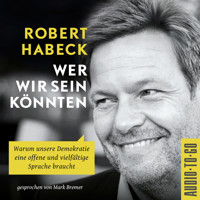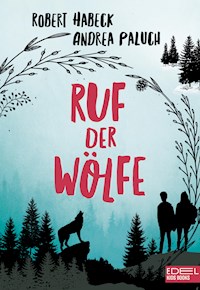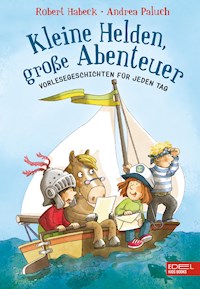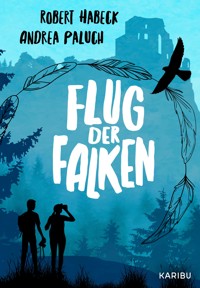0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kursbuch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Erfolgskurs, dessen sich die Partei Bündnis90/Die Grünen seit den Bundestagswahlen 2017 erfreut, scheint untrennbar mit der Person Robert Habeck zusammenzuhängen. Wieso? Sein rauer, norddeutscher Charme macht ihn vielleicht öffentlichkeitswirksam, aber ob politisches Wirken allein über Medientauglichkeit transportiert werden kann? Die Kursbuch-Herausgeber Peter Felixberger und Armin Nassehi wollen es genau wissen und besuchen Robert Habeck zu Hause in Schleswig-Holstein zum Interview in Kursbuch 197.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Robert Habeck»Das Grüne ist die neue Normalität«Im Gespräch mit Peter Felixberger und Armin Nassehi
Die Autoren
Impressum
Robert Habeck»Das Grüne ist die neue Normalität«Im Gespräch mit Peter Felixberger und Armin Nassehi
»Ich will mein Leben selbst bestimmen, nicht irgendwelche Konzerne oder Herrenstaaten sollen es regeln.«
Kursbuch: Im Kursbuch der ersten Jahrzehnte waren die politischen Lager sauber getrennt. Jeder wusste, wo er hingehörte. Für die Linke war das Kursbuch eines der wichtigsten Selbstvergewisserungsmedien. Mit unserer Herausgeberschaft hat sich der Blick auf Gesellschaft, Politik und Kultur verändert. Heute sind es die Widersprüche, Antinomien und Paradoxien, die uns inhaltlich antreiben. Nicht mehr die Suche nach der letzten Wahrheit. Uns geht es in diesem Gespräch deshalb um die persönliche Haltung zu diesen Widersprüchen, die jeder für sich aushalten muss. Lassen Sie uns zu Beginn das biografische Rad etwas zurückdrehen. Sie sind 1969 geboren und haben die Gründerjahre der Grünen als Kind erlebt und natürlich noch nicht bewusst wahrgenommen. Dann aber begann in den 1980ern der Widerstand gegen technische Großprojekte von Brokdorf bis Wackersdorf. Wo sind Sie eingestiegen in den grünen Protest, Tschernobyl?
Habeck: Tschernobyl hat mich politisch in Bewegung gesetzt. Ich war 16 Jahre, als das Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist. Die Situation damals war geradezu absurd. Wir hatten in der Schule den Sommernachtstraum inszeniert, und Premiere war an einem Tag im Mai. Der Sommernachtstraum war natürlich für einen 16-Jährigen die Metapher, wie das Leben sein sollte. Jede Nacht sich zweimal verlieben und im Wechselspiel der Paare durch den Sommer tanzen. Nach der Premiere sind lauter beseelte Pennäler in den Maiabend getreten. Da setzte ein leichter Nieselregen ein, und alle rissen in Panik die Regenschirme auf und liefen nach Hause in der Angst, dass sie den Krebstod sterben müssten. Dieser Moment mit seiner Gleichzeitigkeit von Bedrohung und Lebenshunger war prägend. Ich habe eine Zerrissenheit gespürt, weniger vielleicht die ökologische Angst, sondern vielmehr das Gefühl, dass anonyme große Mächte mir mein Leben wegnehmen wollten. Eine Freiheitssehnsucht, die abrupt ausgebremst wurde. Dies war meine erste Annäherung an die Grünen. Es hat sich bis heute eigentlich nicht viel geändert: Ich will mein Leben selbst bestimmen, nicht irgendwelche Konzerne oder Herrenstaaten sollen es regeln. Ich weiß, dass dies mit der Parteigeschichte in vielerlei Hinsicht in Spannung steht, aber die Realisierung und Verteidigung von Freiheit war mein Antrieb, den Grünen mein Vertrauen zu geben. Ich habe die Nähe zu einer Partei gesucht, die aus meiner Sicht am stärksten, sowohl im ökologischen als auch im individuellen Bereich, das Versprechen der Selbstbestimmung des Lebens verkörpert.
Kursbuch: Wir würden, obwohl wir zehn Jahre älter sind, diese Beschreibung sicher ähnlich vornehmen. Dahinter steckt eine interessante Generationslage. Durch konkrete Ereignisse treten Kapitalismuskritik und Ähnliches in das eigene authentische Leben ein. Ist das nicht generationstypisch, dass sich die Dinge jetzt über die eigene Lebenspraxis erschließen?
Habeck: Ich habe mit 16 Jahren natürlich noch nicht irgendwelche kapitalismuskritischen Bücher gelesen. 1968 war für mich eher eine ästhetische Wahrnehmung. Langhaarige Leute auf der Straße, Rudi Dutschke mit dem Megafon, alles starke Bilder. Ich habe die Revolte oder Rebellion zwar gesehen, aber nicht den politischen Hintergrund durchdrungen. Wenn es einen Kipppunkt gab, war es der, dass ich aus dem persönlichen Interesse an individueller Freiheit zu einem politischeren Menschen geworden bin. Das Theoriegebilde der Grünen hat mich weder interessiert noch irgendwie umgetrieben. Und geht es nicht meistens so? Allgemeine Debatten sind schön und gut, aber erst der Bezug zum persönlichen Leben macht sie greifbar und prägend. Oft braucht es dafür einen Schlüsselmoment, der das Große im Kleinen sichtbar macht. Als ich Landwirtschaftsminister war, hat einer meiner Söhne ein Praktikum auf einem Bauernhof gemacht und miterlebt, wie Tiere geschlachtet wurden. Am Abend fragte er, warum wir Tiere essen. Darauf hatte ich keine richtig gute Antwort. Und habe dann selbst aufgehört, Fleisch zu essen.
Kursbuch: Ist das etwas speziell Grünes oder fast schon eine Theorie der Politisierung und des Engagements?