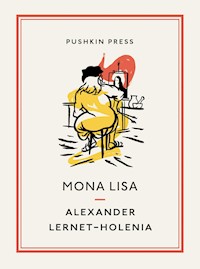11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Im Jahre 1783 lockte eine gewisse Jeanne de la Motte-Valois den Pariser Hofjuwelieren ein Diamanthalsband im Werte von mehr als einer Million unter dem Vorwand ab, sie solle es für die Königin Marie-Antoinette erwerben. Tatsächlich aber zerlegten die Betrügerin und ihre Helfershelfer das Halsband, verkauften die Steine und verschwendeten den Erlös. Die Betrugsaffäre, in die die größten Namen Frankreichs verwickelt waren, erregte einen ungeheuren Skandal; der sich anschließende Prozeß erschütterte die Gesellschaft am Vorabend der Französischen Revolution. Alexander Lernet-Holenia ist den Ereignissen und den vielfältigen menschlichen Beziehungen mit subtiler Kunst und historischem Sinn nachgegangen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Ähnliche
Alexander Lernet-Holenia
Das Halsband der Königin
FISCHER Digital
Inhalt
Madame de la Motte
Die Halsbandgeschichte hat die Große Revolution in Frankreich zwar nicht eigentlich hervorgerufen, aber doch unmittelbar ausgelöst; und die Folgen davon sollten unabsehbar sein. Denn wohin die Ereignisse, die damals in Gang gekommen sind, auch uns selbst noch führen werden, weiß niemand.
Angehörige zweier der größten Häuser Europas, des römisch-deutschen, später österreichischen Kaiserhauses und des französischen Königshauses nämlich, sowie einer der Angehörigen eines der berühmtesten Häuser von Frankreich selbst, des Hauses Rohan, waren die Hauptpersonen der Affäre. Doch ahnten sie allesamt nicht, was ihre Handlungsweise nach sich ziehen werde. Allein es gab auch Mitglieder der gleichen Familien, die es ebensowenig an Besonnenheit und Weitblick fehlen ließen, wie ihre Anverwandten des Leichtsinns und der Gedankenlosigkeit entbehrten. So sind es denn auch nur ungewisse, schwankende Bilder, die wir uns von der geistigen und sittlichen Verfassung jener Geschlechter zur Zeit ihrer Verwicklung in den Halsbandskandal zu machen vermögen.
Zu allen Zeiten und in allen Ländern hat die sogenannte gute Gesellschaft für eine Auslese gegolten, und wenn sie auch, wie zum Beispiel jetzt, nicht mehr unbedingt dafür gilt, so hält sie sich doch wenigstens selber noch dafür. Gerät sie aber aus der Bahn, so geschieht auch dies in einem beim einfacheren Bürger- und Bauerntum unvorstellbaren Maße. Dafür kann die Geschichte jener La Motte-Valois, welche die Halsbandaffäre ausgelöst hat, als Beispiel gelten.
Wie schon aus dem Beinamen der La Motte, de Valois, zu vermuten ist, entstammte sie, wenngleich auf weiten Wegen, dem französischen Herrschergeschlechte. Heinrich der Zweite von Frankreich nämlich, viertletzter der Könige aus dem Hause Valois, hatte mit seiner Geliebten Nicole de Savigny, Haute et Puissante Dame, Dame de Saint-Remy, de Fontette, du Chatelier et de Noëz, einen natürlichen Sohn erzeugt, Henri de Saint-Remy, dem er im Jahre 1558 dreißigtausend Taler hinterließ, welche jenem von seiner Mutter aber erst zweiundzwanzig Jahre später, nämlich am 2. Januar 1590, und auch da nur testamentarisch, ausgefolgt wurden, da die genannte Dame äußerst geizig war und sich daher auch, zum mindesten zu Lebzeiten, nur sehr ungern von dem Gelde getrennt hätte.
Dieser Henri, »Monsieur« betitelt wie später zum Beispiel auch die Herzoge von Orléans, Chevalier und gleichfalls Seigneur du Chatelier sowie der übrigen schon im Zusammenhange mit Frau von Savigny erwähnten Nester und eines neu hinzutretenden Nestes Beauvoir, Ritter des Ordens vom Heiligen Geiste, Kammerherr seines Halbbruders Heinrichs des Dritten und später auch seines Vetters Heinrichs des Vierten – mit dem er aber freilich nur noch recht entfernt verwandt war, da der letztere bekanntlicherweise schon nicht mehr aus dem Hause Valois, sondern bereits aus dem Hause Bourbon stammte –, Henri de Saint-Remy also, Oberster eines Regiments zu Roß sowie eines Regiments zu Fuß und Gouverneur von Château-Villain, heiratete am 31. Oktober 1592 eine gewisse Chrétienne de Luz, Tochter des Jacques de Luz, gleichfalls Ritters vom Heiligen Geiste.
René de Saint-Remy, der Sohn »Monsieurs« und der Chrétienne de Luz, war zwar für seine eigene Person nicht mehr »Monsieur«, aber immerhin noch, wie’s auch sein Vater und seine Großmutter gewesen waren, »hochgeboren und gebietend«, Chevalier und Baron, das heißt Freier Herr von Fontette bei Bar-sur-Aube, Kammerherr seines allerdings schon sehr entfernten Vetters Ludwigs des Dreizehnten und Kapitän von hundert Gensdarmen.
Allein bei dessen Sohne Pierre-Jean von Saint-Remy, einem Major im Kavallerieregimente de Bachevillier, wenngleich auch er noch hochgeboren und gebietend sowie Chevalier und Herr von Fontette genannt wird, konnte vom »Monsieur«-Titel überhaupt keine Rede mehr sein; und da auch seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem damals regierenden König von Frankreich, dem vierzehnten Ludwig, nur mehr so entfernt waren, daß er sich mit ihm eigentlich schon so gut wie gar nicht mehr als verwandt betrachten konnte, hielt er für richtig zu betonen, daß er’s dennoch sei, und hängte seinem Namen, de Saint-Remy, auch noch ein de Valois an, so daß er also als ein Herr de Saint-Remy de Valois vor den Augen seines Königs wandelte.
Ob das dem Sonnenkönige angenehm gewesen, weiß man allerdings nicht mehr. Doch schaffte er’s ihm auch nicht ab, wie denn überhaupt jeder in jener angeblich so tyrannischen Zeit mehr oder weniger tun und lassen konnte, was er wollte, und seinem Namen so viele weitere Namen anhängen durfte, als es ihm gefiel – vorausgesetzt daß er bloß von einigem Stande war. Jedenfalls aber sollte sich der durch das »de Valois« angebahnte Wiederaufstieg der Familie Saint-Remy auch noch fortsetzen, finden wir doch Pierre-Jeans Sohn gleichfalls mit wesentlich verbesserten Titeln vor. Er begegnet uns nämlich als Nicolas-René de Saint-Remy de Valois, Chevalier, Baron de Saint-Remy und Seigneur de Luz. Allerdings befehligte er nicht mehr eine Kompanie der Gardes du Corps des Königs, sondern er diente nur noch in einer Kompanie der Gardes du Corps, nämlich in der des Herrn von Charost; und am 4. März 1714 heiratete er eine Demoiselle Marie-Elisabeth de Vienne.
Danach aber ging es mit der Familie Saint-Remy erneut bergab, und zwar diesmal sogar mit Riesenschritten, denn von Nicolas-Renés beiden Söhnen fiel der ältere zwar noch als Cadet-Gentilhomme im Regimente Grassin glorreich im Jahre 1745 bei Fontenoy; Nicolas-Renés jüngerer Sohn jedoch, Jacques de Saint-Remy de Valois, Chevalier, der, indem er in die Erbrechte des Gefallenen eintrat, gleichfalls Baron de Saint-Remy wurde, dachte für seine eigene Person gar nicht mehr daran, zu fallen, weder glorreich noch sonstwie, und führte auch statt des Daseins eines Landedelmannes, der etwas auf sich hält, nur noch das eines Bauern. Er war zudem ständig betrunken und heiratete schließlich auch noch seine Geliebte, die Tochter des Wärtels von Fontette, nachdem sie ihm bereits zwei Kinder geboren hatte.
Man hätte also glauben sollen, daß von diesem Zweige des Hauses Valois nichts Rechtes mehr zu erwarten sein werde. Aber just mit der älteren der beiden Töchter dieses Säufers, Jeanne de Saint-Remy de Valois, seit 1780 verehelichten Gräfin de la Motte, beziehungsweise bloß de la Motte ohne Gräfin, hatten die Geschicke noch große Dinge vor; und diese letzten völlig heruntergekommenen Valois sollten auf einmal wieder von sich reden machen, und zwar mehr, weit mehr und auf unvergleichlich verhängnisvollere Weise als alle andern Träger ihres Namens, eine ganze Reihe inzwischen mehr oder weniger wieder vergessener Könige von Frankreich, je zuvor.
Es ist wahr – so ruft später, im Halsbandprozeß, der Verteidiger der La Motte, der Advokat Doillot, aus – es ist leider nur allzu wahr, daß sich Jacques de Saint-Remy de Valois durch seine Ehe, welcher drei Kinder entsprossen waren, 1755 ein Knabe, 1756 Jeanne und 1757 Marie-Anne, sozial tief herabgesetzt fühlte; daß er das Los seiner Nachkommenschaft nicht minder als sein eigenes beklagte; und daß er unter der Last seines berühmten Namens seufzte. Der große Grundbesitz, den seine Titel auswiesen, existierte für ihn nicht mehr, denn schon hatten sich die letzten Reste desselben unter seinen Händen zu nichts aufgelöst: ein Bauernhof, eine Scheuer, etliche Feldstreifen waren zuletzt noch ohne jede schriftliche Bestätigung verschleudert worden, nur um, durch den Erlös, den dringendsten Bedürfnissen der Familie abzuhelfen; und im Jahre 1760, als Herr von Saint-Remy schon gar nichts mehr besaß, mußte er sich sogar zur Flucht aus Fontette, der Wiege seiner Ahnen, entschließen. Bei Nacht und Nebel hängte er die jüngere seiner beiden Töchter, Marie-Anne, in einem Korbe an das Fenster desjenigen Bauern von Fontette, der sich aus der Mißwirtschaft seines Grundherrn am meisten bereichert hatte, und dann entwich er. Er entwich zu Fuß, indem er nur seine in andern Umständen befindliche Gattin, seine ältere Tochter Jeanne und deren Brüderchen mit sich nahm; und mit keinerlei andrem Gepäck belud er sich als mit seinen Papieren und Pergamenten.
Er langt in Paris an, verweilt sich daselbst aber nicht, denn er will weiter nach Versailles. Doch kommt er dort nicht mehr hin, weil seine Frau, unterwegs, mit einer dritten Tochter niederkommt, die von der Baronin Choiseul-Bay und von dem Enkel derselben über die Taufe gehalten wird; und am gleichen Tage erkrankt Herr von Saint-Remy tödlich, und Frau von Choiseul stellt ihren Wagen zur Verfügung, um ihn – wohin bringen zu lassen? Ins Hôtel-Dieu, wo ihn denn auch sein Ende ereilt. Denn das Unglück, von dem das Haus Valois durch zweihundertundsechzig Jahre auf dem Throne verfolgt worden ist, macht auch vor diesem letzten Nachkommen eines natürlichen Sprosses des Hauses nicht halt …
Seine Frau, die »Baronin von Saint-Remy«, blieb aber mit ihren Kindern gleich weiter in Boulogne, wo sie niedergekommen war, und lachte sich dortselbst auch, als Ersatz für den Verstorbenen, im Handumdrehen einen weiteren Trunkenbold an – denn für dergleichen Leute hatte sie, wahrscheinlich weil sie selber mitsoff, eine Schwäche –, einen ehemaligen Gardesoldaten, dessen alkoholische Bedürfnisse jedoch so groß waren, daß sie sich selbst durch den Erlös intensivsten Bettelns der beiden in ihren ärmlichen Fähnchen auf die Straße geschickten Valois-Mädchen nicht stillen ließen. »Habt Erbarmen«, riefen die Kinder, indem sie die Hände ausstreckten, »habt Erbarmen mit zwei armen Waisen aus königlichem Blut!« Das ging so lang weiter, bis der Pfarrer von Boulogne fand, daß es nicht mehr lang so weitergehen könne, und die zwei Mädchen samt ihrem kleinen Bruder der Mildtätigkeit der Marquise von Boulainvilliers, Gattin des Herrn Prévôts von Paris und Eigentümerin der nahe gelegenen Châtellenie von Passy, aufs dringlichste anempfahl; woraufhin sie denn auch in der Tat von ihr aufgenommen und von ihren drei Töchtern, den beiden späteren Vicomtessen von Faudoas und Tonnerre, sowie der Baronin von Crussol, eingekleidet wurden. »Nicht wahr, Maman«, sagten – immer noch laut Mitteilung des Advokaten Doillot – die Demoisellen von Boulainvilliers, »nicht wahr, es sind doch unsere Geschwister!« Und in Ansehung der königlichen Herkunft der Saint-Remy-Kinder einerseits, andererseits aber auch ihrer Verkommenheit, wußte Frau von Boulainvilliers nicht, ob sie sich freuen oder ob sie bedauern solle, daß es sich anders verhielt.
Jedenfalls tat sie die Saint-Remy-Kinder, zumindest bis sie wieder in den Besitz ihrer Titel gelangt sein würden, in die Schule von Passy; und einige Zeit später ward der junge Saint-Remy dem Marquis de Courcy anvertraut, der ihn, eben im Begriffe sich einzuschiffen, alle Grade eines Seemanns durchlaufen ließ. Das in Boulogne geborene Mädchen aber starb, und Frau von Boulainvilliers ließ Marie-Anne de Valois, »délaissée dans son panier«, aus Fontette kommen und tat sie und Jeanne zuerst in das Kloster von Hyères bei Montgeron und später in dasjenige von Longchamp bei Passy, wo sie sie immerzu unter den Augen haben und besuchen konnte.
Herrn d’Hozier de Serigny, dem Wappenkönig des französischen Adels, war es nämlich inzwischen geglückt, die königliche Herkunft der Kinder nachzuweisen; und er bestätigte sie Ludwig dem Sechzehnten, der ihnen – zu seinem Unheil, wie sich herausstellen sollte – drei Pensionen zu je 800 Livres aussetzen ließ: die eine, am 9. Dezember 1775, für Jeanne de Luze de Saint-Remy de Valois; und die beiden andern, am 27. Juni 1776, für Marie-Anne de Valois und den »Sieur Jacques, Baron de Saint-Remy de Valois, Lieutenant de Vaisseau; lequel, est-il dit, a obtenu ladite pension étant Enseigne, pour le mettre en état de suivre son service«. Als jener nämlich mit Herrn von Courcy von seinen ersten Seegefechten glücklich wieder zurückgekehrt war, hatte ihn Herr von Maurepas – damals noch Erster Minister, jedoch bereits im Begriffe, davongejagt zu werden – dem König vorgestellt; und als ihn der König – Gott mochte wissen, aus welchem Grunde, vielleicht weil er an das ständig wachsende Defizit, vielleicht weil er an seine Lieblingsbeschäftigung, die Schlosserei, dachte, vielleicht aber auch bloß, weil er ihn für jemand anders hielt – gefragt hatte, ob er Geistlicher werden wolle, hatte der junge Valois geantwortet: »Servir son Roi, Sire, c’est servir Dieu.« Zur Zeit des Halsbandprozesses hatte er’s denn dann auch in der Tat bis zum Kommandanten der »Surveillante« gebracht.
1779 sollten Jeanne und Marie-Anne den Schleier nehmen, zogen jedoch vor, aus Longchamp zu entweichen und sich nach Bar-sur-Aube, woher sie gekommen waren, zurückzubegeben. Das stellt Herr Doillot, im Halsbandprozeß so dar, daß er sagt, die Demoiselles de Valois seien »aux Ursulines près Bar-sur-Aube et Fontette« gegangen, »parce qu’on avoit persuadé aux deux soeurs qu’elles seroient plus à portée d’y connoître, et peut-être de se faire restituer tout ou partie des biens de leur père«; und er fährt fort: »Dans les visites qu’elles reçurent à leur arrivée à Bar-sur-Aube, de la Noblesse et des autres personnes considérables de la Ville, enchantées de revoir les enfants dont ils avoient connu le malheureux père, le Comte Marc-Antoine-Nicolas de la Motte de la Pénissière, Officier dans la Gensdarmerie, fit demander, par la dame sa mère, la main de la demoiselle de Valois l’aînée. Elle vint à Paris prendre les conseils de la dame de Boulainvilliers, et le mariage a été célébré au mois de Juin 1780, après des informations favorables faites par M. l’Evêque de Langres; nous disons favorables, parce que le Comte de la Motte est le huitième de sa famille, qui ait servi, et dont sept décorés de la Croix, sont morts au service, son père sur-tout, qui après quarante cinq ans passés, tant dans le Régiment du Vicomte d’Argonges que dans la Gensdarmerie, fut tué des premiers à la bataille de Minden; et dans un dernier brevet du Roi, du 18 janvier 1784, qui porte la pension à 1.500 liv. il est dit, en faveur de demoiselle de Luze de Saint-Remy de Valois, épouse du sieur Comte de la Motte, et en considération de la famille de la demoiselle de Valois, aussi ancienne qu’illustre par son origine.«
Zu deutsch:
»Die Demoisellen von Valois hatten sich schließlich zu den Ursulinerinnen bei Bar-sur-Aube und Fontette begeben, weil man die beiden Schwestern davon überzeugt hatte, daß sie dortselbst imstande sein würden, die Güter, die ihrem Vater gehört hatten, besser im Auge zu behalten und sie entweder zum Teile oder gar zur Gänze wieder an sich zu bringen; und unter den Besuchern von Adel und andern beachtlichen Personen vom Stande, von denen sie aufgesucht wurden und die entzückt waren, in ihnen die Kinder wiederzusehen, deren unglücklichen Vater sie so gut gekannt hatten, befand sich auch der Graf de la Motte, ein Gensdarmerieoffizier, der durch seine Frau Mutter um die Hand des älteren Fräuleins von Valois anhalten ließ. So begab sich denn die letztere zurück nach Paris, um Frau von Boulainvilliers’ Rat einzuholen; und die Hochzeit fand im Juni 1780 statt, nachdem der Herr Bischof von Langres die günstigsten Auskünfte über den Bräutigam erteilt hatte. Denn der Graf de la Motte war der achte seines Namens, der in militärischen Diensten gestanden; und von diesen acht waren sieben gefallen, zuletzt sein Vater nach fünfundvierzig Dienstjahren als einer der ersten in der Schlacht bei Minden« – einer, wie es scheint, ganz besonders verhängnisvollen bewaffneten Auseinandersetzung für die Familien aller, die an der Halsbandgeschichte beteiligt sein sollten.
In Wirklichkeit aber hatte sich alles natürlich ganz anders abgespielt. Denn die Notabeln von Bar-sur-Aube hatten keinesfalls bei den zwei Fräuleins von Saint-Remy in einem Kloster Besuch gemacht und hatten auch nicht etwa Tränen der Rührung beim Angedenken an den alten Säufer Saint-Remy vergossen, sondern die Frau des Prévôt der Stadt Barsur-Aube hatte die Schwestern aus dem elenden Wirtshaus geholt, in welchem sie gestrandet waren, und sie zu sich genommen; und der Graf de la Motte, der gar kein wirk licher Graf war, sondern sich bloß als Graf hatte in die Militärlisten eintragen lassen, hatte auch nicht durch seine Frau Mutter um das ältere der beiden Mädchen angehalten, sondern Jeanne, ohne viel Federlesens, ganz einfach in andre Umstände versetzt, so daß schließlich in aller Eile geheiratet werden mußte. Denn schon einen Monat nach der Hochzeit brachte Jeanne Zwillinge zur Welt, die jedoch starben.
Gegen Ende des Jahres 1780 – so fährt Doillot fort – war der Graf de la Motte wieder in Lunéville, dem Standorte seiner Gensdarmen; und während seiner Abwesenheit hatte sich seine Frau in das Kloster von Saint-Nicolas, zwischen Lunéville und Bar-sur-Aube, zurückgezogen. Dort erfuhr sie, daß sich ihre hochherzige Beschützerin, Frau von Boulainvilliers, in Straßburg befand, in den Händen eines Arztes, der berühmt war für seine Heilungen von allen nur erdenklichen Krankheiten – des Grafen Cagliostro. Doch befand sich Frau von Boulainvilliers gar nicht in Straßburg selbst, sie suchte die Stadt vielmehr, um Cagliostros willen, nur gelegentlich auf. Ihr eigentliches Standquartier war vielmehr Zabern, wo sie im äußerst prächtigen Palaste des Kardinals Rohan wohnte. Herr und Frau de la Motte verfügten sich also gleichfalls nach Zabern, und Frau von Boulainvilliers stellte dem Kirchenfürsten die beiden Ankömmlinge »sous le doux nom de leurs enfants« – unter dem holden Namen ihrer lieben Kinder vor.
Monsieur de Rohan
Louis-René-Edouard de Rohan Guémenée, Kardinal, Fürst des Heiligen Römischen Reiches, Landgraf im Elsaß, Großalmosenier von Frankreich, Kommandeur des Ordens vom Heiligen Geiste, Bischof von Straßburg, Abt von Saint-Vaast, von Chaise-Dieu und so weiter, Generalsuperior des Hôpital Royal des Quinze-Vingts, Provisor der Sorbonne und einer der vierzig Unsterblichen der Académie Française, rühmte sich der Abkunft aus einem Hause, welches von den souveränen Herzögen der Bretagne stammen wollte, zum Zeichen dieser Prätension sein halbes Wappen mit dem Hermelin jenes Herzogtums belegt und das Recht, beim König von Frankreich unmittelbar hinter den Prinzen von Geblüt und zugleich mit den Herzögen von Lothringen, jedenfalls aber vor dem gesamten übrigen französischen Adel eintreten zu dürfen, durchgesetzt hatte; und niemand, selbst der Gothasche Hofkalender nicht, hatte bis zum Jahre 1918, zu welcher Zeit die Rohans Frankreich schon längst verlassen und sich mit Henri-Louis-Marie de Rohan, beziehungsweise dessen Sohn Charles-Alain-Gabriel in Österreich ansässig gemacht hatten – niemand hatte gewagt, den Anspruch auf eine so hohe Herkunft zu entkräften. Nur das Recht des absoluten Vortritts am französischen Hofe war inzwischen hinfällig geworden. Denn einen französischen Hof gab es längst nicht mehr.
Henri-Louis-Marie ist übrigens der gleiche, der 1782 mit zweiunddreißig Millionen Passiven seinen Bankrott erklärt hatte. »Il n’y a qu’un roi ou un Rohan«, hatte er gesagt, »pour faire une faillite pareille.«
Die historische Notiz im Hofkalender jedenfalls lautete bis 1918 immer noch:
»Direkte Nachkommen der souveränen Herzöge der Bretagne, als deren Seitenzweig sie die Titel Comte de Porrhoët et de Rennes 1008 und Vicomte de Rohan (Dpt Morbihan) 1128 erhielten; Baron de Lanvaux 1485; Prince de Guémenée (Loire-inférieure) 1570; franz. Erhebung der Herrschaft Monbazon (Indre-et-Loire) zur Grafschaft 1536, zum Herzogtum und zur Pairie Mai 1558, bestätigt 27. April 1589, bzw. 1594 und 24. März 1595; franz. Erhebung der Vicomté de Rohan in der Bretagne zum Herzogtum und zur Pairie, sowie Annahme des Titels Prince de Léon (die Besitzungen gingen 1648 auf das Haus Chabot über) 1603; Prince de Soubise 1667; franz. Erhebung der Herrschaft Fontenay-l’Abattu en Saintonge zum Herzogtum Rohan-Rohan und zur Pairie im Oktober, bzw. 18. Dezember 1714; Prince de Rochefort 1728« und so weiter und so weiter.
Auf den Gedanken, von den souveränen Herzögen der Bretagne zu stammen, müssen die Rohans aus dem Anlasse der 1407 geschlossenen Ehe Alains des Neunten, Vizegrafen von Rohan, mit Marguérite, der Tochter Johannes des Vierten von Bretagne aus dem seit 1213 regierenden Hause Dreux, verfallen sein, wahrscheinlich um nach dem Aussterben des Hauses Dreux nicht mehr und nicht weniger als die ganze Bretagne zu erben. In Wirklichkeit aber ward sie natürlich von Frankreich ererbt. Doch so oder anders: als die mitteleuropäischen Monarchien, 1918, Republiken geworden waren, brachte auch der Hofkalender die historische Notiz über die Rohans auf einmal ohne jeden Hinweis auf eine Abstammung ihres Hauses von den Herzögen der Bretagne.
Was sich bei den Rohans ereignet hatte, war also offenbar ganz dasselbe gewesen wie bei Jeanne de la Motte: zu einer gewissen Zeit hatte ein Familienmitglied für gut erachtet, den Anspruch auf die Abstammung seines Hauses von einem souveränen Hause zu erheben. Nur daß das bei der Schwindlerin de la Motte auch wirklich gestimmt haben dürfte – bei den beschwindelten Rohans aber nicht.
Louis de Rohan, am 25. September 1734 zu Paris geboren, studierte zuerst am Collège du Plessis und später am Seminar de Saint-Magloire Theologie. 1760 ward er Koadjutor seines Onkels, des Bischofs von Straßburg, und im gleichen Jahr auch für seine eigene Person Bischof, nämlich von Kanope, in partibus.
In ihren Memoiren schildert ihn die Elsässerin Baronin Oberkirch, geborene Waldner, wie folgt:
»Er sieht vortrefflich aus, ist aber alles eher als fromm und hat eine bedenkliche Neigung zu den Frauen. Voll von Geist zwar und Liebenswürdigkeit, legt er dennoch eine Leichtgläubigkeit an den Tag, die ihn schon teuer zu stehen gekommen ist«; und sein gewesener Generalvikar, der Abbé Georgel, ergänzt dieses Porträt, indem er sagt: »Zu seinem guten Aussehen und zum Zauber jugendlicher Züge verfügt er nicht allein über die Gabe der Beredsamkeit im allgemeinen, sondern, im besonderen, auch über die Kunst der Überredung.«
Über alle einem Geistlichen unangemessenen Eigenschaften also verfügte er, nur hatte er – so scheint es – nicht die bei einem Geistlichen noch verzeihlichste: den Hang zur Homosexualität.
1761 ward der Koadjutor zum Mitgliede der Französischen Akademie ernannt. »In Ihren Kreis«, schrieb er aus diesem Anlaß an seine neuen Kollegen, »in Ihren Kreis nehmen Sie bloß Berühmtheiten auf, die Ihrer Bemühungen und Ihres Rufes würdig sind; so daß Sie wohl auch nur von der Erinnerung an zwei bestimmte in Ihre Ruhmestafeln bereits eingegrabene Namen« – womit er auf die Kardinäle Rohan und Soubise anspielte – »bewogen worden sein dürften, mich ebensowohl zu erwählen. Doch schafft ja der Umgang mit den Künsten und Wissenschaften unter denen, die sich ihnen ergeben, in der Tat so enge Beziehungen wie die Bande des Bluts«; und der Herzog von Nivernois, Präsident der Akademie, antwortete ihm: »Indem wir Ihren Namen auf unsere Listen setzen, werden wir dennoch nicht verlangen, daß Sie auch immerzu an unseren Versammlungen teilnehmen, wissen wir doch zu gut, welch große Aufgaben, welch wichtige Obliegenheiten Ihr Leben bereits ausfüllen; und wenn wir den Blick auf die Wohlordnung Ihrer künftigen Bestimmung richten« – womit gemeint war, daß dem Koadjutor nichts sicherer sei als der Kardinalshut –, »so sehen wir voraus, mit wie vielem Ernste und mit welcher Genauigkeit Sie jenen Verpflichtungen auch weiterhin nachkommen werden, indem Sie sich, der Kirche wie dem Staate gleich nützlich, um die eine wie um den andern durch tagtägliche Anstrengungen verdient zu machen und beider Vertrauen im höchsten Maße zu erwerben bestimmt sind; so daß Ihr Ruhm unzertrennlich sein wird von den Triumphen der Religion und auch Ihr weltlicher Ruf Ihnen überallhin folgen wird.«
Wenn das erstere auch durchaus nicht der Fall sein sollte, so sollte in der Tat nichts so sehr der Fall sein wie das letztere.
Zwar kann man, was Nivernois dem neuen Mitgliede schrieb, auch für bloße Floskeln halten. Voltaire aber schätzte Rohan in der Tat sehr hoch ein.
»Wenngleich der Fürst Louis de Rohan«, schrieb er am 8. Dezember 1763 an d’Alembert, »schon Koadjutor des Bischofs von Straßburg ist, so hat er sich, aus dem Anlasse der Wahl Marmontels in die Akademie, doch auch noch herabgelassen, sich zum Koadjutor der Philosophie zu machen und ihr in dem Maße, in welchem es ihm sein Stand nur gestattet hat, jeden erdenklichen Dienst zu leisten« – das heißt soweit ihm die theologischen Wahrheiten erlaubten, die menschliche Vernunft zu verfechten –; »so daß er den Dank und die Anerkennung aller Literaten, die er zu protegieren und denen er zu nützen weiß, in Wahrheit verdient.«
»Gott segne den Fürsten Rohan!« ruft er wenige Tage später aus; und am 15. Januar des folgenden Jahres schreibt er an d’Alembert:
»Es gibt einen Grandseigneur, dem Sie, ostentativ, einen Brief schreiben sollten, um ihm, in unser aller Namen, für die Art zu danken, auf die er mit uns umgeht; und zwar ist dies der Fürst Louis de Rohan, der zweifellos äußerst geschmeichelt sein wird, ein solches Zeichen Ihrer Wertschätzung zu empfangen. Ja vielleicht wären Sie sogar imstande, Ihrem Schreiben ein paar Verse anzufügen …«
Diesen Rat befolgte d’Alembert, und am 22. Februar vermochte ihm Voltaire zu melden:
»Apropos Briefe: dem Fürsten Louis haben Sie einen Brief geschrieben, von dem er ganz bezaubert ist. Er zeigt ihn aller Welt; und zufolge der Zuvorkommenheit, die er uns Literaten erweist, verdient er ja auch in der Tat all das Lob, das Sie ihm gespendet haben.«
Andrer Leute Urteil über Louis de Rohan war allerdings weit weniger günstig. »Er war ein Ahnungsloser und so leichtgläubig, als ob er überhaupt ohne allen Verstand geboren worden wäre«, schreibt der spätere Ludwig der Achtzehnte über ihn; und Besenval sagt: »Er war voller Gleichgültigkeit und Leichtfertigkeit.« – »So leichtfertig wie unmoralisch«, sagt die Campan, »hatte er nicht die geringste Begabung zum diplomatischen Dienste.« Nicht viel besser denkt Madame de Genlis: »Selbst in reifem Alter beging er nichts als lächerliche Fehler und stiftete ein Übermaß von Unheil.« Der Herzog von Lévis sprach ihm zwar nicht allen Geist, wohl aber jede Urteilskraft ab. Auch »un triste sire croyant à tout et en tous, sauf peut-être en Dieu, ayant beaucoup d’ambition et très peu de cervelle«, »un âne bâté« und »un grand benêt pourpré« wird er genannt.
Gegenteiliger Meinung, allerdings, war der Graf Beugnot, welcher behauptete, der Kardinal sei ganz gewiß alles eher als »un imbécile« gewesen; und in der Tat kann Rohan weder so dumm noch so leichtgläubig gewesen sein, wie die meisten glauben. Er war wohl nur ein weitaus größerer Herr als die meisten und hielt es daher auch für seiner nicht würdig, seinen Verstand sonderlich anzustrengen – war es ihm doch auch ohne sonderliche Anstrengung desselben, zumindest eine ganze Zeit lang, recht gut ergangen; und vor allem verachtete er es, übertrieben mißtrauisch zu sein. Für beides gab es ja genug weniger große Herren in seiner Umgebung.
Das treffendste Urteil dürfte also Friedrich der Große über ihn gefällt haben. »Man weiß«, schreibt der Autor der Correspondance Secrète, »daß der König von Preußen zu Beginn des Halsbandprozesses gesagt hat, der Kardinal werde seine ganzen Geisteskräfte zusammennehmen müssen, um seine Richter davon zu überzeugen, daß er in der Tat ein solcher Tölpel gewesen sei, wie er sich den Anschein gegeben …«
Im Jahre 1771 ward Louis de Rohan zum Botschafter am Kaiserlichen Hofe zu Wien ernannt.
Die Ernennung des Barons Breteuil, gleichfalls zum Botschafter am Kaiserlichen Hofe, war unmittelbar vorhergegangen. Aber sie war noch seitens des Ministers Choiseul erfolgt, nach dessen Sturze sein Nachfolger, der Herzog von Aiguillon, nichts Eiligeres zu tun wußte, als, seinerseits, Breteuils Ernennung rückgängig zu machen und Rohan zum Botschafter zu ernennen; »und diese ganz unerwartete Abänderung«, stellte der Abbé Georgel fest, »war die Ursache all des unbeugsamen und unauslöschlichen Hasses, den Herr von Breteuil dem Koadjutor von da an entgegengebracht hat.«
Marie Antoinette, damals noch Dauphine, berichtete die Neuigkeit sogleich ihrer Mutter und fügte an: »Der Fürst ist zwar aus sehr großem Hause, doch ist das Leben, das er bisher geführt hat, eher eines Soldaten als eines Koadjutors würdig gewesen. Er gehört zur Partei der Frau du Barry.«
So schrieb denn Maria Theresia dem Grafen Mercy-Argenteau, ihrem Botschafter in Paris, sie habe allen Grund, unzufrieden zu sein, daß die Wahl auf ein so deklariertes Mauvais Sujet wie auf den Koadjutor von Straßburg gefallen sei; und hätte sie nicht gefürchtet, die Dauphine werde die Unannehmlichkeiten zu tragen haben, im Falle sie, die Kaiserin, den Koadjutor als Botschafter an ihrem Hofe ablehne, so hätte sie ihn wohl wirklich abgelehnt. Mercy, jedenfalls, werde gut daran tun, den französischen Hof zu ersuchen, daß er dem Fürsten Louis eine gewisse Zurückhaltung anempfehle.
Fürs erste benahm sich der Fürst Louis denn auch in der Tat etwa so, wie es einem Prälaten zusteht; und als er am 19. Januar 1772 sein Beglaubigungsschreiben überreichte, machte er auf die Kaiserin einen guten Eindruck. Aber schon zwei Monate später kam sie auf ihr ursprüngliches Urteil über ihn zurück. »Der Fürst Rohan«, schrieb sie, »mißfällt mir mehr und mehr, ist er doch wirklich ein Mauvais Sujet, ganz unbegabt und sittenlos, dazu auch noch ohne alle Vernunft und vor allem überhaupt kein Botschafter oder gar ein Würdenträger der Kirche. Es ist zwar wahr, daß sich der Kaiser« – gemeint ist hier nicht mehr der damals schon verstorbene Gemahl Maria Theresias, Franz Stefan von Lothringen, sondern sein und Maria Theresias Sohn Josef der Zweite – »gern mit ihm unterhält. Doch tut er’s freilich nur, um ihn zu allerhand Bavardagen und Turlupinaden zu verleiten; und auch Kaunitz ist mit ihm bloß deshalb so wohl zufrieden, weil er ihm in nichts im Wege steht und jede Art von Unterwürfigkeit gegen ihn an den Tag legt. Mir selbst hingegen wäre nichts lieber, als ihn so bald wie möglich wieder abreisen zu sehen …« Ja, sie gelangte sogar auf den Punkt, den Tod des alten Bischofs von Straßburg zu wünschen, da sie annahm, daß man dann den Koadjutor sogleich abberufen und an des Verstorbenen Stelle setzen werde; und wenig später wünschte sie, aus dem gleichen Grunde, ebensowohl dem Großalmosenier von Frankreich den Tod, galt es doch für so gut wie sicher, daß der Fürst Louis dann auch noch Großalmosenier werden würde. Insonderheit nämlich bangte sie um das gesamte adelige Frauenzimmer, das, ob nun jung oder alt, ob schön oder häßlich, von diesem eigentümlichen Kirchenfürsten wie verzaubert war.
Auch sagte man ihm nach, er sei mit einer Jagdgesellschaft quer durch eine Prozession galoppiert, habe auf einer andern Jagd nicht weniger als 1328 Gewehrschüsse abgefeuert, die Feste, die er zu geben pflegte, seien stets in Orgien ausgeartet, und als, eines schönen Tages, seine Karosse umgestürzt, sei er, pêle-mêle mit den Damen seiner Begleitung, im Straßengraben gelegen. Ingleichen habe er stets den unziemlichsten Pomp entfaltet und an Pracht des Auftretens sogar die Erzherzoge übertroffen.
Zu alledem jedoch ward seine Botschaft auch noch beschuldigt, französische Luxusartikel unverzollt nach Österreich einzuschmuggeln. Das erwies sich allerdings als richtig. Er selbst aber war natürlich ein viel zu großer Herr, um mit diesem Treiben seiner Untergebenen auch nur das mindeste zu tun zu haben. Dennoch hob die Kaiserin die Zollfreiheit für alle Botschaften mit sofortiger Wirksamkeit auf.
Vergeblich bemühte sich Mercy, die Kaiserin zu beruhigen. Die Ambassade des Fürsten Louis, meinte er, werde gewiß nicht mehr lange dauern, denn gehalten werde er ja nicht mehr von Aiguillon, der ihn zum Botschafter gemacht, sondern nur noch von einigen seiner eigenen Verwandten, so vor allem vom Marschall von Soubise und von Frau von Marsan, die vorzeiten eine der Erzieherinnen des Dauphin gewesen war. Beide, Soubise und die Marsan, waren übrigens nicht nur Anhänger der Frau du Barry und Gegner Choiseuls, sondern auch erklärte Feinde Österreichs. Doch ward die Kaiserin immer ungeduldiger. Auch die Leute des Prinzen Louis, schrieb sie, verdürben nun das Volk, ebensosehr, wie er den Adel verdürbe, sie malträtierten die Bauern, und die Pagen, die ihn zu Pferde begleiteten, hätten sich sogar einen Spaß daraus gemacht, eine Schildwache von Schönbrunn niederzureiten. Er selbst aber gebärde sich geradezu insolent, seit er von den seine Rückberufung betreffenden Demarchen Wind bekommen habe.
Da starb, am 10. Mai 1774, Ludwig der Fünfzehnte; und am 14. schrieb Marie Antoinette an Maria Theresia:
»Madame meine vielgeliebte Mutter, Mercy wird Ihnen die Umstände unseres Unglücks berichtet haben. Glücklicherweise hat des Königs grausame Krankheit« – es waren die schwarzen Pocken gewesen – »ihn bis zum letzten Augenblick bei klarem Verstande gelassen, und sein Ende war sehr erbaulich. Der neue König scheint das Herz seiner Völker zu besitzen. Zwei Tage vor dem Tode seines Großvaters hat er 200.000 Franken an die Armen verteilen lassen, was den besten Eindruck gemacht hat; und seit dem Tode des alten Königs hört er nicht auf zu arbeiten und den Ministern und vielen andern mit eigenhändig geschriebenen Briefen zu antworten und ihnen zu versichern, daß er noch nicht klar sehen könne … Die Öffentlichkeit hingegen erwartet in diesen Augenblicken viele Veränderungen. Der König jedoch hat sich darauf beschränkt, die Kreatur« – womit die du Barry gemeint ist – »in ein Kloster« – nämlich nach Pont-aux-Dames bei Brie – »zu stecken und alles vom Hofe zu vertreiben, was den Stempel des Skandalösen trägt, war er’s doch dem Volke schuldig, ein solches Exempel zu statuieren. Denn kaum war der alte König gestorben, als das Volk auch schon die Herzogin von Mazarin, eine der ergebensten Dienerinnen der Favoritin, mit Beschimpfungen überhäuft hat. Hingegen bittet man mich oft, dem König alle nur erdenkliche Milde für eine Anzahl korrupter Seelen anzuraten, die seit Jahren schon genug Böses verübt haben. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt …«
Bestimmt nicht eingesetzt hat sich die neue Königin aber für den Fürsten Rohan. Doch empfing dieser dennoch sogleich wieder ein Beglaubigungsschreiben, während es sonst, beim Tode eines Königs, üblich war, alle Ambassadeurs zurückzuberufen; und es bedurfte einer neuerlichen Demarche des Grafen Mercy, daß Rohan denn doch heimbeordert ward, allerdings, um seine Verwandtschaft nicht aufzubringen, bloß unter dem Vorwande der Berichterstattung. Danach aber, hieß es, werde man Mittel und Wege finden, ihn gleich in Paris zu behalten, beziehungsweise ihn wieder nach Straßburg zu schicken.
So hatte er sich also am 30. Juni 1774 vom Kaiser und der Kaiserin zu verabschieden, und Maria Theresia war so glücklich über seine Abreise, daß sie ihm, zum Zeichen ungewöhnlicher Gunst, sogar noch anwesend zu sein gestattete, als der türkische Botschafter die Nachricht von dem jüngst erfolgten Ableben des Sultans überbrachte. Josef der Zweite und Kaunitz jedoch sahen den Fürsten Louis mit besonderem Bedauern scheiden, so daß er sich bei seiner Rückkehr in der Tat rühmen konnte, er sei zum Schlusse durch die besondere Huld der Majestäten ausgezeichnet worden. Ja am 1. Juli schrieb die Kaiserin sogar noch an ihre Tochter:
»Sie werden durch Rohan, der sich gestern von hier verabschiedet hat, einen Brief erhalten. Ich schulde ihm gerechterweise die Feststellung, daß er sich seit einigen Monaten zu seinem Vorteil verändert hat. Immerhin gestehe ich, über seine Abberufung nicht ungehalten zu sein; und ich hoffe, daß der König auch den Abbé Georgel nicht mehr lange als Chargé d’Affaires hier lassen wird.«
So war es dem Fürsten Louis also am Ende doch noch geglückt, den Kaiserlichen Hof in Ehren zu verlassen. Hingegen vermochte von da an nichts mehr, ihm die Gunst seiner eigenen Königin zurückzugewinnen. Denn während der Zeit seiner Abwesenheit war sie zu seiner tödlichen Feindin geworden; und daß sie’s zu Unrecht geworden war, änderte nichts an der Verachtung, die sie für ihn empfand, und an ihrem Hasse.
Marie Antoinette
Von den zehn überlebenden der sechzehn Kinder Franz Stefans von Lothringen und Maria Theresias war eine ganze Zahl zu hohen Aufgaben bestimmt: so der älteste Sohn, Josef, zum Kaiser, der zweitälteste, Leopold, zum Großherzog von Toskana, die Erzherzogin Karoline, den Thronerben von Neapel zu heiraten, und die jüngste Tochter, Maria Antonia, um Königin von Frankreich zu werden.
Diese letztere war zu Allerseelen des Jahres 1755 geboren, am gleichen Tage also, an dem ein furchtbares Erdbeben die Stadt Lissabon zerstörte, wobei 30.000 Menschen umkamen und der König und die Königin von Portugal aus ihrem Palaste flüchten mußten, der hinter ihnen in Trümmer sank.
Noch ehe die Erzherzogin das Licht der Welt erblickte, hatte sie schon Anlaß zu einer Wette gegeben. Die Kaiserin nämlich, die bereits Mutter von fünf Töchtern war, aber erst zwei Söhne hatte, wünschte sich einen dritten Sohn. »Ob es wohl wirklich ein Sohn, oder ob es wiederum eine Tochter werden wird?« fragte sie sich im Sommer 1755. »Ganz gewiß ein Sohn«, antwortete einer der anwesenden Hofleute. »Sie meinen?« sprach Maria Theresia. »Nun, und ich wette zwei Dukaten, daß es, wie gewöhnlich, eine Tochter werden wird.«
Im Herbst verlor der Hofmann die Wette; und kniend reichte er der Kaiserin die beiden Dukaten dar, die in ein Blatt Papier gewickelt waren.
Auf dieses Blatt hatte er einige Verse geschrieben, die Pietro Metastasio für ihn gedichtet hatte.
Sie lauteten:
Ho perduto: l’augusta figlia
A pagar m’ha condannato;
Ma s’è ver ch’a Voi somiglia,
Tutto ’l mondo ho guadagnato.
Die Regierungsgeschäfte ließen der Kaiserin wenig Zeit, sich mit ihren Kindern zu befassen. Zudem verstand sie, gewohnt zu herrschen und sich Gehorsam zu verschaffen, auch vollauf die Kunst, ihrer eigenen Familie Respekt einzuflößen. Die Furcht, welche die Kinder vor der Monarchin empfanden, hielt ihre Zärtlichkeit zurück; und die Erziehung der kaiserlichen Nachkommenschaft blieb durchaus den Hofmeistern und Gouvernanten anvertraut. Kamen aber hervorragende Fremde nach Wien, so unterließ die Kaiserin niemals, sie in die Hofburg oder nach Schönbrunn zu laden und sich im Schoß der Familie als liebende Mutter zu zeigen.
Erzogen und unterrichtet ward Maria Antonia zuerst von einer Gräfin Brandeisen, danach von einer Lerchenfeld; und Metastasio gab ihr Unterricht im Italienischen, Gluck in der Musik. Zu singen und was weniges Italienisch zu plaudern erlernte sie denn auch in der Tat, hingegen alles eher, als ein richtiges Deutsch zu schreiben, und ebenso soll sie im Zeichnen versagt haben. Dazu kam, daß man sie, sehr früh schon, mit dem Dauphin verlobte und daß ein gewisser Abbé de Vermond aus Paris nach Wien beordert ward, ihr überhaupt erst einmal die Anfangsgründe des Französischen beizubringen. Nun geriet ihr alles, was sie lernen sollte, durcheinander, und vor allem das Französische hat sie, selbst als Königin von Frankreich, niemals vollkommen beherrscht.
Über die jugendliche Erzherzogin schreibt Vermond:
»Die Fremden, doch auch Leute, die sie seit mehreren Monaten nicht gesehen haben, sind immer wieder betroffen von der Lieblichkeit dieses Antlitzes, das täglich reizvoller wird, könnte man doch keine schöneren, regelmäßigeren Züge finden; und welche Vorstellung immer die Reisenden, die sie hier erblickt haben, von ihr in Frankreich zu geben vermöchten, man wird ganz überrascht sein von der Güte, Heiterkeit und Liebenswürdigkeit dieses bezaubernden Gesichtchens.«
Allerdings fügt er dann hinzu:
»Ob sie aber gleichwohl verständiger ist, als man lange Zeit meinen wollte, so ist dieser ihr Verstand bis zu ihrem zwölften Jahre zu allem eher herangebildet worden, als daß sie ihn auch richtig gebrauche; und was weniges an Trägheit von ihrer Seite, sowie ein gerüttelt volles Maß von Leichtsinn haben mir’s noch schwerer gemacht, sie auszubilden. Sechs Wochen lang habe ich sie in die schöne Literatur einzuführen versucht: sie hat alles sehr rasch aufgefaßt, und auch ihr Urteil war fast immer richtig. Doch ist mir’s nicht gelungen, sie zu veranlassen, daß sie sich mit irgendeinem Gegenstande wirklich beschäftigt hätte, wenngleich sie dazu sehr wohl imstande gewesen wäre; und wahrscheinlich war ihr Geist nur dadurch zu fesseln, daß man sie unterhielt.«
Am 21. April 1770 verließ Maria Antonia, um sich nach Paris zu begeben, die Wiener Hofburg auf immer, und der Abschiedsschmerz war groß. Zudem konnte sie sich auch gar kein richtiges Bild von den Zuständen in Versailles, ja nicht einmal von ihrem Verlobten machen. Man hatte ihr zwar zwei Porträts von ihm gezeigt, auf denen er in Galakleidern dargestellt war, aber sie ahnte nichts von der Schüchternheit und dem linkischen Wesen dieses ihres Bräutigams, der nur vierzehn Monate älter als sie selbst war und sein sechzehntes Jahr mithin noch gar nicht vollendet hatte.
Auch von ihrem zukünftigen Königreiche wußte sie so gut wie nichts. Sie wußte nur, daß es derzeit noch von einem alten König beherrscht ward, der eine Freundin hatte – Madame du Barry, von der zu sprechen man in Wien soviel wie möglich vermied.
Überdies hatte dieser alte König vier nicht eben angenehme Töchter, Marie Antoinettes zukünftige Tanten, »la première pimbêche, la seconde brouillon, la troisième bigote, la dernière bégueule, vieilles filles tracassières, désagréables même à leur père, inconnues au dehors, enfermées dans une étroite étiquette«; und dann gab es auch noch zwei jüngere Brüder ihres Bräutigams: den Grafen von Provence und den Grafen von Artois. Stellte sich der eine ganz erfüllt von eifersüchtigem Ehrgeiz und egoistisch und abweisend dar, so war der andre nichts weiter als frivol und ausschließlich seinen Vergnügungen hingegeben.
Von Marie Antoinette sonderlich entzückt konnten also diese Leute alle nicht sein. Madame Adélaide, eine der vier alten Jungfern, stempelte die Dauphine sogar gleich mit der Bezeichnung »l’Autrichienne« ab, die ein ganzes Programm der Abneigung gegen die junge Frau selbst und gegen das Haus Habsburg-Lothringen und die Politik der deutschen Kaiser in sich enthielt; und diesen Namen ward Marie Antoinette nie mehr los, nicht einmal zur Zeit der Revolution, ja da erst recht nicht. Aber auch der alte König, wenngleich er das junge hübsche Geschöpf auf seine schon etwas greisenhafte Art fortwährend mit den Augen sozusagen abtastete, stand viel zu sehr unter dem Einfluß der du Barry, als daß er sich seinen Sympathien für andre Frauen wirklich hätte hingeben dürfen. Entzückt von Marie Antoinette war also eigentlich bloß das Volk von Paris, dieses jedoch dafür auch um so mehr; und nachdem die Dauphine, an des Dauphin Seite, ihren Einzug in Paris gehalten hatte, vermochte sie ihrer Mutter zu schreiben: »Was mich am meisten ergreift, ist die Zuneigung, ja die Liebe, die mir von diesem armen Volke entgegengebracht wird, das, ungeachtet der Steuern, die es niederdrücken, ganz hingerissen war, uns zu sehen. Ich kann Ihnen die Freude, die Begeisterung, die uns bewiesen ward, gar nicht beschreiben.«
Zwei Monate später schildert sie den französischen Hof wie folgt:
»Madame meine geliebte Mutter, wir reisen also morgen, den 10. Juli, nach Choisy und kommen am 13. zurück, um am 17. nach Bellevue und am 18. nach Compiègne zu fahren, wo wir bis zum 28. August bleiben werden. Von dort gehen wir dann für einige Tage nach Chantilly. Der König hat tausend Freundlichkeiten für mich übrig, und ich liebe ihn zärtlich, doch tut er mir wegen seiner Schwäche für Madame du Barry leid, die das dümmste und impertinenteste Geschöpf ist, das man sich vorstellen kann. Sie hat jeden Abend mit uns in Marly gespielt und hat sich zweimal neben mir befunden; doch hat sie mich wenigstens nicht angeredet, und ich habe nicht eben versucht, ein Gespräch mit ihr in Gang zu bringen. Wenn es aber nötig war, habe ich dennoch zu ihr gesprochen.
Was meinen lieben Gemahl betrifft, so hat er sich sehr, und durchaus zu seinem Vorteil, verändert. Er bringt mir viel Freundschaft entgegen und beginnt sogar, wirkliches Vertrauen gegen mich an den Tag zu legen. Herrn von Vauguyon« – Antoine de Quélen, Herzog von Vauguyon, den Erzieher des Dauphins und seiner Brüder – »liebt er gewißlich nicht, aber er fürchtet ihn. Neulich ist ihm eine merkwürdige Geschichte widerfahren. Ich befand mich nämlich allein mit meinem Gemahl, als sich Herr von Vauguyon eiligen Schrittes der Tür näherte, um zu horchen. Ein Kammerdiener, der zwar sehr ehrlich, aber auch sehr dumm ist, öffnete die Tür, und der Herzog stand wie ein Pflock da, ohne zurückweichen zu können. Daraufhin stellte ich meinem Gemahl vor Augen, wie ungehörig es sei, wenn an den Türen gehorcht werde; was er denn auch, als sehr richtig, gut aufgenommen hat.«
Verschafft uns schon diese Szene einigen Einblick in das Wesen Marie Antoinettes, so schildern uns die Brüder Goncourt die Dauphine mit den folgenden noch kennzeichnenderen Worten:
»Ein Herz, das sich aller Lebhaftigkeit hingibt, sich verschwendet, ein junges Mädchen, das dem Leben mit weit ausgebreiteten Armen entgegeneilt, begierig, zu lieben und geliebt zu werden: das ist die Dauphine. Sie liebt alles, was den Träumereien der Jugend entgegenkommt, alle Freuden, welche jungen Frauen etwas bedeuten und jugendliche Fürstinnen zu zerstreuen vermögen. Denn in Gestalt eines einzigartigen Gegensatzes verbirgt sich hinter dieser Fröhlichkeit der empfindsame, fast schwermütige Sinn der Dauphine. Es ist eine ausgelassene, fast närrische Fröhlichkeit, die da bei ihr kommt und geht und ganz Versailles mit Bewegung und Leben erfüllt. Naivität, Ausgelassenheit, ja Eulenspiegelei, all dies und obendrein die Wirkung ihrer tausend Reize verbreitet die Dauphine ständig um sich her. Kindlichkeit und Jugendlichkeit verbünden sich bei ihr gegen die Etikette, und alles bezaubert und verführt an dieser Fürstin, welche die anbetungswürdigste Frau aller Frauen am Hofe ist …«
Am 21. April 1770, dem Tage der Abreise Marie Antoinettes aus Wien, hatte Maria Theresia ihrer Tochter neben einer Reihe von Verhaltungsvorschriften allgemeiner Art auch noch eine »Besondere Verhaltungsvorschrift« mitgegeben in der es hieß:
»Übernehmen Sie keine Empfehlung und hören Sie auf niemanden, wenn Sie in Ruhe leben wollen. Seien Sie vor allem nicht neugierig – es ist dies etwas, das ich bei Ihnen insonderheit befürchte. Vermeiden Sie jede Art von Vertraulichkeit mit kleinen Leuten. Fragen Sie in allen Fällen Herrn und Frau von Noailles.« (Der Generalfeldmarschall Graf Noailles war französischer Bevollmächtigter bei der Übernahme der Erzherzogin durch die Franzosen gewesen, und seine Frau war die erste Obersthofmeisterin der Dauphine.) »Ja verlangen Sie von diesen beiden sogar selbst zu erfahren, was Sie tun sollen. Denn Sie sind ja Ausländerin, wollen dem französischen Volke aber in allen Stücken gefallen. Sie müssen also unbedingten Wert darauf legen, daß man Ihnen mitteile, ob es in Ihrem Benehmen, in Ihren Reden oder in andern Punkten auch nur das mindeste zu verbessern gibt. Antworten Sie aller Welt freundlich, mit Anmut und Würde. Das vermögen Sie ja, wenn Sie nur wollen. Doch muß man auch abzuschlagen verstehen. Sie werden die Annahme von Petitionen sowohl für das Reich wie auch für meine eigenen Länder nicht verweigern können. Aber Sie werden sie alle an Starhemberg« (den Bevollmächtigten der Kaiserin bei Übergabe Marie Antoinettes) »weitergeben und jedermann an ihn oder an Schaffgotsch weisen.« (Gemeint ist hier der Obersthofmeister Graf Anton Schaffgotsch.) »Sie werden auch jedem sagen, daß Sie die Petitionen nach Wien schicken müssen und mehr nicht tun können. Aber von Straßburg an werden Sie überhaupt nichts mehr annehmen, ohne Herrn und Frau von Noailles um deren Meinung befragt zu haben; und an diese beiden werden Sie auch alle jene weisen, die zu Ihnen von ihren Angelegenheiten sprechen werden, und Sie werden ihnen aus diesem Anlaß auch ganz offen sagen, daß Sie Ausländerin sind und es nicht übernehmen können, dem König irgend jemanden zu empfehlen. Wenn Sie aber wollen, so können Sie auch hinzufügen: ›Die Kaiserin, meine Mutter, hat mir ausdrücklich verboten, wie immer geartete Empfehlungen weiterzuleiten.‹ Schämen Sie sich, weiters, nicht, jedermann um Rat zu fragen, und tun Sie nichts, indem Sie bloß Ihrem eigenen Kopfe gehorchen.
Zu Anfang jedes Monats werde ich einen Kurier von hier nach Paris abfertigen; und bis zur Ankunft dieses Kuriers können Sie Ihre Briefe vorbereiten, um sie ihm mitgeben zu können, wenn er zurückgeht. Sie können mir allerdings auch durch die Post schreiben, aber nur über unbedeutende Dinge, von denen jeder erfahren kann. Doch glaube ich nicht, daß Sie Ihrer Familie schreiben sollten, besondere Anlässe und Nachrichten an den Kaiser allerdings ausgenommen.« (Gemeint ist hier wiederum Josef der Zweite, Marie Antoinettes ältester Bruder, der, nach seinem Vater Franz Stefan, die deutsche Krone trug.) »Sie werden sich mit ihm darüber einigen. Ferner glaube ich, daß Sie Ihrem Onkel und Ihrer Tante« (dem Prinzen Karl von Lothringen und der Prinzessin Charlotte, Schwester des verstorbenen Kaisers), »sowie dem Prinzen Albert« (von Sachsen-Teschen, der Marie Antoinettes Schwester Marie Christine geehelicht hatte) »schreiben könnten. Auch die Königin von Neapel« (Marie Karoline, eine weitere Schwester Marie Antoinettes) »wünscht mit Ihnen zu korrespondieren; und ich habe nichts dagegen einzuwenden.
Zerreißen Sie jedoch meine Briefe, denn dies wird mir ermöglichen, Ihnen offener zu schreiben; und ich will dasselbe mit Ihren Briefen tun. Erwähnen Sie nichts über die hiesigen häuslichen Angelegenheiten; und auch über Ihre Familie sollen Sie zwar wahrheitsgemäß, aber mit Zurückhaltung sprechen …«
Wie wenig sicher die Kaiserin des Umstandes war, daß Marie Antoinette ihre Rolle richtig spielen werde, geht aus diesen übergenauen Vorschriften nur allzu deutlich hervor. Auch konnte sich Maria Theresia niemals wirklich zur Ansicht bekennen, daß ihre Tochter, schließlich und endlich, Dauphine und später sogar Königin von Frankreich war, sondern sie schrieb an sie eigentlich stets bloß wie an ein in das wenn schon nicht feindliche, so doch zum mindesten feindselige Ausland verkauftes Mädchen. Der Kurier, jedenfalls, ging tatsächlich zu Anfang jedes Monats aus Wien ab und brachte immer weitere Befehle, Ratschläge und Verhaltungsmaßregeln nach Paris. Er nahm seinen Weg über Brüssel, damals Hauptstadt der österreichischen Niederlande, lieferte dortselbst Depeschen ab und traf nach etwa zehn Tagen bei Mercy in Paris ein, wo er dem Botschafter nicht nur die für diesen selbst bestimmten Nachrichten der Kaiserin, sondern auch den an die Dauphine gerichteten Brief übergab. Die Dauphine hatte ihre Briefe, wie ihr aufgetragen worden war, in der Tat schon vorbereitet, und mit diesen ihren Antwortschreiben und den sehr genauen für den Kaiser, die Kaiserin oder den Fürsten Kaunitz bestimmten Berichten Mercys versehen, reiste der Kurier, wieder über Brüssel, nach Wien zurück.
Von dieser ganzen Geheimkorrespondenz wußte in Frankreich außer Mercy selbst nur der Abbé de Vermond, der Marie Antoinette von Wien nach Paris begleitet hatte und sie, so gut es eben gehen wollte, etwa auf die gleiche Art weitererzog, auf die auch der Dauphin und seine beiden Brüder immer noch unter Aufsicht des Herzogs von Vauguyon standen. Vermond berichtete dem Grafen Mercy über alle Vorgänge am Hofe und über das gesamte Tun und Lassen der Dauphine, so daß der Botschafter in der Lage war, die Kaiserin fast über jede Tagesstunde ihrer Tochter ins Bild zu setzen. Solange sich die Dauphine an die Anweisungen ihrer Mutter hielt, hatte der Botschafter keinen Anlaß, Unerfreuliches zu berichten. Als Marie Antoinette aber mehr und mehr heranwuchs und die mütterlichen Vorschriften in den Wind zu schlagen begann, nahmen auch in Mercys Rapporten die unerquicklichen Nachrichten über die Dauphine ständig zu; und zwar wollte es das Unheil, daß die Wandlung in Marie Antoinettes Wesen etwa zur Zeit einsetzte, zu welcher Louis de Rohan, als Botschafter, seinen Posten in Wien antrat. Von da an häuften sich nämlich auch die Vorwürfe, die Maria Theresia ihrer Tochter machte, und da die Dauphine nicht ahnte, daß es Mercy war, der alles über sie ausforschte und nach Wien weitergab, so nahm sie an, es sei Rohan, welcher der Kaiserin, um sich bei ihr in Gunst zu setzen, selbst das Geringste über die wenn schon nicht mißratene, so doch wenigstens ungehorsame und unzuverlässige Tochter zu berichten wisse; und deshalb haßte sie ihn.
Die Dauphine
Welches nun aber waren die Verfehlungen, die sich Marie Antoinette zuschulden kommen ließ? Wir erfahren von ihnen wiederum aus dem Briefwechsel mit ihrer Mutter, später aber auch aus den Berichten, welche die Gesandten ihren Souveränen zukommen ließen. Mit der Dauphine sich zu befassen hatten sie nämlich noch keine eigentliche Ursache gehabt. Um so mehr Veranlassung jedoch fanden sie, sich mit der Königin zu beschäftigen.
Zunächst freilich lief der Tag Marie Antoinettes so artig ab, wie sie selbst ihn ihrer Mutter schildert: