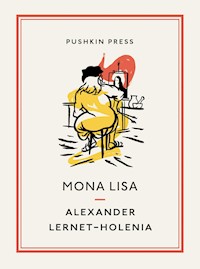11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein Jüngling vergißt im Schmerz über den Untergang eines Reiches, einer Hierarchie, einer Ordnung buchstäblich seine Liebe und findet sie erst wieder, nachdem er das Symbol jener Ordnung, die ihm anvertraute Standarte seines Regiments, zurückgebracht und gemeinsam mit den anderen Soldaten des zerschlagenen Heeres als Sinnbild einer versinkenden Welt in Feuer hat zerfallen sehen. Alexander Lernet-Holenia stellt diese leidenschaftlichen Gefühle in einer phantastischen, spannungsreichen Handlung dar, in der auch das Ende des Ersten Weltkriegs dichterische Spiegelung gefunden hat. Der elementare Ausbruch einer Meuterei in der zerfallenden Donaumonarchie und das plötzlich erwachende Heimatgefühl der polnischen, rumänischen und ruthenischen Bauern sind ebenso unvergeßlich wie die strahlende, allen Untergang überdauernde Liebesgeschichte. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Ähnliche
Alexander Lernet-Holenia
Die Standarte
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
»Wir schwören bei Gott dem Allmächtigen einen heiligen Eid, Seiner Majestät, unserem Allerdurchlauchtigsten Fürsten und Herrn, treu und gehorsam zu sein, auch Allerhöchstihren Generalen, überhaupt allen unseren Vorgesetzten und Höheren zu gehorchen, sie zu ehren und zu beschützen, ihren Geboten und Befehlen in allen Diensten Folge zu leisten, gegen jeden Feind, wer immer es sei und wo immer Seiner Kaiserlichen und Königlichen Majestät Wille es erfordern mag, zu Wasser und zu Lande, bei Tag und bei Nacht, in Schlachten, in Stürmen und in Gefechten jeder Art, mit einem Worte an jedem Ort, zu jeder Zeit und in allen Gelegenheiten tapfer und mannhaft zu streiten, unsere Truppen, Geschütze, Fahnen und Standarten nicht zu verlassen …«
I
Auf einem Fest, dem ersten, großen, zehn Jahre nach dem Kriege, das die Herren fast sämtlicher Kavallerieregimenter einander gaben, kam ich an der Tafel neben einen noch jugendlichen, auffällig gutaussehenden Menschen zu sitzen, auf dessen Namen, als er mir genannt wurde, ich nicht sogleich achtgab, doch sagte man mir später, als ich selbst mich danach erkundigte, daß er Menis heiße und Neffe eines der anwesenden Generale sei.
An meiner anderen Seite saß damals, wenn ich mich recht erinnere, irgendein Graf Haunsperg, und in meiner näheren Umgebung sah ich die Herren von Schirinski und Kreil, einen Baron Repnin und noch ein paar andre Leute, die mich nicht weiter interessierten und die mir von ehedem auch nur flüchtig bekannt waren. Überhaupt hatten diese alle sich nur zufällig an meinem Tisch eingefunden. Denn die Leutnants und Fähnriche mehrerer Regimenter, von Limburg zum Beispiel, von Caraffa und Auersperg, sowie die meines eigenen, saßen hier, ganz wie sie eben noch Plätze bekommen, durcheinander, hatte man sich doch viel zahlreicher versammelt, als ursprünglich vorausgesetzt worden war, und im ganzen war der Eindruck, den die Zusammenkunft so vieler Offiziere anläßlich dieses ersten großen Treffens so lange nach dem Ende der Armee auf die Anwesenden selber machte, auch ein ungewöhnlicher, starker und fast düsterer. Obenan, an quergestellter Tafel, präsidierten in ziviler Kleidung zwei Erzherzoge, ein Feldmarschall und mehrere Generale, die den Rest dieses Reiterheeres zusammenberufen hatten, an Längstafeln saßen, gleichfalls in Zivil, die Offizierskorps der einzelnen Regimenter, oder vielmehr was davon noch lebte, und von da bis zu den ungewisse Lichter widerspiegelnden Marmorwänden des Saales konnte man sich bei einiger Einbildungskraft von einem andern, noch dichteren Gedränge umgeben fühlen: von denen, die gleichfalls gekommen waren, wenngleich sie nicht mehr kommen konnten, von den Verschollenen und Toten, einem zweiten, glorreicheren, von Uniformen und Orden glitzernden und blitzenden, unsichtbaren Heer, das, wenn auch nur im Geiste erschienen, dennoch fast noch eher ein Recht, hier gegenwärtig zu sein, haben mochte als wir selbst. Denn das wirkliche Heer sind nicht die Lebenden, sondern die Toten sind das wirkliche Heer.
Auch durch die Reden unserer alten Führer konnte man glauben, noch einmal den Lärm vergessener Gefechte, den Klang längst verhallter Befehle und das Rauschen von den Hufen ganz verschollener Reitergeschwader zu vernehmen; dann hatte man die Versammlung privaten Gesprächen unter sich selbst überlassen. Doch war, was man einander nun noch zu sagen wußte, bald erschöpft. Zu lange Zeit waren wir voneinander ferne gewesen. So wendete ich mich schließlich an den an meiner Seite sitzenden, damals mir noch unbekannten, Zigaretten rauchenden jungen Herrn. Freilich war aber auch das, was wir beide nun redeten, belanglos, und ich empfing von ihm eigentlich keinen weiteren Eindruck als den von einem sehr höflichen, gutgekleideten, im Wesen jedoch ziemlich alltäglichen Menschen von etwa achtundzwanzig oder dreißig Jahren; und erst als man die Tafel aufhob, sagte man mir, wie er überhaupt hieß und daß er Fähnrich im Dragonerregiment Maria Isabella gewesen. Später dann habe er reich geheiratet. Er sei, wie erwähnt, Großneffe des Generals der Kavallerie Crenneville. Ich blickte zu dem General hinüber und sah eben noch, wie er, ein kleiner, magerer, uralter Herr, auf den Arm meines ehemaligen Obersten gestützt, sich anschickte, den Saal zu verlassen.
Meinen Tischnachbarn vergaß ich in der Folge selbstverständlich sehr bald, auch sah ich ihn während etwa zweier Jahre nicht wieder. Doch ergab es sich dann, daß ich ihn ein paar Male nacheinander auf Abendgesellschaften traf. Aus diesen Anlässen lernte ich auch seine Frau kennen, eine wahrhaft schöne Person mit auffällig hellem Teint und wundervollen, graublauen Augen. Sie sprach wenig, und überhaupt fiel mir später auf, daß die beiden, auch wenn sie, viele Stunden lang, gemeinsam unter Leuten gewesen waren, kaum irgend etwas miteinander geredet hatten. Dennoch hieß es, sie seien eine sogenannte gute Menage. Sie hatten, sagte man mir, drei Kinder, einen Knaben und zwei Mädchen.
Auch auf der Straße traf ich Menis dann noch ein paar Male. Wir wechselten bei diesen Gelegenheiten stets einige belanglose Worte. Erst die letzte unserer Begegnungen sollte eine ganz ungewöhnliche, ja erschütternde sein.
Sie fand gegen Ende November statt, an einem frühen Nachmittag, in einer wenig belebten Straße. Ich nahm da einen sehr korrekt gekleideten Menschen wahr, der, schon während der ganzen Zeit, die ich auf ihn zuging, mit einem Bettler sprach, oder vielmehr, wie ich beim Näherkommen merkte, mit einem Invaliden, der ein verkrümmtes und verbundenes Bein hatte, auf Krücken dastand und, wenngleich er in schlechtem Zivil war, mehrere Medaillen an der Brust trug. Diese Medaillen hingen an beschmutzten Bändern, das Gesicht des Mannes hatte einen sonderbaren, zerstörten Ausdruck, auch fror er, er war ohne Mantel, es war ein kalter Tag. Ich war bereits im Begriff, ihm eine Münze zu geben, unterließ es aber, weil er mit jemandem im Gespräch begriffen war. Es hätte mir taktlos geschienen, das, selbst bei einem Bettler, nicht zu respektieren. Ich wollte also schon vorübergehen, da wendete der Herr, mit dem er gesprochen hatte, sich um. Ich erkannte Menis und blieb stehen, um ihn zu begrüßen.
Menis aber schien, sonderbarerweise, äußerst verlegen. Ich hatte schon den Hut gezogen; doch vergaß Menis im Moment sogar zu danken. Ich hatte geradezu den Eindruck, daß es ihm peinlich sei, mich zu sehen, und seine Befangenheit war eine so große, daß sie sich, nach meinem ersten Erstaunen, mir selber mitteilte, gewissermaßen als hätte nun auch ich plötzlich Grund, wegen unseres Zusammentreffens betreten zu sein. Wir starrten uns einen Augenblick an, und schließlich, um nur irgend etwas zu sagen und mich aus der Affäre zu ziehen, fragte ich ihn, wie es ihm gehe. Dabei blickte ich rasch von ihm zu dem Bettler und wieder zu ihm zurück, und eigentlich wollte ich nun schon wieder an ihm vorbei und weiter, allein er stand mir im Wege und rührte sich nicht. – »Ach«, brachte er endlich heraus, »du bist es?«, und damit blickte auch er hastig den Bettler an, doch sah er sofort wieder weg, und dann wendete er den Kopf rasch nach der andern Seite, und ich sah gleichfalls hin. Da hielt, ein paar Schritte weiter, am Gehsteig ein Wagen mit offenen Schlägen, ein Chauffeur stand daneben und sah zu uns herüber.
Menis wandte sich jedoch sogleich wieder zu mir zurück. Er schien sich inzwischen halbwegs gefaßt zu haben, jedenfalls fragte er nun: »Wie geht es dir?«, fuhr aber rasch fort: »Ich gehe nämlich hier spazieren, das heißt: ich bin eigentlich bis hierher gefahren, jetzt aber ausgestiegen, um … zu Fuß weiterzugehen.«
So? dachte ich. Der Wagen ist also sein Wagen? Doch setzte er sogleich hinzu: »Ich wollte da eigentlich auch diesem Invaliden … ich wollte ihm eine Kleinigkeit geben«, und indessen ich wieder auf den Invaliden blickte, wendete Menis sich neuerlich zu seinem Chauffeur und sagte: »Sie können heimfahren!«
Gleichzeitig winkte er mit der Hand.
Der Chauffeur verbeugte sich, schloß den Schlag, stieg in den Wagen und zog auch den zweiten Schlag zu. Dann brachte er den Wagen in Gang und fuhr davon.
Es war ein schwerer, ganz neuer, von Chrom und schwarzem Lack blitzender Wagen.
Als er fort war, standen wir noch einen Augenblick einander gegenüber, und der Bettler, vorgebeugt und auf seine Krücken gestützt, sah uns an. Dabei schwankte sein Oberkörper ganz leicht vorwärts und rückwärts, und die Medaillen klapperten leise aneinander. Wollten etwa, dachte ich, die beiden sich noch etwas sagen? Was denn eigentlich? Worüber hatten sie denn überhaupt gesprochen? Ich war schon im Begriff, nochmals den Hut zu ziehen und mich endgültig zu empfehlen, als Menis mich beim Arm nahm, ein paar Schritte von dem Mann wegzog und sagte: »Ich gebe nämlich immer den Bettlern etwas. Hauptsächlich solchen … solchen Invaliden. Wohin willst du übrigens? Hätte ichdich mit dem Wagen nicht vielleicht irgendwohin bringen können? Schade, daß ich ihn weggeschickt habe. Im Augenblick hatte ich wirklich gar nicht daran gedacht, daß … Oder wollen wir nicht doch lieber zu Fuß … vorausgesetzt, daß es dir recht ist, wenn wir ein paar Schritte zusammen …«
»Oh, bitte«, sagte ich, »bitte sehr«, denn ich hatte den Eindruck, als wolle er nun dadurch, daß er mit mir kam, die Sonderbarkeit, mit der er sich aufgeführt hatte, verwischen. »Ich wollte zu Bekannten … aber das hat ja Zeit … Störe ich dich denn in der Tat nicht?«
»Nein, gar nicht!« sagte er. »Ich dachte im Moment wirklich nur, du könntest es eigentümlich finden, daß ich da mit diesem Bettler … ich schenke, wie gesagt, den Leuten immer irgendeine Kleinigkeit.« Während er das sagte, ging er, indem er mich noch am Arme festhielt, die Gasse rasch hinunter, als hätte er es eilig, dem Menschen, von dem er sprach, aus den Augen zu kommen. »Ich brauche dir das«, fügte er hinzu, »doch nicht erst zu erklären, es sind ja alles entsetzlich arme Kerle.«
Damit wollte er schon um die Hausecke, an die wir inzwischen gekommen waren, sah sich aber vorher noch rasch um, und ich sah mich gleichfalls um. Der Bettler hatte sich zu uns herumgewendet und blickte uns nach. Menis bog hastig um die Ecke. Dann erst ließ er meinen Arm los, machte eine Bewegung, als sei ihm nun leichter, jenem Menschen aus den Augen zu sein, und sprach schnell weiter:
»Du mußt dir nur vorstellen, was diese Leute, wenn sie den ganzen Tag so in der Kälte dastehen, mitmachen, ganz abgesehen von dem, was sie schon mitgemacht haben, bis sie zu Bettlern geworden sind! Und wo sie dann nachts etwa unterkriechen, wenn sie schlafen gehen! Und was für Abfall das wohl sein mag, den sie essen! Und wie sie die Reste weggeworfener Zigaretten aufheben müssen, wenn sie rauchen wollen! Und was für Kleider das sind, die sie anhaben, solche, die schon niemand mehr hat tragen mögen, bis man sie ihnen gegeben hat! Und was es überhaupt heißt, so arm zu sein, daß sie nicht einmal mehr das eigene Leben haben, wenn andre ihnen nicht etwas zu leben schenken, und dabei diesen andern so gleichgültig zu sein, daß sie’s egal finden, wenn jene krepieren! An den Häuserwänden zu stehen, und niemand kümmert sich um sie, und, wenn sie nicht mehr stehen können, auf den Gehsteigen im Schmutz hocken zu müssen, mitten im Lärm und Verkehr, und nichts mehr zu sein, schmutziges Nichts! Und man hatte ihnen doch ehemals gesagt, wer sie wären: Soldaten in glänzenden Regimentern, Infanterieregiment König von Spanien zum Beispiel, Ulanenregiment Fürst Soundso, oder wie sie sonst alle geheißen haben mögen, bei deren Fahnen, wenn sie geweiht worden waren, Erzherzoginnen als Patinnen gestanden hatten! Wegen eines Knopfes an ihren Monturen, der nicht in Ordnung war, wurden Majore pensioniert, der Stolz des Reichs, sagte man ihnen, seien sie gewesen, einer Welt, die man gegen sie aufbot, bedurfte es schließlich, um sie zu besiegen. Und nun? Was sind sie? Schmutzige Gespenster im Straßenkot, Verkehrshindernisse an den Ecken, häßliche Anblicke, die die Passanten erschrecken, erbärmliche Gestalten, denen man wünschte, sie wären besser schon tot. Ich halte es für einen Skandal, wenn nicht wenigstens ehemalige Offiziere ihnen geben, was sie nur geben können. Ich gebe jedem etwas. Ich spreche dann stets auch ein paar freundliche Worte. Ich kenne die Leute auch schon alle. Es ist selbstverständlich, daß ich auch mit dem Mann da vorhin einige Worte geredet habe. Er sagte mir, in welchem Regiment er gedient hätte und wo er verwundet worden wäre. Du begreifst doch, nicht wahr?«
»Ja, ja«, sagte ich, »natürlich«; und ich wollte ihn schon fragen, warum es ihm denn dann eigentlich so unangenehm gewesen sei, daß ich ihn dabei bemerkt hatte, doch unterließ ich’s. Wir waren inzwischen an den Übergang einer ziemlich belebten Straße gekommen, der eben gesperrt war, und wir hatten zu warten. Menis schwieg und starrte vor sich hin. Knapp neben uns tauchte in diesem Augenblick, mit einem Kind auf dem Arm, eine Bettlerin auf, eine noch junge Person, die aber elend und verwahrlost aussah und das Kind in schmierige Lappen gewickelt hatte. Sonderbarerweise, nachdem er sie einen Moment lang angesehen, beachtete Menis sie gar nicht weiter. Ich reichte ihr eine Münze. Menis blickte kurz auf. Zugleich war auch der Übergang freigegeben worden; und Menis, während wir die Straße überquerten, sagte:
»Man braucht freilich nur irgendwo stehenzubleiben, und es sprechen einen schon Bettler an. Doch gibt es eben Bettler und Bettler. Ich muß dir das Geständnis machen, daß ich mich nur für gewisse Arten von ihnen interessiere, vor allem eben für solche, die erst zu Bettlern geworden sind, denn nur die sind die wirklich Bedauernswerten, viel bedauernswerter zum mindesten als jene, die schon als Kinder zum Betteln angehalten worden sind. Ich habe auch bereits einen gewissen Blick für solche, die aus der Bettelei bloß ein Geschäft machen. Zum Beispiel gibt es hier gleich in der Nähe, bei der Oper, einen Kerl, der mir besonders zuwider ist. Ich weiß nicht, ob er heute da ist, sonst könnte ich ihn dir zeigen. Er hat sich aus einem alten Zigarrenkasten und aus einem Stock eine Geige gemacht, auf der er, wie man zugeben muß, ganz gut spielt; aber bei diesem Spielen verbiegt und verkrümmt er sich, obwohl er ganz gerade Glieder hat, derart, daß es ekelhaft ist. Er tut bestimmt nur so, als ob ihm etwas fehlte. Er ist auch noch ganz jung, sonst hielte er ja auch diese Akrobatik auf die Dauer nicht aus. Ich bin überzeugt, daß er, grotesk wie er sich anstellt, eine Menge Almosen bekommt und sich besser steht, als wenn er irgendwelche Arbeit angenommen hätte. – Da ist er.«
In der Tat sahen wir nun, noch auf einige Entfernung vor uns, mitten im Verkehr einen Menschen, der in unbequemster Haltung auf einer Geige spielte, die er in der Weise sozusagen auf dem Schoß hielt, daß er im Stehen so tat, als säße er. Diese Geige bestand, wie wir im Herankommen merkten, wirklich nur aus einem Stock und aus einer Zigarrenschachtel. Er spielte eben die »Paloma«, sogar recht virtuos, obwohl er nur eine oder zwei Saiten hatte. Die »Paloma« ist ein sehr schwermütiges Lied. Vor seiner Erschießung soll Maximilian von Mexiko sich’s noch einmal haben vorspielen lassen, und wir hatten einmal ein Küchenmädchen, die sang das Lied fast fortwährend, bevor sie, aus unglücklicher Liebe, hinging und sich ertränkte. Es ist wirklich ein trauriges Lied. Aber es schien Menis gar nicht zu rühren. »Es gibt«, sagte er, »weiß Gott ärmere Bettelmusikanten als diesen hier, die dennoch eine wirkliche Geige haben. Diese Zigarrenkiste ärgert mich grenzenlos. Und sieh nur, wie er die Kappe, damit man ihm Almosen hineinwerfen soll, herausfordernd mitten unter die Passanten gelegt hat!« Doch konnte ich nicht feststellen, ob der Mann simulierte oder nicht. Allerdings sah er elend aus. »Aber es gehört zu seinem Beruf«, sagte Menis, »elend auszusehen. Er ißt fast nichts, obwohl er genug verdient, um essen zu können. Unter diesen Leuten gibt es eben unverhältnismäßig mehr Simulanten als wirkliche Bettler. Andre wieder, die ein wirkliches Gebrechen haben, übertreiben es maßlos. Da gibt es zum Beispiel weiter oben einen, der hockt immer auf dem Boden, als ob er nicht mehr stehen könne. Aber wenn er sich genug zusammengebettelt hat, so steht er ganz einfach auf und geht heim. Ich habe ihn schon ein paarmal gesehen, wie er bolzengerade und rasch davonging. Denn an den Beinen fehlt ihm gar nichts. Er hat bloß eine Schädelverletzung. Ich will ihn dir zeigen.«
So, dachte ich, bloß eine Schädelverletzung! »Und beim Betteln«, sagte Menis, »macht er ein Bettlergesicht, wenn er aber heimgeht, macht er ein arrogantes Privatgesicht wie ein Schauspieler nach der Vorstellung.« Er bog in eine Seitengasse ein, und schon nach ein paar Schritten kamen wir an diesem Menschen vorbei, der, wie ein Haufen Elend, auf dem Pflaster mehr lag als saß. Auf dem Kopf hatte er ein gebogenes, vernickeltes, blitzendes Ding, eine Art metallener Hirnschale, mit Leder gepolstert, und sein rechter Arm stak in Schienen aus dem gleichen Material. Mochte er immerhin nur vorgeben, daß er nicht mehr stehen und gehen könne, die Tatsache, daß ihm, wahrscheinlich von einem berstenden Artilleriegeschoß, ein Teil der Kopfdecke weggerissen worden war, schien mir entsetzlich genug. Durch den Lärm des Verkehrs glaubte ich das ungeheure, grausame Brüllen der Granate zu vernehmen, die ihm das getan. »Aber man plakatiert«, sagte Menis, indem wir vorbeigingen, »seine Wunden nicht so. Man erschreckt die Leute nicht durch einen solchen Anblick, um Almosen zu erpressen. Keiner, der ein guter Soldat gewesen ist, täte das. Man stellt sich nicht selbst an den Pranger. Der Mann könnte ein Tuch um den Kopf nehmen oder einen Hut aufsetzen. Es ist nichts widerlicher als diese Aufdringlichen. Zum Beispiel gibt es da auch solche, die im Gehen plötzlich neben einem auftauchen und einem einfach so lang nicht mehr von der Falte gehen, bis sie etwas erhalten haben. Oder andre, die mit Schuhriemen in der Hand neben einem herrennen. Oder wiederum andre, die in den Straßenbahnen singen, so falsch, daß man ihnen anmerkt, wie oberflächlich sie’s nehmen. Aber man sieht fast nur mehr Elende, die eine Industrie aus ihrem Elend gemacht haben. Sie mißkreditieren die wirklichen Bettler. Wirkliche, tragische Bettler sind, wie gesagt, eigentlich nur die, die früher alles andre eher als Bettler waren, Soldaten vor allem. Es gibt in unserer Zeit und in unserem Lande keine tragischere Figur als den bettelnden Soldaten. Jeder Soldat, der nun keiner mehr sein darf, ist in irgendeinem Sinn schon zum Bettler geworden, ob er nun arm ist oder reich.«
Ich gestehe, daß ich allmählich von dieser Inspektion von Bettlern, mit denen allen Menis nicht zufrieden war, genug bekam. Ich hatte ihnen stets etwas gegeben, ohne mir den Kopf darüber zu zerbrechen, ob sie nun zu Recht bettelten oder nicht. Menis aber hatte ein System daraus gemacht, wenn er Almosen gab. Er ist vermögend, dachte ich, er hat wenig zu tun, er befaßt sich kritisch mit Bettlern wie ein anderer mit seiner Sammlung. Es ist sein Steckenpferd. Er ist gar nicht mildtätig, er geht aus, um die Ärmsten zu benörgeln. Er hätte sich einen anderen Spleen aussuchen sollen. Es wäre geschmackvoller gewesen.
Er war mir sympathisch gewesen, nun aber war ich von ihm enttäuscht. Ich blieb stehen und sagte ein paar Worte, etwa des Inhalts, daß ich nun meiner eigenen Wege gehen müsse, doch merkte ich, daß er gar nicht auf mich achtgab. Wir waren inzwischen in die Nähe der Hofburg gekommen. Als ich stehenblieb, war Menis gleichfalls stehengeblieben, offenbar aber aus einem ganz andern Grund als ich. Ich sah nämlich, daß er plötzlich einen Menschen anstarrte, der da neben der Einfahrt zu einem Palais stand. Dieser Mensch war allerdings wiederum ein Bettler, aber er war sauber gekleidet. Er hatte eine Uniform an und um die Augen eine schwarze Binde. An seiner Seite stand ein kleines, mageres Mädchen von etwa acht oder neun Jahren. Das Kind hielt ihn an der Hand. Der Mann war blind.
Ich sah flüchtig hin, dann sagte ich nochmals, daß ich mich nun empfehlen müsse. Ich hatte keine Lust mit anzuhören, wie Menis nun auch diesen Blinden kritisieren würde. Er achtete aber auf meine Worte noch immer nicht. – »Einen Moment«, sagte er schließlich, ohne jedoch die Augen, die er starr auf den Blinden gerichtet hatte, abzuwenden, »einen Moment, ich muß da zu diesem Menschen, der ist möglicherweise sogar von meinem eigenen Regiment.«
Ich sah nun von neuem zu dem Bettler hin, und Menis tat ein paar Schritte auf ihn zu. »Ich kenne ihn aber gar nicht«, sagte er, »und sonst kenne ich doch alle«, und damit stand er schon vor ihm.
In der Tat trug der Blinde die Uniform eines Dragonerkorporals. Auf seiner linken Schulter sah ich die gelbe Achselspange, die andeutete, daß er ein Reiter gewesen war. Die Uniform war sehr sauber. Er trug hohe Stiefel und Sporen. Auf dem Kopf hatte er die schirmlose Kappe der Reiterei. Darunter ging die Binde über seine Augen. Er hatte schwarze Parolen, mit den zwei Zwirnsternen benäht, die seine Charge anzeigten.
»Welches Regiment?« fragte Menis. Denn es hatte zwei schwarze Dragonerregimenter gegeben, die nur durch die Farbe der Knöpfe voneinander unterschieden gewesen waren. Der graue Knopf an der Achselspange des Korporals aber verriet nichts.
Auch erfaßte der Mann nicht sogleich, daß ihn jemand, den er nicht sah, nach seinem Regiment fragte. Menis hatte die Frage also zu wiederholen.
»Dragonerregiment Maria Isabella«, sagte der Mann.
Das Kind, das ihn an der Hand hielt, blickte uns, offenbar eingeschüchtert von dem befehlenden Ton, in welchem Menis das zweitemal gefragt hatte, mit großen Augen an.
Als der Blinde das Regiment nannte, sagte ich: »Tatsächlich« und wollte, zu Menis gewendet, hinzusetzen: »Dein Regiment«, doch winkte er mir rasch ab. – »Wie heißen Sie?« fragte er den Korporal.
Der Mann antwortete: »Johann Lott.«
Ich sah Menis an, aber ihm war nicht anzumerken, ob er den Menschen kannte oder nicht. »Und Sie sind«, fragte er, »erblindet?«
»Ja.«
»Im Krieg?«
»Ja.«
»Vollständig?«
»Ja. Vollständig.«
»Wie ist es dann«, fragte Menis nach einem Moment, »möglich, daß Sie betteln müssen? Sie haben doch, in Ihrem Fall, eine Rente zu beziehen, die Ihnen erlaubt, ganz davon zu leben.«
Der Korporal zögerte einen Augenblick, dann fragte er: »Wer ist der Herr eigentlich?«
»Beunruhigen Sie sich deswegen nicht«, sagte Menis rasch. »Ich habe bestimmt nicht die Absicht, Sie auszuhorchen. Ich frage nur aus Teilnahme.«
»Oder glauben Sie vielleicht nicht, daß ich wirklich blind bin?«
»Doch«, sagte Menis. Allein der Mann hatte schon, mit einer sehr schnellen Bewegung, für einen Moment die Binde gehoben. Er hatte keine Augen mehr.
»Lassen Sie das«, fuhr Menis auf, »ich sagte ja, daß ich’s Ihnen glaube!« Er war bleich geworden. »Wieso«, schrie er nervös weiter, »stehen Sie also, zum Teufel, hier und betteln?«
Der Korporal richtete sich die Binde wieder zurecht, dann sagte er: »Ich bettle nicht für mich selbst. Aber ich habe so arme Verwandte, daß ich mit der Unterstützung, die ich erhalte, eigentlich noch der Vermögendste von ihnen bin. Ich gebe ihnen auch von meinem Geld, so viel ich kann. Doch nun ist meine Schwester, die Mutter dieses Mädchens hier, krank geworden. Ich habe mich also von der Kleinen auf die Straße führen lassen, um ein wenig Geld heimbringen zu können. Einem Blinden gibt man ja noch am ehesten etwas. Ich habe auch meine Uniform angezogen, man darf ja jetzt die Uniformen wieder tragen. Ich habe gedacht, wenn ich so dastünde, würde man merken, daß ich Grund genug habe zu betteln, und mir etwas geben.«
Die Szene war mehr als peinlich. Daß Menis, in seiner Manie, alle Bettler auszufragen, sie heraufbeschworen hatte, fand ich widerlich von ihm. Ich hatte aber wenigstens die Genugtuung, zu merken, wie sehr nun auch er selbst davon betroffen war. Er war blaß geworden bis in die Lippen. Um so weniger begriff ich allerdings, warum er dem Menschen nicht endlich etwas Geld gab und dazusah, daß er weiterkam, statt dazustehen und ihn immerzu weiter anzustarren. Auch das Kind war schon ganz erschreckt, weil er mit dem Blinden so geschrien hatte. »Gab es denn«, fragte ich schließlich in meinem Ärger über seine Aufführung, »gab es denn in Ihrem Regiment nicht auch einen Fähnrich, der Menis hieß?«
Zugleich fühlte ich mich von meinem Begleiter heftig am Arm ergriffen, als wolle er mich am Weitersprechen hindern, doch antwortete der Korporal schon: »Menis? Ja. Es war ein Fähnrich Menis bei uns, aber nur wenige Tage.«
»Wieso nur wenige Tage?«
»Er war von einem andern Regiment gekommen und bei uns bloß kurze Zeit, das heißt: bis ich verwundet wurde. Doch da war ohnedies schon das Ende da.«
»Aber gesehen haben Sie ihn noch?«
»Ja«, sagte er, und ich war schon im Begriff, zu sagen: »Nun, er steht vor Ihnen«, als der Blinde fortfuhr: »Gesehen habe ich ihn. Er war sogar das letzte, das ich überhaupt noch gesehen habe.«
Die Wirkung, die diese Worte auf Menis machten, war eine außerordentliche. Er schien den Blinden wirklich jetzt erst zu erkennen. Er war schneeweiß im Gesicht geworden und starrte ihn an wie einen Geist, und auch ich, ganz verwirrt, stotterte: »Was meinen Sie damit?«
»Es war auf den Donaubrücken bei Belgrad«, sagte der Blinde. »Die Regimenter sollten hinübergehen, aber mitten auf den Brücken hielten sie an und begannen auf einander zu schießen. Der Fähnrich Graf Heister, der die Standarte trug, fiel, und ich fing die Standarte auf. Da kam mitten im Feuer, zwischen den Leuten und Pferden, die stürzten und sich auf der Brücke wälzten, der Oberst auf mich zugaloppiert und befahl mir, die Standarte dem Fähnrich Menis zu übergeben. Ich reichte dem Fähnrich also die Standarte. Er hatte sie aber kaum ergriffen, als mich ein Karabinerschuß von der Seite her durch beide Augen traf und vom Pferde warf. Das letzte, was ich gesehen habe, waren der Fähnrich und die Standarte.«
Mit einem Ruck hatte Menis sich den Mantel aufgerissen und aus den Taschen seines Anzuges mit beiden Händen Geld herausgeholt, offenbar alles, was er bei sich hatte, es war eine Menge großer Noten dabei, er drückte es dem Blinden in die Hände, dann riß er mich mit sich weg. Er hatte mich an der Schulter ergriffen und rannte mit mir, mehr als daß er gegangen wäre, die Straße hinab und in eine Seitengasse hinein. Seine Lippen zitterten fortwährend. »Ich muß mit dir reden«, stammelte er, »ich will dir alles erklären. – Hast du eine Zigarette?« Ich reichte ihm eine. Er brachte es aber, indem er immer weiterlief, minutenlang nicht dazu, sie anzuzünden. Schließlich zwang ich ihn stehenzubleiben und gab ihm Feuer. Lauter kleine Schweißtropfen standen auf seinem Gesicht. »Wir müssen«, stammelte er, »irgendwohin, wo ich mit dir reden kann.« Er sah sich um, wir standen vor der Tür eines kleinen Kaffeehauses, er riß sie auf, sah jedoch, daß es voller Leute war, warf die Tür wieder zu und rannte fort. Ein paar Häuser weiter trat er in ein zweites Kaffeehaus, wandte sich aber sofort wieder um und wollte neuerlich davonrennen. Ich bat ihn zuletzt dringend, sich nicht so zu gebärden. »Du verstehst das nicht«, stieß er hervor, »du kannst es ja unmöglich begreifen, bis ich dir’s nicht erklärt habe!« Immerhin brachte ich ihn zu einem langsameren Tempo. Er wischte sich mit dem Ärmel ein paarmal über die Stirn und schien sich Mühe zu geben, sich zu fassen. Nach einigen Minuten waren wir zum Neuen Markt gekommen, er überquerte ihn mit der Richtung auf das »Ambassador« und trat ein. Die Halle des Hotels war leer. Er eilte an den Bediensteten vorbei, trat am andern Ende der Halle zu einem Tisch, um den ein paar Fauteuils standen, warf seinen Hut hin und rief nach einem Kellner. Dann ließ er sich in einen der Fauteuils fallen. »Setz dich, bitte«, sagte er. »Ich muß jetzt unbedingt etwas trinken. Du wirst die Güte haben, es zu bezahlen, ich habe, glaube ich«, und er wühlte in seinen Taschen, »kein Geld mehr bei mir.« Er stand auf, warf den Mantel ab und schlug mit den Händen fortwährend auf die Fauteuillehnen. Er war immer noch sehr bleich. Ein Kellner erschien. Er bestellte zwei Gläser Kognak. Ich reichte ihm nochmals Zigaretten. »Versteh mich recht«, sagte er, indem er wieder anfing, Zündhölzer zu verschwenden, »daß ich mich für Bettler interessiere, ist ja natürlich nicht wahr. Ich interessiere mich gar nicht für sie. Ich interessiere mich nur für die, die aus dem Krieg kommen. Ich komme davon einfach nicht los. Ich glaube auch gar nicht, daß dieser Krieg überhaupt zu Ende gegangen ist. Er geht immer noch weiter. Er geht in all denen weiter, die dabei waren und nun auf der Straße stehn müssen und betteln. Er geht auch in mir weiter. Er hat für mich sogar erst begonnen, als er zu Ende war. Ich hatte ihn vorher nicht begriffen. Erst als gar nicht mehr Krieg war, habe ich angefangen, ihn zu begreifen.«
Der Kellner kam zurück und brachte den Kognak. Menis goß ein Glas hinunter und bestellte sofort ein zweites. Ich bot ihm inzwischen meines an. Er trank es aus und schien endlich etwas gefaßter. »Ich habe«, sagte er, »geheiratet, als der Krieg vorbei war, meine Ehe gilt für glücklich, ich habe Kinder, ich liebe sie, ich liebe auch meine Frau immer noch, aber manchmal ist mir, als ob ich sie nie geliebt hätte. Ich habe sie vielleicht auch bloß geheiratet, weil sie eben noch da war, als sonst nichts mehr da war, nichts von dem, was mich nicht verläßt, obwohl es nicht mehr existiert, was immer noch sein wird, obwohl es längst vorüber ist, was wirklicher ist als alles, das wirklich ist. Du mußt mich verstehen! Hör mich an!«
Die Halle blieb auch weiterhin leer, nur hin und wieder ging jemand vorbei, ein Hotelangestellter oder ein Gast, doch das störte nicht. Eine Lampe mit dunklem Schirm beleuchtete die Seidensessel, die Glasplatte des Tisches, die Messingbeschläge des Kamins. Der Rauch unserer Zigaretten schwebte in Schleiern durch den dämmerigen Raum. Von der Straße drang der Lärm nur gedämpft herein. Sonst war es hier ganz still. Menis erzählte mir seine Geschichte.
II
Ich heiße Herbert Menis, sagte er. Mein Vater war Heinrich Crenneville, Fregattenleutnant, meine Mutter hieß Maria Menis. Zufolge gewisser Auseinandersetzungen jedoch, die mein Vater mit der Admiralität hatte und die ihn schließlich auch auf seine Charge verzichten ließen, nahm er den Namen meiner Mutter an, ließ den Namen Crenneville fallen und nannte sich nur mehr Menis. Der Vater meines Vaters war Ludwig Crenneville, Rittmeister im Kürassierregiment Lothringen. Dessen jüngerer Bruder war eben jener Ferdinand Crenneville, der später General der Kavallerie wurde. Er ist im vorigen Jahre gestorben.
Nach dem Verzicht auf seine Charge ertrug mein Vater das Leben nur mehr kurze Zeit. Er ging herum und suchte Händel mit den Herren des Admiralstabes, die, seiner Meinung nach, schuld daran gewesen waren, daß er seine Charge hatte niederlegen müssen. Den Linienschiffsleutnant Luchesi Palli, mit dem er sich schlug, verwundete er schwer. Nachdem er dann zwei Jahre auf einer Festung verbracht hatte, ließ er sich auf einen Wortwechsel mit einem Korvettenkapitän Fiedler ein und wurde von ihm in der Reitschule der Garden erschossen.
Seit mein Vater tot war, reiste meine Mutter viel. In Florenz lernte sie dann einen gewissen Shuttleworth kennen, einen jungen Menschen, der, trotz seines englischen Namens, Russe war und Neffe des Intendanten der Prinzessin-Witwe Peter von Oldenburg, Henry Fedorowitsch Shuttleworth. Meine Mutter heiratete ihn und zog mit ihm nach Rußland. Auch habe ich sie dann nur noch einmal wiedergesehen, als ich vierzehn Jahre alt war, in Sankt Petersburg, knapp vor dem Kriege. Im Kriege selbst erreichten ihre Briefe uns nur auf dem Umweg über die Schweiz. Schließlich blieben sie ganz aus. Erst viel später erfuhren wir, Shuttleworth sei von den Sowjets erschlagen worden und meine Mutter auf der Flucht in die Ukraine gestorben.
Meine Erziehung war meinem Großonkel Ferdinand Crenneville überlassen geblieben. Indessen schwärmte er, trotz der glänzenden militärischen Karriere, die er selber gemacht hatte, nicht eben sehr für den Dienst im Heere. Er bestimmte mich vielmehr für einen bürgerlichen Beruf. Doch überholten ihn die Ereignisse, und er mußte zugeben, daß ich, ein Jahr nach Kriegsbeginn, erst sechzehnjährig, in das Dragonerregiment Beide Sizilien eintrat.
Ein Jahr später wurde ich, auf dem Rückzuge von Luzk, so schwer verwundet, daß ich fast bis ans Ende des Krieges keinen eigentlichen Dienst mehr tun konnte. Ich war nämlich, mit einem Schuß im Unterleib, mehrere Tage auf einem Gepäckwagen gelegen, bis wir endlich zu irgendwelchen Ärzten kamen, aber auch die waren von jeglichen Hilfsmitteln entblößt und konnten nichts für mich tun, als daß einer von ihnen, weil meine Wunde inzwischen völlig vereitert war, die Bauchdecke eine Handbreit aufschnitt. Das rettete mir zwar das Leben, allein es heilte dieser Schnitt später nur so oberflächlich zu, daß ich monatelang eine Art Mieder zu tragen hatte. Ich mußte mich erst einer Operation unterziehen, bei der die zerschnittene Muskulatur aneinandergenäht wurde, bis ich mich wieder ohne Mieder bewegen konnte. Doch galt ich auch dann noch immer für schonungsbedürftig. Man zog mich demzufolge also auch nicht zu meinem Regiment ein, das im Felde stand, sondern zu einem der Kommandos der Balkanarmeen, nach Belgrad, als eine Art Ordonnanzoffizier, wenngleich ich eben erst Fähnrich geworden und also noch nicht Offizier war, und stellte drei Pferde und zwei Ordonnanzen zu meiner Verfügung.
Das war schon gegen Ende Oktober 1918. Als ich mich beim Armeekommando meldete, bewies mir die Art, auf die man mich empfing, daß man mich als unter dem besonderen Schutz meines Großonkels stehend betrachtete. Die Leute konnten sich nicht vorstellen, daß ich wirklich nur da sei, weil ich zwei Jahre lang mit zerschossenem Bauch herumgelaufen war. Ich blieb bei diesem Armeekommando aber auch nicht länger als einen halben Tag und eine halbe Nacht, und das kam so:
Am Abend dieses ersten und letzten halben Tages ging ich in Gesellschaft mehrerer Offiziere in die Oper. Es war zahlreichen prominenten Sängern und Sängerinnen in Belgrad zu gastieren befohlen worden. Auf dem Weg ins Theater aber besprach man sich weit weniger über ihre Stimmen als vielmehr fast ausschließlich über die Situation an der Front.
Zufolge des Zusammenbruchs der Bulgaren nämlich klaffte schon seit Tagen und Wochen zwischen den Armeen des Generalfeldmarschalls von Mackensen und denen der Österreicher ein Raum, in den die Truppen des französischen Marschalls Franchet d’Esperey stürmisch vordrangen. Unsere Balkanheere, deren Flügel nun in der Luft hingen, befanden sich alsbald im Zustand wachsender Verwirrung. An Mackensens Front stände, so hieß es, nur mehr auf alle siebzig Schritte ein Mann, und französische Reiterei bedrängte unsern eigenen Rückzug aufs äußerste.
Dennoch dachten die Armeekommanden noch nicht daran, zurückzugehen. Sie hatten sich zu wohl installiert. Große Mengen unserer Truppen, sagte man überdies, die in der Ukraine gelegen hatten, waren nach Ungarn beordert worden, sich da zu sammeln, über die Donau herüberzukommen und die Front zum Stehen zu bringen.
Jedenfalls verriet auch der Anblick des Zuschauerraums in der Oper noch nicht im mindesten, daß man sich in Belgrad etwa schon unsicher gefühlt hätte. Die Sitzreihen waren gedrängt voll von Offizieren, ihren Damen, Maltesern, Pflegerinnen und Stenotypistinnen der Kommandos. In den Logen gab es eine Menge Generale; und manche der Damen trugen sogar Abendkleider und Schmuck.
Es sollte die »Hochzeit des Figaro« gegeben werden.
Bevor aber noch die Ouvertüre einsetzte, ging eine Bewegung durch den Zuschauerraum, und es erhob sich fast alles von den Sitzen. In der Hofloge, in der ehedem die Könige von Serbien gesessen hatten, war eine Dame erschienen, der die Aufmerksamkeit des Hauses galt. Begleitet war sie von zwei anderen noch sehr jungen Damen und mehreren Offizieren.
Sie war von hohem Wuchs und äußerst konservativ gekleidet und frisiert. Sie trat an die Logenbrüstung und dankte. Danach nahm ihr einer der Offiziere den Pelz von den Schultern, ein zweiter schob einen Fauteuil von hinten an sie heran, und sie setzte sich, worauf das Haus gleichfalls wieder seine Plätze einnahm.
Links und rechts von ihr, doch ein wenig weiter zurück, setzten sich nun auch die beiden jungen Damen; die Offiziere blieben im Hintergrund der Loge stehen.
Man sagte mir, es sei dies die Erzherzogin Maria Antonia, welche die Verwundeten in den Spitälern von Belgrad besuche.
Die Dame zu ihrer Rechten war dunkelhaarig, schlank und hatte ein im ganzen nicht uninteressantes, ein wenig kalmückenhaftes Gesicht. Man bezeichnete sie mir als eine Baronesse Mordax.
Die Dame zur Linken der Erzherzogin war, geradeheraus gesagt, bezaubernd.
Sie trug ein blaßrosenfarbenes Kleid, Perlen und lange weiße Handschuhe. Ihre Schultern und der Ansatz ihrer Arme waren wundervoll.
Indessen das Haus sich schon verdunkelte und die Ouvertüre einsetzte, erkundigte ich mich nach ihr, und man sagte mir, sie heiße Resa Lang.
Während der neben mir sitzende Leutnant, ein Herr von Bagration, mir nun auch noch die Namen der im Hintergrund der Loge stehenden Offiziere nannte, wendete ich keinen Blick von der Schönen. Sie mochte höchstens achtzehn Jahre alt sein. Im Dämmer des Raumes schimmerte ihr Gesicht wie Alabaster. Als der Vorhang sich hob, fiel der Widerschein einer Flut von Licht auf sie und glänzte in ihren Augen, auf ihrem Haar und ihren Perlen auf. Als sie dann das Opernglas hob, fiel davon ein Schatten, wie von einer Halbmaske, auf ihr Gesicht, nur ihr Mund und ihr Kinn blieben beleuchtet, und für einen Moment, als sie eine Bemerkung machte, sah ich den schneeigen Blitz ihrer Zähne.
Sie sei, erklärte Bagration, die Tochter eines Industriellen, als Pflegerin erst vor wenigen Tagen hierhergekommen, von der Erzherzogin jedoch sofort bemerkt und unter besonderen Schutz genommen worden, als Vorleserin, glaube er, oder als sonst etwas Ähnliches. Im übrigen gelte sie als eines der schönsten Mädchen. – Eine Bemerkung, murmelte ich, die zu selbstverständlich sei, als daß er darauf stolz sein dürfe. Ich hatte ihm den Feldstecher fortgenommen und blickte fast ausschließlich in die Loge.
Von der Aufführung merkte ich demzufolge auch so gut wie nichts. Ich fand nur, daß diese Art von Musik besonders geeignet war, unterdessen eine so entzückende Person wie die dort oben in der Loge anzusehen; und als der Vorhang nach dem ersten Akt fiel, drückte ich Bagration den Feldstecher wieder in die Hand, stand auf und verließ den Zuschauerraum.
Ich trat in das Foyer und lief die Treppen in den ersten Rang hinauf. Das Publikum hatte die Plätze nicht verlassen, und auf den Gängen hinter den Logen fand ich nur die Garderobieren und Logenschließer. Ich eilte die Logentüren entlang, bis ich zur Tür der Hofloge kam. Sie befand sich in einer quergestellten Wand, die den ganzen Komplex der Hofloge gegen das übrige Vestibül abgrenzte.
Ich machte mich darauf gefaßt, diese Tür versperrt zu finden. Doch gab die Klinke, als ich vorsichtig darauf drückte, nach, und ich zog die Tür auf.
Ich blickte in eine Art von Vorraum, der pompös in Gold, Mattgrün und Elfenbeinweiß dekoriert war und an dessen Wänden mehrere Offiziersmäntel und Pelze hingen. Eine Ampel verbreitete gedämpftes Licht. Auf einer Samtbank saß ein Lakai. Sonst war niemand da, doch schien dieses Vorzimmer nur durch einen Vorhang von der eigentlichen Loge getrennt zu sein, denn von hinter dem Vorhang her hörte man das Geräusch und Durcheinandersprechen aus dem Zuschauerraum bis hier herein.
Indessen der Lakai erstaunt aufblickte, trat ich leise und rasch an den Vorhang heran und schob ihn ein wenig zur Seite.
Auch in der Loge, wie im Zuschauerraum, hatte niemand die Plätze verlassen. Vor mir sah ich die Rücken der Offiziere, und vorne an der Brüstung saßen die drei Damen. Die Erzherzogin plauderte mit den beiden jungen Mädchen.
Ohne daß ich bemerkt worden wäre, ließ ich den Vorhang wieder vorfallen.
Als ich mich umwandte, stand der Lakai vor mir. Er hatte sich, offenbar um mich am Weitergehen zu verhindern oder wenigstens um mich zu fragen, was ich denn hier eigentlich wolle, erhoben und war nun im Begriff, etwas zu sagen. »Schweigen Sie!« befahl ich ihm leise. Damit durchschritt ich auch schon sehr rasch wieder den Vorraum, drückte die Tür auf und trat zurück in das Vestibül.
Indem ich meinen Platz wieder einnahm, setzte der zweite Akt ein.
»Wo warst du?« fragte Bagration.
Ich murmelte irgend etwas und nahm ihm den Feldstecher neuerlich aus der Hand.
Den Intrigen des Grafen Almaviva auf der Bühne wendete ich nicht die geringste Aufmerksamkeit zu, sondern beobachtete Resa statt dessen fast unausgesetzt durch Bagrations Glas.
Mein Benehmen mußte ihm sonderbar vorkommen, denn er sah mich wiederholt von der Seite an.
Resa schien nicht sonderlich musikalisch zu sein, denn ich bemerkte, daß sie gegen Ende des Aktes zwei oder drei Male die Hand vor den Mund hielt, als unterdrücke sie ein Gähnen.
Aus irgendeinem Grunde freute ich mich darüber. Ich selbst konnte ja ihr Interesse nicht beanspruchen, denn sie hatte mich ja noch gar nicht gesehen. Um so mehr war es mir eine Genugtuung, daß wenigstens auch die Oper sie nicht interessierte.
Als nach dem zweiten Akt der Vorhang fiel, bekam Bagration sofort wieder seinen Feldstecher in die Hand zurück, und ich erhob mich, doch standen nun auch die meisten andern auf, denn das war jetzt die große Pause. Ehe sie aber noch den Zuschauerraum verließen, war ich ihnen schon voraus, lief wieder die Treppen hinauf, hinter den Logen, deren Türen sich nun öffneten, entlang, und vor der Tür zur Hofloge blieb ich stehen.
Ich wartete noch etwa eine Minute, dann drückte ich die Tür wieder auf. Diesmal war die Situation im Vorraum, wie ich es auch erwartet hatte, eine andere. Ich sah mit einem Blick:
Unmittelbar vor mir war der Lakai damit beschäftigt, Erfrischungen auf einem kleinen Tisch herzurichten. Resa und drei Offiziere standen gleichfalls schon im Vorraum. Die Ampel brannte nun mit stärkerem Licht. Der Vorhang zur Loge war überdies halb zurückgezogen, und die Erzherzogin und die Baronesse Mordax waren ebenfalls aufgestanden und unterhielten sich mit zwei weiteren Offizieren.
Mein Eintritt, da die meisten der Anwesenden mir den Rücken zuwendeten, war nicht sogleich bemerkt worden.
Resa trat indessen an den Tisch mit den Erfrischungen heran und fragte die drei Herren, die bei ihr standen, ob sie ihnen etwas anbieten dürfe. Offenbar hatte sie zu dieser Höflichkeit Auftrag erhalten.
Von den drei Offizieren im Vorraum waren zweie Österreicher, der eine ein Stabsoffizier vom Generalstabe, der andere trug die Adjutantenschärpe. Der dritte war ein deutscher Husarenrittmeister. Er stand in zeremonieller Haltung da, die behandschuhte Linke auf seinen großen Säbel gestützt. Mit der Rechten, die bloß war, stemmte er den hohen Pelztschako gegen die Hüfte, den Handschuh hatte er zwischen den Fingern und schwenkte ihn ein wenig hin und her. Er war schlank und außerordentlich hochgewachsen. Wenngleich in grauer Uniform, hatte er einen silberglitzernden Riemen, offenbar eine Art Feldbinde, um die Hüften.
Ich trat rasch an den Adjutanten heran, verbeugte mich und sagte, ich sei der Fähnrich Soundso vom Dragonerregiment Beide Sizilien. Dann verbeugte ich mich auch vor den beiden andern und bat den Adjutanten, mich der jungen Dame vorzustellen.
Der Adjutant, momentan überrumpelt, kam gar nicht dazu, über mein Erscheinen erstaunt zu sein. Er mochte es für motiviert halten, daß ich plötzlich da war, wandte sich an Resa und sagte:
»Gestatten Sie, gnädiges Fräulein, daß ich Ihnen den Fähnrich …« (hier murmelte er etwas, weil er meinen Namen offenbar nicht verstanden hatte) »vom Dragonerregiment Beide Sizilien …«
In diesem Augenblick legte der Generalstabsoffizier ihm schon die Hand auf den Arm. Er verstummte, und Resa, die inzwischen aufgeblickt hatte, sah mich an.
Der vom Generalstab tat zwei Schritte auf mich zu und blieb vor mir stehen. »Was wünschen Sie?« fragte er.
»Ich habe«, sagte ich, »gebeten, dem gnädigen Fräulein vorgestellt zu werden.«
»Wer sind Sie?«
»Ich hatte«, sagte ich, »bereits die Ehre, es zu melden.«
»Wie kommen Sie hier herein?«
Ich machte eine Handbewegung zur Tür.
»Unter welchem Prätext«, fragte er, »wünschen Sie denn, dem gnädigen Fräulein vorgestellt zu werden, wenn Sie Ihrer Kaiserlichen Hoheit noch gar nicht vorgestellt sind?«
Er hatte mit der Raschheit von Leuten, die bei Stäben und in Suiten ihre Position zu verteidigen gewohnt sind, die Lage begriffen. Zum mindesten ahnte er sie. Jedenfalls sah sie für mich nun übel aus. Ich machte mir die bittersten Vorwürfe, daß ich nicht eine günstigere Gelegenheit abgewartet hatte, Resa kennenzulernen. Es entstand eine Pause. Resa sah mich mit großen Augen an. Diese Augen waren blaugrau. Sie war schlank, über mittelgroß und bei weitem eines der schönsten Mädchen, das ich je gesehen hatte. Ich mußte Bagration recht geben. Ich fand sie wundervoll.
»Nun?« fragte der Generalstabsoffizier. »Sind Sie Ihrer Kaiserlichen Hoheit schon vorgestellt oder nicht?«
Es mochten ihm inzwischen Zweifel gekommen sein, ob ich nicht vielleicht doch ein Recht hatte, hier zu sein. Es konnte ja ganz leicht möglich sein, daß in der Loge einer Erzherzogin wirklich einmal ein Fähnrich auftauchte, von dem sich dann herausstellte, daß er zum Beispiel ein Prinz sei oder dergleichen und mit dem Kirschen zu essen für einen vermutlich bürgerlichen Herrn vom Generalstabe nicht gut war. Einen Augenblick lang dachte ich sogar daran, meinen Großonkel ins Treffen zu führen. Auf jeden Fall beschloß ich, die Unsicherheit des Generalstabsoffiziers auszunutzen.
»Nein«, sagte ich. »Ich bin der Kaiserlichen Hoheit noch nicht vorgestellt worden, bitte aber Herrn Oberstleutnant, es zu tun.«
Es war nämlich anzunehmen, daß die Erzherzogin gar nicht danach fragen werde, warum man mich ihr vorstellte. Denn wenn man ihr schon jemand vorstellte, so war ganz offenbar ein Grund dazu vorhanden, nach dem sie sich nicht erst zu erkundigen brauchte.
Doch war der Oberstleutnant andrer Ansicht. Er erkundigte sich nämlich nach diesem Grunde. »Warum«, fragte er, »wünschen Sie vorgestellt zu werden?«
Ich mußte ihm darauf die Antwort schuldig bleiben. Es war nun zu erwarten, daß er mich maßregeln werde. Um dem die Spitze abzubrechen, sagte ich: »Zum mindesten habe ich selber mich Herrn Oberstleutnant vorgestellt, und ich erwarte nun, daß auch Herr Oberstleutnant, wenn schon nicht mich Ihrer Kaiserlichen Hoheit, so doch wenigstens sich selber mir vorstellen werden.«
Leider verfehlte dieser Angriff seine Wirkung vollkommen, oder vielmehr: er brachte eine ganz andere hervor, als ich gewünscht hatte. Ich merkte dem Gesichte des Oberstleutnants sofort an, daß er meine Zurechtweisung weit weniger als Korrektur seines Benehmens wie vielmehr für bloße Überheblichkeit eines jungen Menschen hinzunehmen gewillt war. Er winkte dem Adjutanten: »Zieh bitte den Vorhang vor«, sagte er; und während der Adjutant den Vorhang rasch vor die Loge zog, trat er noch einen halben Schritt näher an mich heran und sagte, gedämpft und fast zischend:
»Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie sind wohl wahnsinnig, daß Sie hier einzudringen wagen, um eine junge Dame kennenzulernen? Mit welcher Institution verwechseln Sie die Loge Ihrer Kaiserlichen Hoheit? Sie werden sich morgen auf dem Stadtkommando melden. Jetzt aber verschwinden Sie!«
Ich zögerte, ehe ich antwortete, und sah die andern an. Resa hatte sich verfärbt, ein Aufflackern, wie von Empörung, war in ihre Augen getreten, doch schlug sie sie, als sie meinen Blicken begegnete, sofort zu Boden. Der Adjutant stand betreten und ein wenig geistlos da, um den Mund des Husaren aber glaubte ich sogar die Spur eines Lächelns zu bemerken. Jedenfalls sah er mich durchaus wohlwollend an. Die Sache schien ihn mehr zu amüsieren als zu ärgern.
Ich sagte mit ziemlich erhobener Stimme:
»Herr Oberstleutnant können mir keine Verfehlung vorwerfen. Ich habe gebeten, der jungen Dame vorgestellt zu werden. Ich besitze ohne Zweifel das Recht dazu. Wenn Herr Oberstleutnant aber finden, daß hier nicht der richtige Ort dazu ist, so wäre diese Mitteilung mir immer noch in angemessener Form zu machen gewesen.«
»Schreien Sie nicht so!« zischte er.
»Wir sind hier nämlich«, fuhr ich, ohne meine Stimme zu dämpfen, fort, »nicht im Dienst.«
»Ich schon!«
»Aber ich nicht. Und mindestens kann ich von jedem Offizier die Form verlangen, die mir gebührt.«
»Ein Fähnrich ist noch kein Offizier!«
»Er gilt aber außerdienstlich dafür. Und es ist selbstverständlich, daß andere Offiziere sich daran halten!«
Er wollte etwas erwidern, doch ward in diesem Augenblick der Vorhang zurückgezogen, und die Erzherzogin, gefolgt von der Baronesse Mordax, trat ein. Die beiden andern Offiziere, mit denen sie gesprochen hatte, kamen gleichfalls näher und machten erstaunte Gesichter.
»Was ist denn«, fragte die Erzherzogin, »hier eigentlich los?«
Es entstand eine Pause.
»Nun?« fragte sie. »Wer ist überhaupt dieser junge Herr?«
In diesem Augenblick tat der deutsche Husarenrittmeister etwas sehr Nettes. Er nahm mich nämlich beim Arm, führte mich der Erzherzogin zwei Schritte entgegen und sagte:
»Kaiserliche Hoheit gestatten, daß ich einen Fähnrich vom Dragonerregiment Beide Sizilien vorstelle. – Junker«, wendete er sich an mich, »ich habe nicht genau verstanden, wie Sie heißen.«
Ich flüsterte ihm meinen Namen zu.
»… nämlich den Fähnrich Menis«, ergänzte er.
Die Erzherzogin reichte mir die Hand zum Kuß.
Das wurde dem Oberstleutnant zuviel. Daß ein Aufsehen vertuscht worden war, indem der Husar mich vorgestellt hatte, schluckte er noch. Aber den Handkuß schluckte er nicht. Er riskierte lieber das Aufsehen.
»Graf Bottenlauben«, rief er dem Husaren zu, »wie können Sie den Fähnrich vorstellen? Begreifen Sie nicht, daß er kein Recht hatte, hier einzudringen?«
»Wieso?« fragte nun die Erzherzogin. »Wer ist hier eingedrungen?«
»Der Fähnrich, Kaiserliche Hoheit!«
»Der Fähnrich?«
»Ja.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Er trat einfach ein und wollte Fräulein Lang kennenlernen.«
Die Erzherzogin zog die Brauen hoch und richtete ihren Blick auf mich, dann auf Resa. Resa war blutrot geworden. Bottenlauben sah den Oberstleutnant an und schüttelte den Kopf. Auch ich war empört.
»Wie können Herr Oberstleutnant«, rief ich, »das gnädige Fräulein in eine solche Situation bringen!«
»Ich?« schrie er erbittert. »Sie selbst haben sie doch in diese Situation gebracht!«
Damit hatte er eigentlich recht, aber seine Rechtfertigung blieb trotzdem ohne Wirkung. Unter den Blicken aller Anwesenden, die sich plötzlich nicht mehr auf mich oder Resa, sondern nur mehr auf ihn richteten, mochte er auf einmal einsehen, daß er sich durch sein Benehmen in eine noch schiefere Lage brachte als mich selbst. Er beherrschte sich zwar sogleich wieder, doch merkte man ihm an, daß er außer sich war. Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Schließlich wendete die Erzherzogin wieder den Blick von ihm ab und sah mich an.
»Was bedeutet das alles?« fragte sie. »Sind Sie wirklich ganz einfach hier eingetreten, um die Bekanntschaft von Fräulein Lang zu machen? – Beruhigen Sie sich, Liebe«, wendete sie sich an Resa. »Daß eine junge Dame wie Sie Erfolg haben muß, ist doch selbstverständlich. Ich habe Sie ja auch vor allem deshalb sogleich in meine nächste Nähe gezogen, damit Ihnen nicht etwa die Bemühungen einzelner unserer Herren allzu unangenehm werden. Denn daß man Ihnen alle Aufmerksamkeiten zuwenden würde, war ja vorauszusehen. Dennoch«, und hier wendete sie sich wieder zu mir zurück, »geht das Interesse des Fähnrichs zu weit. Es läßt weitere Unbesonnenheiten erwarten. Sind Sie hier in der Stadt selbst stationiert, Fähnrich Menis?«
»Jawohl, Kaiserliche Hoheit«, sagte ich.
»Bei einem Kommando?«
»Jawohl, Kaiserliche Hoheit.«
»Bei welchem?«
»Beim Armeekommando.«
»Und in welcher Eigenschaft?«
»Als Ordonnanzoffizier.«
»Hatten Sie denn da noch keine Gelegenheit gehabt, die Bekanntschaft des Fräuleins zu machen?«
»Nein, Kaiserliche Hoheit.«
»Wieso nicht? Seit wann sind Sie denn überhaupt da?«
»Seit heute.«
»Erst seit heute?«
»Jawohl, Kaiserliche Hoheit.«
Es kam mir vor, als unterdrücke sie ein Lächeln. »Wem sind denn«, fragte sie, »die Ordonnanzoffiziere eigentlich unterstellt?«
»Herrn Major Orbeliani, Kaiserliche Hoheit.«
»Herr Hauptmann«, wendete sie sich an den Adjutanten, »bitten Sie Herrn Major Orbeliani, sich zu mir zu bemühen. Sollte er nicht hier im Hause sein, so wolle nach ihm geschickt werden.«