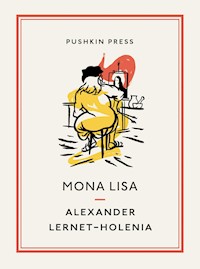11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Dieser Roman eines österreichischen Regimentes, der im Brennpunkt des Unterganges Taten und Träume von Generationen vereinigt, gibt vollendet Zauber und Macht des Vergänglichen wieder. Längst nach dem Ende des ersten Weltkrieges und der Auflösung des Regimentes setzt sich das Abenteuer auf geheimnisvolle Weise fort. Zur Zeit des Friedens fallen seine ehemaligen Offiziere in einer Kette von Ereignissen unerklärlichen Umständen zum Opfer. Eine Frau erscheint als der Anlaß des Verhängnisses, dessen Ursachen tiefer liegen. Der Leser wird in die Spannung eines Kriminalfalles hineingerissen. Aber nicht nur die Versuche einer Aufklärung, die vorerst immer tiefer ins Dunkel führen, kommen schließlich an ein Ziel. Es erhellt sich zugleich der Hintergrund alles Geschehens, die starke Einwirkung des Vergangenen in Späteres und die tiefe Zusammengehörigkeit, die äußeren Bindungen zugrunde liegt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Ähnliche
Alexander Lernet-Holenia
Beide Sizilien
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
Engelshausen
1
Der Oberst des Regiments «Beide Sizilien» stand am Fenster und sah den Tauben zu, die hin und wider flogen. Von dem Platz, auf den er blickte und von welchem sie Futter pickten, erhoben sie sich zeitweilig in Schwärmen und erfüllten die Luft mit ihrem Flügelschlag.
Es waren Tauben aller Art, braune, grünschillernde und weiße mit purpurfarbenen Füßen.
Der Oberst wohnte in der Nähe der alten Universität. Es gab da noch eine Menge barocker Häuser und Kirchen, wundervolle Bauten, welche selbst den meerentstiegenen Träumen eines Palladio und Sansovin nichts nachgaben und auf deren Fenstersimsen und Säulenkapitellen die Tauben nisteten. Viele der Simse waren an ihren oberen Rändern mit Reihen von Nägeln oder Eisenstiften wie mit kleinen Geländern umgeben. Dadurch, offenbar, sollte verhindert werden, daß der Taubenmist herabfalle. Aber er fiel dennoch herab und beschmutzte die Fassaden.
Überhaupt–fand der Oberst–waren die Tauben unreine Tiere. Es hieß, sie seien voller Läuse. Zudem galten sie für Träger häßlicher und ansteckender Krankheiten.
Dennoch bedeuteten sie den Frieden.
Es war nun schon Friede seit sieben Jahren. Es war das Jahr 1925. Es war tiefer Friede. Aber der Oberst fand, daß dieser Friede gar kein Friede sei. Wenngleich es ganz unmöglich schien, daß er sich wieder in Krieg verwandeln könne, war es, im Grunde, weniger ein Friede als je. Aller Herzen waren unruhig geblieben, und wenn die Leute vom Frieden sprachen, so meinten sie niemals die Gegenwart, in der sie lebten, sondern die Zeit vor dem Kriege. Und wenn es je wieder Krieg geben sollte, so würde es kein neuer Krieg sein, sondern immer noch der von einst.
Der Oberst hieß Rochonville. Das Regiment «Beide Sizilien» existierte längst nicht mehr, es war aufgelöst, seine Angehörigen hatten sich in die vielen Länder zerstreut, in die das Reich zerfallen war, und niemand mehr wußte, wo sie waren. Rochonville selbst unterhielt zwar noch eine Art von Verkehr mit einigen von seinen Leuten–doch mehr aus Zufall als aus Absicht und eigentlich nur, weil sie in der gleichen Stadt lebten wie er: mit fünf Offizieren und einem Korporal. Das war aber auch alles, von dem man noch wußte. Zwischen diese Sieben und alle die übrigen hatte sich schon das Vergessen gedrängt. Und auch zwischen die Sieben selber drängte sich schon das Vergessen.
Dennoch aber sollten, als es das Regiment längst nicht mehr gab, Ereignisse eintreten, durch welche der Oberst, seine fünf Offiziere und der Unteroffizier sich zu handeln entschlossen, als ob es das Regiment noch gegeben hätte, und denen zufolge sie bereit waren, sich füreinander aufzuopfern, ja zu sterben, als stünden hinter ihnen noch immer die bewaffneten Reihen der Unzähligen, die ihnen einst gehorcht.
Es begann zu dämmern, und die Tauben, um schlafenzugehen, kehrten auf ihre Simse zurück. Eine Kirchenglocke fing an zu läuten. Die Luft schlug heran wie mit Wellen aus Erz. Der Oberst blickte noch eine Zeit auf den Platz, der sich mit durchsichtigen Schatten füllte, dann schloß er das Fenster, trat ins Zimmer zurück und öffnete einen Schrank, um einen Abendanzug zurechtzulegen und sich umzukleiden.
Es war dazu freilich noch zu früh, es mochte erst gegen sechs Uhr sein. Aber der Oberst hatte die Gewohnheit angenommen, viel mehr Zeit mit den Dingen hinzubringen, als nötig war. Doch konnte es auch sein, daß er damit recht hatte. Denn unsere Schätzung, wie lange wir uns mit einem Ding abzugeben hätten, ist vielleicht eine ganz oberflächliche. Vielleicht erfordert die wirkliche Beschäftigung mit den Dingen unvergleichlich mehr Zeit, als wir glauben.
Rochonville kleidete sich mit Sorgfalt an–doch nicht, weil er sonderlichen Wert auf sein Aussehen gelegt hätte; sondern weil seine Gedanken abschweiften, verlangsamten sich seine Handlungen. Der Frack, den er anzog, war altmodisch. Zwar bestanden die Reverse des Rockes und die Weste aus so kostbarem Material, wie man’s längst nicht mehr herstellte. Aber das Beinkleid zum Beispiel war zu eng. Es hätte also nahegelegen, einen neuen Frack zu bestellen. Allein es mangelten dem Obersten die Mittel zu einer so bedeutenden Auslage.
Die Weste war gelblich. Der Oberst schloß sie mit vier Knöpfen aus Granatsteinen, welche mit Brillantsplittern gefaßt waren; und er zog Schuhe aus Kalbleder an, die er selber so lange behandelt hatte, bis sie glänzten, als ob sie aus Lack gewesen wären.
Bei der Armee war Lackleder verpönt gewesen.
Nachdem der Oberst den Mantel angezogen und den Hut aufgesetzt hatte, öffnete er eine Schachtel, in welcher unzählige Handschuhe aus weißem Waschleder lagen. Denn auch Glacéleder war bei der Armee nicht gestattet gewesen.
Der Oberst wählte ein Paar Handschuhe, danach stellte er die Schachtel wieder in die Kommode, aus der er sie genommen, und schob die Lade zu. Er stand nun noch einige Minuten lang im Zimmer. Schließlich trat er zum Schalter, drehte das Licht ab und verließ den Raum.
Es war halb acht Uhr, als er an die Zimmertür seiner Tochter klopfte.
Er erhielt keine Antwort, trat aber, nachdem er den Hut abgenommen, trotzdem ein. Denn es war die Art seiner Tochter, Antworten, die sie für selbstverständlich hielt, nicht zu geben. Nur wenn sie gewünscht hätte, daß er nicht eintreten solle, hätte sie geantwortet.
Gabrielle Rochonville war gleichfalls schon angekleidet. Sie war rothaarig und hatte die Reize, aber auch die Fehler der Rothaarigen, zum Beispiel zu derbe Hände, und ihre Zähne, obzwar regelmäßig, schienen ohne Schmelz. Im ungewissen Licht, welches den Raum erhellte, schimmerte ihr Gesicht perlenfarben wie durch einen Schatten.
Die Lichter ihres Toilettetisches hatte sie bereits abgedreht. Ihre Sachen lagen im Zimmer umher.
Wenngleich eine schöne Person, trug sie sich mit einer gewissen Gleichgültigkeit, ja Nachlässigkeit. Die Farbe ihres Haares war stumpf, ein etwas zu trübes Rot, als daß sie dadurch sogleich aufgefallen wäre, und unter ihren Kleidern waren die Vorzüge ihres Wuchses nicht ohne weiteres zu erraten. Im ganzen kam sie eigentlich immer erst nach einiger Zeit zur Geltung, rief dann aber stets eine Art von Betroffenheit vor ihrer Schönheit, die einen Atem von Animalität hatte, in den Betrachtern hervor, etwa wie auch die Richter der rothaarigen Phryne erschrocken waren, als ihr Anwalt zu dem wundervollen Argument gegriffen hatte, vor dem Gericht ihren Busen zu entblößen, um ihre Schuldlosigkeit zu beweisen–so daß man sie freigesprochen. Und wie die merkwürdig spröde Haut jener Griechin, deretwegen sie Phryne genannt worden war (was «Kröte» bedeutet), im Gegensatz zum Glanz ihrer Gestalt gestanden, machte auch bei der Tochter des Obersten der Gegensatz zwischen der Gleichgültigkeit, mit der sie sich trug, und ihren Vorzügen den eigentümlichsten Reiz.
Vater und Tochter, wenngleich ihr Verhältnis ein gutes war, hatten sich angewöhnt, sich zu verständigen, ohne überflüssige Worte zu machen. Der Oberst, nachdem er einen Augenblick dagestanden, half Gabrielle in ihren Mantel. Danach griff sie zu ihrer Handtasche, und sie verließen die Wohnung, versperrten sie und gingen die Treppe hinab.
Die Frühlingsnacht, die sich über den Platz wölbte, war von einer Schönheit, welche die spärlich flackernden Laternen nicht zu beeinträchtigen vermochten. Der zunehmende Mond sandte Stürze von Silber herab, danach verbarg er sich hinter weißem Gewölk, in dessen samtenen Buchten Sterne flimmerten.
Die beiden, Gabrielle und der Oberst, standen einen Augenblick stille, dann machten sie sich auf den Weg.
Auf dem Ring nahmen sie die Straßenbahn.
Die Fahrgäste, welche sich miteinander unterhalten hatten, ehe die beiden eingestiegen waren, verstummten und betrachteten das Paar in Abendkleidern, den ältlichen Mann, der einen zwischen den Reversen des Mantels sichtbaren Halsorden trug, und die Rothaarige, die vor sich hinblickte.
Gebeten waren die beiden zu einem ihrer Verwandten, einem gewissen Flesse von Seilbig, welcher Statthalter von Triest gewesen war. Die Flesses galten immer noch für vermögend und sahen häufig Leute bei sich.
Sie wohnten in einer der Gassen zwischen der Wiedener Hauptstraße und der Favoritenstraße im Hoftrakt eines älteren Hauses. Die Fenster gingen auf einen Garten. Die Wohnung war weitschweifig, und die Zimmer waren geräumig, doch hatten sie niedere Decken, und weil Frau von Flesse es für angemessen erachtet hatte, an diesem Abend nur Kerzen zu brennen, so herrschte unverhältnismäßige Hitze. Zudem qualmten überall die offenen Kamine, durch die–ziemlich überflüssigerweise–Frau von Flesse in der ganzen Wohnung die Öfen hatte ersetzen lassen. Die Dienstleute verstanden sich nicht auf die Behandlung der ihnen ungewohnten Feuerstätten.
Aber im großen und ganzen gestaltete der Abend sich erträglich. Bei Tisch waren zehn Personen anwesend, danach erschienen noch etwa doppelt so viele, darunter einer von Rochonvilles ehemaligen Offizieren, Kaminek von Engelshausen, ein junger Mensch, der Gabrielle den Hof machte.
Es war im Verlauf des spätern Abends, daß Rochonville sich von einem Herrn, den er bis dahin nicht gekannt und dessen Namen er nicht verstanden hatte, in ein längeres Gespräch gezogen sah. Dieser Unbekannte mochte im Alter von fünfunddreißig oder vierzig Jahren stehen. Er war hochgewachsen und schlank, fast mager. Anfangs nahm er von Rochonville keinerlei Notiz. Er stand inmitten einer Gruppe von Herren, zu welcher der Oberst trat, und redete über Rußland. Er sprach mit leichtem, nicht sogleich bestimmbarem Akzent, etwa wie Leute, die viel gereist sind.
Es schien, daß er in russischer Gefangenschaft gewesen, aus dem Lager jedoch entwichen sei. Jedenfalls schilderte er eben, wie er längere Zeit an der Wolga bei einem Kolonisten gelebt habe, der ihn offenbar versteckt gehalten.
«Dieser Mensch», erzählte er, «hatte einen Sohn, welcher ungefähr in meinem Alter stand und, ursprünglich dienstuntauglich, nunmehr zu den Soldaten eingezogen werden sollte. Ich machte mich sofort erbötig, beim Militär seine Rolle zu spielen. Denn ich zweifelte nicht daran, daß ich, zur Front geschickt, Gelegenheit finden könne, überzulaufen und auf diese Art zu den Unsern zurückzukehren.
Wegen meiner Körperlänge aber tat man mich nicht einfach zu einem der Regimenter des Gouvernements, sondern ich kam zu den Garderekruten. Ich habe immer auf dem Standpunkt gestanden, daß über das Mittelmaß hinauszureichen nur Nachteile bringt. Ein hochgewachsener Mensch fällt überall auf, er paßt auf kein Pferd, in keinen Wagen, in kein Bett; er kann sich, wenn er eine Hose zerreißt, keinerlei fertigen Ersatz kaufen; und hat er, vollends, auch ein wenig mehr Verstand als seine Mitmenschen, so findet er sich überhaupt nicht mehr zu ihnen.
Auch in meinem Fall sollte ich von meiner Zuteilung zu den Garderekruten nur Nachteile haben. Wäre ich zu einem Linieninfanterieregiment getan worden, so hätte man mich, nach einer Ausbildungszeit von wahrscheinlich nicht mehr als sechs oder acht Wochen, ins Feld geschickt, und ich hätte meine Flucht ins Werk setzen können. Bei der Garde aber war die Ausbildungszeit eine unvergleichlich längere und bei der Gardekavallerie–vor allem der überflüssigen Manöver mit der Lanze wegen–und bei der Artillerie vermutlich gar nicht abzusehen.
Zudem geschah mit uns Garderekruten zunächst mehrere Wochen lang überhaupt nichts, sondern man sparte uns für einen Vorgang auf, welcher sich, erhebliches Aufsehen erregend, alljährlich in der Hauptstadt abspielte. Der Großfürst Nikolaj nämlich pflegte die Zuteilung der Rekruten zu den einzelnen Garderegimentern persönlich vorzunehmen, die Offiziere der Garde und ihre Damen waren dabei anwesend, und das Ganze gab Anlaß zu einer Art von militärischem Fest. Auch in diesem Jahr war der Großfürst, trotz dem Kriege, in die Hauptstadt gekommen und nahm die Rekrutenzuteilung persönlich vor.
Das Ereignis spielte sich in der sogenannten Michailowskij-Manege ab, einer Reitschule, die so groß war, daß darin, wie es hieß, zwei Batterien zu gleicher Zeit exerzieren konnten. Die schöne Welt füllte die Logen, es wurden Erfrischungen und Champagner gereicht, zwei Militärkapellen spielten abwechselnd, mithin ununterbrochen, und in der Mitte der Reitschule stand der Großfürst und teilte den Regimentern die Rekruten zu.
Es waren dies Leute aus allen Gegenden des ungeheuren Reiches, Hirten aus dem Ural sowohl wie Jäger aus den sibirischen Tundren, Bauern aus Weißrußland und Nomaden von den Küsten des Gelben Meeres. Sie hatten hochgewachsen zu sein und gut auszusehen. Mehr ward nicht verlangt. Weil sie aber einfache Menschen waren, vom Lärm, der Musik und dem Blitzen der Uniformen und Orden verwirrt, so hatte man Maßnahmen getroffen, daß sie nicht etwa durch Tölpelhaftigkeit den Ablauf der ganzen Geschichte stören sollten. Von der Mitte der Reitschule nämlich, wo Nikolaj Nikolajewitsch stand, zu den Wänden führten, den einunddreißig Regimentern der Garde entsprechend (und die Gardekosakendivision nicht mitgerechnet), einunddreißig Reihen von Unteroffizieren der einzelnen Regimenter. Das Ganze sah aus wie ein vielstrahliger Stern. Stand der Rekrut vor dem Großfürsten, so musterte ihn dieser und teilte ihn zu einem der Regimenter ein. Der Adjutant schrieb dem Rekruten den Namen oder die Nummer des betreffenden Regiments mit Kreide auf den Rücken und schob ihn der entsprechenden Reihe von Unteroffizieren zu. Der erste Unteroffizier nahm ihn in Empfang und schob ihn in die Arme des zweiten, der zweite in die des dritten, und so gelangte der Mensch bis zur Wand, wo seine neuen Kameraden schon standen. Inzwischen waren bereits die nächsten drangekommen.
Die Zuteilung zu den einzelnen Regimentern erfolgte nach ganz bestimmten Grundsätzen. Es gab da zum Beispiel das Regiment Pawlowskij, dessen Angehörige durchwegs gelbhaarig zu sein hatten, pockennarbig und stulpnäsig; und dies zur Erinnerung an das Aussehen des 1801 ermordeten Zaren Paul I. In einem andern Regiment hatten alle Leute blauäugig zu sein und schwarze Bärte zu haben. Und wenn der Großfürst einen Rekruten zugeteilt, so applaudierten jedesmal die Offiziere und Damen des betreffenden Regiments.
Das Ganze ging verhältnismäßig schnell vor sich, denn es waren Hunderte, ja Tausende von Rekruten abzufertigen. Nikolaj Nikolajewitsch, in einer Husarenuniform und immerzu Zigaretten mit langem Mundstück rauchend, die er auch unterm Reden nicht aus dem Munde nahm, musterte die Leute, und zwar mit großer Sicherheit. Es ging fortwährend in rascher Folge: ‚Gelbe Kürassiere, Ismailowskij! Leibhusaren, blaue Kürassiere! Preobraschenskij, Chevauxlegers, Ulanen Seiner Majestät!‘ Gemeint war damit das Leibulanenregiment des Zaren. Es gab aber auch Leibulanen der Zarin, genannt ‚Ulanen Ihrer Majestät‘. Der Adjutant schrieb mit seiner Kreide, und die Rekruten verschwanden in alle Richtungen der Windrose.
Ich hatte mir, als ich dieses Bildes ansichtig geworden, natürlich sofort gesagt, daß auch das Verfahren meiner eigenen Zuteilung zu einem der Regimenter bloß einen Moment dauern werde. Wenn man mich an dem Generalissimus vorübertrieb, würde er mich nur mit einem Blick streifen und mich, meiner verhältnismäßigen Schmächtigkeit wegen, wohl zu den Dragonern, zu den Husaren oder zur Artillerie einteilen und nicht zu den Kürassieren–was übrigens keinen Unterschied in der Ausbildungszeit gemacht hätte–, jedenfalls aber nicht zur Infanterie, die aus lauter vierschrötigen Kerlen bestand.
Es sollte aber ganz anders kommen, als ich vermutet. Wenn das Schicksal wirklich zu walten beginnt, kommt alles immer ganz anders, als man geglaubt hat. Ich hatte mir den Kopf zerbrochen, wie ich mich aus dieser Affäre ziehen könne, jedoch keinerlei Einfall gehabt. Ich stand in der Reihe der übrigen Rekruten und ward von der schrittweisen Bewegung, mit der sie gegen den Großfürsten vorrückte, mitgenommen wie von etwas Unausweichlichem, von welchem auch mein Denken ausgelöscht ward. Zudem benahm es mich, daß Nikolaj Nikolajewitsch mich an meinen Vater erinnerte; und je näher ich ihm kam, desto mehr nahm mich diese Ähnlichkeit gefangen. Er trug den Bart auf die Weise meines Vaters und hatte auch die gleiche Art von Tränensäcken unter den Augen. Selbst seine Hände, an denen er keine Handschuhe trug, schienen mir vollkommene Ähnlichkeit mit meines Vaters Händen zu haben. Sie waren, wenngleich groß und kräftig, schön gestaltet, ein wenig rötlich, mit Fingern, die an ihren Enden schmäler wurden und nach unten umgebogene Nagelspitzen hatten.
Ich war schon so nahe an ihn herangeschoben worden, daß ich all dies ganz genau wahrnehmen konnte. Nikolaj Nikolajewitsch streifte auch mich mit seinem Blick, und nun, dachte ich, werde er den Namen irgendeines Kavallerie- oder Artillerieregiments mit hoffnungslos langer Ausbildungszeit nennen. Statt dessen aber erweiterten sich seine–wie bei meinem Vater–ein wenig zusammengekniffenen Augen, danach nahm er–gewissermaßen mit meines Vaters Hand–sogar die Zigarette aus dem Mund, und schließlich brach er in Lachen aus.
‚Sieh da, Konstantin Iljitsch!‘ rief er. ‚Dachtest du wirklich, ich würde dich nicht erkennen?‘
Ich hatte damals schon lange genug in Rußland gelebt, um das Russische, wenngleich ich es kaum sprechen konnte, einigermaßen zu verstehen. Doch begriff ich durchaus nicht, was er meinte.
‚Und sogar einen Bart hast du dir wachsen lassen‘, fuhr er fort. ‚Einen Bartanflug, zum mindesten. Einen echten Bartanflug!‘ Hierbei hatte er sich mir genähert und zog nun, wiederum mit den Händen meines Vaters, an dem kleinen Barte, der mir gewachsen war. Ich hatte ein Gefühl, wie ich es immer gehabt, wenn mich mein Vater am Ohr gezogen. ‚Nur die Haltung, mein Sohn Konstantinuschka!‘ lachte er. ‚Die Haltung! Sagte ich dir nicht, daß dich, ob du nun einen Bauern spielen würdest, einen Kutscher oder einen Postbeamten, die Haltung verraten werde? Denn aus seiner Haltung kann man nicht heraus, mein Söhnchen, so wenig, wie man aus seiner Haut kann. Man bleibt eben, was man ist.‘
Ich überlegte, so schnell ich konnte, wohin diese offenbare Verwechslung mich führen werde. Daß ich nun etwas zu erwidern hatte, war klar. Dieser Konstantin Iljitsch, von dem ich nicht ahnte, wer er sei, für den er mich aber hielt, mußte jetzt etwas sagen, wenn Nikolaj Nikolajewitsch Konstantin Iljitschs Verkleidung nicht krumm nehmen sollte.
In meinem schlechten Russisch durfte ich nicht antworten. Auf deutsch zu antworten schien mir zwecklos und gefährlich. Ich wählte also das Französische, wenngleich mir auch dies gefährlich genug schien.
‚Kaiserliche Hoheit‘, sagte ich, ‚ich bin nicht Konstantin Iljitsch. Ich bin der Sohn eines Kolonisten aus dem Gouvernement Saratow und bitte, zu einem der Infanterieregimenter eingeteilt zu werden.‘
‚So?‘ lachte er und setzte, zu meiner Verwunderung in gutem Deutsch, hinzu: ‚Ein Kolonist willst du sein, ein ganz gewöhnlicher Bauer, und sprichst das Französische wie nur irgendeiner?‘
‚Ich bin in Astrachan zur Schule gegangen‘, erwiderte ich, nun gleichfalls auf deutsch.
Es war jetzt an ihm, sich zu verwundern.
‚Das wußte ich ja gar nicht, daß du auch deutsch sprichst‘, sagte er. ‚Das hattest du mir verheimlicht, Kleiner.‘ Und er wandte sich an seinen Adjutanten: ‚Was sagen Sie, Konstantin Iljitsch spricht alle Sprachen, und dabei will er einen Bauern spielen!‘
Auch der Adjutant fühlte sich nun verpflichtet, zu lachen. Er schien gleichfalls nicht daran zu zweifeln, daß ich Konstantin Iljitsch sei. Der Zwischenfall begann Aufsehen zu erregen. Die Unteroffiziere und Rekruten, die rundum standen, wußten zwar noch nicht, was sie von der Sache halten sollten, in den Logen aber war es aufgefallen, daß die Prozedur nicht weiterging, und man reckte die Hälse.
‚Und warum willst du denn durchaus zur Infanterie, mein Sohn?‘ fragte der Großfürst. ‚Immer zu Fuß, immer mit dem Gepäck auf dem Rücken! Was hast du dir da nur ausgedacht? Findest du’s denn nicht schöner, zu reiten? Du reitest doch, weiß Gott, gut genug. Oder bist du etwa zu faul zur Pferdewartung? Du wirst sie ja doch nicht selber warten müssen, deine Pferdchen, es wird sich schon ein andrer finden, der sie dir wartet.‘
Ich war auf die Beantwortung aller dieser Fragen durchaus nicht vorbereitet. Überhaupt merkte ich, in welche Gefahr man geriet, wenn man jemand anders vorstellen wollte. Es schien, daß man dann ohne weiteres auch für einen dritten oder vierten konnte gehalten werden. Man wußte auf einmal nicht mehr, wer man war. Es überkam mich wie ein Schwindel.
‚Kaiserliche Hoheit‘, sagte ich, ‚gäbe man mich zur Kavallerie, so müßte ich fürchten, nicht mehr zurecht ins Feld zu kommen.‘
‚Du bist doch im Feld‘, lachte er. ‚Du kommst ja aus dem Felde. Eigens um dieses Späßchen mit mir aufzuführen, bist du doch aus dem Felde gekommen. Und patriotisch tust du auch noch, wenngleich du doch eigentlich ein Zweifler und Nörgler bist! Oder etwa nicht? Ich weiß es, mach mir nichts vor, ich weiß es ganz genau. Wozu also wirklich, meinst du, kämest du nicht mehr zurecht?‘
‚Zum Kriege.‘
‚Er wird dir noch lang genug dauern. Oder glaubst du etwa, wir würden ihn so schnell gewinnen?‘
‚Nein.‘
‚Sondern? Was sonst?‘
‚Vielleicht verlieren?‘
Gott allein weiß, wer mir diese Antwort eingegeben hatte. Wahrscheinlich dachte ich, ich müsse so reden, weil Konstantin Iljitsch ‚ein Zweifler und Nörgler‘ war; und Fürsten, solang sie bei Laune sind, lieben ja die Bemerkungen von Zweiflern. Zweifler vertreten ungefähr die Stelle von Hofnarren. Es stellte sich aber sofort heraus, daß meine Antwort die unklügste gewesen war, die ich hatte geben können. Ich muß selber ganz verblüfft gewesen sein, daß sie mir entfahren war, und auch der Gesichtsausdruck des Großfürsten veränderte sich sofort.
‚Das meinst du?‘ schrie er.
Ich vermochte keine Antwort mehr zu geben. Ich versuchte zu stottern, daß ich, als deutscher Kolonist, eigentlich gemeint hätte, die Mittelmächte würden den Krieg verlieren. Doch brachte ich es nicht heraus. Aber auch auf ihn schien meine Bemerkung wirklichen Eindruck gemacht zu haben. Vielleicht zweifelte er selber schon am Erfolge der russischen Sache. Vielleicht hatte sich nur noch niemand gefunden, der ihm diese damals schon allgemeine Meinung zu hinterbringen gewagt. Jedenfalls näherte er sein Gesicht dem meinen und fuhr mich an:
‚Das glaubst du wirklich? Glaubt ihr das vielleicht schon alle bei eurem verdammten Regiment? Nun, und wie lange, sagt ihr, wird es also noch dauern?‘
‚Ein Jahr vielleicht‘, sagte ich.
Es blieb mir nichts andres übrig, als etwas dergleichen zu sagen. Denn ich konnte ja nun nicht mehr zurück.
Er richtete sich auf. Dieses Maß vermeintlicher Vertraulichkeit schien ihm zu weit zu gehen.
‚Dann‘, schrie er auf russisch, ‚hast du ja wirklich keine Zeit mehr zu verlieren, mein Sohn! Aber du sollst sie mir auch nicht versäumen! Fort! Zurück zu deinem Regiment! Und als erstes hast du vierzehn Tage Stubenarrest!‘
Zugleich gab er mir einen Stoß vor die Brust. Der Adjutant mochte das Deutsche nicht verstanden haben. Aber das Russische zu verstehen schien er sich verpflichtet zu fühlen. Ich spürte, wie er mir, immer noch lachend, mit seiner Kreide etwas auf den Rücken schrieb. Offenbar hielt er, was Nikolaj Nikolajewitsch gesagt, für die Krönung des zwischen uns vorgefallenen Spaßes und schrieb mir des wirklichen Konstantin Iljitsch Regimentsnummer auf den Rücken.
‚Lachen Sie nur nicht so blöde!‘ hörte ich Nikolaj den Adjutanten anschreien. Aber auch das Benehmen von einigen der Unteroffiziere, denen ich zugeschoben ward, ließ mich nicht daran zweifeln, daß sie glaubten, in mir einen Offizier ihres Regiments zu erkennen. Sie reichten mich mit vorsichtiger Hochachtung zur Wand weiter.
Ich wandte mich an einen der neben mir stehenden Rekruten. ‚Was steht auf meinem Rücken?‘ flüsterte ich ihm zu. Der Tölpel konnte nicht lesen. ‚Bei welchem Regiment, zum Teufel, sind wir?‘ zischte ich, und er antwortete: ‚Grodnoer Husaren.‘
Es war eines der vornehmsten Regimenter. Augenscheinlich stellte ich einen Aristokraten vor, mit dem sich der Großfürst befreundet hatte, zum mindesten aber war ich ‚dworianin‘, adelig. Denn andre als adlige Offiziere dienten kaum bei der Garde. Als wir aus der Reitschule geführt wurden, atmete ich auf. Noch am gleichen Abend wurden wir–etwa hundert meiner neuen Kameraden und ich–einwaggoniert. Auch der Wachtmeister, der den Transport befehligte, nahm mich augenscheinlich für einen Offizier. Er nannte mich ‚Euer Hochwohlgeboren!‘ und schien es für einen Wahn zu halten, daß ich bloß für einen Rekruten gelten wollte.
Wir waren eine Nacht und einen Tag unterwegs gewesen, als ich, während der Zug in einer Station hielt, den Wachtmeister mit Donnerstimme meinen Namen oder vielmehr den des Sohnes des deutschen Kolonisten, für den ich eingesprungen war, ausrufen hörte. ‚Gagemann!‘ brüllte er. ‚Wilgelm Karlowitsch Gagemann!‘ Denn die Russen können das deutsche H nur schlecht aussprechen. Ich blickte hinaus. Der Wachtmeister stand, umgeben vom Stationspersonal, auf dem Bahnsteig, und sie reichten einander ein Blatt weiter, offenbar eine Depesche.
Der Schwindel–sofern man ihn einen solchen nennen konnte–war heraus. Ich sprang sofort auf der andern Seite aus dem Zuge und rannte um mein Leben. Um keine Zeit zu verlieren, wandte ich mich nicht ein einziges Mal um. Doch merkte ich, daß man mir nachsetzte. Auch hörte ich den platzenden Knall einiger Revolverschüsse, und die Geschosse schwirrten über mich hinweg. Gewehre, erfreulicherweise, schien man nicht sogleich zur Hand gehabt zu haben.
Nach etwa einer halben Stunde war ich meine unmittelbaren Verfolger los. Ich ließ mich in einen trockenen Wassergraben fallen und schnappte nach Luft. Sobald ich konnte, setzte ich meine Flucht fort.
Es ist nicht meine Absicht, die Aufmerksamkeit der Herren weiterhin auf die Einzelheiten dieser Flucht zu ziehen, die mich schließlich, nach langen Strapazen und Gefahren, über den Kaukasus geführt hat. Tausende solcher oder ähnlicher Fluchtversuche sind gelungen, ein Vielfaches davon ist mißglückt. Es gibt zwar Leute, welche behaupten, die Wirklichkeit des Lebens erzähle die interessantesten Geschichten. Aber diese Behauptung ist so flach wie alles, was allgemein behauptet wird. Ich habe vielmehr gefunden, daß, was man Wirklichkeit nennt, zwar unangenehm, sonst aber ganz uninteressant ist. Interessant zu werden beginnt das Leben überhaupt erst in den Augenblicken, in welchen es unwirklich wird; und die vollkommensten Erzählungen sind jene, welche bei größter Wahrscheinlichkeit, die sie für sich beanspruchen können, den höchsten Grad von Unwirklichkeit erreichen.
Es war schon einige Zeit nach dem Kriege, daß ich Gelegenheit fand, mich in das Kriegsministerium zu begeben, um die russischen Heereslisten zu studieren. Man wies mich in das Archiv, in die Stiftskaserne. Das Ereignis in der Michailowskij-Manege hatte sich 1916 abgespielt. Ich ließ mir diesen Jahrgang heraussuchen. Es war, nebenbei bemerkt, der letzte, der gesammelt worden. Bei den Grodnoer Husaren hatte es damals nur einen Offizier gegeben, der Konstantin Iljitsch geheißen. Es war das ein gewisser Konstantin von Pufendorf gewesen.
Ich blickte lange auf den Namen. Dieser Mensch, also, sollte ich gewesen sein. Ich kannte ihn nicht, ich hatte gar nicht gewußt, daß er existierte. Dennoch war ich er, und er war ich gewesen, und er hatte aus mir gesprochen. Denn wenn man eigentlich jemand anders ist, so weiß man’s ja, glaube ich, selber nie.
Nikolaj Nikolajewitsch mochte sich mit Pufendorf gelegentlich darüber unterhalten haben, ob es möglich sei, sich mit Erfolg zu verkleiden, beziehungsweise ob er, der Großfürst, Konstantin Iljitsch auch in einer Verkleidung erkennen könne. Anlaß zu diesem Gespräch scheint die damals schon wachsende Beunruhigung in ganz Rußland gewesen zu sein. Auch ein gewisser Verfolgungswahn mag mitgespielt haben. Es glauben ja die Mitglieder souveräner Familien immer, daß sie ihres Blicks ganz sicher seien. In den Gesichtern der Massen meinen sie lesen zu können wie in aufgeschlagenen Büchern. Kurz: als ich vor den Großfürsten getreten, hatte er mich, weil ich Konstantin Iljitsch offenbar ähnlich sah, für jenen gehalten.
Aber hätte er mit ihm über diese Dinge nicht gesprochen gehabt, so hätte er mich mit ihm wahrscheinlich auch gar nicht verwechselt.
Ich blätterte, in Gedanken, weiter in den Listen. Nach einiger Zeit schien mir ein Punkt noch unklar. Ich verstand nämlich nicht, wieso man die Verwechslung so bald entdeckt. Ich hatte aber sogleich eine bestimmte Vermutung.
Ich ließ mir die Verlustlisten der russischen Armee geben. Und in der Tat fand ich nach einigem Blättern, was ich suchte. Konstantin Iljitsch war gefallen.
Und zwar hatte ihn der Tod nur wenige Tage vor meinem Erlebnis in der Michailowskij-Manege ereilt. Das ging aus den Daten in der betreffenden Liste hervor. Zwischen dem Gespräch, das ich mit Nikolaj Nikolajewitsch geführt, und dem Augenblick, in welchem man meinem Transport nachgedrahtet, mußte die Nachricht den Großfürsten erreicht haben, sei es nun, weil er etwa an das Regiment telegraphiert, um Konstantin Iljitschs Strafe zu verschärfen, und zur Antwort bekommen hatte, Konstantin Iljitsch sei tot; oder sei es, weil die Todesnachricht unabhängig davon angelangt war. Vielleicht auch mochte er sich mit Vorwürfen wegen der Unverschämtheit seines Sohnes an den alten Elias von Pufendorf–der, seinerseits wiederum, meinem Vater und mithin auch dem Großfürsten so ähnlich gesehen haben mag wie ich dem Sohn–gewendet und erfahren haben, daß der vorgeblich Unverschämte gar nicht mehr lebe.
Nur auf diese oder auf eine sehr ähnliche Art konnte das Ganze sich abgespielt haben. Es war nicht anders möglich. Dennoch–so schien mir–hatte dadurch alles erst seinen eigentlichen Sinn bekommen; und es blieb noch lange Zeit ein Spiel meiner Gedanken, daß ich mir vorzustellen suchte, was in der Seele des Großfürsten vorgegangen, nachdem er erfahren, ich sei von dem Transport verschwunden. Denn daß man sich sogleich auch an den Vater des Kolonisten gewandt, für den ich eingesprungen, scheint mir sicher. Da aber fand man ‚mich‘ noch einmal, das heißt: man glaubte ‚mich‘ wirklich gefunden zu haben–aber ich sah mir auf einmal gar nicht mehr ähnlich, ‚ich‘ war jemand ganz anders als in jener Reitschule. Will man eben wirklich einmal die Identität eines Menschen nachweisen, so stürzt man ins Bodenlose. Wissen doch auch wir selber nicht, wen wir, in Wahrheit, vorstellen! Armer Wilhelm Hagemann! Armer Wachtmeister von den Grodnoer Husaren, dem es mißlungen war, mich einzufangen!
Und Nikolaj Nikolajewitsch? Er hatte gewiß nur mehr davon überzeugt sein können, mit des ein paar Tage zuvor gefallenen Konstantin Iljitsch Geist gesprochen zu haben, welcher ihm, selbst nach dem Sterben noch ein ‚Zweifler und Nörgler‘, die Niederlage Rußlands geweissagt. Die Zeichen, die uns das Schicksal gibt, haben ja genau so viel oder so wenig Bedeutung, wie wir selber davon erraten …
Der Großfürst jedenfalls muß sicher gewesen sein, daß die Katastrophe eintreten werde. Denn an dem Wort eines Soldaten kann man vielleicht noch zweifeln; an dem Wort eines toten Soldaten nicht.»
2
Hiermit schloß der Erzähler. Es entstand eine Stille, in der man nur mehr die Unterhaltung der übrigen, entfernter sitzenden Gäste vernahm, danach sagte Flesse:
«Wenn du nicht erklärt hättest, nur die unwirklichen Geschichten seien erzählenswert–ich würde sagen, deine Geschichte sei wahr.»
Der Unbekannte zuckte die Achseln und lächelte.
«Man soll niemandem eine Illusion zerstören», sagte er. «Am wenigsten, indem man ihm eröffnet, daß sie eine Wahrheit ist.»
«Und warum», ergriff nun der Oberst das Wort, «warum meinst du, daß einem toten Soldaten mehr zu glauben sei als einem lebenden?»
Der Unbekannte wandte sich herum und faßte den Obersten ins Auge.
«Vielleicht», sagte er, «könnte ich dir nun erwidern, daß Tote nicht lügen. Allein das wäre, erstens, zu billig, und zweitens ist es auch nicht erwiesen. Wie heißt es vielmehr im Sprichwort? Ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe–oder so ähnlich. Aber ein toter Soldat scheint mir mehr zu gelten als einer, der noch am Leben ist.»
«Wieso?» fragte der Oberst. «Was willst du damit sagen?»
«Tote», sagte der Unbekannte, «sprechen freilich überhaupt nicht mehr. Könnte aber ein toter Soldat sprechen, so erführe man erst, was ein Soldat in Wirklichkeit ist.»
«Weshalb?» fragte der Oberst. «Warum müßte er dazu erst tot sein?»
«Weil jemand, der Soldat wird, sich auch bereitmachen muß, zu sterben; und weil ein Soldat, der noch nicht gefallen ist, also auch noch nicht alles erfüllt hat, wozu er sich entschlossen. Entschlossen aber hat er sich zum Tode.»
«Aber er schwört doch nicht, um jeden Preis zu sterben», sagte der Oberst. «Er schwört doch nur, sein Leben einzusetzen. Wem ist denn damit gedient, wenn er’s auch wirklich verliert? Doch bloß seinen Gegnern. Oder glaubst du etwa, daß die Ehre eines Heeres an der Zahl seiner Opfer zu messen sei? Sie ist an seinen Siegen zu messen.»
«Wir verstehen einander nicht ganz», sagte der Unbekannte. «Ich spreche von Kriegern schlechthin, du aber redest vom Fache.» Dabei näherte er, wie in einer Art von Zerstreutheit, die Fingerspitze dem Orden des Obersten, als wolle er ihn berühren. «Du redest von der praktischen Seite der Angelegenheit, und ich rede vom soldatischen Geiste. Ein Sieg hängt doch, außer von der Bravour der Truppen, vom Geschick der Stäbe und vom Kriegsglück ab. Die ehrenhafte Haltung eines Soldaten aber hängt nur von ihm selber ab. Und die höchste Ehre im Leben des Soldaten ist der Tod. Auch das Volk hat ja, wie immer die Kriege enden mögen, die es führt, eine vollkommene Verehrung für seine Toten. Überhaupt erweist sich der Sinn eines Krieges niemals während des Krieges selbst, sondern stets erst aus der Geschichte. Dies heißt zwar, den Geschichtsschreibern vielleicht zuviel Auszeichnung erweisen. Aber kommt es denn wirklich darauf an, wie die Dinge und Ereignisse waren? Es kommt darauf an, wie sie sind. Nichts Vergangenes existiert mehr, es sei denn in der Gegenwart, und nichts ist wirklich gewesen, als was noch ist. Es ist gleichgültig, wie es war. Es ist nur mehr das, als was es sich für uns darstellt.»
Der Oberst wollte etwas erwidern, kam aber nicht dazu, denn der Unbekannte fuhr fort:
«Was bedeutet uns also, an sich, zum Beispiel noch das Ringen bei Borodino, was Plewna, was der Aladja Dagh! Wer erinnert sich noch, wer wirklich bei Höchst gesiegt hat, bei Harsany, bei Thionville! Wir wissen nur mehr, daß überall dort, von wo die Namen der Schlachten zu uns herüberklingen, verwundete und tote Helden die Erde mit ihrem Blute gefärbt haben. Ja vielleicht haben an den unzähligen Morgen, die schon über Gefechtsfeldern gedämmert, an den klaren oder nebligen, den dumpfen oder fröstelnden nach durchwachten Nächten–vielleicht haben all die Krieger, die zum Kampfe widereinander gezogen sind, selbst nicht gewußt, um was es den Feldherrn gehe. Sie wußten wohl nur, es sei eben Krieg. Sie hatten die Überzeugung, Soldaten zu sein und sich aufopfern zu müssen, wenn die Trommeln schlagen, die Trompeten blasen würden.»
Wieder wollte der Oberst etwas entgegnen, doch ließ der Unbekannte ihn noch immer nicht zu Wort kommen. Er schien unter einem unwiderstehlichen Redezwange zu leiden und erging sich, obwohl er eben erst vorhin eine so lange Geschichte beendet hatte, noch weiter in seinen Betrachtungen:
«Wie man über Kriege also auch denken mag: die Toten erst heiligen die Kriege. Die Opfer, die sie bringen, sind glorreicher als ein Sieg. Die Falten der Fahnen, die in den Kirchen und Arsenalen aufbewahrt werden, flüstern nur von ihnen, und die goldenen Lettern, die in den Marmor der Gedenktafeln eingegraben sind, rühmen nur sie. Denn es gibt keinen Ruhm ohne Trauer.–Du siehst also», schloß der Unbekannte mit Befriedigung, «daß es auf jeden Fall für das Ehrenhafteste im Leben eines Soldaten gilt, wenn er fällt.»
«Gewiß», gab der Oberst nachsichtig zu. «Aber du kannst doch auch niemandem einen Vorwurf daraus machen, daß er noch nicht gefallen ist. Es genügt, daß ein Soldat bereit sei, sein Leben hinzugeben. Dies ist genau so viel, wie wenn er es schon hingegeben hätte. Überhaupt fällt es nicht schwer, zu sterben, wenn man nicht daran denkt; aber es wird zu einer gewaltigen Tat, wenn man weiß, daß man wird sterben müssen. Wie die Natur das Entstehen des Lebens durch alle Lust begünstigt, will sie ja sein Vergehen durch alle Unlust hindern. Kurz, es läßt sich der Tod des einen Menschen mit dem Tod eines andern gar nicht vergleichen. Es erübrigt sich also auch, das von dir vorgeschlagene Verhör mit toten Soldaten anzustellen. Ich wüßte nicht, was sie andres sagen könnten, als auch lebende sagen.»
«Nun», entgegnete der Unbekannte, «sie könnten zum Beispiel fragen, wieso ihre Kameraden immer noch leben.»
«Sie leben», sagte der Oberst und zog die Brauen zusammen, «–sie leben, oder vielmehr: sie haben nicht mehr sterben können, weil man ihnen eines Tages erklärt hat, daß sie aufgehört hätten, Soldaten zu sein.»
«Ein Soldat hört niemals auf, Soldat zu sein», sagte der Unbekannte.
Der Oberst antwortete nicht sogleich. Er dachte offenbar darüber nach, wer dieser Mensch sein könne, der es unternahm, ihm Vorträge über die Soldatentugenden zu halten. Er schickte sich schließlich an, etwas zu erwidern, als der Unbekannte sagte:
«Aber es ist ein ganz unzeitgemäßes Gespräch, das wir führen. Die Soldatenehre steht jetzt niedrig im Kurs, der Stolz ist vergessen und der Ruhm verflogen. Überhaupt, Ruhm! Was ist das eigentlich? Der Lärm um die Stille des Helden. Oder, bestenfalls, die erschütterte Anerkennung der Mitwelt und Nachwelt. Gut. Allein was wäre das für ein Mensch, der irgend etwas nur um der Anerkennung willen täte! Auch der Soldat handelt ja nur ehrenhaft, weil er gar nicht anders handeln kann. Bist du ein anständiger Mensch, so mach du nur den Versuch, unanständig zu handeln–es wird dir nicht gelingen. Was soll also die ganze Berühmung? Irgendein Dichter–ich glaube, es ist Ossian–behauptet zwar, ‚die Geister der Gefallenen hingen vorwärts nach ihrer Besingung‘. Aber ich kann das nicht glauben. Rühmen heißt: schweigen. Und so oder so, man bleibt Soldat, auch ohne Anerkennung. Mag man, vorübergehend, sogar vergessen, daß man es ist, man wird es, im Grunde, immer bleiben. Man wird, auch wenn man die Uniform längst ausgezogen hat, immer noch als Soldat handeln,»
«Zweifellos», sagte der Oberst, «–wenngleich ich selber, zum Beispiel, im Augenblick nicht genau wüßte wie. Denn ich kann es für keine sehr soldatische Beschäftigung halten, daß ich nun nicht mehr weiß, was ich mit meiner Zeit anfangen soll.»
«Auch wenn du im tiefsten Frieden in den Ruhestand versetzt worden wärest, hättest du nicht mehr gewußt, was beginnen», sagte der Unbekannte. «Aber es ist nicht das, was ich meine. Sondern es brauchen nur irgendwelche Ereignisse an dich heranzutreten, und du bist wieder, der du warst.»
«Es treten aber keinerlei Ereignisse an mich heran», sagte der Oberst. «Das ist es ja eben, daß alle Welt jetzt tut, als sei nichts geschehen und als ob auch weiterhin nie wieder etwas geschehen werde.»
«Jederzeit», sagte der Unbekannte, «geschieht unvergleichlich mehr, als man auch nur ahnt, und jederzeit tut die Welt, als ob nichts geschähe. Man kann zwar nichts Bestimmtes vorhersagen. Es gibt keine wirklichen Wahrsagungen. Nur wenn man alles wüßte, was war, könnte man auch alles voraussagen, was sein wird. Da aber schon unendlich viel geschehen ist, so läßt sich daraus schließen, daß auch noch unendlich viel kommen muß–abgesehen freilich davon, daß es ein wenig kümmerlich ist, immer erst auf äußere Ereignisse warten zu müssen, damit man handeln könne. Man handelt, besser, aus sich selbst. Doch so oder so: in jedem Augenblick kannst du wieder Gelegenheit finden, dich zu bewähren, du–und die Deinen.»
«Wer sollte das sein–diese Meinen?»
«Dein Regiment, zum Beispiel.»
«Das existiert ja nicht mehr.»
«Also dann: was davon noch existiert. Vielleicht könnt ihr dabei sogar nachholen, was euch nicht vergönnt gewesen ist.»
«Was sollte uns nicht vergönnt gewesen sein?»
«Als Soldaten zu sterben, zum Beispiel.»
«Das ist dein Wahn», sagte der Oberst achselzuckend und streifte die Asche seiner Zigarre, die er aus einer Papierspitze rauchte, in eine Schale, die auf einer Spiegelkonsole stand. «Du willst, daß alle Welt dahin sein soll, damit nur mehr du die schönen Geschichten erzählen kannst, die du erlebt haben willst.»
«Nun», sagte der Unbekannte, «schon einmal war ich ja eigentlich tot, als ich eine solche Geschichte erlebte.»
Aber dann, als wollte er dieses Gespräch abtun, das zu nichts mehr zu führen schien, fragte er:
«Kannst du mir vielleicht sagen, wer der junge Herr war, der sich vorhin mit deiner Tochter unterhalten hat?»
Diese Frage stellte der Unbekannte, ohne sich nach den zweien umzuwenden, von denen er sprach. Der Oberst blickte in die Richtung, in der Gabrielle und Engelshausen saßen–oder vielmehr gesessen hatten. Denn nun waren ihre Sessel leer. Die beiden mochten in ein andres Zimmer gegangen sein. Der Oberst, im Gespräch, hatte es nicht bemerkt. So fand er es um so merkwürdiger, daß der andre es, ohne hinzublicken, entdeckt habe.
«–Ein Herr von Engelshausen», sagte er schließlich. «Einer der Offiziere meines Regiments», fühlte er sich bemüßigt, hinzuzusetzen.
«Nun also!» sagte der Unbekannte. «Es existiert also doch noch jemand von diesem deinem Regimente.»
«Nicht einmal das», sagte der Oberst, «trifft hier wirklich zu. Ich könnte nämlich ebensogut sagen, dieser junge Mensch sei nicht bei meinem Regiment gewesen. Sein Fall ist ein sonderbarer, obzwar sich dergleichen auch sonst noch, hin und wieder, mag ereignet haben. Er hatte nämlich die Akademie besucht und war erst zum Regiment kommandiert worden, als die Armee sich eigentlich schon auflöste. Als er ins Feld kam, hatten wir unsere Standorte soeben verlassen und befanden uns bereits auf dem Rückwege. Es blieb ihm also nichts andres übrig, als gleichfalls wieder zurückzureisen, und er hatte keine Gelegenheit, sich früher bei mir zu melden als in dem Augenblick, in welchem ich das Regiment liquidiert hatte.»
«Das ist schmerzlich», sagte der Unbekannte, und es schien, eigentlich zum erstenmal, daß er das, was er sagte, auch wirklich meine. «Aber ich zweifle nicht daran, daß er, hätte er Gelegenheit gefunden, sich bewährt hätte.»
Und damit machte er den Anwesenden die Andeutung einer Verbeugung und verließ die Gruppe.
«Wer war das?» fragte der Oberst sofort.
Flesse sagte, es sei ein Rittmeister Gasparinetti gewesen.
«Von welchem Regiment?» fragte der Oberst.
Er war sicher, den Namen in der Armee nicht gehört zu haben. Dennoch schien ihm, er kenne ihn von woanders her–nur wußte er nicht, wo er ihn schon gehört habe. Es mochte sein, daß er ihn irgendwo gelesen.
Flesse jedoch erwiderte, er wisse das Regiment nicht.–«Ein merkwürdiger Mensch, jedenfalls», erklärte er.
In diesem Augenblick trat Gabrielle wiederum ein, befand sich aber nicht mehr in Engelshausens Begleitung. Die Gesellschaft war, um diese Zeit, schon im Begriff, aufzubrechen. Es mochte ein Uhr sein. Man verabschiedete sich und verließ die Räume. Von den beiden Mädchen, die bedient hatten, half die eine, im Vorhaus, den Gästen in die Mäntel, die andre war zum Haustor hinabgegangen, hatte es aufgeschlossen und sich daneben aufgestellt.
Als Rochonville den Mantel anzog, wollte er an seine Tochter eine Frage richten, doch kam sie ihm zuvor, indem sie sagte, Engelshausen habe sich erbötig gemacht, beide, sie selbst und den Obersten, im Wagen heimzubringen.
Sie warteten also eine Zeit im Vorhause, während die andern Gäste, von denen sie sich schon verabschiedet hatten, sich ankleideten und nochmals von ihnen empfahlen. Nur Engelshausen erschien nicht. Sie nahmen also an, er sei etwa schon zu seinem Wagen vorausgegangen, und gingen hinab zum Haustor.
Auf der Treppe schloß Gasparinetti sich ihnen an. Er trug einen ein wenig taillierten Mantel und ein Halstuch aus weißer Seide. Den Hut hatte er, etwas schräg, in die Augen gedrückt und die Hände in die Taschen gesteckt. Sie gingen über den Hof, und Gasparinetti machte Konversation, das heißt: er unterhielt sich eigentlich nur mit Gabrielle, denn der Oberst beteiligte sich nicht an dem Gespräch; er hatte entschieden, Gasparinetti sei ein Schwätzer.
Ein Flügel des Haustors stand offen, daneben wartete das Mädchen. Vor dem Hause hielt nur mehr ein Wagen, es mochte der Wagen Engelshausens sein, aber Engelshausen war nicht da. Sie schickten also das Mädchen wieder hinauf, nachzufragen, ob er etwa noch oben sei. Inzwischen plauderte der Rittmeister mit Gabrielle. Nach einiger Zeit kam das Mädchen zurück und sagte, Engelshausen sei zwar nicht oben, doch ein Mantel und ein Hut, offenbar die seinen, hingen noch auf dem Vorplatze.
Die dreie sahen einander an, danach sagte der Oberst: wenn Engelshausen nicht da sei, so müßten sie eben zu Fuß nach Hause. Aber Gabrielle erwiderte, mit ihren Abendschuhen zu gehen sei ihr unbequem; und ob man Engelshausen nicht dennoch verständigen könne, daß man auf ihn warte?
Der Oberst ging also mit Gabrielle wieder hinauf, und sonderbarerweise ging auch Gasparinetti mit zurück, obwohl das Ganze ihn eigentlich gar nichts anging. «Bist du sicher, daß Engelshausen uns hat mitnehmen wollen?» fragte der Oberst seine Tochter.–«Ja», erwiderte sie. «Natürlich. Und überhaupt muß er doch noch hier sein, sonst wäre ja auch sein Wagen schon fort.» Im Vorhause hing noch immer der Mantel samt dem Hut, und in der Wohnung fanden sie die Flesses im Begriff, mit Hilfe des Mädchens, das oben geblieben war, die Ordnung oberflächlich wiederherzustellen.
Der Oberst, als er eintrat, entschuldigte sich wegen seines Zurückkommens und sagte, er suche Engelshausen. Die Flesses waren erstaunt und erwiderten, auch sie hätten ihn nicht gesehen. Ob er denn nicht etwa doch schon fort sei?
«Hat er sich denn nicht von dir verabschiedet?» fragte Flesse seine Frau.
Sie könne sich nicht daran erinnern, erwiderte sie. Und Gasparinetti meinte, wenn so viele Leute sich zu gleicher Zeit verabschiedeten, so sei es ja nicht unbedingt Sitte, daß jeder sich einzeln empfehle.
«Wann hast du denn Engelshausen zuletzt gesprochen?» wandte der Oberst sich an Gabrielle.
«Vor kurzem», gab sie zur Antwort.
«Und wo?» fragte er.